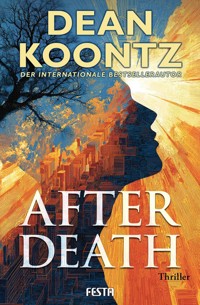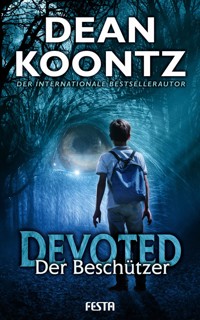9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Odd Thomas
- Sprache: Deutsch
Odd Thomas ist zurück!
Eigentlich ist Odd Thomas ein bescheidener, sympathischer Schnellimbisskoch. Doch er hat besondere Fähigkeiten: Er kann die Geister der Toten sehen. Diesmal ist es eine ermordete Frau, die seine Hilfe sucht. Er soll ihren kleinen Sohn retten – vor dem eigenen Vater. Schon bald merkt Odd, dass noch viel mehr Menschenleben auf dem Spiel stehen.
Gemeinsam mit seiner hochschwangeren Begleiterin Annamaria gelangt Odd Thomas auf den Landsitz eines mächtigen Filmproduzenten. Da Odd geradezu körperlich angezogen wird von dunklen Geheimnissen und unmenschlicher Gewalt, überrascht ihn eine unheilvolle Geistererscheinung dort nicht: Eine ermordete Frau erscheint ihm und fleht ihn an, ihr Kind zu retten, das in tödlicher Gefahr schwebt. Also durchstreift Odd das Anwesen, findet aber zunächst statt eines Kindes nur weitere Schrecken: ein Mausoleum voller ermordeter Frauen, am helllichten Tag einbrechende Nacht und dunkle, menschenähnliche Kreaturen, die gnadenlos Jagd auf ihn machen. Offensichtlich hat sich der Hausherr mit bösen Kräften verbunden. Aber zu welchem Zweck? Als Odd Thomas seinen Schützling endlich findet, erkennt er, dass nicht nur Timothys und sein Leben in Gefahr ist. Sondern das unendlich vieler Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Dean Koontz
Schwarze
Fluten
Thriller
Aus dem Amerikanischen von
Bernhard Kleinschmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
ODD APOCALYPSE bei Bantam Books, New York
Copyright © 2012 by Dean Koontz
Copyright © 2013 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung und Artwork: Eisele Grafik·Design, München
Redaktion: Werner Bauer
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-08691-6 V003
www.heyne-verlag.de
Für Jeff Zaleski –
danke
für deine Einsicht und Lauterkeit
Von Kindheit an war ich nicht so, wie andere waren –
ich hab die Dinge nicht gesehen, wie jene sie sahen.
Edgar Allan Poe, »Allein«
1
Als ich an meinem zweiten ganzen Tag als Gast in Roseland kurz vor Sonnenuntergang über den weitläufigen Rasen zwischen dem Haupthaus und dem Eukalyptuswäldchen schlenderte, blieb ich auf einmal instinktiv stehen und drehte mich um. Der große schwarze Hengst, der auf mich zustürmte, war das mächtigste Pferd, das ich je gesehen hatte. In einem Rassebuch hatte ich es als Friesen identifiziert. Die blonde Frau, die darauf ritt, trug ein weißes Nachtgewand.
Lautlos wie ein Gespenst trieb die Frau das Pferd an. Auf Hufen, die keinen Laut von sich gaben, preschte der Hengst durch mich hindurch, ohne eine Wirkung zu hinterlassen.
Ich habe gewisse Talente. Abgesehen davon, dass ich ein ziemlich guter Grillkoch bin, habe ich gelegentlich prophetische Träume. Und wenn ich wach bin, sehe ich manchmal die Geister von Toten, die aus unterschiedlichen Gründen zögern, ins Jenseits weiterzuziehen.
Pferd und Reiterin, die schon lange tot und in unserer Welt nur noch Geister waren, wussten gut, dass niemand außer mir sie sehen konnte. Nachdem sie mir bereits zweimal am Vortag und einmal an diesem Morgen in der Ferne erschienen waren, hatte die Frau offenbar beschlossen, diesmal um alles in der Welt meine Aufmerksamkeit zu erregen.
In einem weiten Bogen jagten Ross und Herrin um mich herum. Als ich mich drehte, um ihnen mit dem Blick zu folgen, galoppierten sie erneut auf mich zu, blieben jedoch abrupt vor mir stehen. Der Hengst bäumte sich auf und schlug mit den Vorderhufen lautlos in die Luft. Mit seinen geblähten Nüstern und rollenden Augen strahlte er derart gewaltige Kraft aus, dass ich rückwärtstaumelte, obwohl ich doch wusste, er war so immateriell wie ein Traum.
Wenn ich sie berühre, sind Geister für mich körperhaft und warm wie Wesen, die am Leben sind. Ich aber bin das für sie nicht, weshalb sie mir weder das Haar zausen, noch mir einen tödlichen Schlag versetzen können.
Weil mein sechster Sinn meine Existenz ziemlich kompliziert macht, versuche ich, mein Leben ansonsten einfach zu gestalten. Ich habe weniger Habseligkeiten als ein Mönch. Ich habe keine Zeit und Muße, an einer Karriere als Grillkoch oder als irgendetwas anderes zu arbeiten. Ich mache nie Pläne für die Zukunft, sondern schreite einfach in sie hinein, mit einem Lächeln im Gesicht, Hoffnung im Herzen – und aufgestellten Nackenhärchen.
Wilde rote Bänder aus Blut liefen über das weiße, mit Spitze verzierte Seidengewand der blonden Schönheit, die barfuß und ohne Sattel auf dem Friesen saß. Auch ihr langes Haar war blutverschmiert, obwohl ich keine Wunde ausmachen konnte. Ihr Gewand war bis an die Hüften hochgerutscht, die Knie hatte sie an die schwer atmenden Flanken des Hengstes gepresst. Mit der linken Faust umklammerte sie dessen Mähne, als hätte sie sich selbst im Tod an ihrem Pferd festhalten müssen, damit die beiden Geister vereinigt blieben.
Wäre es nicht undankbar, ein Geschenk zu verschmähen, dann würde ich meinen übernatürlichen Blick sofort zurückgeben. Ich wäre damit zufrieden, meine Tage mit der Zubereitung von Omeletts zu verbringen, bei denen ihr vor Vergnügen stöhnen würdet, und mit dem Backen von derart luftigen Pfannkuchen, dass selbst die sanfteste Brise sie von eurem Teller wehen würde.
Allerdings ist jedes Talent unverdient und mit der Pflicht verbunden, es so vollständig und weise einzusetzen wie nur möglich. Würde ich nicht an diese heilige Pflicht glauben, so wäre ich inzwischen bereits so verrückt geworden, dass ich für zahlreiche hohe Regierungsposten infrage käme.
Während der Hengst auf seinen Hinterbeinen tanzte, streckte die Frau den rechten Arm aus und deutete auf mich, als wollte sie sagen, sie wisse, dass ich sie gesehen hatte, und habe mir eine Botschaft zu überbringen. Ihr wunderschönes Gesicht war grimmig vor Entschlossenheit, und in den kornblumenblauen Augen leuchtete zwar kein Leben, aber dafür große Qual.
Als sie abstieg, sprang sie nicht zu Boden, sondern schwebte von ihrem Pferd und schien über das Gras in meine Richtung zu gleiten. Von ihrem Haar und ihrem Nachtgewand verschwand das Blut, und sie erschien nun so, wie sie im Leben vor ihrer tödlichen Verwundung ausgesehen hatte. Vielleicht fürchtete sie, die grausigen Flecken würden mich abstoßen. Sie hob die Hand an mein Gesicht, als wäre es ihr, einem Geist, schwerer gefallen, an mich zu glauben als umgekehrt. Ich spürte die Berührung.
Hinter ihr versank die Sonne im fernen Meer. Darüber glühten merkwürdig geformte Wolken wie eine Flotte aus alten Kriegsschiffen, deren Masten und Segel in Flammen standen.
Als ich sah, wie der qualvolle Ausdruck der Frau sich in eine zaghafte Hoffnung verwandelte, sagte ich: »Ja, ich kann dich sehen. Und wenn du es zulässt, kann ich dir helfen, auf die andere Seite zu gelangen.«
Sie schüttelte heftig den Kopf und trat einen Schritt zurück, als fürchtete sie, ich könnte sie mit einer Berührung oder einem Zauberspruch von dieser Welt lösen. Aber eine solche Kraft habe ich nicht.
Ich glaubte, den Grund für ihre Reaktion zu verstehen. »Man hat dich ermordet, und bevor du diese Welt verlässt, willst du dafür sorgen, dass Gerechtigkeit geschieht.«
Sie nickte, schüttelte dann jedoch den Kopf, als wollte sie sagen: Ja, aber nicht nur das.
Da ich mit den Verstorbenen vertrauter bin, als mir eigentlich lieb ist, kann ich euch aus langer persönlicher Erfahrung sagen, dass die Geister der zögerlichen Toten nicht sprechen. Ich weiß nicht, warum. Selbst wenn sie brutal ermordet worden sind und verzweifelt versuchen, den Mörder seiner gerechten Strafe zuzuführen, sind sie nicht in der Lage, mir wichtige Informationen mitzuteilen, ob telefonisch oder von Angesicht zu Angesicht. Sie senden auch keine SMS-Nachrichten. Vielleicht liegt das daran, dass sie sonst etwas über den Tod und die Welt im Jenseits verraten würden, das wir Lebenden nicht wissen sollen.
Jedenfalls kann der Umgang mit den Toten noch frustrierender sein als der mit einer ganzen Reihe von Lebenden, was erstaunlich ist, wenn man in Betracht zieht, dass es Lebende sind, die in der Kfz-Zulassungsstelle ihr Unwesen treiben.
Ohne im letzten direkten Licht der versinkenden Sonne einen Schatten zu werfen, stand der Hengst mit hoch erhobenem Kopf da, stolz wie ein Patriot beim Anblick der geliebten Flagge. Das Einzige, was im Wind wehte, war jedoch das goldene Haar seiner Herrin, und grasen würde er erst wieder auf Wiesen, die nicht von dieser Welt waren.
Die Frau trat wieder auf mich zu und blickte mir so intensiv ins Gesicht, dass ich ihre Verzweiflung spüren konnte. Sie bildete mit den Armen eine Wiege, die sie hin- und herschwang.
»Ein Baby?«, fragte ich.
Ja.
»Dein Baby?«
Wieder nickte sie, um dann den Kopf zu schütteln.
Die Frau runzelte die Stirn und biss sich auf die Unterlippe. Sie zögerte, bevor sie die Hand ausstreckte und sie knapp eineinhalb Meter über den Boden hielt.
Da ich mit den Rätseln von Geistern inzwischen ziemlich gut vertraut bin, ahnte ich, dass sie die heutige Größe ihres Kindes anzeigte, das jetzt kein Baby mehr war, sondern neun bis zehn Jahre alt. »Es ist nicht mehr dein Baby«, sagte ich, »sondern dein Kind.«
Sie nickte heftig.
»Dein Kind ist noch am Leben?«
Ja.
»Hier in Roseland?«
Ja, ja, ja.
Die Farbe der am Himmel lodernden Wolkenschiffe verwandelte sich aus einem feurigen Orange in blutiges Rot, während der Himmel langsam in Violett überging.
Als ich fragte, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handle, bejahte die Frau Letzteres.
Obwohl mir hier bisher kein Kind begegnet war, sah ich die Qual, die das Gesicht der Frau zerfurchte, und stellte die naheliegende Frage: »Und dein Sohn ist hier … in Schwierigkeiten?«
Ja, ja, ja.
Ein ganzes Stück östlich des Haupthauses befand sich, hinter einem Wäldchen aus Lebenseichen verborgen, eine mit Unkraut überwucherte Reitbahn. Ein verfallener Zaun umrahmte sie.
Die Ställe hingegen sahen aus, als wären sie erst letzte Woche errichtet worden. Merkwürdigerweise waren sämtliche Boxen makellos rein. Kein Strohhalm und keine einzige Spinnwebe waren darin zu sehen, nicht einmal Staub. Offenbar wurde der Boden regelmäßig geschrubbt. Angesichts der Sauberkeit und einem Geruch, so frisch und rein wie der eines Wintertags nach einem Schneefall, wurden dort schon seit Jahrzehnten keine Pferde mehr gehalten. Offensichtlich war die Frau in Weiß schon lange tot.
Wie konnte ihr Kind dann erst neun oder zehn Jahre alt sein?
Manche Geister erschöpft ein längerer Kontakt mit mir, oder er strengt sie zumindest dermaßen an, dass sie für Stunden oder Tage verschwinden, bevor sie wieder genug Kraft gesammelt haben, um zu erscheinen. Der Wille dieser Frau schien jedoch stark genug zu sein, um ihr Bild aufrechtzuerhalten. Plötzlich aber, als ein Schimmern in die Luft trat und ein seltsames zitronengelbes Licht die Landschaft überflutete, waren sie und der Hengst – der vielleicht zur selben Zeit getötet worden war wie seine Herrin – verschwunden. Sie verblassten nicht von ihrer Peripherie zur Mitte hin, wie es andere ruhelose Seelen manchmal tun, sondern verschwanden in dem Augenblick, in dem das Licht sich veränderte.
Genau als die rote Dämmerung in Gelb umschlug, erhob sich im Westen ein Wind, peitschte das Eukalyptuswäldchen hinter mir, rauschte durch die Kalifornischen Lebenseichen im Süden und wehte mir das Haar in die Augen.
Ich blickte in einen Himmel, aus dem die Sonne noch nicht ganz verschwunden war, so als hätte ein himmlischer Zeitnehmer die kosmische Uhr einige Minuten zurückgestellt.
Diese Unmöglichkeit wurde von einer anderen noch übertroffen. Über den gelben Himmel, der bis auf die Wolkenschiffe am Horizont völlig leer gewesen war, zogen sich nun Streifen, die aussahen wie Ströme aus Rauch oder Ruß. Grau und schwarz gestreift, bewegten sie sich mit gewaltiger Geschwindigkeit. Sie wurden breiter und schmaler, bildeten Schlangenlinien und liefen bisweilen zusammen, um sich aber gleich wieder zu trennen.
Ich hatte keine Ahnung, woraus diese Ströme bestanden, doch der Anblick weckte eine düstere Ahnung in mir. Hoch über mir brausten Asche, Ruß und winzige Trümmer durch die Luft, Materie, aus der einst große Städte bestanden hatten. Explosionen von beispielloser Wucht hatten diese Metropolen zu Staub zerlegt und dann weit in den Himmel gespien, wo sie vom Jetstream erfasst und festgehalten worden waren, von den Starkwindbändern einer vom Krieg verwandelten Troposphäre.
Visionen im Wachzustand habe ich noch seltener als prophetische Träume. Wenn eine mich ergreift, so bin ich mir bewusst, dass es sich um ein inneres Ereignis handelt, das sich nur in meinem Kopf abspielt. Dieses Schauspiel aus Wind, unheilvollem Licht und grausigen Mustern am Himmel war jedoch keine Vision. Es war so real wie ein Tritt ins Gemächt.
Geballt wie eine Faust, hämmerte mein Herz, als über den Himmel ein Schwarm von Wesen zog, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ihre wahre Natur war nicht leicht zu entschlüsseln. Sie waren größer als Adler, sahen aber eher wie Fledermäuse aus. Zu Hunderten kamen sie von Nordwesten her und sanken dabei immer tiefer. Mein Herz schlug so heftig, als wollte meine Vernunft Reißaus nehmen und sich verflüchtigen, damit der Wahnsinn dieser Szene mich voll und ganz erfassen konnte.
Angesichts dessen kann ich euch versichern, dass ich nicht wahnsinnig bin, nicht wie ein Serienmörder es ist und auch nicht wie jemand, der ein Metallsieb als Hut trägt, um sich davor zu schützen, dass die CIA sein Gehirn überwacht. Überhaupt trage ich nicht gern Hüte und andere Kopfbedeckungen, wenngleich ich nichts gegen sachgemäß verwendete Siebe habe.
Getötet habe ich durchaus, und zwar mehr als einmal, aber immer zur Selbstverteidigung oder um Unschuldige zu beschützen. So etwas kann man nicht als Mord bezeichnen. Wenn ihr anderer Meinung seid, so habt ihr bisher ein behütetes Leben geführt, um das ich euch beneide.
Ich war zwar nicht sicher, ob der nahende Schwarm mich vernichten wollte oder meine Existenz überhaupt nicht wahrnahm, aber da ich unbewaffnet und ihm zahlenmäßig deutlich unterlegen war, konnte ich mich im Ernstfall mit Sicherheit nicht verteidigen. Deshalb drehte ich mich um und rannte den langen Abhang hinab auf das Eukalyptuswäldchen zu. Darin stand das Gästehaus, in dem ich wohnte.
Da diese Situation in jeder Hinsicht absurd war, ließ mich dies keine Sekunde lang zögern. Obwohl ich in zwei Monaten gerade mal den zweiundzwanzigsten Geburtstag feiern würde, war das Unmögliche schon lange zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden. Ich wusste, dass die wahre Natur der Welt merkwürdiger war als jedes bizarre Gewebe, das irgendein Hirn aus den Fäden seiner Fantasie hätte erschaffen können.
Während ich, vor Furcht und Anstrengung schwitzend, ostwärts rannte, erhoben sich hinter und über mir erst die schrillen Schreie des Schwarms und dann das ledrige Flattern seiner Flügel. Als ich es wagte, mich umzublicken, sah ich die Wesen im böigen Wind schweben. Ihre Augen waren so gelb wie der schaurige Himmel. Sie steuerten auf mich zu, als hätte ein Meister, dem sie gehorchten, ihnen eine düstere Version des Wunders von den Brotlaiben und den Fischen versprochen, indem er mich zum üppigen Proviant für den riesigen Schwarm machte.
Als die Luft plötzlich erneut schimmerte und das gelbe Licht in Rot umschlug, stolperte ich, stürzte und drehte mich auf den Rücken. Ich hob die Hände, um die gefräßigen Wesen abzuwehren, doch der Himmel sah wieder aus wie immer. Nichts flatterte durch die Luft außer zwei Watvögeln in der Ferne.
Ich war wieder in Roseland, wo die Sonne untergegangen und der Himmel fast vollständig violett geworden war. Die einst lodernden Galeonen waren zu einem trüben Rot niedergebrannt.
Nach Atem ringend, kam ich auf die Beine und beobachtete eine Weile, wie das Himmelsmeer schwarz wurde und die letzten Funken der Wolkenschiffe in den aufgehenden Sternen versanken.
Zwar fürchtete ich mich nicht vor der Nacht, doch die Klugheit gebot, mich nicht unnötig lange darin aufzuhalten. Deshalb ging ich weiter auf das Eukalyptuswäldchen zu.
Der verwandelte Himmel und die bedrohlichen Flügelwesen hatten mir ebenso etwas zum Nachdenken gegeben wie die Frau und ihr Pferd. Da mein Leben allzeit höchst ungewöhnlich ist, brauche ich mir keine Sorgen zu machen, es könnte mir einmal an Denkanstößen mangeln. Was das angeht, werde ich bestimmt nie Mangel leiden.
2
Nach dem Erlebnis mit der Frau, dem Pferd und dem gelben Himmel konnte ich mir nicht so recht vorstellen, in dieser Nacht Schlaf zu finden. Ich lag im gedämpften Lampenlicht da und merkte, wie meine Gedanken düsteren Pfaden folgten.
Wir sind schon begraben, wenn wir geboren werden. Die Welt ist ein Ort voll bereits belegter und potenzieller Gräber. Das Leben ist das, was geschieht, während wir auf unsere Verabredung mit dem Leichenbestatter warten.
Obwohl das nachweisbar stimmt, wird diese Erkenntnis genauso wenig auf Pappbecher gedruckt wie der Spruch Kaffeetrinken kann tödlich sein.
Schon bevor ich nach Roseland gekommen war, hatte ich mich in einer gedrückten Stimmung befunden. Aber die würde sich bestimmt bald heben, da war ich mir sicher. Bei mir ist das immer so. Egal, welches Horrorszenario sich einstellt – ich bin nach einer kleinen Weile wieder so beschwingt wie ein Luftballon im Sommerwind.
Wieso ich so beschwingt bin, weiß ich auch nicht. Es könnte sich allerdings um einen entscheidenden Aspekt meiner Lebensaufgabe handeln. Wenn mir irgendwann klar ist, wieso ich selbst in der dunkelsten Dunkelheit noch Humor aufbringe, wird der Leichenbestatter womöglich meine Nummer wählen, und dann ist die Zeit gekommen, mir einen Sarg auszusuchen.
Eigentlich erwarte ich, gar keinen Sarg zu bekommen. Das himmlische Amt für Lebensthemen – oder wie immer es heißen mag – scheint beschlossen zu haben, dass meine Reise durch diese Welt in besonderem Maße von Absurdität geprägt wird – und von der Sorte Gewalt, auf die die Gattung Mensch so stolz ist. Deshalb werde ich wahrscheinlich irgendwann von einem wütenden Mob aus Antikriegsdemonstranten in Stücke gerissen und auf ein Freudenfeuer geworfen werden. Oder ich werde von einem Rolls-Royce überrollt, an dessen Steuer ein Fürsprecher der Armen sitzt.
So sicher ich mir auch war, nicht einschlafen zu können, schlief ich dann doch ein.
Es war vier Uhr an jenem Februarmorgen, als ich tief in einem verstörenden Traum von Auschwitz versunken war.
Meine typische Beschwingtheit war offenbar noch nicht ganz wieder eingetreten.
Ich erwachte durch einen vertrauten Schrei, der hinter dem halb offenen Fenster meines Apartments im Gästehaus von Roseland erklang. Silberhell wie die Flöten in einem keltischen Lied spann er Fäden aus Kummer und Sehnsucht in die Nacht und den Wald. Noch einmal erklang er näher, dann ein drittes Mal in größerer Entfernung.
Die klagenden Laute waren immer nur kurz, doch als sie mich an den vergangenen zwei Tagen kurz vor der Morgendämmerung geweckt hatten, hatte ich nicht mehr einschlafen können. Sie waren wie ein elektrischer Strom im Blut, der durch jede Arterie und Vene fuhr. Noch nie hatte ich ein einsameres Geräusch gehört, und es flößte mir einen Schrecken ein, der mir unerklärlich schien.
Diesmal war ich also aus einem Vernichtungslager aufgewacht. Ich bin zwar kein Jude, aber in meinem Albtraum war ich einer gewesen und hatte furchtbare Angst gehabt, zweimal zu sterben. Das zweimal zu tun, war mir im Schlaf völlig logisch vorgekommen, im Wachzustand jedoch nicht, und der gespenstische nächtliche Schrei entzog dem lebhaften Traum sofort alle Luft, woraufhin dieser sich auflöste.
Dem derzeitigen Herrn von Roseland und allen zufolge, die für ihn arbeiteten, stammte der verstörende Schrei von einem Seetaucher. Die das behaupteten, hatten jedoch entweder keine Ahnung, oder sie logen.
Mit dieser Vermutung wollte ich meinen Gastgeber und sein Personal nicht beleidigen. Schließlich habe ich von vielen Dingen keine Ahnung, weil ich gezwungen bin, mich auf einen überschaubaren Gesichtskreis zu beschränken. Eine ständig zunehmende Zahl von Leuten scheint nämlich entschlossen zu sein, mich umzubringen, weshalb ich mich darauf konzentrieren muss, am Leben zu bleiben.
Aber selbst in der Wüste, wo ich geboren und aufgewachsen bin, gibt es Tümpel und Seen, die zwar künstlich, für Seetaucher jedoch durchaus geeignet sind. Daher kenne ich deren Schreie, die zwar melancholisch, aber nie derart trostlos sind. Sie sind merkwürdig hoffnungsvoll, während die hier verzweifelt klangen.
Roseland, ein privates Anwesen, war eine Meile von der Küste Kaliforniens entfernt. Seetaucher aber bleiben Seetaucher, wo immer sie auch nisten; sie ändern ihre Stimme nicht, um sie der Landschaft anzupassen. Es sind Vögel, keine Politiker.
Außerdem verhalten Seetaucher sich nicht wie Hähne, die mit Vorliebe zu einer bestimmten Zeit krähen. Besagte Schreie jedoch kamen zwischen Mitternacht und Morgendämmerung, während ich sie bei Sonnenlicht bisher noch nie gehört hatte. Je früher sie an einem neuen Tag erklangen, desto öfter wiederholten sie sich in den verbleibenden Stunden, in denen Dunkelheit herrschte. Jedenfalls kam es mir so vor.
Ich schlug die Decke zurück, hockte mich auf die Bettkante und sagte: »Verschone mich, damit ich dienen kann.« Das ist ein Morgengebet. Hat meine Oma Sugars mir als kleinem Jungen beigebracht.
Pearl Sugars war eine professionelle Pokerspielerin; sie trat häufig bei Privatspielen gegen Falschspieler an, die zweimal so groß waren wie sie und nicht mit einem charmanten Lächeln reagierten, wenn sie verloren. Die lächelten nicht mal, wenn sie gewannen. Meine Oma war ausgesprochen trinkfest, und sie konnte eine ganze Wagenladung Schweinefett in verschiedener Form verputzen. Wenn sie nüchtern war, fuhr Oma Sugars so schnell, dass die Polizeibehörden mehrerer Staaten im Südwesten einen eigenen Aktenordner für sie angelegt hatten. Dennoch lebte sie lange und starb im Schlaf.
Ich hoffte, dass ihr Gebet bei mir genauso gut wirkte wie bei ihr, aber in letzter Zeit war ich dazu übergegangen, dieser ersten Bitte eine weitere folgen zu lassen. Heute lautete die: »Bitte lass nicht zu, dass jemand mich umbringt, indem er mir eine wütende Eidechse in den Schlund stopft.«
So was von Gott zu erbitten, das kommt euch jetzt vielleicht ziemlich schnoddrig vor, aber ein ebenso wahnsinniger wie voluminöser Kerl hat einmal gedroht, mich zwangsweise mit einer exotischen, scharfzahnigen Echse zu füttern, die außer Rand und Band war, weil man ihr eine anständige Dosis Methamphetamin verpasst hatte. Das wäre ihm auch gelungen, wenn wir nicht auf einem Bauplatz gewesen wären und ich nicht eine Sprühdose mit Isolierschaum als Waffe gefunden hätte. Später hat der Kerl mir gedroht, wenn er wieder aus dem Gefängnis käme, würde er mich aufspüren, um die Sache mit einer anderen Eidechse zu Ende zu bringen.
An anderen Tagen hatte ich Gott in letzter Zeit gebeten, mir den Tod durch eine Autopresse auf dem Schrottplatz zu ersparen, den Tod durch eine Nagelpistole und dadurch, an tote Männer gekettet in einem See versenkt zu werden. Das waren Dinge, die ich in der Vergangenheit eigentlich nicht hätte überleben sollen, und wenn ich erneut mit einer dieser Bedrohungen konfrontiert wurde, würde ich demselben Schicksal bestimmt nicht zum zweiten Mal entrinnen.
Mein Name ist nicht Lucky Thomas. Er lautet Odd Thomas.
Ganz ehrlich. Odd.
Meine wunderschöne, aber wahnsinnige Mutter behauptet, auf der Geburtsurkunde hätte eigentlich Todd stehen sollen. Mein Vater, der nach Teenagern giert und Grundstücke auf dem Mond verhökert – allerdings in einem bequemen Büro hier auf der Erde –, sagt manchmal, sie hätten von Anfang an beabsichtigt, mich Odd zu nennen.
Ich neige dazu, in dieser Angelegenheit meinem Vater zu glauben. Falls er nicht lügt, könnte dies das einzig Wahre sein, was er je zu mir gesagt hat.
Nachdem ich mich abends vor dem Schlafengehen schon geduscht hatte, zog ich mich jetzt unverzüglich an, um bereit für alles zu sein, was kam.
Mit jedem Tag fühlte Roseland sich mehr wie eine Falle an. Ich hatte den Eindruck, überall lauerten verborgene Damoklesschwerter, die durch einen Fehltritt ausgelöst werden und mich zerhacken konnten.
Infolgedessen wäre ich am liebsten abgereist, hatte jedoch die Pflicht zu bleiben. Die schuldete ich der Glockendame. Sie war mit mir aus Magic Beach gekommen, einer kleinen Stadt weiter nördlich an der Küste, wo ich auf verschiedene Weise fast umgebracht worden wäre.
Die Pflicht braucht nicht zu rufen; es reicht, wenn sie flüstert. Und wenn man ihrem Ruf folgt, ist es nicht nötig, etwas zu bereuen, egal, was auch geschehen mag.
Stormy Llewellyn, die ich geliebt und verloren habe, war der Meinung, diese zerrissene Welt sei ein Ausbildungslager zur Vorbereitung auf das große Abenteuer, das zwischen unserem ersten und unserem ewigen Leben kommt. Sie hat gesagt, wir könnten uns nur verirren, wenn wir taub gegenüber unserer Pflicht seien.
Wir gehen alle verwundet durch eine Welt, die ein Kriegsgebiet ist. Alles, was wir lieben, wird uns weggenommen werden, alles, und als Letztes das Leben selbst.
Dennoch finde ich überall, wohin ich auf diesem Schlachtfeld blicke, große Schönheit und die Möglichkeit, mich daran zu erfreuen.
Zum Beispiel besaß der steinerne Turm in dem Eukalyptuswäldchen, in dem ich momentan wohnte, eine raue Schönheit. Das lag nicht zuletzt an dem Kontrast zwischen seinen wuchtigen Mauern und der Zartheit der silbergrünen Blätter, die von den Zweigen der Bäume ringsum hingen.
Der Turm war nicht säulenförmig, sondern hatte einen quadratischen Grundriss. Jede Seite war etwa neun Meter breit, und der Bau war gut achtzehn Meter hoch, wenn man die Bronzekuppel einrechnete. Darüber erhob sich eine ungewöhnliche Verzierung, die aussah wie Krone und Ring einer alten Taschenuhr.
Bezeichnet wurde der Turm als Gästehaus, aber er hatte bestimmt nicht immer diesem Zweck gedient. Die schmalen Flügelfenster, durch die man frische Luft hereinlassen konnte, gingen nach innen auf, weil sie nach außen mit senkrecht angebrachten Eisenstäben gesichert waren.
Die dicke, eisenbeschlagene Holztür sah aus, als hätte sie einem Rammbock, wenn nicht gar Kanonenkugeln standhalten können. Dahinter trat man erst einmal in einen Vorraum mit nackten Steinwänden.
Linkerhand führte hier eine Treppe zur oberen Wohnung. Dort war Annamaria, die Glockendame, untergebracht.
Direkt gegenüber dem Eingang befand sich die Tür zur Erdgeschosswohnung, deren Benutzung mir Noah Wolflaw, der derzeitige Besitzer von Roseland, gestattet hatte.
Meine Behausung bestand aus einem gemütlichen Wohnzimmer, einem kleineren Schlafzimmer, beides mit Mahagoni getäfelt, und einem hübsch gefliesten Bad, das aus den 1920er Jahren stammte. Die Einrichtung war im Craftsman-Stil gehalten: schwere gepolsterte Armsessel aus Holz, Bocktische mit Zapfenverbindung und sparsamem Dekor.
Ich weiß nicht, ob die Buntglaslampen tatsächlich von Tiffany stammten, aber möglich gewesen wäre es. Vielleicht hatte man sie aus Europa mitgebracht, als sie noch keine fantastisch teuren Museumsstücke gewesen waren, und nun blieben sie einfach deshalb in diesem abgelegenen Bau, weil sie immer da gewesen waren. Ein Aspekt von Roseland war eine lässige Gleichgültigkeit dem Reichtum gegenüber, den es darstellte.
Zu jeder Gästewohnung gehörte eine Kitchenette mit Kühlschrank, die mit den nötigsten Lebensmitteln ausgestattet war. Darin konnte ich mir entweder selbst eine einfache Mahlzeit kochen oder mir von Mr. Shilshom, dem Koch des Anwesens, jeden vernünftigen Wunsch erfüllen lassen. In diesem Fall brachte man das Bestellte auf einem Tablett vom Haupthaus herüber.
Ich hatte keine große Lust, mehr als eine Stunde vor der Morgendämmerung schon zu frühstücken. Dann hätte ich mich wie ein Verurteilter gefühlt, der versuchte, an seinem letzten Tag möglichst viele Mahlzeiten zu verschlingen, bevor ihn die Giftspritze erledigte.
Unser Gastgeber hatte mir warnend geraten, zwischen Abend- und Morgendämmerung im Haus zu bleiben. Er hatte behauptet, ein oder mehrere Pumas seien in letzter Zeit in andere Anwesen der Gegend eingedrungen und hätten dabei zwei Hunde, ein Pferd und mehrere zahme Pfaue gerissen. Womöglich seien die Biester dreist genug, über einen nachts durch die Gegend wandernden Gast von Roseland herzufallen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab.
Ich kannte mich mit Pumas genug aus, um zu wissen, dass sie ebenso bei Tageslicht wie im Dunkeln jagten. Offenbar hatte Noah Wolflaws Warnung deshalb den Zweck, mich davon abzuhalten, bei Nacht den Schrei des angeblichen Seetauchers und andere Eigentümlichkeiten von Roseland zu erforschen.
Dennoch verließ ich an jenem Montag den Turm, bevor es dämmerte, und schloss die eisenbeschlagene Tür von außen ab.
Annamaria und ich hatten je einen Schlüssel erhalten und waren streng angewiesen worden, den Turm immer verschlossen zu halten. Als ich bemerkte, ein Puma könne keinen Knauf drehen, um eine Tür zu öffnen, egal, ob diese abgeschlossen sei oder nicht, erklärte Mr. Wolflaw, wir lebten am Beginn eines neuen dunklen Zeitalters. Nun seien selbst die bewachten Bollwerke der Reichen nicht mehr sicher, weil überall »dreiste Diebe, Vergewaltiger, Journalisten, mordlüsterne Revolutionäre und noch wesentlich Schlimmeres« auftauchen könnten.
Als er diese Warnung aussprach, rotierten seine Augen zwar nicht wie Windrädchen, und es kam auch kein Rauch aus seinen Ohren, aber mit seiner mürrischen Miene und seinem unheilvollen Tonfall kam er mir trotzdem wie eine Karikatur vor. Ich dachte, er wollte mich auf den Arm nehmen, bis ich ihm lange genug in die Augen gesehen hatte, um zu erkennen, dass er so paranoid war wie eine dreibeinige, von Wölfen umringte Katze.
Egal, ob seine Paranoia nun gerechtfertigt war oder nicht, ich hatte den Eindruck, dass ihm weder Diebe noch Vergewaltiger, Journalisten oder Revolutionäre wirklich Sorgen machten. Seine Furcht galt dem, was er vage als etwas »wesentlich Schlimmeres« bezeichnete.
Nachdem ich den Gästeturm verlassen hatte, ging ich den durch das duftende Eukalyptuswäldchen führenden Plattenweg entlang zum Anfang einer sanften Steigung. An ihrem Ende erhob sich das Haupthaus. Der weitläufige, sorgsam gepflegte Rasen vor mir fühlte sich unter den Füßen weich wie Teppichboden an.
In den wilden Wiesen rund um das Anwesen, durch die ich an den vergangenen Tagen gestreift war, wuchsen Schneeweiße Hainsimse, Rohrglanzgras und Landschilf zwischen majestätischen Lebenseichen, offenbar in einem nicht ohne Weiteres erkennbaren, aber harmonischen Muster gepflanzt.
Kein Ort, den ich je aufgesucht hatte, war schöner gewesen als Roseland, und kein Ort hatte sich je so vom Bösen durchdrungen angefühlt.
Nun werden manche Leute sagen, ein Ort sei nur ein Ort und könne nicht gut oder böse sein. Andere werden sagen, die Vorstellung des Bösen als einer realen Kraft oder Instanz sei hoffnungslos veraltet. Boshafte Taten von Männern und Frauen ließen sich gut durch allerhand psychologische Theorien erklären.
Auf solche Leute höre ich nie. Wenn ich auf sie hören würde, dann wäre ich schon lange tot.
Unabhängig vom Wetter und selbst unter einem gewöhnlichen Himmel schien das Tageslicht in Roseland von einer anderen Sonne zu stammen als von der, die den Rest der Welt erhellte. Hier sah das Vertraute seltsam aus, und auch ein stabiler, hell erleuchteter Gegenstand hatte etwas von einem Trugbild an sich.
Wenn ich, wie jetzt, nachts unterwegs war, hatte ich den Eindruck, nicht allein zu sein. Ich fühlte mich verfolgt und beobachtet.
Bei anderen Spaziergängen hatte ich ein Rascheln gehört, das angesichts der stillen Luft unerklärlich war, ein oder zwei gemurmelte, nicht ganz verständliche Worte, hastige Schritte. Wenn mir da tatsächlich jemand nachstellte, so blieb er von Strauchwerk oder Mondschatten verborgen, oder er postierte sich hinter einer Ecke, um mich zu beobachten.
Was mich dazu brachte, nachts durch Roseland zu streifen, war der Verdacht, hier sei ein Mord geschehen. Die Frau auf dem schwarzen Hengst war jemandem zum Opfer gefallen, und nun suchte sie diesen Ort heim, weil sie Gerechtigkeit für sich und ihren Sohn wollte.
Das zwanzig Hektar umfassende Anwesen lag in Montecito, einer wohlhabenden Gemeinde nahe Santa Barbara, das selbst so wenig einem armseligen Kaff glich, wie man das Ritz-Carlton mit dem Bates Motel in Psycho hätte verwechseln können.
Das Haupthaus und die Nebengebäude waren in den Jahren 1922 und 1923 erbaut worden, im Auftrag eines Pressezaren namens Constantine Cloyce, der auch zu den Mitbegründern eines der legendären Filmstudios von Hollywood zählte. Er besaß zwar eine Villa in Malibu, doch Roseland war sein spezieller Rückzugsort, ein sprichwörtlicher Herrensitz, an dem er sich so maskulinen Vergnügungen wie Reiten, Tontaubenschießen, Jagen, bis zum Morgengrauen dauernden Pokerspielen und vielleicht auch feuchtfröhlichem Armdrücken hingeben konnte.
Zudem war Cloyce ein Liebhaber ungewöhnlicher – ja bizarrer – Theorien gewesen. Er hatte, so hieß es, mit Madame Helena Petrovna Blavatsky, dem berühmten Medium, und mit dem weltbekannten Ingenieur und Erfinder Nikola Tesla verkehrt.
Manche glaubten, Cloyce habe hier in Roseland einst insgeheim die Erforschung und Entwicklung von Dingen wie Todesstrahlen, modernen alchemistischen Methoden und Telefonen finanziert, durch die man mit den Toten sprechen konnte. Aber schließlich gab es auch Leute, die glaubten, das Sozialversicherungssystem werde immer und ewig flüssig bleiben.
Vom Rand des Eukalyptuswäldchens aus blickte ich nun den langen, flachen Hang zum Haupthaus hinauf, in dem Constantine Cloyce 1948 im Alter von siebzig Jahren gestorben war. Auf dem mit Rundziegeln gedeckten Dach glänzten Kolonien aus phosphoreszierenden Flechten im Mondlicht.
Noch 1948 hatte anschließend der einzige Erbe eines steinreichen südamerikanischen Bergwerksmagnaten Roseland mit sämtlichem Mobiliar erworben. Er war damals knapp dreißig, und vierzig Jahre später verkaufte er es wieder, ebenfalls möbliert. Da er ein zurückgezogenes Leben geführt hatte, wusste man kaum etwas über ihn.
Momentan brannte nur hinter einigen Fenstern im ersten Stock Licht. Dort befanden sich die Schlafgemächer von Noah Wolflaw, der sein beträchtliches Vermögen als Gründer und Manager eines Hedgefonds erworben hatte, was immer das sein mag. Ich bin ziemlich sicher, dass es etwas mit der Wall Street zu tun hat, aber mehr will ich gar nicht wissen.
Inzwischen hatte Mr. Wolflaw sich im Alter von fünfzig Jahren zur Ruhe gesetzt, sofern man von Ruhe sprechen konnte. Er behauptete nämlich, eine Verletzung im Schlafzentrum seines Gehirns erlitten zu haben, weshalb er in den letzten neun Jahren kein Auge zugetan habe.
Mir war nicht klar, ob diese extreme Schlaflosigkeit Wahrheit oder Lüge war oder ein Hinweis auf irgendeine wahnhafte Störung.
Er hatte das Anwesen von dem eigenbrötlerischen Bergwerkserben erworben und das Haupthaus renovieren und erweitern lassen. Die Architektur war im Stil von Addison Mizner gehalten und stellte eine eklektische Mischung aus spanischen, maurischen, gotischen, griechischen und römischen Einflüssen dar, die Renaissance nicht zu vergessen. Breite Kalksteinterrassen mit Balustraden führten stufenförmig zum Garten hinab.
Als ich in dieser Stunde vor der Dämmerung über den kurz geschorenen Rasen auf das Haupthaus zuging, hatten die Kojoten in den Hügeln hoch oben ihr Geheul schon eingestellt. Sie hatten sich an wilden Kaninchen satt gefressen und waren in den Schlaf gesunken. Nach stundenlangem Gesang waren auch die Frösche erschöpft verstummt, und die Grillen waren von den Fröschen verschlungen worden. Eine friedliche, wenn auch nur vorübergehende Stille hatte sich über die gefallene Welt gesenkt.
Ich hatte vor, mich auf der südlichen Terrasse in einen Liegestuhl zu legen, bis in der Küche Licht anging. Mr. Shilshom begann seinen Arbeitstag immer schon, bevor es hell wurde.
Bereits die beiden vergangenen Morgen hatte ich bei dem Küchenchef verbracht, nicht nur, weil er fantastisches Frühstücksgebäck zaubern konnte, sondern auch, weil ich hoffte, ihm etwas über die Geheimnisse von Roseland aus der Nase ziehen zu können. Er wehrte meine Neugier ab, indem er sich als kulinarisches Pendant eines zerstreuten Professors gab. Das machte ihm allerdings sichtlich so viel Mühe, dass er sich wahrscheinlich früher oder später selbst ein Bein stellen würde.
Als Gast war ich im gesamten Erdgeschoss des Hauses willkommen, in der Küche, dem Salon, der Bibliothek, dem Billardzimmer und anderswo. Mr. Wolflaw und sein vor Ort lebendes Personal waren darauf bedacht, sich als gewöhnliche Leute zu präsentieren, die nichts zu verbergen hatten und an einem romantischen Ort ohne jegliches Geheimnis lebten.
Ich wusste es besser, was meinem besonderen Talent, meiner Intuition und meinem ausgezeichneten Bockmistdetektor zu verdanken war. Außerdem hatte ich in der vergangenen Abenddämmerung bekanntlich etwas gesehen, das so schaurig war, dass es jede Vorstellung sprengte.
Wenn ich sage, dass ich Roseland für einen vom Bösen durchdrungenen Ort hielt, dann heißt das nicht, ich hätte angenommen, sämtliche seiner Bewohner – oder auch nur ein einziger – seien böse gewesen. Sie waren ein unterhaltsamer, exzentrischer Haufen, und wer exzentrisch ist, der ist oft ein anständiger Mensch oder zumindest jemand, dem es an wahrhaft bösen Absichten mangelt.
Der Teufel und seine Dämonen sind allesamt dumpf und berechenbar, weil ihr einziges Ziel darin besteht, gegen die Wahrheit zu rebellieren. Auch das Verbrechen selbst wirkt auf jemanden mit einem komplexen Verstand eher langweilig, wenngleich es interessant sein kann, eines aufzuklären. Wer dumm ist, findet Verbrechen hingegen unendlich faszinierend. Ein Film über Hannibal Lecter ist spannend, der zweite unweigerlich öde. Wir lieben Serienhelden, aber ein Serienschurke wirkt rasch lächerlich, da er auf so offensichtliche Weise versucht, uns zu schockieren. Das Gute ist fantasievoll, das Böse wiederholt sich nur.
Man hatte Geheimnisse hier in Roseland. Es gab jedoch viele Gründe, Geheimnisse zu bewahren, und nur ein Bruchteil davon war bösartiger Natur.
Als ich es mir auf dem Gartensessel bequem gemacht hatte, um darauf zu warten, dass Mr. Shilshom das Küchenlicht anknipste, nahm die Nacht eine interessante Wendung. Ich rede hier nicht von einer unerwarteten Wendung, denn ich habe gelernt, so ziemlich alles zu erwarten.
Südlich der Terrasse, auf der ich saß, führten Stufen in einem weiten Bogen zu einem runden Brunnen, der von eineinhalb Meter hohen Urnen im Stil der Renaissance flankiert wurde. Dahinter gelangte man über eine weitere geschwungene Treppe zu einer Rasenfläche, umrahmt von Hecken, an deren Seiten leicht gestufte Kaskaden herabströmten. Ganz außen erhob sich links und rechts je eine Reihe hoher Zypressen. Die ganze Anlage führte etwa hundert Meter weit zu einer weiteren Terrasse auf der Kuppe der Anhöhe, und dort stand ein reich mit Ornamenten verziertes, fensterloses Mausoleum. Seine Kalksteinmauern waren bestimmt zwölf Meter breit.
Das Mausoleum stammte aus dem Jahr 1922 und damit aus einer Zeit, als Bestattungen auf Privatgrund noch nicht gesetzlich verboten gewesen waren. Ohnehin wurde das grandiose Monument nicht von verwesenden Leichen bewohnt. In seinen Wandnischen standen mit Asche gefüllte Urnen. Bestattet waren hier Constantine Cloyce, seine Frau Madra und das einzige Kind des Paares, das früh gestorben war.
Plötzlich begann das Mausoleum zu glühen, als wäre es vollständig aus Glas gewesen. Es sah aus wie eine riesige Öllampe, in der ein goldenes Licht pulsierte. Die Phönixpalmen dahinter reflektierten das Leuchten, sodass ihre Wedel aufblühten wie Feuerwerksraketen.
Ein Krähenschwarm barst aus den Palmen hervor. Zu erschrocken, um zu kreischen, verschwanden die Vögel mit knatternden Flügelschlägen im dunklen Himmel.
Überrascht sprang ich auf die Beine, wie ich es immer tue, wenn ein Gebäude aus unerklärlichen Gründen zu glühen beginnt.
Ohne mich daran zu erinnern, dass ich die Stufen erklommen und den Brunnen umrundet hatte, fand ich mich auf der langen Rasenfläche. Wie unter einem Bann stehend, hatte ich schon den halben Weg zum Mausoleum zurückgelegt.
Ich hatte das Grabmal bereits früher besichtigt und wusste, dass es so massiv war wie ein Munitionsbunker.
Nun sah es jedoch wie ein gläserner Vogelkäfig aus, in dem Scharen von leuchtenden Elfen hausten.
Obwohl das gespenstische Licht von keinerlei Geräuschen begleitet wurde, stürmten Druckwellen auf mich ein und durch mich hindurch. In einem Anflug von Synästhesie spürte ich den Klang der Stille.
Offenbar waren es diese Erschütterungen, die mich von meinem Gartenstuhl geholt und die Stufen hinauf auf den Rasen getrieben hatten. Sie wirbelten durch mich hindurch wie ein pulsierender Strudel, der mich in eine Art Trance versetzte. Als mir klar wurde, dass ich mich wieder in Bewegung gesetzt hatte und aufwärtsging, wehrte ich mich gegen den Drang, mich dem Mausoleum zu nähern – und war tatsächlich in der Lage, der mich vorwärtsziehenden Kraft zu trotzen. Ich blieb stehen und hielt stand!
Während die Druckwellen mich durchströmten, überfluteten sie mich mit einer Sehnsucht nach etwas, das ich nicht benennen konnte, nach irgendeinem großen Lohn, den ich nur empfangen würde, wenn ich zum Mausoleum ging, solange das seltsame Licht durch dessen durchsichtige Mauern strahlte. Als ich mich weiterhin wehrte, nahm die Anziehungskraft ab, und das Leuchten verblasste allmählich.
Hinter meinem Rücken erklang eine tiefe Männerstimme mit einem mir unbekannten Akzent: »Ich habe dich gesehen …«
Verblüfft drehte ich mich um, aber auf dem Rasen zwischen mir und dem murmelnden Brunnen stand niemand.
Hinter mir, so nah, als wäre der Mund, aus dem die Worte kamen, nur wenige Zentimeter von meinem linken Ohr entfernt gewesen, fuhr die Männerstimme etwas leiser fort: »… wo du nicht gewesen bist.«
Wieder drehte ich mich um und stellte fest, dass ich noch immer allein war.
Während das Leuchten des Mausoleums auf der Anhöhe weiter verblasste, senkte die Stimme sich zu einem Flüstern: »Ich zähle auf dich.«
Jedes Wort war leiser als das vorherige. Als das goldene Licht sich endgültig in die Kalksteinwände des Grabs zurückgezogen hatte, kehrte wieder Stille ein.
Ich habe dich gesehen, wo du nicht gewesen bist. Ich zähle auf dich.
Wer das gesagt hatte, war kein Geist. Schließlich sehe ich die zögerlichen Toten, doch dieser Mann war unsichtbar geblieben. Außerdem sprechen die Toten nicht.
Gelegentlich versuchen sie allerdings, nicht nur mit Nicken, Kopfschütteln und anderen Gesten mit mir zu kommunizieren, sondern auch pantomimisch, was ziemlich frustrierend sein kann. Wie jeder geistig gesunde Bürger werde ich jedes Mal, wenn ich unversehens auf einen seine Kunst ausübenden Pantomimen stoße, von dem Drang ergriffen, ihn zu erwürgen. Einen Pantomimen, der bereits tot ist, kann diese Drohung natürlich nicht schrecken.
In scheinbarer Einsamkeit drehte ich mich einmal ganz um die eigene Achse und sagte dabei: »Hallo?«
Die einzige Stimme, die antwortete, war eine Grille, die den räuberischen Fröschen entkommen war.
3
Die Küche im Haupthaus war zwar nicht so riesig, um darin Tennis spielen zu können, aber dafür war jede der beiden Arbeitsinseln in der Mitte groß genug für ein Tischtennismatch.
Einige der Arbeitsflächen ringsum waren aus schwarzem Granit, andere aus Edelstahl. Wandschränke aus Mahagoni. Ein weiß gefliester Boden.
Keine einzige Ecke war geschmückt mit, sagen wir mal … Keksdosen in Teddybärenform, Keramikfrüchten oder bunten Geschirrhandtüchern.
Die warme Luft duftete nach Frühstückscroissants und unserem täglichen Brot. Gesicht und Statur von Mr. Shilshom ließen vermuten, dass seine Sünden allesamt mit Essen zu tun hatten. Seine in sauberen weißen Turnschuhen steckenden Füße waren so klein, dass sie aussahen, als hätte man sie an die massigen Beine eines Sumoringers transplantiert. Von dem monumentalen Rumpf leitete ein mehrfach gestuftes Doppelkinn zu einem fröhlichen Gesicht mit einem bogenförmigen Mund, einer glockenförmigen Nase und zwei Augen über, die so blau waren wie die des Weihnachtsmanns.
Während ich mich auf einem Hocker niederließ, der an einer der Arbeitsinseln stand, verriegelte der Küchenchef doppelt die Tür, durch die er mich eingelassen hatte. Tagsüber blieben die Türen unverschlossen, aber von der Abend- bis zur Morgendämmerung lebten Wolflaw und sein Personal hinter Schloss und Riegel, was er ja auch Annamaria und mir dringend empfohlen hatte.
Mit sichtlichem Stolz setzte Mr. Shilshom mir einen Teller vor, auf dem das erste frisch aus dem Ofen gekommene Croissant lag. Der Duft von Buttergebäck und warmem Marzipan stieg in die Luft wie ein Opfer an den Gott kulinarischer Exzesse.
Vorerst schnupperte ich nur, um einen kleinen Belohnungsaufschub zu genießen. »Ich kann bloß mit Grill und Bratpfanne hantieren«, sagte ich. »So etwas betrachte ich mit wahrer Ehrfurcht.«
»Na, na. Schließlich habe ich Ihre Pfannkuchen und Kartoffelpuffer gekostet. Sie können bestimmt genauso gut backen, wie Sie braten können.« Der Koch bestand darauf, mich zu siezen, obwohl das sonst praktisch niemand tut. Ich hingegen sieze grundsätzlich. Ist einfach meine Art.
»Kaum, Sir. Wenn kein Pfannenwender im Spiel ist, dann ist es kein Gericht, für das mein Talent sich eignet.«
Trotz seiner Masse bewegte Mr. Shilshom sich mit der Anmut eines Tänzers, und seine Hände waren so flink wie die eines Chirurgen. In dieser Hinsicht erinnerte er mich an meinen hundertachtzig Kilo schweren Freund und Mentor Ozzie Boone, einen Autor von Kriminalromanen, der einige Hundert Meilen von diesem Ort entfernt in meiner Heimatstadt Pico Mundo lebte.
Abgesehen davon hatte der rundliche Koch kaum etwas mit Ozzie gemein. Der einzigartige Mr. Boone war gesprächig, vielseitig gebildet und an allem interessiert. Ans Schreiben seiner Bücher, ans Essen und an jedes einzelne Gespräch ging Ozzie mit so viel Energie heran wie David Beckham an sein Fußballspiel. Er schwitzte jedoch nicht so stark wie Beckham.
Mr. Shilshoms Leidenschaft schien sich hingegen ausschließlich aufs Backen und Kochen zu erstrecken. Wenn er bei der Arbeit war, bestritt er seinen Teil unseres Dialogs mit einer derartigen Zerstreutheit – echt oder vorgetäuscht –, dass seine Antworten oft scheinbar keinerlei Zusammenhang mit meinen Bemerkungen und Fragen hatten.
Dennoch hatte ich die Küche mit der Hoffnung betreten, dass er eine wertvolle Information preisgab, mit der ich das Geheimnis von Roseland entschlüsseln konnte, und zwar ohne wahrzunehmen, dass ich seine Schale geknackt hatte.
Zuerst aß ich das köstliche Croissant, aber nur zur Hälfte. Durch diese Zurückhaltung bewies ich mir, dass ich trotz allem Druck und aller Turbulenzen, denen ich in besonderer Weise ausgesetzt war, immer diszipliniert blieb. Dann kam die andere Hälfte dran.
Mit einem ungewöhnlich scharfen Messer hackte der Küchenchef gedörrte Aprikosen in Stücke, während ich endlich damit fertig war, mir die Lippen zu lecken, und das Wort ergriff. »Die Fenster hier sind nicht vergittert wie drüben im Gästeturm.«
»Das Haupthaus ist umgebaut worden.«
»Also waren hier auch mal Gitterstäbe?«
»Vielleicht. Vor meiner Zeit.«
»Wann hat man das Haus denn umgebaut?«
»Damals.«
»Wann damals?«
»Mmmmm.«
»Wie lange arbeiten Sie schon hier?«
»Ach, schon ewig.«
»Sie haben ein gutes Gedächtnis.«
»Mmmmm.«
Das war in etwa alles, was ich über die Geschichte der vergitterten Fenster von Roseland erfahren würde. Der Koch hackte so konzentriert seine Trockenfrüchte, als würde er eine Bombe entschärfen.
»Mr. Wolflaw hält doch keine Pferde hier, oder?«, fragte ich.
Aprikosenbesessen sagte der Koch: »Keine Pferde.«
»Die Reitbahn und der Übungsplatz sind voller Unkraut.«
»Unkraut«, pflichtete der Koch mir bei.
»Aber die Ställe sind makellos sauber.«
»Makellos.«
»Sie sind fast so sauber wie ein Operationssaal.«
»Sauber, sehr sauber.«
»Ja, aber wer reinigt die Ställe?«
»Irgendjemand.«
»Alles sieht frisch getüncht und gewienert aus.«
»Gewienert.«
»Aber weshalb – wenn es gar keine Pferde gibt?«
»Tja, weshalb?«, überlegte der Koch laut.
»Vielleicht hat Mr. Wolflaw vor, bald Pferde anzuschaffen.«
»Genau.«
»Will er tatsächlich Pferde anschaffen?«
»Mmmmm.«
Mr. Shilshom schaufelte sich die Aprikosenstücke in die Hand, um sie in eine Rührschüssel zu befördern. Dann griff er nach einer Tüte und schüttete halbierte Pekannüsse auf sein Hackbrett.
»Wie lange ist es wohl schon her, seit es hier zuletzt Pferde gab?«, fragte ich.
»Lange, sehr lange.«
»Dann gehört das Pferd, das ich manchmal hier umherstreifen sehe, wohl einem Nachbarn.«
»Gut möglich«, sagte der Koch und fing an, die Nusshälften zu halbieren.
»Haben Sie das Pferd auch schon gesehen?«, fragte ich.
»Lange, sehr lange.«
»Es ist ein riesiger schwarzer Hengst.«
»Mmmmm.«
»In der Bibliothek hier stehen viele Bücher über Pferde.«
»Ja, die Bibliothek.«
»Ich habe nach der Rasse gesucht. Ich glaube, es ist ein Friese.«
»Na also.«
Sein Messer war so scharf, dass die Nusshälften überhaupt nicht bröselten, als er sie zerteilte.
»Sir«, sagte ich, »haben Sie draußen vor Kurzem vielleicht ein merkwürdiges Licht gesehen?«
»Wieso denn?«
»Oben am Mausoleum.«
»Mmmmm.«
»Ein goldenes Licht.«
»Mmmmm.«
Ich sagte: »Mmmmm?«
Er sagte: »Mmmmm.«
Fairerweise musste ich ihm zugestehen, dass das Licht, das ich gesehen hatte, womöglich nur für jemanden sichtbar gewesen war, der meinen sechsten Sinn besaß. Dennoch argwöhnte ich, dass Mr. Shilshom ein verlogener Fettkloß war.
Über sein Hackbrett gebeugt, starrte der Koch so angestrengt auf die Nüsse, als wollte er das Kleingedruckte auf einer Packung Pillen lesen.
»Ist das da eine Maus neben dem Kühlschrank?«, fragte ich, um ihn auf die Probe zu stellen.
»Na also.«
»Nein. ’tschuldigung. Das ist eine fette alte Ratte.«
»Mmmmm.«
Wenn er nicht völlig in seine Arbeit versunken war, dann war er ein guter Schauspieler.
Ich rutschte von meinem Hocker. »Tja, ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, ich geh jetzt mal raus und setze meine Haare in Brand.«
»Wieso denn?«
Ich wandte dem Koch den Rücken zu und ging zur Terrassentür. »Vielleicht wachsen sie dichter nach, wenn man sie hin und wieder mal abfackelt.«
»Mmmmm.«
Das spröde Geräusch des Nüsse spaltenden Messers war verstummt.
In einer der vier Scheiben, mit denen die obere Hälfte der Tür verglast war, sah ich Mr. Shilshoms Spiegelbild. Er beobachtete mich. Sein Mondgesicht war so bleich wie seine weiße Uniform.
Ich öffnete die Tür. »Es dämmert noch nicht mal. Vielleicht schleicht draußen noch ein Puma herum und versucht sich an den Türen.«
»Mmmmm«, sagte der Koch, als wäre er weiterhin so von seiner Arbeit abgelenkt gewesen, dass er mir kaum Aufmerksamkeit schenkte.
Ich trat hinaus, zog hinter mir die Tür zu und ging über die Terrasse bis zum Beginn der Treppenstufen. Dort blieb ich stehen und blickte zum Mausoleum hinauf, bis ich hörte, wie der Koch die beiden Schlösser verriegelte.
Nun, da die Dämmerung in wenigen Minuten hinter den Bergen im Osten hervorsteigen würde, erscholl der Schrei des angeblichen Seetauchers ein letztes Mal aus einer entfernten Ecke des riesigen Anwesens.
Der klagende Klang rief mir ein Bild aus meinem Traum über Auschwitz ins Gedächtnis, aus dem mich der erste Schrei der Nacht geweckt hatte: Hungrig und geschwächt, wie ich es bin, mühe ich mich mit einer Schaufel ab, voll Furcht, zweimal zu sterben, was immer das bedeuten mag. Ich grabe nicht schnell genug, um den Wachposten zufrieden zu stellen, der mir die Schaufel aus den Händen kickt. Die Stahlkappe seines Stiefels schneidet mir in die rechte Hand, aus der zu meinem Schrecken kein Blut fließt, sondern pulvrige graue Asche ohne einen einzigen glühenden Funken, nur kalte, graue Asche, die aus mir herausströmt, unablässig …
Während ich zum Eukalyptuswäldchen zurückging, verblassten die Sterne im Osten, und der Himmel färbte sich mit dem ersten schwachen Morgenlicht.
Annamaria, die Glockendame, und ich waren erst seit drei Nächten und zwei Tagen zu Gast in Roseland, doch ich ahnte, dass unsere Zeit hier sich rasch dem Ende zuneigte und dass unser dritter Tag gewaltsam enden würde.
4
Zwischen Geburt und Begräbnis wandern wir durch eine Komödie der Geheimnisse.
Falls ihr meint, das Leben sei nicht geheimnisvoll, und falls ihr glaubt, ihr hättet alles voll und ganz kapiert, dann passt ihr entweder nicht auf, oder ihr habt euch mit Alkohol, Drogen oder irgendeiner tröstlichen Ideologie betäubt.
Und falls ihr meinen solltet, das Leben sei keine Komödie – dann, liebe Freunde, könnt ihr am besten gleich zu eurem Begräbnis eilen. Wir anderen brauchen Leute, mit denen wir lachen können.
Bei Anbruch der Dämmerung im Gästeturm angekommen, erklomm ich die Wendeltreppe zum Obergeschoss, wo Annamaria mich erwartete.
Die Glockendame hat zwar einen trockenen Humor, ist jedoch eher geheimnisvoll als komödiantisch.
Als ich an ihre Tür klopfte, schwang diese auf, als hätte die leichte Berührung meiner Fingerknöchel auf dem Holz ausgereicht, um das Schloss zu entriegeln und die Angeln in Bewegung zu setzen.
Die beiden schmalen, tiefen Fenster waren so mittelalterlich wie jene, durch die Rapunzel ihr langes Haar zu Boden gelassen hatte. Sie ließen die Morgensonne nur spärlich ein.
Im Licht einer bronzenen Stehlampe mit einem Schirm aus buntem Glas, in dem verschlungene gelbe Rosen leuchteten, saß Annamaria an einem kleinen Esstisch. Ihre zarten Hände umschlossen einen Becher.
»Ich hab dir Tee eingegossen, Oddie«, sagte sie und zeigte auf einen zweiten Becher, aus dem Dampf aufstieg. Obwohl ich mich gerade erst entschlossen hatte, sie zu besuchen, hatte sie genau gewusst, wann ich kommen würde.
Noah Wolflaw behauptete, er habe neun Jahre nicht geschlafen, was höchstwahrscheinlich geschwindelt war. In den vier Tagen, die ich Annamaria nun kannte, war sie jedoch immer wach gewesen, wenn ich mit ihr sprechen musste.
Auf dem Sofa lagen zwei Hunde, darunter ein Golden Retriever, dem ich den Namen Raphael gegeben hatte. Er war ein guter Kerl, der sich mir in Magic Beach angeschlossen hatte.
Das zweite Tier, ein weißer Schäferhundmischling namens Boo, war ein Geisterhund und das einzige nach seinem Tod auf Erden verweilende Exemplar seiner Art, das ich je gesehen hatte. Er begleitete mich seit meiner Zeit im Kloster St. Bartholomew, wo ich eine Weile zu Gast gewesen war, bevor es mich nach Magic Beach verschlagen hatte.
Für einen jungen Mann, der seine Heimatstadt so liebte wie ich Pico Mundo, der Einfachheit, Stabilität und Tradition schätzte und an den Freunden hing, mit denen er aufgewachsen war, hatte ich mich allzu sehr zum Zigeuner entwickelt.
Selber ausgesucht hatte ich mir das nicht. Die Ereignisse hatten für mich die Wahl getroffen.
Ich gehe tastend meinen Weg zu etwas hin, das meinem Leben Sinn verleihen wird, und ich erfahre unterwegs, wohin ich gehen muss. Dabei finden sich immer wieder neue, freundliche Begleiter.
Zumindest sehe ich die Sache so. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht bloß eine Ausrede ist, um nicht aufs College zu gehen.
In dieser ungewissen Welt bin ich mir nicht vieler Dinge gewiss, aber ich weiß, dass Boo nicht deshalb hierbleibt, weil er – wie manche menschlichen Geister – Angst vor dem hat, was nach diesem Leben kommt, sondern weil ich ihn an einem kritischen Punkt meiner Reise brauchen werde. Ich will mich nicht zu der Behauptung versteigen, er sei mein Schutzgeist oder -engel, aber seine Gegenwart tröstet mich. Punkt.
Beide Hunde wedelten mit dem Schwanz, als sie mich erblickten. Allerdings klopfte nur der von Raphael hörbar an das Sofa.
Früher hatte Boo mich oft begleitet. Hier in Roseland jedoch blieben beide Hunde in der Nähe der Glockendame, als fürchteten sie um deren Sicherheit.
Raphael war sich bewusst, dass Boo vorhanden war, und Boo sah manchmal Dinge, die ich nicht sah. Das ließ vermuten, dass Hunde aufgrund ihrer Unschuld die ganze Realität der Existenz sehen, für die wir blind geworden sind.
Ich setzte mich zu Annamaria an den Tisch und kostete den Tee, der mit Pfirsichnektar gesüßt war. »Mr. Shilshom ist ein Schwindler«, sagte ich.
»Er ist ein guter Koch«, erwiderte Annamaria.
»Er ist sogar ein sehr guter Koch, aber er ist nicht so unschuldig, wie er sich gibt.«
»Das ist niemand«, sagte sie mit einem so feinen und nuancierten Lächeln, dass die Mona Lisa vergleichsweise die Zähne bleckte.
Seit dem Augenblick, als ich Annamaria in Magic Beach auf einem Pier getroffen hatte, war mir klar gewesen, dass sie einen Freund brauchte und dass sie anders als andere Menschen war. Nicht so wie ich es bin mit meinen prophetischen Träumen und meinem Blick für Geister, sondern auf ihre ganz eigene Weise anders.
Ich wusste kaum etwas über diese Frau. Als ich sie gefragt hatte, woher sie komme, da hatte sie geantwortet: »Von weit her.« Ihr Tonfall und ihr leicht amüsierter Gesichtsausdruck hatten darauf hingedeutet, dass diese Antwort ein Understatement war.
Sie wiederum wusste eine Menge über mich. Zum Beispiel hatte sie meinen Namen schon gekannt, bevor ich mich vorgestellt hatte. Sie hatte auch gewusst, dass ich die Geister der zögerlichen Toten sehe, obwohl ich nur einigen meiner engsten Freunde von dieser Gabe erzählt habe.
Inzwischen war mir klar geworden, dass sie mehr als nur anders war. Sie stellte ein so komplexes Rätsel dar, dass ich ihre Geheimnisse nie erfahren würde, falls sie sich nicht entschied, mir den Schlüssel zu schenken, mit dem ich die Wahrheit über sie erschließen konnte.
Sie war achtzehn Jahre alt und schien im achten Monat schwanger zu sein. Bis wir uns zusammengetan hatten, war sie eine Weile allein auf der Welt gewesen, hatte jedoch keinen der Zweifel und keine der Sorgen gehabt, die andere junge Frauen in ihrer Lage plagen.
Obwohl sie absolut nichts besaß, war sie nie in Not. Sie sagte, die Leute schenkten ihr, was sie brauche – Geld, ein Dach über dem Kopf –, obwohl sie nie um etwas bitte. Dass diese Behauptung stimmte, hatte ich mit eigenen Augen gesehen.
Wir hatten Magic Beach in einem Mercedes verlassen, den uns Lawrence Hutchison geliehen hatte. Hutch war vor fünfzig Jahren ein berühmter Filmschauspieler gewesen; inzwischen war er achtundachtzig und betätigte sich als Kinderbuchautor. Ich hatte eine Weile als Koch und Chauffeur für ihn gearbeitet, bevor es in Magic Beach zu gefährlich für mich geworden war. Den Wagen hatten wir später bei Hutchs Großneffen Grover abgegeben, der in Santa Barbara als Anwalt praktizierte.
Im Empfangszimmer von Grovers Kanzlei waren wir dann auf Noah Wolflaw getroffen, der dort Klient war und gerade einen Termin gehabt hatte. Wolflaw fühlte sich sofort von Annamaria angezogen, und nach einem kurzen Gespräch, das so verwirrend war wie viele Unterhaltungen hier, hatte er uns nach Roseland eingeladen.
Annamarias starke Anziehungskraft war nicht sexueller Natur. Sie war weder schön noch hässlich, aber hausbacken sah sie auch nicht aus. Klein, aber nicht zierlich, mit einem vollkommenen, wenn auch bleichen Teint, strahlte sie eine Präsenz aus, über deren Ursprung ich immer wieder nachgrübelte, ohne zu einem Schluss zu kommen.
Was immer uns verband, Romantik war nicht dabei. Die Wirkung, die sie auf mich – und auf andere – hatte, war tiefer als sinnliches Verlangen. Man wurde seltsam demütig dabei.
Vor hundert Jahren hätte man Annamaria vielleicht als charismatisch bezeichnen können. Aber in einer Zeit, in der banale Filmstars und die neuesten Reality-TV-Affen angeblich Charisma hatten, bedeutete das Wort nichts mehr.
Außerdem verlangte Annamaria von niemandem, ihr zu folgen, wie es ein Sektenguru getan hätte. Stattdessen weckte sie in ihrer Umgebung das Bedürfnis, sie zu beschützen.
Sie behauptete, keinen Familiennamen zu besitzen, und obwohl mir nicht klar war, wie sie das zustande gebracht hatte, zweifelte ich es nicht an. Zwar war sie oft undurchschaubar, aber dennoch glaubte ich, dass sie nie log. Beweise brauchte ich dafür nicht, nur Vertrauen, und das hatte ich.
»Ich hab den Eindruck, wir sollten Roseland sofort verlassen«, sagte ich.
»Darf ich nicht mal meinen Tee austrinken? Muss ich postwendend aufspringen und zum Tor rennen?«
»Das meine ich ernst. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht.«
»Das wird auch an jedem anderen Ort, an den wir kommen, der Fall sein.«
»Aber nicht so sehr wie hier.«
»Und wo sollen wir hin?«, fragte sie.
»Irgendwohin.«
Ihre sanfte Stimme nahm nie einen schulmeisterlichen Tonfall an, obwohl normalerweise ich es war, der sich belehren lassen musste. Das tat sie jedoch ebenso geduldig wie liebevoll. »Irgendwo ist überall. Wenn es egal ist, wo wir hin wollen, dann kann es bestimmt nicht sinnvoll sein aufzubrechen.«
Ihre Augen waren so dunkel, dass ich keinen Unterschied zwischen Iris und Pupille erkennen konnte.
»Man kann nur an einem Ort zur selben Zeit sein, du komischer Kauz«, sagte sie. »Deshalb kommt es darauf an, dass man aus dem richtigen Grund am richtigen Ort ist.«
Vor Annamaria hatte nur Stormy Llewellyn mich »komischer Kauz« genannt.
»Meistens hab ich den Eindruck, dass du in Rätseln sprichst«, sagte ich.
Ihr Blick war so fest, wie ihre Augen dunkel waren. »Meine Mission und dein sechster Sinn haben uns hierher geführt. Roseland war ein Magnet für uns. Wir hätten nirgendwo anders hinkönnen.«
»Deine Mission. Worin besteht die?«
»Das wirst du rechtzeitig erfahren.«
»In einem Tag? Einer Woche? In zwanzig Jahren?«
»Alles zu seiner Zeit.«
Ich sog den Pfirsichduft des Tees ein, atmete seufzend aus und sagte: »An dem Tag, an dem wir uns in Magic Beach getroffen haben, da hast du gesagt, zahllose Leute wollten dich umbringen.«
»Die sind durchaus gezählt worden, aber es sind so viele, dass du die Zahl genauso wenig wissen musst wie die Zahl der Haare auf deinem Kopf, um sie zu kämmen.«
Sie trug Sneakers, Khakihosen und einen beigefarbenen Schlabberpulli, dessen Ärmel zu lang für sie waren. Die dicken, hochgeschlagenen Ärmel betonten die Zartheit ihrer schlanken Handgelenke.
Nachdem Annamaria aus Magic Beach nichts mitgenommen hatte als die Kleider, die sie am Leib trug, war sie erst einen Tag in Roseland gewesen, als Mrs. Tameed, die Haushälterin, einen Koffer gekauft, ihn mit mehreren Garnituren gefüllt und im Gästehaus deponiert hatte, obwohl sie von niemandem darum gebeten worden war.
Auch ich hatte keine Sachen mitgebracht als das, was ich am Leib trug. Niemand hatte mir auch nur ein Paar Socken besorgt. Ich hatte das Anwesen für einige Stunden verlassen und in die Stadt fahren müssen, um mir Jeans, Pullis und Unterwäsche zu kaufen.
»Vor vier Tagen hast du mich gefragt, ob ich dafür sorgen will, dass du am Leben bleibst«, sagte ich. »Die Aufgabe machst du mir schwerer, als es sein müsste.«
»In Roseland will niemand mich ermorden.«
»Wieso bist du dir da so sicher?«
»Hier weiß man nicht, was ich bin. Wenn man mich tötet, werden meine Mörder Leute sein, die wissen, was ich bin.«
»Und was bist du?«, fragte ich.
»In deinem Herzen weißt du das bereits.«
»Und wann wird das auch mein Gehirn herausbekommen?«
»Du weißt es, seit du mich zum ersten Mal auf jenem Pier gesehen hast.«
»Vielleicht bin ich nicht so clever, wie du meinst.«
»Du bist mehr als clever, Oddie. Du bist weise. Aber du hast auch Angst vor mir.«
»Ich hab vor vielem Angst«, sagte ich überrascht, »aber nicht vor dir.«
Ihr Amüsement war zärtlich und ohne jede Herablassung. »Mit der Zeit, junger Mann, wirst du dir deiner Angst bewusst werden, und dann wirst du wissen, was ich bin.«
Gelegentlich nannte sie mich »junger Mann«, obwohl sie achtzehn war und ich fast zweiundzwanzig. Das hätte merkwürdig klingen sollen, doch das tat es nicht.
»Vorläufig bin ich in Roseland sicher«, sagte sie, »aber es ist jemand hier, der in großer Gefahr ist und dich dringend braucht.«
»Wer?«
»Vertrau darauf, dass dein Talent dich leitet.«
»Du erinnerst dich doch an die Frau auf dem Pferd, von der ich dir erzählt habe? Gestern hatte ich eine ziemlich gespenstische Begegnung mit ihr. Es ist ihr gelungen, mir klarzumachen, dass ihr Sohn hier ist. Neun bis zehn Jahre alt. Er ist in Gefahr, allerdings weiß ich nicht, inwiefern oder weshalb. Ist er es, dem ich helfen soll?«
Annamaria zuckte die Achseln. »Über alles und jedes weiß ich nicht Bescheid.«
Ich leerte meinen Becher Tee. »Ich glaube zwar nicht, dass du je lügst, aber eine direkte Antwort gibst du mir irgendwie auch nie.«
»Wer zu lange in die Sonne starrt, wird geblendet.«
»Wieder ein Rätsel.«
»Das ist kein Rätsel, sondern eine Metapher. Ich sage dir die Wahrheit auf Umwegen, denn wenn ich sie direkt aussprechen würde, dann würde sie dich durchbohren, wie grelle Sonne die Netzhaut verbrennen kann.«
Ich schob meinen Stuhl zurück. »Aha. Ich hoffe bloß, dass du dich nicht als eine von diesen New-Age-Spinnerin entpuppst.«
Sie lachte leise. Das war das musikalischste Geräusch, das ich je gehört hatte.
Weil die Schönheit ihres Lachens meine Bemerkung reichlich grob erschienen ließ, sagte ich: »War nicht bös gemeint.«
»Hab ich auch nicht so empfunden. Du sprichst immer aus dem Herzen, und das ist ganz in Ordnung so.«
Als ich aufstand, wedelten die Hunde wieder mit dem Schwanz, aber keiner der beiden machte Anstalten, mich zu begleiten.