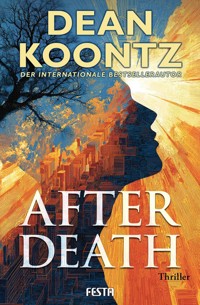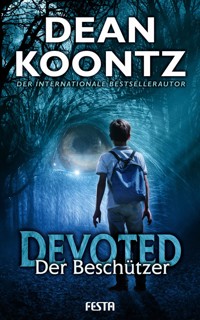7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bibi Blair ist 22, als ihr die Ärzte sagen, dass sie maximal noch ein Jahr zu leben hat. Zwei Tage später ist ihr Tumor verschwunden ... Wie ist das möglich? Auf mysteriöse Weise erfährt sie, dass sie geheilt wurde, um ein Mädchen namens Ashley Bell zu retten. Die Suche führt Bibi in eine Welt voller Verbrechen und Verschwörungen. Die Ereignisse werden immer seltsamer und bösartiger ... Auf der Suche nach Ashley Bell ist ein Leseerlebnis für alle, die dunkle psychologische Spannung und moderne Mystery-Abenteuer lieben. Gleichzeitig lyrisch und spannend geschrieben. Dean Koontz ist neben Stephen King der weltweit meistverkaufte Meister der dunklen Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen
von Manfred Sanders
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Ashley Bell
erschien 2015 im Verlag Bantam Books.
Copyright © 2015 by The Koontz Living Trust
Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: Arndt Drechsler-Zakrzewski
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-029-8
www.Festa-Verlag.de
Dieses Buch ist mit großer Zuneigung Susan (Allison) Cathers gewidmet, meiner Schwester von einer anderen Mutter, zum Dank für 30 Jahre Güte und Vortrefflichkeit.
Sie …
Hört das Lied im Ei eines Vogels.
James Dickey, Im Freien schlafen an Ostern
Teil 1
Die Frau, die vorhatte, einen Helden zu heiraten
1
Das Mädchen, dessen Geist immer neues Garn spann
In dem Jahr, als Bibi Blair zehn wurde – das war zwölf Jahre, bevor der Tod an ihre Tür klopfte –, war der Himmel von Januar bis Mitte März fast jeden Tag eine düstere Gruft der Trauer und die Engel weinten Flut um Flut über das südliche Kalifornien. So beschrieb sie es jedenfalls in ihrem Tagebuch: ein trauernder Himmel, die Tage und Nächte überschwemmt vom Kummer der Engel, auch wenn sie keine Vermutungen über die Ursache des himmlischen Schmerzes anstellte.
Schon damals führte sie nicht nur Tagebuch, sondern schrieb auch Kurzgeschichten. In jenem verregneten Winter drehten sich ihre simplen Erzählungen alle um einen Hund namens Jasper, dessen grausames Herrchen ihn an einem sturmumtosten Strand südlich von San Francisco ausgesetzt hatte. In jeder der kleinen Geschichten fand Jasper, ein grau-schwarzer Mischling, ein neues Zuhause. Aber immer erwies sich die Zuflucht am Ende aus dem einen oder anderen Grund als nicht dauerhaft. Und der gute Jasper, fest entschlossen, den Mut nicht zu verlieren, wanderte weiter südwärts, Hunderte von Meilen auf der Suche nach seinem endgültigen Heim.
Bibi war ein fröhliches Kind, jede Melancholie war ihr fremd; deshalb erschien es ihr damals – und noch Jahre danach – seltsam, dass sie so viele traurige Episoden über eine einsame, heimatlose Promenadenmischung verfasste, deren Suche nach Liebe nie mehr als nur kurz von Erfolg gekrönt war. Erst nach ihrem 22. Geburtstag sollte sie es verstehen.
In gewisser Weise ist jeder eine Elster. Bibi war eine, aber das wusste sie damals nicht.
Viel Zeit sollte vergehen, bevor sie einige der Wahrheiten erkannte, die sie in ihrem Elsternherzen versteckt hatte.
Die Elster, ein Vogel mit einem auffällig gescheckten Gefieder und einem langen Schwanz, hortet oft Gegenstände, die ihr bedeutsam erscheinen: Knöpfe, Schnüre, Bänder, bunte Perlen, Glasscherben. Nachdem sie diese Kleinode vor der Welt verborgen hat, baut die Elster im folgenden Jahr ein neues Nest und vergisst die Lage ihres Schatzes; und deshalb, da sie ihre Sammlung nun auch vor sich selbst versteckt hat, legt die Elster eine neue an.
Menschen verstecken Wahrheiten über sich selbst vor sich selbst. Eine solche Selbsttäuschung ist ein Bewältigungsmechanismus, und in gewissem Maße fangen die meisten schon als Kinder damit an, sich selbst zu täuschen.
In jenem nassen Winter, als sie zehn war, lebte Bibi mit ihren Eltern in einem kleinen Bungalow in Corona del Mar, einem malerischen Stadtteil von Newport Beach. Obwohl sie nur drei Straßen vom Pazifik entfernt wohnten, hatten sie keinen Blick aufs Meer. Am ersten Samstag im April war sie allein zu Hause. Sie saß in einem Schaukelstuhl auf der vorderen Veranda des idyllischen Schindelhauses, während warmer Regen senkrecht durch die Blätter der Palmen und Feigen fiel und auf dem Asphalt zischte wie heißes Öl auf einem Backblech.
Sie war kein Kind, das sich dem Müßiggang hingab. Ihr Geist war immer beschäftigt, immer dabei, neues Garn zu spinnen. Sie hatte einen gelben linierten Schreibblock auf dem Schoß und eine Kollektion Bleistifte, womit sie gerade eine neue Folge der Saga vom einsamen Jasper komponierte. Eine Bewegung am Rand ihres Gesichtsfeldes ließ sie aufblicken und sie sah einen durchnässten und erschöpften Hund, der vom Meer her den Gehweg heraufkam.
Mit zehn war ihr Sinn für Wunder noch nicht ganz abgenutzt; und sie spürte, dass eine überraschende Wende des Schicksals bevorstand. Erfasst von einem angenehmen Gefühl der Erwartung legte sie Block und Stift beiseite, stand auf und ging zur Verandatreppe.
Der Hund sah völlig anders aus als der einsame Mischling in ihren Geschichten. Der tropfnasse Golden Retriever hielt dort an, wo sich der Fußweg des Bungalows mit dem öffentlichen Bürgersteig traf. Mädchen und Tier musterten einander. Bibi rief ihm zu: »Hierher, Junge, hierher.« Sie musste noch ein bisschen mehr locken, aber schließlich kam er zur Veranda und stieg die Stufen hinauf. Das Mädchen beugte sich bis auf seine Höhe hinab, um ihm in die Augen zu schauen, die so golden waren wie sein Fell. »Du stinkst.« Der Retriever gähnte, als ob er das längst wüsste.
Er trug ein rissiges und schmutziges Lederhalsband. Keine Hundemarke baumelte daran. Es war keine jener Metallplatten mit Name und Telefonnummer daran befestigt, wofür ein verantwortungsvoller Hundebesitzer hätte sorgen sollen.
Bibi führte den Hund von der Veranda herunter, durch den Regen, um das Haus herum und auf einen gepflasterten, zehn mal zehn Meter großen Hinterhof, der gesäumt war von verputzten Sichtschutzmauern entlang der Grundstücksgrenzen im Osten und Westen. Im Süden stand eine zweitorige Garage, von der aus es zur Auffahrt ging. Eine Außentreppe führte hoch zu einem kleinen Balkon und einer Wohnung über der Garage. Bibi vermied es, zu den Fenstern hinaufzuschauen.
Sie ließ den Hund auf der hinteren Veranda warten, während sie ins Haus ging. Er überraschte sie damit, dass er immer noch dort war, als sie mit zwei Strandtüchern, Shampoo, einem Föhn und einer Haarbürste zurückkehrte. Er lief mit ihr über den Hof, aus dem Regen und in die Garage.
Nachdem sie das Licht eingeschaltet und ihm das verschmutzte und schlammverkrustete Halsband abgenommen hatte, sah sie etwas, das ihr vorher nicht aufgefallen war. Sie überlegte, das Halsband in die Mülltonne zu werfen, es unter dem anderen Abfall zu vergraben, aber sie wusste, das wäre falsch. Also öffnete sie stattdessen eine Schublade in dem Schrank neben der Werkbank ihres Vaters, nahm eins von mehreren Poliertüchern aus seinem Vorrat und schlug das Halsband darin ein.
Ein Geräusch erklang aus der Wohnung über ihr, ein kurzes, hartes Poltern. Aufgeschreckt schaute Bibi zur Garagendecke, deren offen liegende Balken mit Spinnenarchitektur verziert waren.
Sie glaubte, auch eine leise, gepeinigte Stimme zu hören. Nachdem sie eine halbe Minute lang aufmerksam gelauscht hatte, sagte sie sich, dass sie es sich wohl nur eingebildet hatte.
Zwischen zwei der Balken, von hinten beleuchtet von einer nackten, verstaubten Glühbirne in einer weißen Keramikfassung, tanzte eine fette Spinne von Faden zu Faden und zupfte auf ihrer seidenen Harfe eine Musik, die jenseits des menschlichen Hörvermögens lag.
Bibi musste an die Spinne Charlotte in dem Buch Wilbur und Charlotte von E. B. White denken, die das Schwein Wilbur, ihren Freund, rettete. Für einen Moment vergaß sie die Garage um sich herum, als ein Bild in ihrem Kopf entstand und für sie wirklicher wurde als die Wirklichkeit:
Hunderte von winzigen Spinnen, Charlottes Nachkommen, frisch geschlüpft aus ihrem Eibläschen, viele Wochen nach Charlottes traurigem Tod, wie sie auf dem Kopf stehen, ihre Spinndrüsen gen Himmel richten und kleine Wolken aus feiner Seide ausstoßen. Die Wolken formen sich zu Miniaturballons und die Babyspinnen erheben sich in die Luft. Das Schwein Wilbur ist überwältigt von Erstaunen und Freude, aber auch voller Traurigkeit, als es zusieht, wie die winzige Luftarmada zu fernen Orten davonfliegt. Es wünscht ihnen alles Gute, ist aber zugleich traurig, seine letzte Verbindung zu seiner verstorbenen Freundin Charlotte zu verlieren …
Mit einem leisen Winseln und einem sanften Bellen holte der Hund Bibi zurück in die Wirklichkeit der Garage.
Später, nachdem der Retriever gewaschen, getrocknet und gebürstet war, nahm Bibi ihn während einer Regenpause mit ins Haus. Als sie ihm das kleine Zimmer zeigte, das ihr gehörte, sagte sie: »Wenn Mom und Dad nicht in die Luft gehen, wenn sie dich sehen, wirst du hier bei mir schlafen.«
Der Hund sah interessiert zu, wie Bibi einen Pappkarton aus dem Kleiderschrank zog. Der Karton enthielt Bücher, die nicht mehr auf die bereits schwer beladenen Regale neben ihrem Bett gepasst hatten. Sie ordnete die Bücher neu an, um einen kleinen Hohlraum zu schaffen, in den sie das eingewickelte Hundehalsband legte, bevor sie den Karton wieder in den Schrank schob.
»Dein Name ist Olaf«, informierte sie den Retriever und er reagierte auf seine Taufe mit einem Schwanzwedeln. »Olaf. Eines Tages erzähle ich dir, warum.«
Mit der Zeit vergaß Bibi das Halsband, weil sie es vergessen wollte. Neun Jahre sollten vergehen, bis sie es auf dem Boden jenes Kartons voller Bücher wiederentdeckte.
Und als sie es fand, schlug sie es erneut in das Poliertuch ein und suchte eine neue Stelle, um es zu verstecken.
2
Zwölf Jahre später
Ein perfekter Tag im Paradies
Jener zweite Dienstag im März mit seinen schrecklichen Offenbarungen und der plötzlichen Drohung des Todes wäre für manche Menschen der Anfang vom Ende gewesen, aber Bibi Blair, jetzt 22, würde ihn letztendlich Tag eins nennen.
Sie erwachte im Morgengrauen und stellte sich gähnend ans Schlafzimmerfenster, um der noch verborgenen Sonne dabei zuzusehen, wie sie ihre Ankunft mit Lichtbannern in Korallenrosa ankündigte, bis sie schließlich auftauchte und westwärts zog. Bibi liebte Sonnenaufgänge. Anfänge. Jeder Tag begann mit einem solchen Versprechen. Alles mögliche Gute konnte passieren. Für Bibi war das Wort Enttäuschung für Abende reserviert, und dann auch nur, wenn der Tag wirklich so richtig mies gewesen war. Sie war Optimistin. Ihre Mutter hatte einmal gesagt, wenn das Leben Bibi Zitronen gab, würde sie keine Limonade daraus machen, sondern Limoncello.
Die fernen Berge, bloße Silhouetten vor dem morgendlichen Blau, erschienen wie Bollwerke, die das magische Königreich von Orange County vor der Hässlichkeit und dem Chaos beschützten, die in diesen Tagen so große Teile der Welt heimsuchten. Überall im kalifornischen Flachland versprachen die von Bäumen gesäumten Straßengitter und die zahlreichen Parks der durchgeplanten Wohnviertel im Südcounty ein ruhiges und ordentliches Leben voll unendlichem Zauber.
Bibi brauchte mehr als bloße Versprechen. Mit 22 hatte sie große Träume, auch wenn sie sie nicht Träume nannte, denn Träume waren Sternschnuppenwünsche, die nur selten in Erfüllung gingen. Konsequenterweise nannte sie sie daher Erwartungen. Sie hatte große Erwartungen, und sie sah auch die Mittel vor sich, mit denen sie diese gewiss erfüllen würde.
Manchmal konnte sie sich ihre Zukunft so deutlich vorstellen, dass es fast schien, als hätte sie sie bereits gelebt und würde sich nun daran erinnern. Um die eigenen Ziele zu erreichen, war Fantasie fast genauso wichtig wie harte Arbeit. Man konnte den Hauptpreis nicht gewinnen, wenn man sich nicht vorstellen konnte, woraus er bestand und wo er zu finden war.
Während sie die Berge betrachtete, dachte Bibi an den Mann, den sie heiraten würde, die Liebe ihres Lebens, in diesem Augenblick eine halbe Welt entfernt an einem Ort voller Blut und Heimtücke. Sie weigerte sich, zu viel Angst um ihn zu haben. Er konnte auf sich selbst aufpassen. Er war kein Märchenheld, sondern ein realer, und die Frau, die seine Ehefrau werden wollte, hatte die Verpflichtung, ebenso stoisch wie er mit den Gefahren umzugehen, mit denen er es zu tun hatte.
»Ich liebe dich, Paxton«, murmelte sie, wie sie es oft tat, als wäre diese Erklärung eine Zauberformel, die ihn beschützen würde, ganz egal wie viele Tausende von Meilen sie beide trennten.
Nachdem sie geduscht und sich angezogen und die Zeitung von der Türschwelle geholt hatte, ging sie in die Küche, in der ihre vorprogrammierte Kaffeemaschine gerade die sechste Tasse in die Pyrexkanne tröpfelte. Die Mischung, die sie bevorzugte, duftete angenehm und enthielt so viel Koffein, dass schon die Dämpfe allein reichen würden, um die Schlafkrankheit zu kurieren.
Die klassischen Stühle in der Essecke hatten verchromte Metallbeine und mit schwarzem Vinyl bezogene Sitzflächen. Sehr 50er-Jahre. Bibi mochte die 50er. Damals war die Welt noch nicht verrückt gewesen. Während sie sich an den verchromten Tisch mit der roten Resopalplatte setzte und die Zeitung durchblätterte, trank sie den ersten Kaffee des Tages, den sie ihre ›Wachmachtasse‹ nannte.
Um in einem Zeitalter konkurrenzfähig zu bleiben, in dem elektronische Medien alle wichtigen Nachrichten längst verbreitet hatten, bevor sie in Druck erschienen, hatte der Herausgeber dieser Zeitung entschieden, nur wenige Seiten den wichtigen globalen und nationalen Ereignissen zu widmen und den restlichen Platz für längere Geschichten aus dem Leben der Bewohner dieser Gegend zu reservieren. Als Romanautorin befürwortete Bibi das. Genau wie gute Erzählliteratur drehten sich die besten Geschichtsbücher weniger um die großen Ereignisse als vielmehr um die Menschen, deren Leben von Kräften beeinflusst wurden, die sich ihrer Kontrolle entzogen. Allerdings gab es für jede Geschichte über eine Frau, die gegen gleichgültige Regierungsbürokraten kämpfte, um eine angemessene Pflege für ihren kriegsversehrten Ehemann zu erstreiten, eine andere über jemanden, der eine riesige Sammlung verschrobener Hüte besaß oder einen heiligen Kreuzzug führte, um die Erlaubnis zu erhalten, seinen Papagei zu heiraten.
Genau wie ihre erste Tasse war auch ihr zweiter Kaffee schwarz und Bibi trank ihn, während sie ein Schokocroissant aß. Trotz aller Propaganda glaubte sie nicht daran, dass eimerweise Kaffee oder eine an Butter und Eiern reiche Ernährung ungesund war. Sie aß, was sie wollte, fast aus einer Art Trotzhaltung heraus, und blieb schlank und gesund. Sie hatte nur ein Leben, und das wollte sie leben, mit Bacon und allem.
Als sie ein zweites Croissant aß, biss sie einen Happen ab, der so widerlich schmeckte wie verdorbene Milch. Sie spuckte ihn auf ihren Teller und wischte sich die Zunge mit einer Serviette ab.
Die Bäckerei, in der sie einkaufte, war bisher immer zuverlässig gewesen. Dem Augenschein nach war alles in Ordnung mit dem Stück, das sie ausgespuckt hatte. Sie schnupperte an dem Croissant, aber es roch normal. Es war mit keinen erkennbaren Fremdsubstanzen kontaminiert.
Zögernd nahm sie einen weiteren Bissen. Er schmeckte so, wie er sollte.
Oder doch nicht?
Vielleicht eine winzige Spur von … irgendwas. Sie legte das Croissant auf den Teller. Sie hatte den Appetit verloren.
Die heutige Zeitung war voll mit Sammlern verschrobener Hüte und dergleichen. Sie legte sie beiseite. Mit einer dritten Tasse Kaffee ging sie in das Arbeitszimmer ihrer Dreizimmerwohnung.
Als sie am Computer die unfertige Kurzgeschichte geöffnet hatte, an der sie nun schon seit drei Wochen herumbastelte, blieb ihr Blick für ein paar Momente auf der Namenszeile hängen: Bibi Blair.
Ihre Eltern hatten sie Bibi genannt, nicht weil sie grausam waren oder gleichgültig gegenüber den Leiden eines Kindes mit einem ungewöhnlichen Namen, sondern weil sie leichtherzig und unbeschwert bis zum Gehtnichtmehr waren. Bibi kam von dem altfranzösischen Wort beubelot, was Spielzeug bedeutete oder Spielerei. Sie war niemandes Spielzeug. War es nie gewesen, würde es nie sein.
Ein anderer Name, der sich von beubelot herleitete, war Bubbles. Das wäre noch schlimmer gewesen. Sie hätte ihren Namen zu etwas weniger Albernem ändern oder Pole-Tänzerin werden müssen.
Bis zu ihrem 16. Geburtstag hatte sie sich längst an ihren Namen gewöhnt. Als sie 20 war, fand sie sogar, dass Bibi Blair sie auf eine etwas schrullige Weise von der Masse abhob. Dennoch fragte sie sich manchmal, ob man sie mit solch einem Namen als Autorin ernst nehmen würde.
Sie scrollte von der Überschrift und ihrem Namen nach unten und hielt beim zweiten Absatz an, wo ihr ein Satz ins Auge fiel, den sie umformulieren musste. Als sie zu tippen begann, machte ihre rechte Hand, was sie sollte, aber die linke fummelte unkoordiniert auf den Tasten herum und verstreute wahllos Buchstaben über den Monitor.
Ihre Verwunderung wich dem Erschrecken, als sie feststellte, dass sie die Tasten unter ihren verkrampften Fingern nicht spüren konnte. Das Tastgefühl hatte sie verlassen.
Bestürzt hob sie die verräterische Hand, beugte die Finger, sah, wie sie sich bewegten, konnte die Bewegung aber nicht fühlen.
Obwohl der Kaffee vollständig den ekligen Geschmack weggewaschen hatte, der ihr das zweite Croissant verleidet hatte, war er plötzlich wieder in ihrem Mund. Sie verzog angewidert das Gesicht und griff mit ihrer rechten Hand nach dem Kaffee. Der Rand der Tasse rappelte gegen ihre Zähne, aber das Gebräu säuberte erneut ihre Zunge von dem Geschmack.
Ihre linke Hand rutschte von der Tastatur auf ihren Schoß. Einen Moment lang konnte sie sie nicht bewegen und in einem Anfall von Panik dachte sie: gelähmt.
Plötzlich erfüllte ein Prickeln ihre Hand, den ganzen Arm, nicht diese vibrierende Taubheit nach einem scharfen Schlag gegen den Ellbogen, sondern ein krabbelndes Gefühl, als würden Ameisen durch Fleisch und Knochen schwärmen. Als sie den Stuhl vom Schreibtisch zurückrollte und aufstand, breitete sich das Prickeln durch die ganze linke Seite ihres Körpers aus, von der Kopfhaut bis zum Fuß.
Auch wenn Bibi nicht wusste, was da gerade mit ihr passierte, spürte sie, dass sie in tödlicher Gefahr war. Sie sagte: »Aber ich bin doch erst 22.«
3
Der Friseursalon
Nancy Blair buchte immer den frühestmöglichen Termin in Heather Jorgensons Friseursalon in Newport Beach, weil sie der festen Überzeugung war, dass selbst die besten Hairstylistinnen wie Heather weniger verlässliche Arbeit leisteten, wenn der Tag vorangeschritten war. Nancy würde sich genauso wenig am Nachmittag die Haare schneiden lassen, wie sie ein Facelifting nach dem Abendessen ansetzen würde.
Nicht dass sie eine Schönheitsoperation nötig gehabt hätte. Mit 48 sah sie aus wie 38. Oder höchstens 39. Ihr Mann Murphy, den alle Murph nannten, sagte, wenn sie je einen Schönheitschirurgen an ihrem Gesicht herumpfuschen ließe, würde er sie weiterhin lieben, aber er würde sie nur noch Cruella de Vil nennen, nach der straff gelifteten Schurkin aus 101 Dalmatiner.
Und sie hatte großartige Haare, dicht und dunkel, ohne eine Spur von Grau. Sie ließ sie alle drei Wochen schneiden, weil sie Wert auf ein präzises Äußeres legte.
Ihre Tochter Bibi hatte das gleiche üppige dunkelbraune, fast schwarze Haar, aber Bibi trug es lang. Das liebe Kind versuchte, seine Mutter immer wieder zu überreden, sich von dem kurzen, zotteligen Schnitt zu trennen. Aber Nancy war eine Macherin, eine Anpackerin, immer auf dem Sprung, und sie hatte nicht die Geduld für das endlose Getue, das nötig war, um mit längeren Haaren gut auszusehen.
Nachdem Heather Nancys Haare mit einer Sprühflasche angefeuchtet hatte, sagte sie: »Ich habe Bibis Roman Die Lampe des Blinden gelesen. Hat mir echt gefallen.«
»O Liebes, meine Tochter hat mehr Talent in ihrem kleinen Finger als die meisten anderen Autoren in allen Fingern und Daumen zusammen.« Noch während sie dieses Statement mit unverhohlenem Stolz abgab, merkte Nancy, dass es eigentlich nicht sonderlich eloquent war, sogar ein bisschen albern. Was auch immer die Quelle von Bibis Sprachtalent war, aus den Genen ihrer Mutter kam es nicht.
»Es hätte ein Bestseller werden müssen«, sagte Heather.
»Dahin kommt sie noch. Wenn es das ist, was sie will. Ich weiß es nicht genau. Ich meine … sie erzählt mir alles, aber was das Schreiben angeht und das, was sie will, ist sie eher zurückhaltend. Sie ist in mancher Hinsicht ein rätselhaftes Mädchen. Schon als Kind war Bibi rätselhaft. Sie war acht, als sie sich diese Geschichten ausdachte über eine Gemeinschaft von intelligenten Mäusen, die in Gängen unter unserem Bungalow lebten. Alberne Geschichten, aber sie konnte einen fast dazu bringen, sie zu glauben. Tatsächlich dachten wir für eine Weile, dass sie an diese verdammten Mäuse glaubte. Fast hätten wir sie zur Therapie angemeldet. Aber dann erkannten wir, dass sie einfach nur das war, was sie war, nämlich Bibi, dazu geboren, Geschichten zu erzählen.«
Als begeisterte Leserin von Zeitschriften, die mit reichlich Fotos und minimalem Text über das Leben von Prominenten berichteten, hatte Heather wahrscheinlich schon nach dem dritten Satz von Nancys langer Ansprache nicht mehr zugehört. »Aber warum sollte sie denn keine Bestsellerautorin sein wollen – und berühmt?«
»Vielleicht will sie es. Aber das ist nicht der Grund, weshalb sie schreibt. Sie schreibt, weil sie schreiben muss. Sie sagt, ihre Fantasie ist wie ein Dampfkessel, der ständig zu viel Druck aufbaut. Wenn sie nicht jeden Tag etwas von dem Dampf ablassen würde, würde der Kessel explodieren und ihr den Kopf abreißen.«
»Wow.«
Heathers Gesicht hing im Spiegel über Nancys Gesicht, mit großen Augen und ein bisschen an ein Nagetier erinnernd. Sie war eine hübsche junge Frau. Noch hübscher wäre sie gewesen, hätte sie ihre oberen Eckzähne mit einer Zahnspange richten lassen.
»Bibi meint das natürlich nicht wörtlich. Ihr Kopf wird genauso wenig explodieren, wie damals unter unserem Bungalow intelligente Mäuse gelebt haben.«
Heathers auffällige Eckzähne verliehen ihrem besorgten Gesichtsausdruck eine gewisse Komik. Sie war einfach bezaubernd.
Murph hatte einmal gesagt, wenn ein Mädchen nur süß genug sei, dann fänden manche Männer einen Überbiss sexy. Seither war Nancy auf der Hut vor allen attraktiven Frauen im Leben ihres Mannes, die eine kieferorthopädische Korrektur benötigten. Murph war Heather nie begegnet. Wenn es nach Nancy ging, blieb es auch dabei. Nicht dass er untreu war. Das war er nicht. Er würde es nie wagen. Vielleicht glaubte er nicht daran, dass seine Frau ihn wirklich mit einem Bolzenschneider kastrieren würde, wie sie es geschworen hatte, aber er war klug genug, um zu wissen, dass die Folgen eines Seitensprungs sehr hässlich wären.
»Augen zu«, sagte Heather. Nancy gehorchte, und die Sprühflasche mit Wasser machte ein leises Spritzgeräusch. Danach folgte etwas duftender Schaum. Dann ein abschließendes Föhnen und die letzten Feinarbeiten mit der Bürste.
Als ihre Haare fertig waren, lagen sie perfekt wie immer. Heather war eine so talentierte Friseurin, dass sie sich nie als Schönheitspflegerin oder Haarstylistin bezeichnen würde. Ihre Visitenkarte wies sie als Coiffeuse aus, und dieses kleine bisschen Anmaßung, das so typisch Newport Beach war, war in ihrem Fall absolut gerechtfertigt.
Nancy bezahlte und gab ein großzügiges Trinkgeld. Sie versicherte gerade ihrer Coiffeuse, dass sie die positive Kritik zur Lampe des Blinden an die Autorin weiterleiten werde, als sie vom aktuellen Klingelton ihres Handys unterbrochen wurde – einige Takte aus dem alten Bobby-McFerrin-Song ›Don’t Worry, Be Happy‹. Sie schaute aufs Display, nahm den Anruf an und sagte: »Bibi, Baby.«
Bibis Stimme klang, als wäre es mehr als nur die räumliche Distanz, die zwischen ihr und Nancy lag. »Mom, irgendwas stimmt nicht mit mir.«
4
Die Suche nach dem Silberstreif
Bibi saß in einem Sessel im Wohnzimmer, ihre Handtasche auf dem Schoß, und versuchte, das gruselige Von-Kopf-bis-Fuß-Kribbeln durch positives Denken zu vertreiben, als ihre Mutter in die Wohnung gestürmt kam wie eine Spezialeinheit der Modepolizei auf der Suche nach Leuten, die fantasielos zusammengestellte Ensembles trugen. Nancy sah herrlich eklektisch aus in ihrer Herrenjacke in Sportjackettschnitt, aus geschmeidigem schwarzem Leder von St. Croix, ihrem komplex gemusterten eierschalenfarbenen Top von Louis Vuitton, ihrer schwarzen Mavi-Jeans mit raffinierten, sorgfältig handgefertigten Verschleißstellen und ihren schwarz-roten Turnschuhen von einem Designer, dessen Namen Bibi nicht mehr wusste.
Bibi teilte nicht die Modebesessenheit ihrer Mutter, wie ihre Billigjeans und das langärmelige T-Shirt bewiesen.
Als Nancy durch das Zimmer zu dem Sessel eilte, sprudelte ein Schwall von Worten aus ihr heraus. »Du bist blass, du bist ganz grau, o mein Gott, du siehst schrecklich aus.«
»Das tue ich nicht, Mom. Ich sehe normal aus und das erschreckt mich mehr, als wenn ich steingrau mit blutenden Augen wäre. Wie kann ich normal aussehen und diese Symptome haben?«
»Ich rufe einen Krankenwagen.«
»Nein, das wirst du nicht«, sagte Bibi entschieden. »Ich will keinen Aufstand machen.« Mit ihrer gesunden rechten Hand stemmte sie sich aus dem Sessel hoch. »Fahr mich nur zur Notaufnahme.«
Nancy sah ihre Tochter an, wie sie vielleicht eine bemitleidenswerte, vom Lastwagen überfahrene Kreatur am Rand des Highways angesehen hätte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Wage es nicht, Mutter! Fang jetzt nicht an zu weinen.« Bibi zeigte auf einen kleinen Beutel mit Kordelzug, der neben dem Sessel lag. »Kannst du das für mich nehmen? Das sind ein Schlafanzug, Zahnbürste, ein paar Sachen zum Übernachten, falls ich bis morgen bleiben muss. Auf keinen Fall werde ich eins von diesen Krankenhaushemden zum hinten Zubinden tragen, bei dem alle meinen nackten Hintern sehen können.«
Mit einer Stimme, die zitterte wie Aspik, sagte Nancy: »Ich liebe dich so sehr.«
»Ich liebe dich auch, Mom.« Bibi ging zur Tür. »Jetzt komm schon. Ich habe keine Angst. Jedenfalls nicht sehr. Du sagst immer: ›Es ist, wie es ist.‹ Also lebe auch danach. Lass uns gehen.«
»Aber wenn du einen Schlaganfall hattest, sollten wir einen Krankenwagen rufen. Jede Minute zählt.«
»Ich hatte keinen Schlaganfall.«
Nancy eilte an ihrer Tochter vorbei und öffnete die Wohnungstür, blockierte aber den Ausgang. »Am Telefon hast du gesagt, deine linke Seite ist gelähmt …«
»Nicht gelähmt. Es kribbelt. Als wären 50 Handys, alle auf stumm geschaltet, an meinen Körper geklebt und würden alle gleichzeitig vibrieren. Und meine linke Hand ist ein bisschen schwach. Das ist alles.«
»Klingt wie ein Schlaganfall. Woher willst du wissen, dass es keiner ist?«
»Es ist keiner. Ich rede nicht undeutlich. Ich kann klar sehen. Keine Kopfschmerzen. Keine Verwirrung. Und ich bin erst 22, verdammt!«
Nancys Miene wurde sanfter und wechselte von nervöser Furcht zu etwas, das möglicherweise Verdruss war, als ihr klar wurde, dass sie ihrer Tochter im Moment nicht gerade half, sondern sie nur beunruhigte. »Okay. Ja, du hast recht. Ich fahre dich.«
Die Türen der Wohnungen im zweiten Stock lagen alle an einer überdachten Galerie, und Bibi ließ ihre rechte Hand über das Geländer gleiten, als die beiden zum Nordende gingen. Es war ein angenehmer, kühler Tag. Singvögel feierten fröhliche Feste. Hinter dem Haus rauschten die Palmen und Farne leise in der sanften Brise. Silberne Phantomfische aus Sonnenlicht flitzten durch das Wasser des Swimmingpools, und diese einfache Szenerie war von einer so tiefgreifenden Schönheit, wie Bibi sie noch nie wahrgenommen hatte.
Als sie das Ende der Galerie erreichten, meinte Nancy: »Liebling, bist du sicher, dass du die Treppe schaffst?«
Die offene Metalltreppe hatte Stufen aus grobkieseligem Beton. Dank ihrer Symmetrie und der Anmut, mit der sie hinunter in den Hof führte, war sie im Grunde eine Skulptur. Bibi hatte sie vorher nie als ein Kunstobjekt betrachtet; die Aussicht, sie möglicherweise niemals wiederzusehen, eröffnete ihr wahrscheinlich diese neue Sichtweise.
»Ja, ich schaffe die Treppe«, versicherte Bibi ungeduldig. »Ich kann sie nur nicht hinabtanzen.«
Sie bewegte sich von Stufe zu Stufe, ohne nennenswerten Zwischenfall, außer dass sich dreimal ihr linker Fuß nicht bewegen wollte, als er es sollte, und sie ihn hinterherziehen musste.
Als sie sich auf dem Parkplatz einem BMW näherten, auf dessen Kennzeichen TOP AGENT stand, wollte Nancy erst zur Beifahrertür gehen, erinnerte sich dann aber offensichtlich daran, dass Verhätscheln nicht erwünscht war, und beeilte sich, zur Fahrerseite zu gelangen.
Bibi stellte zu ihrer Erleichterung fest, dass das Einsteigen in den Wagen nicht schwieriger war als das Besteigen der sanft schaukelnden Gondel eines Riesenrades.
Nancy startete den Motor. »Schnall dich an, Liebes.«
»Ich bin angeschnallt, Mutter.« Als Bibi sich selbst hörte, fühlte sie sich wieder wie eine 16-Jährige, unselbstständig und etwas quengelig, und sie verabscheute es, beides zu sein. »Ich bin angeschnallt.«
»Oh. Bist du. Ja, natürlich.«
Nancy fuhr zügig vom Parkplatz herunter, bog nach rechts auf die Straße und gab Gas, um es über die anschließende Kreuzung zu schaffen, bevor die Ampel umsprang.
»Es wäre schon ironisch«, sagte Bibi, »wenn du uns auf dem Weg zum Krankenhaus umbringen würdest.«
»Ich hatte noch nie einen Unfall, Liebling. Und nur einen einzigen Strafzettel, und das war eine total hinterhältige, arglistige Radarfalle. Der Bulle war ein echtes Smogmonster, ein total mieser Kak, der ein Glassout nicht von Mushburgern unterscheiden könnte.«
Surferslang. Ein Smogmonster war ein Binnenländer. Ein Kak war ein Vollidiot. Glassout war, wenn das Meer im perfekten Fluss war, ideale Bedingungen zum Surfen, und Mushburger waren die Sorte Wellen, bei denen Surfer überlegten, ob sie nicht lieber dem Wasser den Rücken kehren und aufs Skateboard umsteigen sollten.
Manchmal fiel es Bibi schwer, sich daran zu erinnern, dass ihre Mutter vor langer Zeit ein eingefleischtes Surfergirl gewesen war und zusammen mit den Besten der Szene die Tubes und Drops geritten hatte. Nancy liebte noch immer den von der Sonne gebackenen Sand und die Brandung. Von Zeit zu Zeit paddelte sie hinaus und fing ein paar Wellen ein. Aber von den Wörtern, die heute ihre Identität definierten, stand Surferin längst nicht mehr so hoch auf der Liste wie früher einmal. Heutzutage, wenn sie nicht gerade am Strand war, schlich sich Surfspeak nur dann in ihr Vokabular, wenn sie sich über eine Autoritätsperson oder ähnliche Gestalten aufregte.
Nancy konzentrierte sich auf den Verkehr, jetzt ohne Tränen in den Augen, das Kinn entschlossen vorgereckt, die Stirn gerunzelt, sie schaute in den Rückspiegel, die Seitenspiegel, wechselte die Spuren häufiger als gewöhnlich, völlig in ihrer Aufgabe aufgehend, wie sie es sonst nur tat, wenn sie hinter einem Immobilienangebot herjagte oder meinte, dass ein Grundstücksverkauf unmittelbar vor dem Abschluss stand.
»Ach Scheiße.«
Bibi riss ein paar Papiertaschentücher aus der Box am Armaturenbrett und spuckte zweimal hinein, ohne Wirkung.
»Was ist? Was machst du?«
»Dieser eklige Geschmack!«
»Welcher Geschmack?«
»Wie verdorbene Milch, ranzige Butter. Er kommt und geht.«
»Seit wann?«
»Seit … das angefangen hat.«
»Du hast gesagt, deine einzigen Symptome seien die schwache Hand und das Kribbeln.«
»Ich glaube nicht, dass es ein Symptom ist.«
»Es ist ein Symptom«, entschied ihre Mutter.
In der Ferne ragte das Krankenhaus über anderen Gebäuden auf, und bei diesem Anblick musste Bibi sich eingestehen, dass sie mehr Angst hatte, als sie zugeben wollte. Die Architektur des Gebäudes war unscheinbar und fade, aber je näher sie ihm kamen, desto unheilvoller erschien es ihr.
»Es gibt immer einen Silberstreif«, sprach Bibi sich selbst Mut zu.
Ihre Mutter klang besorgt und zweifelnd. »Ach ja?«
»Für eine Autorin gibt es immer einen. Alles ist Material. Wir brauchen ständig neues Material für unsere Geschichten.«
Nancy beschleunigte über eine gelbe Ampel und bog von der Straße auf das Krankenhausgelände ab. »Es ist, wie es ist«, sagte sie wie zu sich selbst, als wären diese Worte magisch, jedes einzelne davon ein Amulett, um das Böse abzuwehren.
»Bitte sag das nicht wieder zu mir«, verlangte Bibi etwas schärfer, als sie beabsichtigt hatte. »Nie wieder. Du sagst es andauernd, und ich will es nicht mehr hören.«
Während sie dem Schild zur Notaufnahme folgte, das sie von der Haupteinfahrt nach links führte, warf Nancy einen Seitenblick auf ihre Tochter. »Okay. Was immer du willst, Liebling.«
Bibi bereute es augenblicklich, ihre Mutter so angefahren zu haben. »Tut mir leid. Sorry.« Die ersten drei Wörter kamen ganz normal heraus, aber sie hörte die leichte Verzerrung beim letzten, das wie Schorri klang.
Als sie vor dem Eingang der Notaufnahme hielten, wurde Bibi der Grund dafür klar, weshalb sie keinen Krankenwagen gerufen hatte: Sie besaß das professionelle Gespür der erfahrenen Schriftstellerin für einen guten Geschichtenaufbau. Vielleicht schon von dem Moment an, als ihre linke Hand nicht das auf der Computertastatur getan hatte, was sie sollte, und ganz sicher von dem Augenblick an, als das Prickeln begann, hatte sie gewusst, wohin das alles führte, wohin es führen musste, nämlich an einen finsteren Ort. Schließlich war jedes Leben eine Geschichte oder eine Sammlung von Geschichten und nicht alle davon liefen würdevoll auf ein gutes Ende hin. Sie hatte immer angenommen, dass ihr Leben eine Geschichte voller Glück sein würde, dass sie es zu einer solchen Geschichte machen würde, und als nun ihre Symptome eingesetzt hatten, hatte sie nur sehr widerwillig in Erwägung ziehen wollen, dass ihre Annahme möglicherweise naiv war.
5
Pet the Cat
Obwohl die Frühlingshitze sich noch nicht endgültig an der südkalifornischen Küste eingenistet hatte, ging Murphy Blair an diesem Morgen zur Arbeit in Sandalen, Boardshorts, einem schwarzen T-Shirt und einem blau-schwarz karierten Pendleton-Hemd, das er offen trug, die Ärmel aufgerollt. Sein sandbrauner Haarschopf war durchzogen mit blonden Strähnen, original sonnengebleicht, nicht aus der Tube, denn selbst an kühleren Tagen ging er für ein paar Stunden in die Sonne. Er war der lebende Beweis dafür, dass mit ausreichender Obsession und Verachtung für Melanome eine Sonnenbräune das ganze Jahr über aufrechterhalten werden konnte.
Sein Laden, Pet the Cat, lag auf der Halbinsel Balboa, der Landmasse, die den Hafen von Newport vor dem Meer abschirmte, in der Nähe des ersten von zwei Landungsstegen. Der Name des Ladens entstammte dem Surferslang und bezeichnete die Bewegung, die Surfer machten, wenn sie auf ihren Brettern hockten und mit der Hand über die Luft oder das Wasser strichen, um ihre Geschwindigkeit zu kontrollieren.
Die Schaufenster waren voll mit Surfbrettern und T-Shirts und Shorts von Mowgli, Wellen, Billabong, Aloha, Reyn Spooner.
Murph verkaufte alles von Otis-Brillen mit Mineralglaslinsen bis zu Surf-Siders-Schuhen, von Neoprenanzügen bis zu Stance-Socken mit Mustern nach Motiven des Surfchampions John John Florence.
Mit 50 lebte Murph seine Arbeit, arbeitete, um zu spielen, spielte, um zu leben. Als er am Pet the Cat ankam, war die Tür unverschlossen, das Licht war an und Pogo stand hinter dem Tresen und las fasziniert die Gebrauchsanweisung von Search, der GPS-Surferuhr von Rip Curl.
Pogo blickte zu seinem Boss auf und sagte: »Ich muss unbedingt eins von diesen Dingern haben.«
Vor drei Jahren war er mit einem perfekten Zweier-Durchschnitt der High School entkommen und hatte den Versuch seiner Eltern vereitelt, ihn auf die College-Bahn zu drängen. Er lebte spartanisch mit zwei anderen Surffreaks, Mike und Nate, in einer Einzimmerwohnung über einem Secondhand-Laden im nahe gelegenen Costa Mesa und fuhr einen grundierfarbengrauen, 30 Jahre alten Honda, der aussah, als wäre er nur noch als Requisit einer Monstertruck-Show zu gebrauchen.
Manchmal fand ein vielversprechender Loser Zuflucht in der Surferszene und blieb größtenteils oder komplett unbeweibt, bis er irgendwann starb, ohne seinen letzten Arbeitslosenscheck eingelöst zu haben. Aus zwei Gründen hatte Pogo dieses Problem nicht. Erstens war er ein König der Wellen, furchtlos und anmutig auf dem Brett, begierig, sogar die gewaltigen Monolithen zu meistern, die Hurrikan Marie gebracht hatte, bewundert für seinen Stil und seine Courage. Er hätte ein Champion werden können, wenn er genug Ehrgeiz besessen hätte, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Zweitens sah er so verdammt gut aus, dass die Frauen ihm hinterherschauten, als säßen ihre Köpfe mit Kugellagergelenken auf ihren Hälsen.
»Gibst du mir den üblichen Rabatt?«, fragte Pogo und zeigte auf die GPS-Uhr.
»Sicher«, sagte Murph. »Klar.«
»Zwölf Wochenraten, null Zinsen?«
»Bin ich die Wohlfahrt? So teuer ist das Ding nicht.«
»Acht Wochen?«
Murph seufzte. »Okay, meinetwegen.« Er zeigte auf den leeren Flachbildschirm des Fernsehers an der Wand hinter dem Tresen, auf dem eigentlich alte Billabong-Surfvideos laufen sollten, um dem Laden Atmosphäre zu verleihen. »Sag mir nicht, dass der im Eimer ist.«
»Nein. Hab’s nur irgendwie vergessen. Sorry, Bro.«
»Bro, hm? Liebst du mich wie einen Bruder, Pogo?«
»Absolut, Bro. Mein richtiger Bruder Clyde ist ein Börsenmakler-Superhirn, könnte genauso gut vom Mars kommen.«
»Sein Name ist Brandon. Warum sagst du immer Clyde?«
Pogo zwinkerte ihm zu. »Du wirst schon noch drauf kommen.«
Murph atmete tief ein und aus. »Willst du, dass der Laden läuft?«
Während er die Billabong-Videos startete, antwortete Pogo: »Klar, natürlich, ich will, dass du der König der Szene bist, Bro.«
»Dann würdest du meinem Geschäft sehr helfen, wenn du dir einen Job in einem anderen Surfladen suchen würdest.«
Pogo grinste. »Ich wäre am Boden zerstört, wenn du das ernst meinen würdest. Aber weißt du, ich verstehe deinen trockenen Humor. Du solltest Comedian werden.«
»Yeah, ich bin der Brüller.«
»Nein, wirklich. Bonnie findet dich auch zum Totlachen.«
»Bonnie, deine hart schuftende Schwester, die sich den Hintern aufreißt, um das Restaurant am Laufen zu halten? Ah! Jetzt hab ich’s. Bonnie und Clyde. Sie ist jedenfalls auch ein Superhirn. Du meinst, du und sie, ihr habt den gleichen Sinn für Humor?«
Pogo seufzte.
»He, wenn ich ›Superhirn‹ sage, dann meine ich das nicht despektierlich. Ich habe viel gemeinsam mit meinen beiden Geschwistern.«
»›Despektierlich‹, hm? Manchmal verrätst du dich selbst, Pogo.« Murphs Handy klingelte und er sah aufs Display. Nancy. Er meldete sich: »Was gibt’s, Schatz?«
Ein Frösteln kletterte sein Rückgrat hinauf bis in sein Herz, als seine Frau sagte: »Ich habe Angst, Baby. Ich fürchte, Bibi hatte einen Schlaganfall.«
6
Das beängstigende Tempo der Untersuchung
An einem Dienstagmorgen war in der Notaufnahme längst nicht so viel los wie in der 19-bis-3-Uhr-Schicht. Die Nacht würde die von betrunkenen Autofahrern Angefahrenen bringen, die Opfer von Überfällen, verprügelte Ehefrauen und alle Sorten aggressiver oder halluzinierender Junkies, die haarscharf an einer Überdosis vorbeikratzten. Als Bibi mit ihrer Mutter ankam, saßen nur fünf Leute im Wartezimmer, von denen keiner übermäßig blutete.
Im Augenblick war für die Ersteinschätzung ein Rettungssanitäter namens Manuel Rivera zuständig, ein kleiner, gedrungener Mann in blauer Krankenhauskluft. Er fühlte Bibis Puls und maß ihren Blutdruck, während er ihr dabei zuhörte, wie sie ihre Symptome schilderte.
Bibi lallte ein paar der Worte, aber größtenteils konnte sie sich klar ausdrücken. Sie fühlte sich besser und sicherer hier im Krankenhaus, bis Manuels gütiges Gesicht, fast schon ein Buddha-Gesicht, sich vor Sorge verfinsterte und er sie zu einem Rollstuhl führte. Mit offenkundiger Dringlichkeit rollte er sie durch eine automatische Doppeltür in die eigentliche Notaufnahme, vor allen anderen, die auf eine Behandlung warteten.
Jeder Behandlungsraum der Notaufnahme war eine Kabine mit grauem PVC-Boden und drei blassblauen Wänden sowie einer Glaswand, die zum Flur ging. Neben dem Kopfende des Bettes standen ein Herzmonitor und andere Geräte, die auf ihren Einsatz warteten.
Nancy setzte sich auf einen der beiden Besucherstühle, mit ihrer und Bibis Handtasche, die sie beide so fest umklammerte, als rechnete sie mit einem Raubüberfall, obwohl es kein Handtaschenräuber war, vor dem sie sich fürchtete.
Manuel senkte das Bett ab und half Bibi, sich auf die Kante zu setzen.
»Solange Ihnen nicht schwindelig wird, legen Sie sich bitte noch nicht hin«, wies er sie an.
Er schob den Rollstuhl in den Flur, wo ihm ein großer, sportlich aussehender Mann im OP-Kittel entgegenkam, offensichtlich ein Arzt. Der Doktor rollte eine transportable Computerstation vor sich her, in die er Einzelheiten zur vorläufigen Diagnose und Behandlung jedes Patienten, den er untersuchte, eingab.
»Ist alles okay, Liebling?«, fragte Nancy.
»Ja, Mom. Ich bin okay. Alles wird gut.«
»Brauchst du etwas? Wasser? Brauchst du Wasser?«
Bibis Mund wurde von Speichel geflutet, als müsste sie sich gleich übergeben, aber sie schluckte ihn tapfer herunter und schaffte es, ihr Frühstück unten zu behalten. Das Letzte, was sie im Moment wollte, war Wasser.
Nachdem Manuel kurz mit dem großen Mann auf dem Flur gesprochen hatte, kam dieser in die Kabine und stellte sich als Dr. Armand Barsamian vor. Sein ruhiges und souveränes Auftreten hätte Bibi unter anderen Umständen mit Zuversicht erfüllt.
Während er ihre Augen mit einem Ophthalmoskop untersuchte, stellte er ihr ein paar Fragen – Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer –, offensichtlich um herauszufinden, ob ihr Gedächtnis von dem, was gerade mit ihr geschah, beeinträchtigt war oder nicht.
»Wir müssen eine Computertomografie Ihres Gehirns machen«, sagte Dr. Barsamian. »Wenn es wirklich ein Schlaganfall ist, werden Sie umso eher wieder vollständig gesund werden, je schneller wir die Ursache identifizieren – Thrombose, Hämorrhagie – und mit der Behandlung beginnen.«
Ein Pfleger war bereits mit einem Rollbett vor der Kabine aufgetaucht. Der Arzt half Bibi, sich hinzulegen.
Als sie weggerollt wurde, stand ihre Mutter mit verlorenem Gesicht im Flur, als rechnete sie halb damit, ihre Tochter nie wiederzusehen. Der Pfleger bog um eine Ecke und Bibi verlor ihre Mom aus den Augen.
Im CT-Raum im ersten Stock war es kühl. Bibi bat nicht um eine Decke. Irgendwie hatte sie die abergläubische Vorstellung, dass der Test umso besser ausfallen würde, je stoischer sie blieb.
Sie stieg von dem Rollbett auf die Scannerliege um.
Der Pfleger verließ den Raum und eine Krankenschwester erschien mit einem Tablett, auf dem ein Gummischlauch zum Abbinden lag, ein in Folie eingeschweißter Desinfektionstupfer und eine Spritze mit dem Kontrastmittel, das die Blutgefäße und Anomalien im Gehirn deutlicher sichtbar machen würde.
»Alles in Ordnung, meine Liebe?«
»Ja, vielen Dank. Mir geht’s gut.«
Nachdem die Schwester wieder gegangen war, sprach die unsichtbare CT-Technikerin über eine Gegensprechanlage mit Bibi, um ihr zu erklären, wie die Prozedur ablaufen würde. Die Frau hatte eine sanfte, mädchenhafte Stimme mit einem ganz leichten japanischen Akzent, und als Bibi die Augen schloss, nahm eine Szene um sie herum Gestalt an, die ihr viel lebensechter erschien als der nüchterne CT-Raum …
Ein Plattenweg führt zu einem roten Mondtor, das umrankt wird von weißen Chrysanthemen. Dahinter steht ein Teehaus unter einem Dach aus blühenden Kirschbäumen, deren blasse Blütenblätter den grauen Steinweg sprenkeln. Im Teehaus sitzen Geishas in Seidenkimonos, die ihre langen schwarzen Haare zu kunstvollen Frisuren arrangiert haben, festgesteckt mit Elfenbeinnadeln in der Form von Libellen.
Der Schlitten der Scannerliege setzte sich in Bewegung und riss Bibi aus dem Teehaus ihrer Fantasie, um sie mit dem Kopf voran in die Öffnung des Scanners zu befördern. Die gesamte Prozedur war so schnell vorüber, dass sie sich fragte, ob wirklich alles richtig gemacht worden war, obwohl sie wusste, dass die Fachkompetenz des Krankenhauspersonals momentan ihre geringste Sorge war.
Bibi war ein bisschen erschrocken über die Geschwindigkeit, mit der man sich ihres Falles angenommen hatte, seit sie das Wartezimmer der Notaufnahme betreten hatte. Sie hatte keine Hoffnung auf Frieden, bis die Diagnose feststand; doch je schneller das Krankenhaus arbeitete, desto mehr hatte sie das Gefühl, eine Rutsche hinabzugleiten, immer schneller, in einen Abgrund hinein.
7
Zwölf Jahre früher
Die Macht der Kekse
Olaf, der herrenlose Golden Retriever, der aus dem Regen gekommen war, lebte noch nicht einmal eine Woche bei der Familie Blair, als er es sich zur Angewohnheit machte, die Treppe zur Wohnung über der Garage hinaufzusteigen. Es gefiel ihm, auf dem kleinen Balkon mit den zwei Schaukelstühlen zu liegen. Er stützte seine Schnauze auf die unterste Querstrebe des weiß gestrichenen Geländers und blickte zwischen den Pfosten hindurch auf den Hof hinter dem Bungalow wie ein Prinz, der zufrieden sein Reich betrachtete.
Jedes Mal wenn die junge Bibi ihn dort entdeckte, rief sie ihn herunter, zuerst mit einem Flüstern, von dem sie sicher war, dass er es hören konnte, denn Hunde hatten ein besseres Gehör als Menschen. Obwohl Olaf sie beobachtete, wenn sie dort unten stand, tat er immer so, als wäre er taub für ihre Bitten. Auch wenn sie die Stimme zu einem Bühnenflüstern erhob, kam er nicht zu ihr herab, aber das leise Klopfen seines Schwanzes auf den Holzboden des Balkons verriet, dass er ihre Befehle verstand.
Bibi wagte es nicht, die Treppe hinaufzugehen, um den Hund beim Kragen zu packen und nach unten zu führen. Oben auf dem Balkon wäre sie nur wenige Schritte von der Tür zur Wohnung entfernt. Zu nahe.
Frustriert ging Bibi im Hof auf und ab, dabei schaute sie immer wieder zu Olaf hoch, aber nie zu einem der drei Fenster. Die Sonne machte die Scheiben zu Spiegeln, deshalb hätte sie ohnehin niemanden sehen können, wenn er dort gestanden und sie beobachtet hätte. Trotzdem richtete sie den Blick nie direkt auf eines der Fenster.
Sie ging in den Bungalow und nahm aus einer Dose in der Speisekammer zwei der Johannisbrotkekse, denen der Retriever nicht widerstehen konnte. Zurück im Hof, hielt sie eins der Leckerlis in jeder Hand, die Arme über den Kopf gehoben, um Olaf die köstliche Belohnung für seinen Gehorsam riechen zu lassen. Sie wusste, dass er den Duft des Johannisbrots auffing, denn selbst vom Hof aus konnte sie seine feuchte schwarze Nase zwischen den Geländerpfosten zucken sehen.
Die Kekse hatten bisher immer funktioniert, doch diesmal nicht. Nach einigen Minuten zog Bibi sich zur hinteren Veranda des Bungalows zurück und setzte sich auf ein Korbsofa mit dicken Kissen, deren Bezüge ein Palmwedelmuster aufwiesen.
Olaf liebte es, dort neben ihr zu liegen, seinen Kopf auf ihrem Schoß, während sie sein Gesicht streichelte, seine Brust kratzte und seinen Bauch rieb. Das Verandadach versperrte die Sicht auf die Fenster der Garagenwohnung, aber Bibi konnte gerade eben noch den unteren Teil des Balkongeländers sehen und den Hund mit seiner Schnauze zwischen zwei Pfosten. Und er beobachtete sie.
Bibi hielt sich einen der Johannisbrotkekse unter die Nase, roch daran und entschied, dass er auch die menschliche Zunge nicht beleidigen würde. Sie biss den Keks halb durch und kaute. Er schmeckte nicht eklig, aber auch nicht wirklich gut. Johannisbrot sollte angeblich so ähnlich schmecken wie Schokolade, die Hunde nicht essen durften, aber gegen ein Stück Hershey’s hatte es keine Chance.
Von seinem Beobachtungsposten auf dem Balkon aus hatte Olaf gesehen, wie die Hälfte seines Leckerlis unverfroren verschlungen worden war. Sein Kopf ruhte nicht mehr auf der untersten Strebe des Geländers. Jetzt lugte seine Schnauze zwischen zwei Pfosten knapp unter dem Handlauf hervor, was bedeutete, dass er aufgestanden war.
Bibi schwenkte die verbliebene Hälfte des Kekses vor ihrer Nase hin und her, hin und her, und erhob ihre Stimme, um ihrer uneingeschränkten Begeisterung für die Delikatesse Ausdruck zu verleihen. »Mmmmmh, mmmmmh, mmmmmh!«
Olaf stürmte die Balkontreppe hinab, über den gepflasterten Hof und auf die Veranda. Er sprang aufs Sofa und landete mit solcher Wucht, dass das Korbgeflecht protestierend knackte und knirschte.
»Braver Junge«, sagte Bibi.
Mit seinem weichen Maul nahm er den halben Keks, den Bibi zwischen Daumen und Zeigefinger hielt. Sie gab ihm den zweiten Keks an einem Stück, und während er mit lautstarkem Wohlgefallen kaute, sagte sie: »Geh nicht wieder da hoch. Bleib von der Wohnung weg. Das ist ein schlimmer Ort. Ein schrecklicher Ort. Ein böser Ort.«
Als der Hund damit fertig war, sich die Lefzen zu lecken, sah er Bibi mit einem Blick an, in dem sie tiefernstes Überlegen zu erkennen glaubte. Im Schatten der Veranda waren seine Pupillen weit und die goldenen Regenbogenhäute schienen in einem inneren Licht zu leuchten.
8
Hammer-Wipeout
Nancy wusste, sie sollte relaxen, einen Sideslip durch den Moment machen, den Wellengang aussitzen, sie sollte sich auf einem der Besucherstühle niederlassen und darauf warten, dass Bibi von ihrer CT zurückgebracht wurde. Aber schon als jugendliche Surfanfängerin, die ihre ersten Gehversuche auf dem Wasser machte, war sie nie eine Barbie mit der Sanftmut einer Puppe gewesen. Wenn sie auf dem Brett gestanden hatte, hatte sie immer die Wellen schreddern, sie zerfetzen wollen, aber auch wenn die Wellen ein matschiger Brei gewesen waren und das Land mehr Anziehungskraft ausübte als das Meer, war sie mit ihrer üblichen Energie durch den Tag geprescht.
Als Murph vom ersten Flur der Notaufnahme in den zweiten bog, schritt Nancy deshalb unruhig vor der Kabine, aus der Bibi mit dem Rollbett abtransportiert worden war, auf und ab. Sie sah ihren Mann nicht gleich, erfasste seine Ankunft aber intuitiv anhand der Art und Weise, wie zwei Schwestern aufmerkten, einladend lächelten und einander zuflüsterten. Auch mit 50 sah Murphy noch aus wie Don Johnson in seinen Miami Vice-Tagen, und wenn er andere Frauen hätte haben wollen, hätten sie an ihm gehangen wie Schiffshalter, jene Fische, die sich mit ihren kräftigen Saugplatten an Haie hefteten.
Murph trug immer noch ein schwarzes T-Shirt, ein Pendleton-Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln und Boardshorts, aber aus Respekt vor dem Krankenhaus hatte er die Sandalen gegen ein Paar schwarze Surf Siders mit blauen Schnürsenkeln ausgetauscht, die er ohne Socken trug.
Newport Beach war einer der wenigen Orte im County, in denen jemand, der wie Murph gekleidet war, in einem Krankenhaus nicht fehl am Platze wirkte – oder in einer Kirche.
Er legte die Arme um Nancy, und sie erwiderte die Umarmung, und für einen Moment sprach keiner von ihnen. Sie brauchten nichts zu sagen. Mussten nur einander festhalten.
Als sie sich aus der Umarmung lösten und nur noch an den Händen hielten, fragte Murph: »Wo ist sie?«
»Sie haben sie zur Computertomografie gebracht. Eigentlich müsste sie längst zurück sein. Ich weiß nicht, warum sie noch nicht wieder da ist. So lange sollte das doch nicht dauern … oder?«
»Geht’s dir gut?«
»Ich fühle mich wie nach einem Hammer-Wipeout«, antwortete sie – Surferslang für einen heftigen Abgang vom Brett durch eine brutale Killerwelle.
»Wie schlägt Bibi sich?«, fragte er.
»Du kennst sie doch. Sie kommt zurecht. Egal was mit ihr passiert, sie denkt schon darüber nach, was sie tun wird, wenn sie es hinter sich hat – ob es vielleicht guter Stoff für eine Geschichte ist.«
Seine mobile Computerstation vor sich herrollend kam Dr. Barsamian, der leitende Arzt während der laufenden Schicht, zu ihnen und informierte sie, dass Bibi nach ihrem CT-Scan im Krankenhaus bleiben werde. »Sie ist in Zimmer 356.« Die Augen des Doktors waren so schwarz wie Kalamata-Oliven. Falls er irgendetwas Schlimmes über Bibis Zustand wusste, konnte Nancy jedenfalls nichts aus seinem Blick herauslesen.
»Die Computertomografie hat offenbar keine eindeutigen Ergebnisse gebracht«, sagte Barsamian. »Es sollen noch weitere Tests gemacht werden.«
Im Aufzug, auf dem Weg vom Erdgeschoss in den dritten Stock, erlebte Nancy einen verstörenden Augenblick der Sinnesverwirrung. Obwohl die Anzeige über der Tür von E zu 1 und dann zu 2 wechselte, hätte sie schwören können, dass die Aufzugskabine nicht aufwärtsfuhr, sondern hinab in die wie auch immer gearteten unterirdischen Etagen, dass Stahlkabel und Gegengewichte sie hinabzogen in eine grenzenlose Finsternis, aus der es keine Wiederkehr gab.
Auch als die Leuchtanzeige auf der 3 hielt und die Tür des Aufzugs zur Seite glitt, ließ ihre Beklemmung nicht nach. Zimmer 356 lag auf der rechten Seite. Als sie und Murph dort ankamen, stand die Tür offen. Das Zimmer enthielt zwei unbelegte Betten, die frisch bezogen waren.
Bibis Beutel lag auf dem Nachttisch neben dem Bett, das näher am Fenster stand. Als Nancy einen Blick hineinwarf, sah sie eine Zahnbürste, Zahnpasta und andere Dinge, aber keinen Schlafanzug.
Zu jedem Bett gehörte ein schmaler Schrank. Einer davon erwies sich als leer. Im anderen hingen Bibis Jeans und ihr langärmeliges T-Shirt. Ihre Schuhe standen ordentlich nebeneinander auf dem Boden des Schrankes, die Socken hineingestopft.
Mit dem Quietschen von Gummisohlen und dem Geruch nach Seife betrat eine blonde junge Frau in blauem Krankenhauskittel das Zimmer. Sie sah zu jung aus, um schon examiniert zu sein, mehr wie eine 15-Jährige, die Krankenschwester spielte.
»Man sagte uns, unsere Tochter sei hier«, sagte Murph.
»Sie müssen Mr. und Mrs. Blair sein. Bibi wurde zu ein paar Tests abgeholt.«
»Was für Tests?«, fragte Nancy.
»MRT, großes Blutbild, alles Routine.«
»Für uns ist nichts davon Routine«, sagte Nancy und bemühte sich vergeblich um einen unbeschwerten Ton.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist nichts Invasives. Bibi hält sich großartig.«
Die Beteuerungen der viel zu jungen Krankenschwester klangen so hohl wie die Versprechen von Politikern.
»Sie wird eine Weile fort sein. Wenn Sie wollen, können Sie zum Mittagessen runter in die Cafeteria gehen. Sie haben genug Zeit.«
Nachdem die Schwester gegangen war, standen Nancy und Murph für einen Moment verunsichert da und schauten sich im Zimmer um, als wären sie gerade durch Zauberei dorthin teleportiert worden.
»Cafeteria?«, fragte Murph.
Nancy schüttelte den Kopf.
»Ich habe keinen Hunger.«
»Ich dachte mehr an Kaffee.«
»Krankenhäuser sollten Bars haben.«
»Du trinkst nie etwas vor halb sechs.«
»Ich hätte Lust, damit anzufangen.«
Sie drehte sich zum Fenster und dann, mit einem plötzlichen Gedanken, wandte sie sich wieder davon ab. »Wir müssen es Paxton sagen.«
Murph schüttelte den Kopf. »Wir können nicht. Hast du vergessen? Seine Einheit ist auf einem Geheimeinsatz. Wir können ihn nicht erreichen.«
»Es muss einen Weg geben!«, protestierte Nancy.
»Wenn wir es versuchen und Bibi es herausfindet, zieht sie uns das Fell über die Ohren. Auch wenn die beiden noch nicht verheiratet sind, wird sie mit jedem Tag mehr wie er, pragmatisch und auf die Einhaltung der militärischen Prozeduren bedacht.«
Nancy wusste, dass er recht hatte. »Wer hätte gedacht, dass sie es ist, um die wir uns Sorgen machen müssen, und nicht er?«
Sie schaltete den Fernseher ein. Keins der Programme war unterhaltsam. Alle erschienen ihr unerträglich belanglos. Die Nachrichten erweckten nur Verzweiflung.
Die beiden gingen hinunter in die Cafeteria, um Kaffee zu trinken.
9
Die Röhre des Schicksals
Später würde man Bibi darüber informieren, dass der CT-Scan nicht eindeutig gewesen sei, aber gewisse Hinweise geliefert habe und dass ihre Ärzte einen Schlaganfall dem vorgezogen hätten, was jetzt vermutet wurde. Nachdem die Möglichkeit einer Embolie oder einer Hämorrhagie ausgeschlossen worden war, setzten die Ärzte die Untersuchung mit einer wachsenden Besorgnis fort, die sie vor ihr zu verbergen versuchten. Das Lächeln der Mediziner war eine Maske, nicht weil sie Bibi täuschen wollten, sondern weil Ärzte nicht weniger als ihre Patienten leben, um zu hoffen.
Ebenfalls später würde sie erfahren, dass ihre beste Chance auf vollständige Gesundung eine mögliche Diagnose auf einen Gehirnabszess war, ein mit Eiter gefüllter Hohlraum umgeben von entzündetem Gewebe. Diese lebensbedrohliche Erkrankung konnte mit Antibiotika und Kortikosteroiden behandelt werden. Ein chirurgischer Eingriff war häufig unnötig.
Man entnahm ihr Blut, um eine Kultur anzulegen. Man röntgte ihren Brustkorb.
Man machte ein EEG, das fast eine Stunde dauerte, um die elektrische Aktivität ihres Gehirns zu studieren.
Als Bibi schließlich zum MRT in einen anderen Raum gebracht wurde, fühlte sie sich, als wäre sie einen Marathon über unzählige Treppenfluchten gelaufen. Sie war nicht nur müde, sondern ausgelaugt. Eine solche Müdigkeit konnte nicht das Ergebnis von dem bisschen körperlicher Aktivität sein, das dieser Tag ihr abverlangt hatte. Sie vermutete, dass ihre wachsende Erschöpfung ein weiteres Symptom ihrer Krankheit war, so wie das Kribbeln in ihrer gesamten linken Körperhälfte, der widerliche Geschmack, der kam und ging, und die Schwäche ihrer linken Hand.
Sie hatte keinen Appetit auf Mittagessen und man hatte ihr ohnehin nur Wasser angeboten. Vielleicht musste sie für einige der Tests nüchtern sein. Oder die Ärzte hatten es eilig, schnell möglichst viele Informationen zu sammeln für eine dringend benötigte Diagnose.
Weil der Tomograf eine geschlossene Röhre war, nur wenig größer als ein menschlicher Körper, fragte eine Krankenschwester: »Sind Sie klaustrophobisch?«
»Nein«, antwortete Bibi.
Sie lehnte ein mildes Beruhigungsmittel ab, als sie sich auf den Schlitten legte, der sie in den unheilvollen Zylinder transportieren sollte.
Bibi weigerte sich, auch nur die Möglichkeit einer solchen Schwäche einzugestehen. Sie war kein Weichei, war es nie gewesen und würde es nie sein. Sie bewunderte Zähigkeit, innere Stärke, Entschlossenheit.
Aber sie nahm die angebotenen Ohrhörer an, mit denen sie Musik hören konnte, und einen Handschalter, mit dem sie dem bedienenden Techniker ein Zeichen geben konnte, falls sie in Panik geriet.
Sie würde für einige Zeit in der Maschine stecken. Moderne Kernspintechnologie ermöglichte Aufnahmen zu hoch spezialisierten Zwecken. Ein funktionales MRT würde die Nervenzellenaktivität im Gehirn messen. MR-Angiografie gab Aufschluss über Herzfunktionen und die Bewegung des Blutes durch den Körper. Ein Magnetresonanzspektrogramm lieferte eine detaillierte Analyse chemischer Veränderungen im Gehirn, wie sie von verschiedenen Krankheitsbildern hervorgerufen wurden.
Die Musik war wortlos, sanfte Orchesterversionen von Songs, die Bibi nicht ganz identifizieren konnte. Von Zeit zu Zeit gab die Maschine ein lautes Rumsen von sich, als müsste der Techniker die Messung mit Hammerschlägen vorantreiben. Bibi fühlte, wie ihr Herz arbeitete. Der Schalter in ihrer Hand wurde glitschig vom Schweiß.
Sie schloss die Augen und versuchte, sich mit Gedanken an Paxton Thorpe abzulenken. Ein schöner Mann in jeder Hinsicht: sein Körper und Gesicht, seine Augen, sein Herz und Verstand. Sie hatte ihn vor etwas mehr als zwei Jahren kennengelernt. Vor fünf Monaten hatte sie seinen Heiratsantrag angenommen. Genau wie ihr Name hatte auch seiner eine Bedeutung: Paxton bedeutete Stadt des Friedens, was angesichts der Tatsache, dass er ein beinharter Navy SEAL war, leicht ironisch wirkte. Pax war zurzeit mit seinem Team auf einer Geheimmission, um irgendwo irgendwas mit bösen Menschen anzustellen, die zweifellos weit Schlimmeres verdienten als das, was sie bekamen. Das Team würde für eine Woche oder zehn Tage im vollen Blackout-Modus operieren. Keine Telefonate. Keine Tweets. Keine Möglichkeit für Pax zu erfahren, was mit seiner Verlobten passierte.
Sie vermisste ihn schmerzlich. Er sagte immer, sie sei der Prüfstein, an dem er am Ende seines Lebens messen werde, ob er ein guter Mensch gewesen sei oder nicht, ob Katzengold oder Edelmetall. Bibi kannte die Antwort bereits: Er war echtes Gold. Er war ihr Fels in der Brandung und sie wünschte sich, er wäre jetzt hier, aber sie hatte bereits den stoischen Kodex des Militärs verinnerlicht und würde ganz bestimmt nicht wegen seiner Abwesenheit in Tränen ausbrechen. Tatsächlich dachte sie manchmal, dass sie schon in einem früheren Leben eine Soldatenfrau gewesen sein musste, da ihr die dazugehörige Einstellung so natürlich erschien.
Während die brummende Maschine klopfte und rumste, füllte sich Bibis Mund plötzlich erneut mit Speichel. Wie schon zuvor wurde dieses Vorzeichen eines möglichen Übergebens nicht von einem Schwindelgefühl begleitet, und die Gefahr ging vorüber.
Mit ihrem inneren Ohr hörte sie ihre Mutter sagen: Es ist, wie es ist. Diese fünf Wörter waren Nancys und Murphys Mantra, ihr Zugeständnis an das Wirken von Natur und Schicksal. Bibi liebte sie so, wie jedes Kind seine Eltern liebte, aber ihr Verständnis vom wahren Wesen der Welt stimmte nicht mit dem ihrer Eltern überein. Sie würde nichts dem Schicksal überlassen. Niemals.
10
Der Mensch, der sie ist
Es wurde vier Uhr nachmittags, und inzwischen war Dr. Sanjay Chandra der für Bibis Fall zuständige Arzt.
Nancy fand ihn auf den ersten Blick sympathisch, aber aus einem etwas skurrilen Grund. In ihrer Kindheit hatte ein Buch über einen zum Leben erwachten Lebkuchenkeks sie verzaubert. In den Illustrationen war der Keks, dessen Name Cookie war, nicht so dunkel wie Lebkuchen gewesen, sondern hatte mehr den warmen Farbton von Zimt gehabt, mit einem goldigen runden Gesicht und Augen aus Schokoladentropfen. Wenn das Buch nicht mindestens 40 Jahre alt gewesen wäre, ungefähr so alt wie der Arzt, hätte Nancy vermuten können, dass der Zeichner den Doktor gekannt und als Vorbild für die Illustration der Figur verwendet hatte. Dr. Chandra besaß eine warme, musikalische Stimme, wie man sie sich durchaus bei einem zum Leben erwachten Keks vorstellen konnte, und sein Auftreten war gleichermaßen angenehm.
Nach der Vielzahl an Untersuchungen, die Bibi über sich ergehen lassen musste, war sie in einem Zustand der Erschöpfung in ihr Zimmer zurückgebracht worden. Trotz ihrer Besorgnis über ihren Zustand wollte sie vor dem Abendessen nur noch schlafen.
Sie war weggetreten, sobald sie die Augen zugemacht hatte.
Dr. Chandra wollte sie nicht stören, und tatsächlich zog er es vor, bis zum nächsten Tag zu warten, um mit ihr die Testergebnisse zu besprechen, nachdem er mehr Zeit gehabt hatte, sie zu sichten. Aber obwohl Bibi 22 war und längst nicht mehr der Obhut ihrer Eltern unterstand, wollte der Doktor zuerst mit diesen sprechen, und zwar sofort, »um herauszufinden«, wie er es formulierte, »was für ein Mensch sie ist«.
Nancy und Murph setzten sich mit ihm an einen Tisch im Pausenraum, am nördlichen Ende des dritten Stockwerks, wo im Augenblick niemand vom Krankenhauspersonal Pause machte. Die Getränke- und Snackautomaten summten leise, als würden sie über wichtige Entscheidungen sinnieren, und die unerbittliche Grelle der Leuchtstoffröhren wirkte nicht gerade beruhigend.
»Ich habe Bibi nur gesagt, dass wir etwas Zeit brauchen, um alle Untersuchungsergebnisse auszuwerten, zu einer Diagnose zu kommen und einen Behandlungsverlauf festzulegen«, sagte Dr. Chandra. »Ich werde morgen früh um zehn mit ihr reden. Es ist mir immer wichtig, meinen Patienten die Diagnose und Prognose auf eine möglichst schonende und persönliche Weise mitzuteilen. Ich habe festgestellt, dass es dabei sehr hilft, schon vorher einen Eindruck von der Psyche und Persönlichkeit des Patienten gewonnen zu haben.«
Nancy fand das nicht sehr ermutigend. Gute Neuigkeiten erforderten nicht das sorgfältige Abwägen der Worte, mit denen sie überbracht wurden. Vielleicht hätte sie das auch gesagt, aber sie traute plötzlich ihrer Stimme nicht mehr.
»Bibi ist eine außergewöhnliche junge Frau«, sagte Murph. Wahrscheinlich hätte niemand außer Nancy die Anspannung in seiner Stimme bemerkt. Er sah nur den Doktor an, als könnte ein Blickkontakt mit seiner Frau ihn aus der Bahn werfen. »Sie ist intelligent, viel intelligenter als ich. Sie wird es erkennen, wenn Sie die Wahrheit auch nur ein kleines bisschen beschönigen. Das würde sie nur verärgern. Sie will es offen und schonungslos hören, nicht aufgehübscht. Bibi ist zäher, als sie aussieht.«
Murph erzählte dem Arzt vom Tod Olafs, des Golden Retrievers, der vor etwas weniger als sechs Jahren gestorben war, ein paar Monate nach Bibis 16. Geburtstag. Zuerst war Nancy überrascht, dass ihr Mann dachte, diese Geschichte sei für die augenblickliche Situation von Bedeutung. Aber während sie zuhörte, erkannte sie, dass sie perfekt Dr. Chandras Frage beantwortete, was für ein Mensch Bibi war.
Der Arzt unterbrach Murph nicht, nickte nur ein paarmal, als hätte er keine anderen Patienten außer Bibi, auf die er sich vorbereiten musste.
Als Murph mit der Geschichte fertig war, rang Nancy sich dazu durch, eine Frage zu stellen, bei der ihre Stimme zitterte. »Dr. Chandra … was für ein Arzt sind Sie? Ich meine … was ist Ihr Spezialgebiet?«
Er sah ihr direkt in die Augen, als ginge er davon aus, dass sie das gleiche unerschütterliche und stoische Wesen besaß wie ihre Tochter. »Ich bin Onkologe, Mrs. Blair. Mit einer zusätzlichen Spezialisierung in chirurgischer Onkologie.«
»Krebs«, hauchte Nancy mit einem solchen Unterton von Entsetzen, als wäre das Wort ein Synonym für Tod.
Dr. Chandras schokoladendunkle Augen waren warm und mitfühlend, und Nancy sah in ihnen etwas, das Kummer sein mochte.