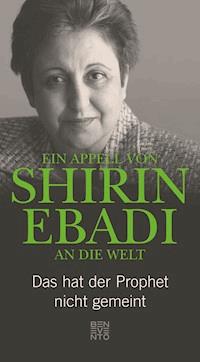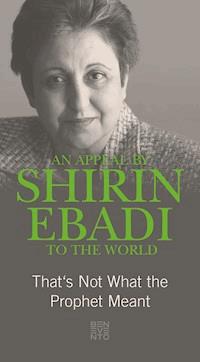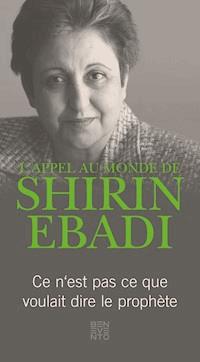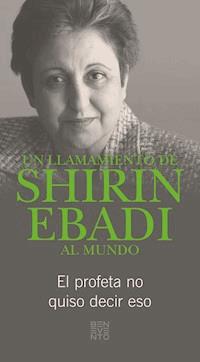11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Seit Jahrzehnten setzt sich Shirin Ebadi für Menschenrechte und eine Reform der iranischen Gesellschaft ein. In »Mein Iran« erzählt die Friedensnobelpreisträgerin von den frühen Jahren ihres politischen Engagements, ihrer Zeit als Richterin, den Demütigungen und Schikanen durch die islamische Revolution bis hin zu ihrer Verhaftung und ihrem dennoch fortwährenden Kampf. Ein beeindruckendes Zeugnis politischen Muts und ein tiefer Einblick in die Strukturen eines gespaltenen Landes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Im Gedenken an meine Mutter und meine ältere Schwester, Mina, die beide von uns gingen, während ich dieses Buch schrieb. Ein Teil des Autorenhonorars soll in ihrem Namen für gemeinnützige Zwecke gespendet werden.
»Mein Iran« berichtet von wahren Begebenheiten. Einige Namen und Indentifikationsdetails wurden abgeändert. Gespräche stützen sich, gezwungenermaßen, auf die Erinnerung der Autorin.
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Iran Awakening. A Memoir of Revolution and Hope« bei Random House New York, einem Imprint von Penguin Random House LLC.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Ursula Pesch
ISBN 978-3-492-97543-8
Oktober 2016
© Shirin Ebadi, 2006
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Shirin Ebadi
Karte: Anita Karl und Jim Kemp
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Traurigkeit ist für mich die glücklichste Zeit, wenn sich aus den Ruinen meines trunkenen Geistes eine strahlende Stadt erhebt.
In jenen Zeiten, wenn ich schweigsam und ruhig bin wie die Erde, ist der Widerhall meines Rufens im ganzen Universum zu hören.
Mevlana Jalaluddin Rumi
Vorwort
Im Herbst 2000, beinahe ein Jahrzehnt nachdem ich meine Arbeit als Anwältin aufgenommen und damit begonnen hatte, vor den Gerichten des Irans Gewaltopfer zu verteidigen, durchlebte ich die zehn quälendsten Tage meines gesamten Berufslebens. Die Fälle, mit denen ich es normalerweise zu tun hatte – misshandelte Kinder, missbrauchte Ehefrauen, politische Gefangene –, führten mir täglich menschliche Grausamkeit vor Augen, doch bei dem Fall, um den es nun ging, hatte ich es mit einer Bedrohung ganz anderer Art zu tun.
Die Regierung hatte vor kurzem eine Mittäterschaft bei den Ende der Neunzigerjahre vorsätzlich verübten Morden an Dutzenden von Intellektuellen eingestanden. Einige waren erdrosselt worden, während sie Besorgungen machten, andere waren in ihren Häusern erschlagen worden. Ich vertrat die Familien von zweien der Opfer und hatte dringend darauf gewartet, die Akten der richterlichen Ermittlungen einsehen zu können.
Der vorsitzende Richter hatte den Anwälten der Opfer nur zehn Tage Zeit gegeben, die gesamte Akte zu lesen – nur zehn Tage, in denen wir Zugang zu den Ermittlungsergebnissen haben würden – und die unsere einzige Chance waren, Beweismaterial zusammenzutragen. Das Durcheinander der Ermittlungen, die Versuche, die Beteiligung des Staates zu verschleiern, der mysteriöse Selbstmord eines Hauptverdächtigen im Gefängnis, machten es uns noch schwerer, zu rekonstruieren, was tatsächlich geschehen war, von den fatwas, religiösen Edikten, die die Morde anordneten, bis zur Hinrichtung der Betroffenen. Es hätte nicht mehr auf dem Spiel stehen können.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Islamischen Republik hatte der Staat zugegeben, seine Kritiker ermordet zu haben, und zum ersten Mal sollte ein Prozess stattfinden, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die Regierung selbst hatte zugegeben, dass eine Gruppe eigenmächtig handelnder Mitarbeiter des Informationsministeriums für die Morde verantwortlich sei, doch der Fall war bislang noch nicht vor Gericht gekommen. Als es schließlich so weit war, trafen wir nahezu bebend vor Entschlossenheit im Gerichtsgebäude ein.
Nachdem wir den Umfang der Akten gesehen hatten – mannshohe Berge –, war uns klar, dass wir sie gleichzeitig würden lesen müssen und nur einer von uns sich an die chronologische Reihenfolge halten konnte. Diesen Part überließ man mir.
Die Sonne schien durch die schmutzige Fensterscheibe und ihre Strahlen schienen viel zu schnell durch den Raum zu wandern, während wir schweigend Schulter an Schulter über den kleinen Tisch gebeugt saßen und nur das Geraschel von Papier und gelegentlich das dumpfe Schaben der Stuhlbeine auf dem Fußboden zu hören war.
Die entscheidenden Passagen in den Akten, die Abschriften der Verhöre mit den des Mordes Angeklagten, waren überall verstreut, vergraben zwischen Seiten voller bürokratischer Worthülsen. Diese Abschriften enthielten Beschreibungen der brutalen Morde, Absätze, in denen der Mörder anscheinend mit Vergnügen davon berichtet, bei jedem Stoß, als düstere Hommage an die Tochter des Propheten Mohammed, »Ya Zahra« ausgerufen zu haben.
Im Raum nebenan saßen die Anwälte der Angeklagten und lasen andere Teile des Dossiers, und durch die Wand hindurch spürten wir beständig die Anwesenheit dieser Männer, die jene verteidigten, die im Namen Gottes gemordet hatten. Die meisten der von ihnen Vertretenen waren Funktionäre des Informationsministeriums von niederem Rang, Handlanger, die die Todeslisten auf Geheiß ranghöherer Beamter unterzeichnet hatten.
Um die Mittagszeit ließ unsere Energie nach, und einer der Anwälte bat den jungen Soldaten im Gang, uns Tee zu bringen. Sobald uns das Teetablett gebracht worden war, beugten wir die Köpfe wieder über die Akten. Ich war bei einer Seite angelangt, auf der die Dinge detaillierter und flüssiger geschildert wurden als in anderen Passagen, und las deshalb langsamer und konzentrierter. Es war die Abschrift einer Unterhaltung zwischen einem Regierungsminister und einem Mitglied des Todeskommandos. Als mein Blick auf den Satz fiel, der mich viele Jahre lang verfolgen sollte, glaubte ich, mich verlesen zu haben. Ich blinzelte einmal, doch der Satz stand noch immer da: »Die nächste Person, die getötet werden soll, ist Shirin Ebadi.« Ich.
Mein Hals war plötzlich wie ausgetrocknet. Ich las diese Zeile immer und immer wieder. Die gedruckten Wörter verschwammen vor meinen Augen. Die einzige weitere Frau im Raum, Parastou Forouhar, deren Eltern zu den Ersten gehört hatten, die in ihrem Teheraner Haus mitten in der Nacht getötet – erstochen und verstümmelt – worden waren, saß neben mir. Ich fasste sie am Arm und deutete mit dem Kopf auf die vor mir liegende Seite. Sie neigte ihr verschleiertes Haupt herüber und ließ die Augen über den Text wandern. »Hast du das gelesen? Hast du das gelesen?«, flüsterte sie immer wieder. Wir lasen gemeinsam weiter, lasen, wie der Mann, der mein Mörder werden wollte, zum Informationsminister ging und um die Erlaubnis bat, mich ermorden zu dürfen. Nicht im Fastenmonat Ramadan (im persischen Ramazan), hatte der Minister geantwortet, aber jederzeit danach. Aber sie fasten doch sowieso nicht, hatte der Söldner argumentiert, diese Leute haben sich von Gott abgewandt. Dieses Argument – dass die Intellektuellen, dass ich, mich von Gott abgewandt hätte –, diente ihnen dazu, die Morde als ihre religiöse Pflicht zu rechtfertigen. In der grausigen Terminologie derjenigen, die den Islam als eine Religion interpretieren, die Gewalt duldet, war es halal, von Gott gestattet, unser Blut zu vergießen.
In diesem Moment öffnete sich knarrend die Tür. Wir bekamen noch einmal Tee, der zwar nach nichts schmeckte, uns aber wach hielt. Ich lenkte mich damit ab, die vor mir liegenden Papiere neu zu ordnen, völlig benommen von dem, was ich gelesen hatte. Ich hatte keine Angst, wirklich nicht, und ich war auch nicht wütend. Ich erinnere mich vor allem an das überwältigende Gefühl, es nicht glauben zu können. Warum hassen sie mich so sehr?, fragte ich mich. Was habe ich getan, um einen solchen Hass auszulösen? Wie ist es möglich, dass ich mir Feinde gemacht habe, die so begierig darauf sind, mein Blut zu vergießen, dass sie nicht einmal bis zum Ende des Ramadan warten können?
Wir sprachen damals nicht sofort darüber. Wir hatten keine Zeit für Pausen oder mitfühlende Worte, etwa: »Wie schrecklich, dass du die Nächste auf der Liste warst.« Wir konnten es uns nicht erlauben, die begrenzte, kostbare Zeit, die uns für das Studium der Akten zur Verfügung stand, zu vergeuden. Ich nippte an meinem Tee und las weiter, obwohl meine Finger wie gelähmt waren und ich nur mit Mühe die Seiten umblättern konnte. Gegen zwei Uhr hörten wir auf, und erst dann, während wir über den Hof nach draußen gingen, erzählte ich es den anderen Anwälten. Sie schüttelten den Kopf und murmelten Alhamdulellah, Gott sei Dank, dass ich im Unterschied zu den Opfern der Familien, die wir vertraten, dem Tod entkommen war.
Als ich auf die Straße hinaustrat, empfing mich die willkommene Kakophonie des Teheraner Verkehrs. Zu dieser Tageszeit waren die breiten, von niedrigen Häusern gesäumten Straßen der Stadt überfüllt von schnaufenden alten Autos. Ich nahm ein Taxi und ließ mich vom Rütteln des staubigen Wagens einlullen, bis wir mein Haus erreichten. Ich rannte hinein, zog mich aus und blieb eine Stunde lang unter der Dusche, ließ das kalte Wasser an mir herabströmen, damit es den Schmutz dieser Akten wegwusch, der sich in meinem Kopf und unter meinen Fingernägeln eingenistet hatte. Erst nach dem Abendessen, nachdem meine Töchter ins Bett gegangen waren, erzählte ich es meinem Mann.
Heute ist mir bei der Arbeit etwas Interessantes passiert, begann ich.
Eine Jugend in Teheran
Meine nachsichtige, liebevolle Großmutter, von der wir Kinder nie auch nur ein einziges böses Wort hörten, schimpfte uns am 19.August 1953 zum ersten Mal richtig aus. Wir spielten in einer Ecke des dämmrigen, von Laternenlicht beleuchteten Wohnzimmers, als sie uns mit angespanntem Gesichtsausdruck anfuhr, ruhig zu sein. Es war das Jahr, bevor ich in die Grundschule kam, und meine Familie verbrachte den Sommer im geräumigen Landhaus meines Vaters, das im Randgebiet der westlichen Provinz Hamadan lag, in der meine Eltern aufgewachsen waren. Meine Großmutter besaß ganz in der Nähe ebenfalls ein Haus, und ihre Enkel kamen dort jeden Sommer zusammen, spielten Verstecken in den Obsthainen und kehrten bei Sonnenuntergang zurück, um sich mit den Erwachsenen um das Radio zu setzen. Ich erinnere mich noch lebhaft an jenen Abend, an dem wir mit klebrigen Fingern und von Beerensaft verschmierten Kleidern ins Haus kamen und die Erwachsenen in einer düsteren Stimmung vorfanden. Diesmal beachteten sie unseren Aufzug gar nicht. Sie saßen völlig gebannt und enger zusammengedrängt als sonst um das Radio und hatten die Kupferschalen mit Datteln und Pistazien nicht angerührt. Eine zittrige Stimme in dem batteriebetriebenen Radio verkündete, dass Ministerpräsident Mohammed Mossadegh vier Tage nach den Unruhen in Teheran durch einen Staatsstreich gestürzt worden sei. Wir Kinder kicherten über die niedergeschlagenen Blicke und die ernsten Gesichter der Erwachsenen und huschten aus dem Wohnzimmer, in dem eine Stimmung herrschte wie bei einem Begräbnis.
Die Anhänger des Schahs, die den staatlichen Rundfunk unter ihre Kontrolle gebracht hatten, verkündeten, das iranische Volk habe mit dem Sturz Mossadeghs einen Sieg errungen. Außer denen, die für die Mitwirkung an diesem Staatsstreich bezahlt worden waren, teilten nur wenige diese Einschätzung. Für die Iraner, ob religiös oder nicht, arm oder reich, war Mossadegh weit mehr als ein beliebter Staatsmann. Für sie war er ein geliebter Nationalheld, eine Persönlichkeit, die ihrer begeisterten Verehrung würdig war, ein fähiger Führer an der Spitze ihrer großen Zivilisation mit ihrer über 2500Jahre alten Geschichte. Zwei Jahre zuvor, 1951, hatte der Ministerpräsident die iranische Ölindustrie verstaatlicht, die bis dahin von westlichen Ölkonsortien kontrolliert worden war. Diese hatten gemäß Verträgen, die für den Iran nur eine geringe Gewinnbeteiligung vorsahen, große Mengen des iranischen Öls gefördert und exportiert. Dieser mutige Schritt, der die Gewinnerwartungen des Westens im ölreichen Mittleren Osten durcheinander brachte, trug Mossadegh die ewige Bewunderung der Iraner ein, die in ihm die Vaterfigur der iranischen Unabhängigkeit sahen, so wie Mahatma Gandhi in Indien dafür verehrt wurde, seine Nation von der britischen Kolonialherrschaft befreit zu haben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!