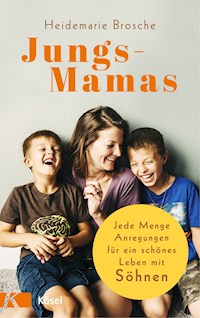11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Viele Eltern hören von Lehrern, ErzieherInnen, Freunden oder anderen Familienmitgliedern: Das Kind sei zu laut oder zu leise, zu aufgedreht oder zu ernst, zu ruhig oder zu aggressiv – jedenfalls nicht so, wie es sein sollte.
Heidemarie Brosche ermuntert Eltern, solche Zuschreibungen kritisch zu betrachten und sie mutig anders zu sehen. Schreibt ein Kind in den Augen seiner Lehrerin zum Beispiel zu langsam, kann das heißen, dass es ganz bei sich ist, sehr konzentriert arbeitet und keine Flüchtigkeitsfehler macht. Oder wird ein Kind als zu dominant und aggressiv beschrieben, kann das bedeuten, dass es auch durchsetzungs- und willensstark ist. Erkennen Eltern das Positive dieser Qualitäten, hilft dies dem Kind, Selbstbewusstsein und Ichstärke zu entwickeln und sein So-Sein zu akzeptieren.
Ein Mutmacher für alle Eltern, die nicht wollen, dass ihre Kinder in Schubladen gesteckt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Viele Eltern hören von Lehrern, Erzieherinnen, Freunden oder anderen Familienmitgliedern: Ihr Kind sei zu laut oder zu leise, zu aufgedreht oder zu ernst, zu ruhig oder zu aggressiv – jedenfalls nicht so, wie es sein sollte.
Heidemarie Brosche ermuntert Eltern, solche Zuschreibungen kritisch zu hinterfragen und mutig anders zu sehen. Ist ein Kind in den Augen seiner Lehrerin zum Beispiel zu langsam, kann das heißen, dass es ganz bei sich ist und nicht zu übereiltem Handeln neigt. Oder wird ein Kind als zu dominant und aggressiv beschrieben, kann die positive Seite Durchsetzungs- und Willensstärke sein.
Ein Mutmachbuch für Eltern, das stärkt und Zuversicht schenkt.
Zur Autorin
Heidemarie Brosche, geboren 1955, ist Mittelschullehrerin und erfolgreiche Autorin von Kinder-, Jugend- und Sachbüchern. Sie ist Mutter von drei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Friedberg/Bayern.
www.h-brosche.de
Heidemarie Brosche
Mein Kind ist genau richtig, wie es ist
Das Ermutigungsbuch für Eltern
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Kösel-Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2017 Kösel-Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Weiss Werkstatt, München
Umschlagmotiv: plainpicture / Jakob Fridholm
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-21074-8V002
www.koesel.de
Inhalt
Ein persönliches Vorwort
1 Unikate – in Schubladen sortiert
Vom einzigartigen Geschenk »Kind« zur bewerteten Ware
Auch Unikate kann man sortieren – ein Ausflug in die Persönlichkeitstypologie
Schubladeninhalte genauer betrachtet
Ist der Inhalt der einen Schubladebesser als der der anderen?
Kann man den Inhalt der Schubladen ändern?
Das ewige Vergleichen
2 Mäkler und Schwächen-Finder
Verwandte, Freunde und Bekannte
Zufallsbegegnungen
Kita und Kindergarten
Institution Schule
Wir Eltern selbst
3 Was Bemängelung anrichten kann
Wie sich Bemängelung auf Eltern auswirkt
Wie sich Bemängelung auf Kinder auswirkt
Immer auf dem Prüfstand – ein Gedankenexperiment
Mögliche Folgen in Kindheit und Jugend
Mögliche Folgen im Erwachsenenleben
4 Wer entscheidet, waswünschens- oder »bemängelnswert« ist?
Bewertungen sind relativ
Zeitgeist
Land, Kultur, Religion
Mädchen oder Junge?
Elternhaus
Ein und dasselbe Kind in unterschiedlichen Umgebungen
Das spätere berufliche und private Leben als Bewertungskriterium
5 Vermeintliche Schwächen anders sehen
Stärken neben den Schwächen sehen
Stärken in den Schwächen sehen
Widerstände gegen ein »Anders-Sehen«
Warum es sich lohnt, Stärkenin den Schwächen zu sehen
Was Eltern aus der neuen Sichtweise lernen können
6 Stärken in den Schwächen – ganz konkret
Zu faul, zu bequem, zu wenig ehrgeizig
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Zu introvertiert, zu schüchtern, zu ängstlich, zu ruhig, zu ernst, zu nachdenklich, zu grüblerisch, zu sensibel
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Zu unkonzentriert, zu verträumt
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Zu extravertiert, zu lebhaft, zu geschwätzig, zu albern, mit zu wenig Ernst bei der Sache
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Zu schnell, zu flüchtig, zu oberflächlich, zu unordentlich
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Zu langsam, zu begriffsstutzig, zu unpünktlich
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Zu eigensinnig, zu undiszipliniert, zu frech, zu aufmüpfig
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Zu gewissenhaft, zu ehrgeizig, zu verbissen, zu perfektionistisch
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Zu aggressiv, zu jähzornig
Die vermeintliche Schwäche
Die Stärke in der Schwäche
Tipps für Eltern
Mängelhäufung mit gutem Ausgang
Schlusswort
Anhang
Dank
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Ein persönliches Vorwort
Als Kind war ich zwar freundlich, aufgeweckt und ehrgeizig, wenn man den Bemerkungen in meinen Grundschulzeugnissen Glauben schenken darf. Ich war aber auch zu schnell, zu flüchtig, zu schwärmerisch und ein bisschen zu mitteilsam – in den Augen meiner diversen Lehrerinnen und Beobachter. Im Beichtstuhl bekannte ich als Zehnjährige, zu jähzornig zu sein, weil mir meine Umgebung das Gefühl vermittelt hatte, dies sei eine Schwäche von mir. Meinem Vater war ich zu eitel, weil er mich öfter mal beim Blick in den Spiegel ertappte. Mir selber war ich immer zu unsportlich, weil ich an den Foltergeräten in der Turnhalle versagte. Am Anfang der Pubertät war ich manchen Mitschülerinnen zu streberhaft und zu uncool, wie sie mich gerne wissen ließen. Wenig später war ich den Lehrkräften zu diskussionsfreudig und plötzlich zu wenig ehrgeizig. Als Erwachsene erhielt ich von meiner Umgebung Etiketten verpasst wie »zu bescheiden«, »zu arbeitsam«, aber auch »zu emotional«, »zu lebenslustig«.
An jedes einzelne Zu seit Kindertagen erinnere ich mich gut, auch an das Gefühl, das damit einherging: Ich erfüllte irgendwelche Erwartungen nicht. Etwas an mir war nicht in Ordnung. An mir wurden Mängel festgestellt.
Als meine Kinder Schüler waren, ließ mich die Schule wissen, sie seien wechselweise zu ruhig, zu lebhaft, zu ernst, zu albern, zu laut, zu kontaktfreudig, zu verschlossen, zu impulsiv, zu eigensinnig. An jedes einzelne Zu seit Muttertagen erinnere ich mich, auch an das Gefühl, das damit einherging: Eines meiner Kinder erfüllte irgendwelche Erwartungen nicht. Etwas an ihm war nicht in Ordnung. An ihm wurden Mängel festgestellt.
Nur, dass diesmal neue Gefühle hinzukamen: War ich als Mutter womöglich an den Mängeln schuld? Musste ich gegensteuern? Hätte ich nicht längst gegensteuern sollen?
Dann wurden die Kinder größer, älter. Sie wurden keine perfekten Wesen, natürlich nicht! Aber ich stellte fest: Sie waren, wie sie waren. Jedes von ihnen war, wie es war. Manche der einst konstatierten Mängel hatten sich ausgewachsen, manche waren Markenzeichen geblieben. Und bei alledem war nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil: Manche ehemaligen Schwächen hatten sich langsam, aber sicher sogar als Stärken erwiesen.
Ich begann intensiv nachzudenken. Was sollte dieses ewige »Du bist zu …«, »Sie sind zu …«, »Ihr Kind ist zu …«? Warum musste ich mich kläglich fühlen, weil irgendjemand beschlossen hatte, ich sei so, wie ich war, nicht in Ordnung? Warum musste ich mich kläglich fühlen, weil irgendjemand beschlossen hatte, mein Kind sei so, wie es war, nicht in Ordnung? Warum musste sich dieses Kind kläglich fühlen, weil irgendjemand beschlossen hatte, es sei so, wie es war, nicht in Ordnung? Hatten all diese Beanstandungen irgendetwas Gutes bewirkt? War ich weniger jähzornig, weniger eitel, weniger emotional geworden, weil man mich dieser Schwächen bezichtigt hatte? Waren meine Kinder besser gediehen, nachdem man sie mit ihren Mängeln konfrontiert hatte? War ich als Mutter besser in der Lage, meine Kinder gut zu erziehen, nachdem ich über ebendiese »Mängel« informiert worden war?
Das Ergebnis meines Nachdenkens und -forschens lautete: Jede einzelne dieser Bemängelungen hatte ungute Gefühle ausgelöst, keine dieser Bemängelungen hatte etwas zum Guten bewegt. Im Gegenteil: Manchmal hatte das Bemühen, gegen die Schwächen anzukämpfen, den Blick auf die Stärken verstellt, auf die Stärken, die nicht nur neben den Schwächen existierten, sondern die in den sogenannten Schwächen selbst verborgen waren.
»Diese eingepflanzte Zu-…-Handbremse hat mich länger begleitet, als mir lieb war«, gestand mir eine Bekannte neulich.
All diese Gedanken waren der Auslöser für das vorliegende Buch. Ich habe es geschrieben, um Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu einem anderen Blick auf die Eigenarten und Verhaltensweisen Ihrer Kinder zu motivieren. Um Ihnen Mut zu machen, die Dinge anders zu sehen und das abwertende Zu in die Ecke zu verbannen. Auf dass kleine und große Menschen sich nicht als Mängelwesen fühlen müssen, weil sie so sind, wie sie sind, sondern voller Zuversicht darauf vertrauen, genau mit diesem So-Sein ein gutes Leben führen zu können.
So weit war ich mit meinem Vorwort gekommen, als ein Vorfall durch die Presse ging, der sich in einem deutschen Klassenzimmer abgespielt hatte: Ein Lehrer war vor Gericht gelandet, weil er einem Schüler nicht erlaubt hatte, bei Unterrichtsschluss das Klassenzimmer zu verlassen. Begründung: Die vom Lehrer geforderte Arbeit war vom Schüler noch nicht fertiggestellt worden. Als ich das las, fuhr mir der Schreck in die Glieder: Hoffentlich werden die Leser dieses Buches mich nicht missverstehen. Hoffentlich werden sie meine Worte nicht so interpretieren, dass der Lehrer diesen Jungen nicht hätte abwerten dürfen. Hoffentlich werde ich den Beifall nicht von der falschen Seite erhalten.
Warum mir das so wichtig ist: Ich kann das Verhalten dieses Lehrers sehr gut verstehen. Ich selbst befand mich als Lehrerin nicht nur einmal in der Situation, dass ich einem Schüler klar zu verstehen gab: »Ehe du dies oder das nicht getan hast, gehst du hier nicht raus.« Dies selbstverständlich nie angesichts eines jungen Wesens, das einfach nicht schneller konnte, aber sehr wohl als Reaktion auf bewusste Trödelei oder Arbeitsverweigerung.
Insofern greife ich an dieser Stelle dem Inhalt des vorliegenden Buches vor und richte einen leidenschaftlichen Appell an die Leser: nicht abwerten, aber auch nicht verhätscheln!
Noch ein Hinweis gleich zu Beginn: Sie finden in diesem Buch nicht nur viele Verweise auf Fachbücher, sondern auch auf Fachartikel, vor allem aus der Zeitschrift Psychologie Heute. Das hat einen einfachen Grund: Seit Jahren informiere ich mich in dieser Zeitschrift über neue Forschungsergebnisse. Immer wieder auch ist die Lektüre Anlass für mich, in den dort erwähnten Büchern genauer nachzulesen. Für das vorliegende Buch habe ich viele Jahrgänge durchforstet und bin erstaunlich oft bestätigt worden: Ja, man kann die Dinge auch anders sehen!
Eine letzte Anmerkung vorab: In diesem Buch werden Sie auf zahlreiche Erfahrungsberichte stoßen. Ich bin allen, die hier so ehrlich Einblick in ihr Erleben gewährt haben, dankbar. Und ich verstehe, wenn nicht jede und jeder mit ihrem/seinem echten Namen abgedruckt werden möchte. Deshalb sind manche dieser Berichte mit einem anderen Namen unterzeichnet. Ich bin sicher, auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben dafür Verständnis.
Nun wünsche ich Ihnen viele Aha-Erlebnisse und viel Zuversicht!
Ihre Heidemarie Brosche
1
Unikate – in Schubladen sortiert
Vom einzigartigen Geschenk »Kind« zur bewerteten Ware
Ich erinnere mich noch gut: an meine eigene Sehnsucht nach einem Kind, an meine eigene übergroße Freude, als es endlich da war, an die erste Zeit, in der das Geschenk »Kind« wie ein Wunder bestaunt wird und Bewertungen schlicht nicht stattfinden. Wie entzückend es ist! Wie schön es schläft! Wie sehr es wohl leidet, wenn es schreit? Wie einmalig, wie einzigartig es doch ist! So etwas gibt es tatsächlich nur einmal!
Auch bei all unseren Freunden und Bekannten konnte ich sie beobachten: die riesengroße Freude, das bedingungslose Annehmen des großen Wunders »Kind«.
Doch bald beginnt das, was in meinen Augen die Ursache vielen Übels ist: Das Kind wird verglichen. Oh, das Kind schläft zu wenig – im Vergleich zum Kind der Nachbarin. Das Kind ist zu mutterbezogen – im Vergleich zum Kind der Freundin. Das Kind trinkt zu viel oder zu wenig. Das Kind schreit zu viel oder zu wenig. Das Kind ist zu dick oder zu dünn. Das Kind läuft zu spät, das Kind spricht zu wenig …
Und schon ist das große Geschenk »Kind« auf dem Prüfstand. Kein Wunder mehr, sondern ein Menschenjunges, das bewertet wird. Klar, manche Dinge müssen medizinisch abgeklärt werden. Entwicklungsverzögerungen können ernste Ursachen haben. Aber viele Probleme sind hausgemacht. Wir wissen doch: Manche Menschen brauchen mehr, manche weniger Schlaf. Manche Menschen brauchen mehr, manche weniger Ruhe. Warum sollte dies bei kleinen Kindern anders sein? Welcher Teufel reitet uns Eltern, unsere Kinder als »Mängelexemplare« abstempeln zu lassen?
Die Kleinkindpädagogin, Buchautorin und dreifache Mutter Susanne Mierau schreibt: »Unsere Kinder brauchen uns. Sie brauchen, dass wir hinter ihnen stehen und sie toll finden. So, wie sie sind. Ob sie schwimmen können, lesen, auf einem Bein hüpfen oder eben all das noch nicht.«1
Dabei ist das Baby- und Kleinkindalter erst der Anfang. In Kita und Kindergarten beginnt das große Vergleichen mit dem Rest der Gruppe, eine gesamte Schulzeit lang wird das fortgesetzt. An sich ist das erst mal nichts Schlimmes. Tatsächlich wirkt das eigene Kind zu Hause vielleicht durchaus lebhaft, im Vergleich zu den anderen Gruppenmitgliedern aber eher ruhig. Für die Eltern eine interessante Information, aber noch lange kein Grund, in Sorge oder Zugzwang zu geraten. Leider kann der Umgang mit den Vergleichsergebnissen dennoch Schlimmes auslösen: das Gefühl nämlich, hier seien Menschen nicht in Ordnung, wie sie sind.
Oje, mein Kind braucht länger zum Anziehen seiner Schuhe als die anderen?! Ist es womöglich zu langsam? Das muss sich ändern!
Oh nein, mein Kind ist zu ängstlich?! Ich muss etwas unternehmen, damit es mutiger wird!
Oder: Was soll ich nur tun, mein Kind ist zu vorlaut?!
Von diesen Elterngefühlen ist es nicht mehr weit zu: »Du bist zu langsam, liebe Tochter!«, »Du bist zu feige, mein Sohn!« oder »Hüte deine Zunge, mein Kind!«
Eltern, Verwandte, Bekannte, Erzieher und nicht zuletzt Lehrkräfte – sie blicken auf das einstmalige Geschenk wie auf eine bestellte Ware. Erfüllt sie die Erwartungen? Wo sind ihre Defizite?
Auf Bewertungsportalen kann man Warenkritik in Rezensionsform lesen, in Zeugnissen finden sich zu diesem Zweck Bemerkungen. Gerne wird die Kritik auch in mündlicher Form vorgetragen, nicht nur von Lehrkräften.
Auch Unikate kann man sortieren – ein Ausflug in die Persönlichkeitstypologie
Ja, der Herrgott hat einen großen Tiergarten, wie der Volksmund so schön sagt.
Dass Menschen von Geburt an unterschiedlich in ihrem Charakter und in ihrem Temperament sind, hat der griechische Philosoph Empedokles schon im 5. Jahrhundert vor Christus festgestellt. Für ihn waren die Menschen von den »vier Elementen« Feuer, Wasser, Erde und Luft geprägt. Hippokrates sagte knapp 100 Jahre später, dass die vier Körpersäfte Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle eine große Rolle spielten. Noch später ordnete man den vier Säften vier Temperamente zu.
Diese Temperamenten-Lehre wurde zu einem Modell, mit dessen Hilfe man Menschen nach ihrer Grund-Wesensart in vier Kategorien einordnete:
• der leichtblütige Sanguiniker mit sorglosem, augenblicksbezogenem Temperament, • der warmblütige Choleriker mit leicht erregbarem, aufbrausendem Temperament, • der schwerblütige Melancholiker mit besorgtem, pessimistischem Temperament und• der kaltblütige Phlegmatiker mit langsamem, untätigem Temperament.Besser als jede theoretisch-langatmige Erklärung verdeutlicht das Wesentliche dieser Temperamenttypen das Beispiel mit dem Stein:
Ein Mensch will eine Wanderung machen. Plötzlich liegt ein großer Stein im Weg.
Der Sanguiniker hüpft oder klettert fröhlich darüber.
Der Choleriker wird wütend und wendet einen Kraftakt an, um den Stein aus dem Weg zu räumen.
Der Melancholiker kommt ins Grübeln: Soll er die Wanderung vielleicht abbrechen? Ist sie wirklich sinnvoll?
Der Phlegmatiker macht einen großen Bogen um den Stein. Auf keinen Fall will er in einen Konflikt geraten.
In der Psychologie der Neuzeit ordnete C. G. Jung (1875–1961) den extravertierten und introvertierten »Einstellungstypen« die Bewusstseinsfunktionen Denken, Fühlen, Empfinden und Intuieren zu, sodass es insgesamt acht Typen gab, zum Beispiel den introvertierten Fühltyp und den introvertierten Denktyp.
In den 1930er-Jahren begann man ein Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitstypologie zu entwickeln, das man auch die »Big Five« nennt und das nach fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit kategorisiert: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Aus diesen Big Five wurden die fünf großen Persönlichkeitseigenschaften entwickelt:
• worauf Menschen ihre Energie richten: introvertiert – extravertiert,• wie Menschen denken: praktisch – theoretisch, • wie Menschen interagieren: hart – kooperativ, • wie Menschen leben: spontan – geplant, • wie empfindlich Menschen sind: resistent – empfindlich.Diese Big Five galten jahrelang nur für Menschen aus westlichen Kulturen als gesichert, einfach deshalb, weil das Phänomen immer nur an ihnen untersucht worden war. Dann aber gab es 2005 eine Untersuchung des National Institute on Aging in Baltimore – und es zeigte sich: Die Big Five sind in allen menschlichen Kulturen dieser Welt nachweisbar.2
Eine kleine Randnotiz: Es stellte sich auch heraus, dass sich Männer und Frauen in asiatischen und afrikanischen Kulturen in Bezug auf ihre Persönlichkeit besonders ähnlich, in europäischen und amerikanischen Kulturen besonders unähnlich sind. Dies liegt wohl daran, dass in sehr individualistischen Kulturen ein ausgeprägtes Rollenverständnis herrscht, das zur Betonung der Geschlechtsunterschiede führt.
Nicht zu vergessen schließlich noch die zwölf Sternzeichen der Astrologie und die neun Typen des Enneagramms, die ebenfalls zur Typenlehre herangezogen werden.
Sie fragen sich jetzt womöglich: Was hat es mit diesem Ausflug in die Persönlichkeitstypologie auf sich? Warum musste ich mich mit so vielen verschiedenen Modellen beschäftigen, die allesamt eines gemeinsam haben: Sie stecken Menschen, die doch einzigartig sind, in Schubladen – nach Körperbau, Eigenschaften, Eigenarten, Temperamenten und Charakterzügen. Warum also das alles durchlesen, obwohl ich doch eigentlich nur mit dem eigenen Kind und vielleicht auch mit mir selbst richtig umgehen will?
Die Antwort lautet: Dieser schon seit Langem unternommene Versuch, Menschen in Kategorien einzuordnen, zeigt, dass man ihre Verschiedenartigkeit auch seit Langem schon bemerkt hat. Vielleicht sogar, dass Menschen unterschiedlich sind und als unterschiedlich wahrgenommen wurden, seit es sie gibt. Die Geschichte von Kain und Abel singt ein Lied davon. Vermutlich gab es auch schon unter den Steinzeitmenschen langsame und schnelle, gerissene und ehrliche, ruhige und lebhafte Zeitgenossen.
Auch die Tierforschung legt dies nahe. Michael Ringelsiep schreibt auf Planet Wissen: »Hundefreunde und Katzenliebhaber wissen es schon lange: Tiere haben einen eigenen Charakter. Der eine Hund ist ängstlich, der andere frech. Die eine Katze ein Draufgänger, die andere leicht neurotisch.«3 Ringelsiep berichtet darüber, dass nicht nur Haustiere, sondern auch Wildtiere in Bezug auf Charakter und Temperament unterschiedlich seien. An Hyänen, Regenbogenforellen, Stichlingen, Goldfischen, Kohl- und Blaumeisen, Tintenfischen, Spinnen, Ameisen und Wasserläufern seien – neben den Affen – Mut, Schüchternheit, Neugierde oder Durchsetzungsfähigkeit festgestellt worden. Kerstin Viering schreibt in ihrem Beitrag »Verhaltensforschung – Auch Affen haben Charakter«: »Biologen und Psychologen haben erkannt, dass Affen Individuen sind. Es gibt Choleriker, Angsthasen und Verspielte – genau wie bei den menschlichen Pendants … Je unterschiedlicher eine Art ist, desto anpassungsfähiger ist sie.«4 Nicht nur eine Bestätigung der These von der Unterschiedlichkeit auch im buchstäblichen Tiergarten, sondern ebenso ein Hoch auf die Unterschiedlichkeit!
Was das Thema dieses Buches betrifft, scheint es gesichert zu sein, dass wir Menschen
• uns einerseits schon von Zeugung an voneinander unterscheiden und somit echte Unikate sind,• bei aller Einzigartigkeit aber doch in Schubladen mit ähnlichen Menschen gesteckt werden können.Schubladeninhalte genauer betrachtet
Es drängen sich zwei Fragen auf:
1. Ist der Inhalt der einen Schublade besser als der der anderen? Ist es also sinnvoll, wenn von außen – allen voran von Eltern und Lehrern – ein Änderungsversuch unternommen wird? Sprich: Sind die Temperamentvollen den Zurückhaltenden grundsätzlich überlegen? Sind die Entspannten »besser« als die Ehrgeizigen? Sind die Sensiblen oder die Robusten »besser«? Ist es von Vorteil, wenn die Ruhigen weniger ruhig, die Ehrgeizigen weniger ehrgeizig, die Sensiblen weniger sensibel sind? 2. Ist es überhaupt möglich, den Inhalt der einzelnen Schubladen zu ändern? Kann man also aus ruhigen Zeitgenossen »Temperamentsbolzen« machen? Lassen sich die Tiefenentspannten zu Perfektionisten ummodeln? Kann man ein Sensibelchen umstricken?Ist der Inhalt der einen Schubladebesser als der der anderen?
Individuelle Vielfalt als Chance für die Gesellschaft
Erinnern wir uns: »Je unterschiedlicher eine Art ist, desto anpassungsfähiger ist sie.« So hieß es in Bezug auf die Vielfalt der Affen. Auch Humanwissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen sagen heute ganz eindeutig: Es geht bei den Menschen-Schubladen nicht um besser oder schlechter. Jede Schublade hat nicht nur ihre Berechtigung, sondern ist für das große Ganze wichtig. Nicht nur jeder Mensch, sondern sogar jede Eigenschaft hat ihre Stärken und Schwächen. In jeder Gruppe, in jeder Gesellschaft werden Menschen gebraucht, die eher introvertiert sind, und Menschen, die extravertierter leben. Es werden Menschen gebraucht, die praktisch an eine Sache herangehen, und Menschen, die sich theoretisch damit beschäftigen. Menschen, die eher hart interagieren, und Menschen, die eher kooperativ sind. Menschen, die eher spontan leben, und Menschen, die lieber alles planen. Menschen, die mehr emotional gesteuert sind, und Menschen, die alles rational betrachten.
Die Inuit zum Beispiel nehmen das mit der Vielfalt schon lange ernst. Sie »sind als Gruppe darauf angewiesen, Individuen mit einer Vielzahl von Fähigkeiten und Expertisen großzuziehen. Ein One-size-fits-all-Ansatz würde einer Gesellschaft wie der der Inuits, die in sehr extremer Umgebung lebt, keinen Überlebensvorteil bieten«, schreibt Michaela Schonhöft in ihrem Buch Kindheiten.5
Der Hirnforscher Gerald Hüther plädiert auch hierzulande für eine Kultur der Kooperation und Integration – weg vom Einzelkämpfer-Denken und hin zu einer neuen Kultur des vertrauensvollen Zusammenlebens und -arbeitens, bei dem jedes Individuum sich mit seinem ureigenen, persönlichen Potenzial einbringt. Genau davon, sagt Hüther, profitiert die Gemeinschaft! Die Überzeugung, nur Wettbewerb sei für Menschen ein Anreiz, sich anzustrengen und weiterzuentwickeln, zählt für ihn zu den klassischen Denkfallen.6
Und wer immer noch meint, es sei erstrebenswert, ein Alphatier zu sein oder ein solches als Kind zu haben, weil Machtmenschen eben doch besonders viel auf dieser Erde bewegen, den verweise ich gerne auf ein Experiment eines Forscherteams um Richard Ronay von der Columbia University zum Thema Aufgabenbewältigung. Es brachte folgendes Ergebnis: Zwar schnitten Gruppen, in denen niemand die Anführerrolle übernahm, nicht gut ab. Aber Gruppen, die nur aus Alphatieren bestanden, erzielten ebenfalls kein gutes Resultat. Vor lauter Machtkämpfen kamen sie kaum zum konstruktiven Arbeiten. Dies bestätigte sich, als Boris Groysberg von der Harvard Business School in Boston untersuchte, welche Folgen es hatte, wenn an der Wall Street eine Menge von Topleuten in einem Team versammelt wurden. Das Resultat war eindeutig: Bei zu vielen »Stars« geht die Leistung der Gruppe in die Knie.7
Unlängst gab es an unserer Schule einen Workshop für zwei Klassen. Trotz der vielen Jugendlichen verwiesen die Damen, die den Workshop abhielten, uns Lehrkräfte auf die Zuschauerränge. Sie wollten den Workshop ohne unser Eingreifen und Ermahnen durchführen. Was mir den Genuss verschaffte, die ganze große Gruppe einfach beobachten zu können. Und plötzlich fühlte ich mich wie in einem Lehrbuch der Persönlichkeitstypologie: Eine bunte Mischung Pubertierender unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Kultur, unterschiedlicher Religion, unterschiedlichen Temperaments entfaltete sich da vor mir. Selbstverständlich ist das nichts Besonderes, wir erleben das täglich in unserem Beruf. Aber: Die Arbeit am vorliegenden Buch machte mich für vieles sensibler als bisher. Was ich sah, war die stets zu ruhige Cristina neben der stets zu lebhaften Daniela. Die beiden harmonierten großartig und waren einen ganzen Vormittag lange ein Dreamteam. Was ich auch sah, waren die sieben Jugendlichen, die alles taten, um vor Publikum zu agieren beziehungsweise eine Gruppe anzuführen, und in ihrer Vorturner-Rolle tatsächlich brillierten. Und ich sah, wie der bei seinen Mitschülern als zu schüchtern geltende David ruhig und ernst seine Meinung vertrat, sobald er in die Rolle des Jurymitglieds geschlüpft war. Wenige Tage vorher hatte er mir im Vertrauen gestanden: »Alle finden, ich bin zu ruhig und zu ernst. Es stimmt: Ich rede nicht viel. Und ich lache nicht oft. Aber wenn ich etwas zu sagen habe, tue ich es. Und wenn ich etwas lustig finde, lache ich. Ich bin halt anders als die anderen.« Ich sah noch viel mehr und war tief berührt, wie der große »Tiergarten« sich zu einem großen, funktionierenden Ganzen entwickelte.
Die Durchschnittsfalle
Der österreichische Genetiker Markus Hengstschläger kritisiert in seinem Buch Die Durchschnittsfalle,8 dass das aktuelle Bildungssystem Kinder immer genau in den Bereichen fördert, in denen sie als schwach erlebt werden. Schließlich und mit viel Mühe erreichen sie dann durchschnittliche Werte. All das aber, was von der Norm abweicht, all das, worin sie von sich aus begabt und gut sind, worin sie besonders sind, all das, was sie zu Unikaten macht, wird vernachlässigt – denn alles strebt zum Mittelmaß, in eine große Schublade. Nach Hengstschläger muss aber – vor allem von der Schule – dringend erkannt werden, wie viele und welche Talente in einer Gruppe schlummern. Dazu sollten Lehrkräfte auch fähig sein, Talente überhaupt zu finden. Gerade die Talente aus verschiedenen Kulturkreisen, Religionen und Ethnien sieht Hengstschläger als Chance für eine Gesellschaft, wobei er Talent nicht mit Erfolg und Leistung gleichsetzt. Keiner kann die Zukunft kennen, so der Genetiker, und so kann keiner wissen, welche Talente später einmal gebraucht werden. Dringend appelliert er auch an die Eltern, nach dem Besonderen ihrer Kinder Ausschau zu halten.
Für mich heißt das: Es ist weder nötig noch sinnvoll, alle Menschen am Ende in ein und dieselbe Schublade zu stecken. In jeder Schublade ist etwas verborgen, was für die Gesellschaft der Zukunft wertvoll sein kann – und auch für den Einzelnen, sofern man ihm nicht das Gegenteil weismacht.
Kann man den Inhalt der Schubladen ändern?
Wenn jede Eigenart ihre Berechtigung und ihren Wert hat: Wieso sollte man Menschen dann ändern, nur damit sie nicht mehr so sind, wie sie sind? Ganz abgesehen davon: Wäre es überhaupt möglich?
Mit Druck – egal, welcher Art – kann man bei Menschen ziemlich viel erreichen. Vermutlich aber wird man selbst mit gezogener Pistole, unter Folterandrohung oder mit Psychoterror keinen Menschen grundlegend umstricken können. Er mag so tun, als gehöre er plötzlich in eine andere Schublade, im Innersten aber bleibt er seiner ganz persönlichen Kategorie treu. Davon wissen alle ein Lied zu singen, die versucht haben, einen lieben Mitmenschen zu ändern, zum Beispiel ihr Kind oder ihren Ehepartner, und die jetzt ehrlich genug sind, das Ergebnis zu betrachten. Der andere ist nun mal nicht Wachs in den Händen des Änderungswilligen. Er lässt sich nun mal nicht wie eine Skulptur verformen. Er lässt sich auch nicht zum »Traummenschen« verwandeln.
Der Psychologie-Professor Dr. Werner Greve ist davon überzeugt, dass wir uns im Laufe unseres Lebens – auch ohne bewusstes Bemühen – ständig wandeln, ja wandeln müssen, um uns an unsere jeweiligen Lebensumstände anzupassen. Dabei bleiben wir aber wir selbst – und das nicht, obwohl, sondern weil wir uns ständig ändern, weil wir »in Arbeit«, in Bewegung sind.9 Wohlgemerkt: Wir wandeln uns ständig – wir werden nicht ständig verändert!
Wieso liegt dann immer wieder Bemängelung in der Luft?
Das ewige Vergleichen
Der Mensch – eine Vergleichsmaschine?
Thomas Mussweiler, Professor der Sozialpsychologie, bezeichnete das menschliche Ich als »Vergleichsmaschine«. Demnach vergleichen wir Menschen uns schnell und ständig, und das häufig, ohne dass es uns bewusst ist. Angeblich versuchen wir so, unsere eigenen Stärken und Schwächen einzuordnen.10
Ein kleines unfreiwilliges Selbstexperiment führte mir dies erst kürzlich wieder vor Augen: Gemeinsam mit meinem Mann verbrachte ich ein paar höchst erholsame Tage im Süden. Wir hatten uns bewusst vorgenommen, uns einfach nur zu entspannen – wir hatten es beide nötig. Das Wetter war wunderbar, der Pool angenehm kühl und sauber, die Liegen bequem. Olivenbäume spendeten wohltuenden Schatten und erlaubten zudem den Blick ins zart wogende Blätterdach, aus dem eine Fülle strotzender Früchte grüßte. Alles war so, wie es sein sollte. Ich spürte, wie ich zur Ruhe kam.
Doch waren wir nicht die einzigen Gäste, die hier lagen?! Ach ja, die einen waren längst auf die Mountainbikes gestiegen, die anderen hatten sich zum Wandern aufgemacht, wieder andere hatten schon etliche Bahnen im kühlen Nass zurückgelegt, während wir uns immer noch unser Frühstück schmecken ließen. Ich spürte, wie etwas in mir hochkroch. Kein Neid, ich wollte all diese Aktivitäten ja gar nicht! Aber ein Gefühl wie: »Machen die alle nicht viel mehr aus dem Tag als wir?« Ich wandte mich wieder meinem Buch zu, ich lächelte meinen Mann an, ich genoss die Aussicht. Und dann legten sich doch noch ein paar andere wie wir – einfach so – in den Garten. Ein Grüppchen hier, ein Grüppchen da. Aha, es gab außer uns also auch noch andere Menschen, die es nicht zu anspruchslos fanden, den Tag mit Lesen, Dösen, Reden und Schwimmen zu verbringen! Wieder spürte ich, wie etwas in mir hochkroch. Ein Gefühl der … ja, man könnte es Beruhigung nennen.
Das war der Moment, an dem ich mir selbst am liebsten eine Ohrfeige verpasst hätte: Warum schielte ich überhaupt auf die anderen? Wieso verglich ich unsere Freizeitgestaltung mit der von wildfremden Menschen? Was hatte deren Lebenszufriedenheit mit der unsrigen zu tun? Ich beschloss wieder einmal, mir das ewige Vergleichen abzugewöhnen. Selbst wenn wir den ganzen Urlaub lang die Einzigen gewesen wären, die im süßen Nichtstun ihre Freude gefunden hätten, selbst wenn wir auf dem gesamten Erdball die Einzigen wären, die im süßen Nichtstun gelegentlich eine große Freude finden würden: Solange es uns guttat und niemandem schadete, war doch alles in bester Ordnung!
Der Arzt und Comedian Eckart von Hirschhausen beklagt in einem seiner viel bejubelten Vorträge, dass Frauen ihre eigene Unzufriedenheit generieren, indem sie sich mit Supermodels vergleichen. »Ich war«, sagt er, »mit Supermodels schon in Talkshows. Ich hab die vor und in der Maske gesehen. Was da passiert, dafür kommt jeder Gebrauchtwagenhändler in den Knast.« Humorvoll demonstriert er die Macht der inneren Haltung: »Warum können sich Menschen nicht akzeptieren, wie sie sind? Weil sie immer denken, die anderen wären besser als sie.« Hirschhausen führt aus: Dies liegt an unseren Gedanken! Wir selber wissen von anderen Menschen ja nur, was sie aussprechen. Von uns aber kennen wir jeden dämlichen Gedanken, der uns durch den Kopf schießt. Was dazu führt, dass wir denken, wir hätten viel mehr »Mist« im Kopf als die anderen. Das stimmt aber nicht, die anderen sind kein bisschen besser.11
Was hat das alles mit unserem Thema zu tun? Wir vergleichen auch unsere Kinder immer wieder, auch wenn wir es nicht wollen. Und das ist nicht gut!
Verurteilen durch Vergleichen
Für den Psychologen Marshall B. Rosenberg sind Vergleiche eine Art Verurteilung. Die Macht des Vergleichens demonstriert er an einigen unterhaltsamen Übungen, die jeder für sich durchführen kann. Man stelle sich vor den Spiegel und vergleiche das, was man sieht, mit dem Foto eines Menschen, der den aktuellen Schönheitsidealen in den Medien entspricht. Welches Gefühl macht sich breit, ohne dass man es will? Ja, ein mieses! Oder: Man vergleiche sich mit Menschen, die auf anderen Ebenen außergewöhnlich sind oder waren – Wolfgang Amadeus Mozart zum Beispiel mit all den Sprachen, die er beherrschte, und all den Stücken, die er komponierte. Welches Gefühl stellt sich ein? Na klar, ein mieses! Die Methode klappt immer.