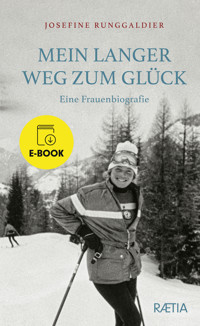
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vom Überwinden schwerer Hürden und spätem Lebensglück Ein schwerer Rucksack voller schlimmer und schöner Erlebnisse: So blickt Josefine Runggaldier auf ihr Leben zurück. Als Kind einer Bergbauernfamilie erlebt Josefine in den 1960er-Jahren den touristischen Aufschwung ihres Heimattales mit. Bei Skirennen, aber auch im künstlerisch-handwerklichen Bereich blitzt Josefines Talent auf, doch das konservative Umfeld bietet ihr keinen Freiraum für Entfaltung. Schon als Jugendliche erfährt sie körperliche und sexuelle Gewalt von Vorgesetzten und Bekannten. Als Josefine sich gegen die Abtreibung ihres unehelichen Kindes und gegen eine arrangierte Ehe entscheidet, wird sie von ihrer Familie verstoßen. Spät findet sie ihr wahres Lebensglück. Ein Lebensbericht, der Mut macht!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 89
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der folgende Text enthält Schilderungenvon sexualisierten Gewalthandlungen,die belastend und retraumatisierendwirken können.
JOSEFINE RUNGGALDIER
MEIN LANGER WEG ZUM GLÜCK
Eine Frauenbiografie
Mit einem Vorwort von Martha Verdorfer
Edition Raetia
Gedruckt mit Unterstützung der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur
1. Auflage
© Edition Raetia, Bozen 2023
ISBN 978-88-7283-894-5
ISBN E-Book 978-88-7283-896-9
Projektleitung: Felix Obermair
Transkription der originalen Handschrift: Tanja Ebner
Redaktionelle Bearbeitung: Michaela Oberhuber
Lektorat: Helene Dorner
Umschlaggestaltung: Philipp Aukenthaler, www.hypemylimbus.com
Alle Fotos stammen, falls nicht anders angegeben, aus dem Privatarchiv von Josefine Runggaldier.
Druckvorstufe: Typoplus, Frangart
Printed in Europe
Unser Gesamtprogramm finden Sie unter www.raetia.com.
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an [email protected].
Vorwort
von Martha Verdorfer
Die Faszination für Lebensgeschichten hat offensichtlich kein Ablaufdatum. Seit dem Paradigmenwandel in der Geschichtswissenschaft in den 1980er Jahren, durch den der Alltag als Inhalt und die biografische Erzählung als Methode Eingang in die historische Erinnerung gefunden haben, gibt es eine konstante Tradition der Publikationen und eine interessierte Leser*innenschaft dafür.
Dabei geht es nicht um die Erfahrungen und Erinnerungen von Eliten – die hatten immer ihren Platz in der Geschichtsschreibung –, sondern um jene der sogenannten einfachen Menschen. Mit der öffentlichen Aufmerksamkeit stieg auch die Bereitschaft, manchmal lässt sich gar von einem Bedürfnis sprechen, die eigenen Lebenserfahrungen zu erzählen bzw. aufzuschreiben. Seit nunmehr rund vierzig Jahren arbeite ich selbst mit der Methode der lebensgeschichtlichen Erinnerung und immer noch bin ich fasziniert von der Vielfalt der Lebensentwürfe und -wege, der Treffsicherheit mancher Einschätzungen, dem Witz oder der sprachlichen Prägnanz der Erzählungen.
Was als kritische und emanzipatorische Intervention in die etablierte Geschichtsschreibung begann, zeigt freilich mitunter inflationäre Abnutzungserscheinungen. Wenn Erinnerungen von Zeitzeug*innen die Nostalgie nach der „guten alten Zeit“, den „armen, aber zufriedenen Menschen“ bedienen, politische Konflikte und soziale Unterschiede im Rückblick geglättet und harmonisiert werden, dann ist das ärgerlich, weil damit das wahre Potenzial der biografischen Erzählung verkannt wird.
Josefine Runggaldier, geboren 1947 als Älteste von neun Kindern in Gröden, erweist sich als gute Beobachterin. Sie konstatiert lakonisch, aber detailgenau die Veränderungen in vielen Lebensbereichen, wie den Wohnverhältnissen, Arbeitsabläufen und Essgewohnheiten, sie beschreibt Familienbeziehungen, die keineswegs immer friedlich waren, eine Kindheit zwischen Spiel und Arbeit sowie Rituale um Geburt und Tod. Sie berichtet über Entwicklungen und Veränderungen im Tal in den 1960er und 1970er Jahren, als Südtirol und insbesondere das Grödental durch den aufkommenden Tourismus in einen Modernisierungsschub katapultiert wurden, dessen Auswirkungen keineswegs nur positiv waren.
Eigentlich geht es Josefine Runggaldier aber um die Darstellung ihres eigenen Lebens, eines Lebens als Mädchen und Frau in einer patriarchal-konservativen Gesellschaft, geprägt von Gewalt gegen Frauen in den verschiedenen Formen: kulturell-religiös, sexuell, psychisch und ökonomisch. Es ist ein weiblicher „Schicksalsrucksack“, über den Josefine Runggaldier auf eine unsentimentale und gleichzeitig sehr direkte Art und Weise schreibt. Sie erzählt von ihrer Mutter, die im schwarzen Kleid und ohne Kopfschmuck heiraten musste, weil sie noch unverheiratet ein Kind geboren hatte, von der im Kindesalter erfahrenen sexuellen Belästigung auf der Schaukel, der erlittenen Gruppenvergewaltigung durch den Chef und einen Kumpanen am Arbeitsplatz, von der sie niemandem erzählte und die sie erst recht nicht zur Anzeige brachte, von der Verweigerung eines selbstbestimmten Lebens und der freien Berufswahl durch die Familie, der Kontrolle durch ihren eifersüchtigen Lebensgefährten, der sie auch misshandelte – ein Frauenleben in Südtirol nach dem Zweiten Weltkrieg, keine Ausnahme, sondern eines, das sich wie viele andere vor dem Hintergrund patriarchaler Gewalt abspielte.
Warum schreibt jemand seine Lebensgeschichte auf? Dafür kann es vielfältige und sehr unterschiedliche Gründe geben: äußere und innere Anstöße, die dazu führen.
Die Motivation von Josefine Runggaldier erschließt sich nur indirekt. „Die ganzen Jahre trug ich alles und litt darunter“, schreibt sie im Zusammenhang mit der erlittenen Vergewaltigung. Gewalterlebnisse aufzuschreiben kann befreiend sein. Es ist aber auch schmerzhaft, und dass sich Josefine Runggaldier diesem Schmerz ein zweites Mal aussetzt, hat auch mit ihrem Wissen darum zu tun, dass sie mit ihrer Geschichte eben keine absolute Ausnahme ist.
Josefine Runggaldier ist 1947 geboren, 1949 erschien Simone de Beauvoirs Essay „Das andere Geschlecht“, der zum Grundlagentext der zweiten Frauenbewegung werden sollte. Die Aufzeichnungen von Josefine Runggaldier spiegeln ein Leben wider, das gekennzeichnet ist von einem zunehmenden Selbstbewusstsein von Frauen, die mit ihren Lebensperspektiven immer wieder auf Hindernisse stoßen, denen es aber auch gelingt, ihren Weg zu gehen. Ein Leben in einer Zeit, in der es zwar die Antibabypille gab, die Mädchen jedoch nicht aufgeklärt waren und in der ein Schwangerschaftsabbruch illegal und gefährlich war. In einer Zeit, in der sich Mädchen zwar dem Ansinnen der Familie, ins Kloster einzutreten, widersetzten, aber dennoch nicht ihre eigenen Berufswünsche durchsetzen konnten. Ausbruchs- und Aufbruchsversuche, die manchmal gelangen und manchmal scheiterten.
Josefine Runggaldier will ihr Leben nicht reduziert sehen auf erlittene Gewalt und verpasste Chancen, sie sieht ihren gelungenen Widerstand und die Verantwortung für ihre Entscheidungen. Dass das Leben glücken möge, trotz aller Widrigkeiten, ist ein nachvollziehbarer Wunsch.
Jede Biografie ist letztlich eine Begegnung, ein Dialog mit einem anderen Menschen. Die Begegnung mit Josefine Runggaldier macht betroffen, sie ist aber auch unterhaltsam und weckt Bewunderung für eine Frau, die trotz zahlreicher Gewalterfahrungen und verhinderter Wünsche nicht verbittert ist. Es ist eine Begegnung, die berührt.
Martha Verdorfer
Geboren 1962 in Lana, Studium der Geschichte und Politikwissenschaften in Innsbruck. Seit 1991 Unterrichtstätigkeit in Bozen, daneben als Historikerin und als Referentin in der Erwachsenenbildung tätig. Verschiedene Veröffentlichungen zur Südtiroler Zeitgeschichte und zur historischen Frauenforschung. Langjährige Präsidentin des Frauenarchivs Bozen. Bei Edition Raetia u. a.: „Einmal Option und zurück. Die Folgen der Aus- und Rückwanderung für Südtirols Nachkriegsentwicklung“ (2019, mit Günther Pallaver und Leopold Steurer).
Gröden: Meine Heimat
Man schrieb das Jahr 1912, als mein Vater Alois am 2. Dezember in Sankt Christina im Grödner Tal als Sohn von Vinzenz Runggaldier und Cecilia Senoner geboren wurde. Er war das zweite von drei Kindern. Die zwei Ältesten, Stina und Alois, kamen im selben Jahr zur Welt, obwohl sie nicht Zwillinge waren: die eine im Jänner und mein Vater im Dezember. Der Jüngste hieß Franz und wurde 1914 geboren. Mein Opa Vinzenz wurde bald darauf als Soldat in den Ersten Weltkrieg eingezogen und starb am 19. April 1915 im Krieg. Die hinterbliebene Witwe Cecilia heiratete nach dem Krieg im Jahre 1920 den Bruder ihres verstorbenen Ehemannes – dies war damals gang und gäbe. Aus dieser zweiten Ehe gingen noch vier Söhne und zwei Töchter hervor: Adolf, Konrad, Adam und Willi sowie Zilia und Sofie. Sie alle wohnten zusammen in dem Haus, das Cecilias erster Ehemann, der verstorbene Vater meines Vaters, gebaut hatte. Das Haus stand am Rande eines großen Grundstücks, gleich nebenan befand sich eine Scheune, gefüllt mit Heu, Getreide, Buchweizen und Kartoffeln, umgeben von Ackerland. Im Stall gab es Pferde, Kühe mit Kälbern, Ziegen, Schweine und Hennen. 1925 aber musste das Haus abgetragen werden, denn es lag in einem Murengebiet und stand auf Boden, der langsam abrutschte. Zusätzlich stellte sich heraus, dass es eigentlich Gemeindegrund war. So musste die Familie den Grund nachträglich von der Gemeinde kaufen und das Haus nebenan wieder neu aufbauen.
Meine Mutter Elisabeth Mussner wurde am 8. April 1921 in Wolkenstein geboren. Sie war das älteste von fünf Kindern: Nach meiner Mutter Beta kamen noch Luisa, Anna und Sefa auf die Welt. Vinzenz, ihr einziger Bruder, starb bereits mit zwanzig Jahren während des Zweiten Weltkrieges im Luftschutzkeller des Bozner Krankenhauses an einer Lungenentzündung.
Mein Vater kämpfte im Zweiten Weltkrieg als deutscher Soldat an der russischen Front, wo er dank anderer Soldaten vor dem Erfrieren gerettet wurde. Gegen Kriegsende kam er nach Rom, wo er das Attentat auf seine Kompanie in der Via Rasella überlebte. 1944 konnte er einen kurzen Heimaturlaub antreten und mit meiner Mutter zusammen sein. Als das Ende des Krieges absehbar war, floh er gemeinsam mit anderen deutschen Soldaten und versteckte sich vor den Partisanen. Als sie in einer Scheune von einigen Frauen überrascht wurden, fragten diese, warum sie sich verstecken würden, der Krieg sei doch vorbei. Sein Heimweg war aber noch lang und gefährlich, erst Monate nach Kriegsende kam er endlich zu Hause an. Hier erwartete ihn eine Überraschung: Meine Mutter hatte am 8. März 1945 einen Sohn, meinen ältesten Bruder Vinzenz, geboren und wohnte bei ihren Eltern. Für meine Mutter war es eine sehr schwere Zeit, denn als Ledige ein Kind zu bekommen, stellte damals eine Schande dar. Dann endlich fand am 22. Juni 1946 die Hochzeit meiner Eltern statt: Die Braut durfte zwar nur in einem schwarzen Kleid heiraten, schmückte den Kopf aber mit einer netten Girlande, die sie jedoch während der Trauung in der Kirche abnehmen musste. Als Mutter eines ledigen Kindes war ihr das Tragen des Kopfschmucks nicht erlaubt.
Nun, nach ihrer Hochzeit, stellte sich meinen Eltern die Frage, wo ihre kleine Familie wohnen sollte – natürlich bei meinem Vater zu Hause, wo dessen gesamte Familie lebte: seine Mutter, der Stiefvater, die vier Stiefbrüder und die zwei Stiefschwestern. Die leiblichen Kinder meines Großvaters teilten sich das Grundstück untereinander auf: Stina und Franz errichteten dort ein neues Haus, mein Vater hingegen erbte das alte. Die Stiefgeschwister aber, die alle noch dort wohnten, machten meiner Mutter das Leben zur Hölle. Es wurde gestritten und geschlagen. Es kam sogar zu einem Prozess, nachdem die Ehefrau des Stiefbruders bei der Heuarbeit mit einem Rechen brutal auf den Rücken meines Vaters eingeschlagen hatte. Auch wir Kinder wurden dafür als Zeugen geladen, wir hatten Angst und verstanden vieles nicht, da die Verhandlung in italienischer Sprache geführt wurde. Bald darauf, Anfang der 1950er Jahre, zogen Stiefopa und Oma mit den Stiefgeschwistern aus, nun lebten nur noch meine Eltern mit uns Kindern im Haus meines Großvaters.
Es handelt sich um den Hof von Aldoss an der Plesdinatz-Straße in der Gemeinde St. Christina, das auf 1.428 Meter Meereshöhe in der Grödner Talmitte zwischen St. Ulrich und Wolkenstein liegt. Im Norden wird der Ort von den Geislerspitzen eingerahmt, im Süden bildet die Langkofelgruppe das Wahrzeichen des gesamten Tales. Die weitläufigen grünen Almen von Cisles, Mont Seura, Ciandevaves und Seceda schmiegen sich an die felsigen Bergmassive. Im Juni 2009 wurde die Landschaft als Teil der berühmten Dolomiten zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt.





























