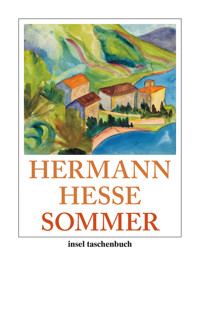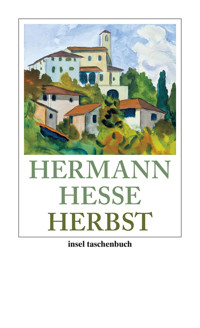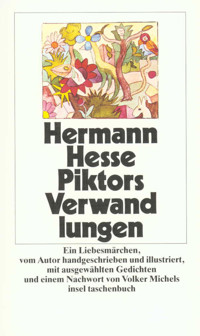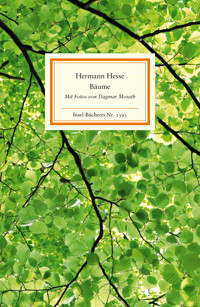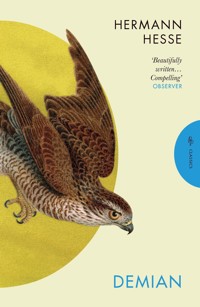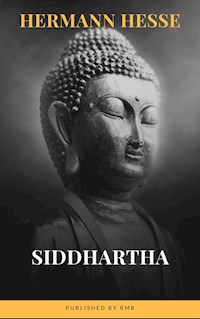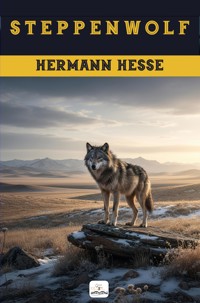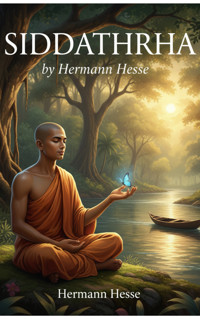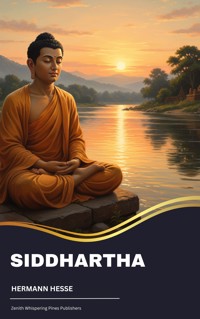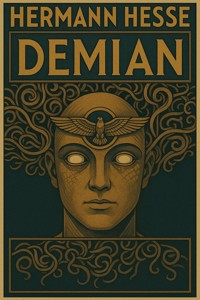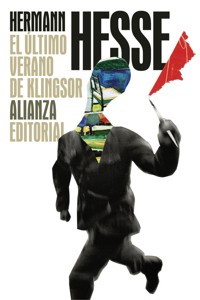32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Brüdi – so wurde Martin, der jüngste Sohn Hermann Hesses, von der Familie genannt.
Als Hermann Hesse im April 1919 seine Familie verließ, um im Tessin auf der Südseite der Alpen ein ungebundenes Leben zu führen, kamen seine drei Söhne zu Pflegefamilien oder ins Heim. Ein Schock vor allem für Martin, gerade sieben Jahre alt. Wie Hesses erste Ehefrau Mia, die wegen einer manisch-depressiven Erkrankung immer wieder in Heilanstalten war, litt Martin unter dieser psychischen Erkrankung, die letztlich wohl auch zu seinem Freitod 1968 führte.
Der 1919 beginnende und sich bis zu Hermann Hesses Tod 1962 fortsetzende Briefwechsel ist das eindrucksvolle Dokument einer Annäherung von Vater und Sohn, der Versuch, verlorenes Vertrauen mittels Briefgespräch neu herzustellen.
Hier findet Hermann Hesse nach und nach zu seiner anfangs verweigerten Vaterrolle. Immer offener sprechen Vater und Sohn von ihren unerfüllten Hoffnungen und wachsenden Lebenszweifeln. Martin, der künstlerisch begabteste und zugleich labilste der Söhne, der Fotograf wird, gesteht: »Ich bin viel in der Dunkelkammer, mehr als mir lieb ist.« Martins Fotos des Vaters, über Jahrzehnte entstanden und zu Ikonen geworden, bezeugen wiedergefundene Nähe.
Der Briefwechsel ist nicht nur in biografischer Hinsicht ein Ereignis. Denn im Gespräch beider entsteht zugleich eine Alltagsgeschichte der Schweiz von 1919 bis 1962.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Hermann Hesse
»Mein lieber Brüdi!«
Briefwechsel mit seinem jüngsten Sohn Martin
Herausgegeben von Gunnar Decker Unter Mitarbeit von Sibylle Siegenthaler-Hesse, Hanspeter, Martin und Matthias Siegenthaler
Mit zahlreichen Fotos von Martin Hesse
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2023
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagfoto: Hermann Hesse und Martin Hesse in Bremgarten, Sommer 1943, Foto Hesse Bern, © Martin Hesse-Erben
eISBN 978-3-518-77395-6
www.suhrkamp.de
»Mein lieber Brüdi!«
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Einleitung
I
II
III
IV
V
Bildteil
Personenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Einleitung
I
Für Nähe-Beziehungen aller Art weiß Hermann Hesse sich untauglich. Doch der hier erstmals veröffentlichte Briefwechsel zwischen dem Dichter und seinem jüngsten Sohn Martin (1911-1968), »Brüdi« genannt – die schweizerdeutsche Koseform für »kleiner Bruder« –, ist kein Dokument kalter Entfremdung. Im Gegenteil, Hesse erschreibt sich aus der Distanz jene Nähe, die ihm allein möglich ist: Anteilnahme per Brief!
Mit den Jahren entsteht so tatsächlich eine enge Vater-Sohn-Beziehung. Es wird ein langer, schwieriger Annäherungsprozess, ein gegenseitiges Werben um Zuneigung. Der jüngste Sohn spielt für Hermann Hesse eine besondere Rolle, denn Martins Leben steht anfangs unter keinem guten Vorzeichen: Krankheit und frühe Trennung von der Familie belasten ihn. Fühlt er sich verstoßen?
Als Martin im Juli 1944 heiratet, schreibt Hermann Hesse an Eugen Zeller, er werde nicht dabei sein – »wie denn das Nichtdabeisein eine Spezialität meines Lebens oder Charakters ist«[1] . Da kennt sich jemand genau, weiß aus jahrzehntelanger Selbstbeobachtung um seine Stärken wie Schwächen. Der Umgang mit anderen Menschen zählt nicht zu seinen Stärken, aber das muss es auch nicht, er ist schließlich Dichter – und Schreiben bleibt ein einsames Geschäft.
Hesse lebt aus dem Abstand, der für ihn überlebensnotwendig ist, imaginiert schreibend Dabeisein aus Nichtdabeisein. Beispiele hierfür gibt es zahlreiche: 1902 bleibt er der Beerdigung seiner geliebten Mutter fern (sie hatte in seinen die Sinnlichkeit feiernden Gedichten Teufelszeug gesehen), kommt 1946 weder zur Verleihung des Goethepreises der Stadt Frankfurt noch zu der des Literatur-Nobelpreises (zu der Zeit verbirgt er sich in der psychiatrischen Anstalt Marin); äußere Anlässe besitzen für ihn keine innere Notwendigkeit.
Der große Eigensinnige, der lebenslang das »Ohne mich« kultiviert, gehört keiner Partei an, auch einer Nation fühlt er sich nie zugehörig. Hesse bekennt sich zum Alemannischen, dieser Mischidentität des Rheinwinkels, in dem das Württembergische und Schweizerische ineinander übergehen und jede Grenzziehung künstlich wirkt.
Er lässt sich nicht in Dienst stellen, das Amt eines repräsentierenden Großschriftstellers, das Thomas Mann so kongenial auszufüllen vermochte, lehnt er für sich rigoros ab. Er bleibt der Außenseiter aus Passion, der überall nur halb dazugehört und die gesellschaftlichen Rituale, mittels derer Ruhm und Ehre verliehen werden, bloß verachtet.
Natürlich stellt sich so unweigerlich die Frage, ob Hesse als »Nichtdabeiseiender« jemals ein guter Vater sein konnte. Am Anfang zeigt sich die Nähe-Verweigerung auch hier. Aber dann passiert mit den Jahren etwas Erstaunliches, so nicht zu Erwartendes: Hermann Hesse setzt – spät, aber nicht zu spät – alles daran, Martin ein guter Vater zu werden. Was für ihn zuallererst bedeutet, auch seinem dritten Sohn ein enger Vertrauter, Freund und Ratgeber zu sein.
Als Martin geboren wird, ist Hesse wieder einmal auf dem Absprung. Am 22. Juni 1911 berichtet er seiner Schwester Adele von der geplanten Reise nach Singapur, zu der ihn der befreundete Maler Hans Sturzenegger eingeladen hat. Hesse zögert keinen Augenblick, die Einladung anzunehmen. Er müsse jetzt Englisch lernen, sich impfen lassen und andere Vorbereitungen treffen. Der Erfolgsschriftsteller aus Gaienhofen vom Bodensee, bereits Vater von zwei Söhnen, kalkuliert über den familiären Rahmen hinaus: »Darum möchte ich die Zeit, die Maria von Ende Juli oder Anfang August an auf ihr Baby verwenden muß, nicht ganz verlieren.«[2]
Ja, er nutzt die Zeit, in der seine Frau Maria, Mia genannt, »ihr Baby« bekommt. Am 26. Juli 1911 wird sein dritter Sohn Martin geboren. Und Hesse bricht auf zur großen Fahrt. Diese gleicht einer Flucht. Denn seine Rolle als Ehemann und Vater ist ihm tief suspekt geworden. Er steckt im falschen Leben als bürgerlicher Erfolgsschriftsteller fest. Wie soll er da wieder herauskommen?
Es scheint, dass bereits in diesen Jahren der dann im Frühjahr 1919 vollzogene Entschluss, allein zu leben, zu reifen beginnt. 1912 zieht er mit der Familie vom Bodensee in die Schweiz nach Bern. Man kann darin den Versuch sehen, mittels Ortswechsel einen gemeinsamen Neuanfang zu schaffen – doch vergeblich, Hesse gerät immer tiefer in eine existenzielle Krise hinein. Er weiß nun, dass er ein Leben nach eigenen, nur der Kunst verpflichteten Maßstäben führen muss.
Aber dafür scheint Mia nicht die geeignete Partnerin. Nach ihrer Heirat 1904 hoffte sie auf ein stilles Leben in ländlicher Abgeschiedenheit, mit Garten, Kindern und einem Klavier, auf dem sie spielte. Hermann Hesses mit dem Erfolg des »Peter Camenzind« wachsenden schriftstellerischen Ehrgeiz sah sie dagegen mit Missfallen.
In seinem 1912/13 entstandenen Roman »Roßhalde« wird Hesse die Problematik der Künstlerehe behandeln. Es ist nicht schwer, ihn selbst in der Figur des Malers Johann Veraguth zu erkennen, der sich in einer tiefen Lebenskrise befindet. Im äußerlichen Erfolg gefangen, lebt er wie ein Bürger in einer repräsentativen Villa, selbst die Katze werde fett, hatte er über diese ihn überkommende Saturiertheit notiert. Und nun ist die Ehe mit der Pianistin Adele am Ende, man lebt nebeneinanderher, ist sich fremd geworden.
Seinem Vater schreibt Hermann Hesse 1914 nach Erscheinen von »Roßhalde«, die Frage sei nicht die nach einer falschen Wahl, sondern ob ein Künstler oder Denker »überhaupt zur Ehe fähig« sei. Damit verschiebt er sein Lebensproblem ins Grundsätzliche. Spricht er sich selbst von allem Versagen frei? Nein, das nicht, aber an seiner Eheuntauglichkeit, die aus seiner schriftstellerischen Berufung resultiere, lässt er keinen Zweifel. Der strenge Künstler sei im Leben ein Dilettant, heißt es in »Roßhalde«.
Hesse, das bestätigte sein mittlerer Sohn Heiner (1909-2003), konnte mit Kindern gut umgehen, war alles andere als ein autoritärer Vater. Wenn er Zeit hatte, spielte er mit ihnen, unternahmen sie gemeinsame Wanderungen oder gingen baden. Doch wenn er keine Zeit hatte, wenn er unter dem Druck stand, etwas schreiben zu müssen, war er reizbar und durfte nicht gestört werden.
Ein drittes Kind war für ihn offenbar zu viel. Der zwei Jahre ältere Bruder Heiner wird kurz vor seinem Tod im Gespräch mit dem Herausgeber erklären, Hermann Hesse habe seinen dritten Sohn Martin einfach nicht ausgehalten, dieser sei oft krank gewesen, habe viel geschrien.
»Roßhalde« scheint wie ein böses Omen. Denn dort wird der kleine Pierre, Veraguths Sohn, krank. Er bekommt eine Hirnhautentzündung und stirbt qualvoll.
Was für eine sich (fast) selbst erfüllende Prophezeiung! Denn im Erscheinungsjahr von »Roßhalde« 1914 wird Martin plötzlich schwerkrank. Handelte es sich um eine Hirnhautentzündung? Das scheint zweifelhaft, denn diese überlebte man in dieser Vor-Antibiotika-Zeit in der Regel nicht.
Und doch bekommt die Pierre-Analogie zu »Roßhalde« angesichts der nachfolgenden Ereignisse etwas Unheimliches. Veraguth klagt sich selbst an: »Ach, nie mehr im Leben würde er eine solche Liebe fühlen können wie zu diesem Knaben.«[3] Als Pierre in »Roßhalde« gestorben ist, steigert sich Veraguth in eine Art Liebestod-Vision hinein: »Da hatte er am Bett seines sterbenden Knaben, allzu spät, seine einzige, wahre Liebe erlebt, da hatte er zum ersten Mal sich selbst vergessen, sich selbst überwunden.«[4]
Was gilt denn nun für Hesse, die bis in den Tod hinein stilisierte Vater-Sohn-Liebe oder die genervte Ablehnung des störenden Kindes? Beides, Hesse weiß um den dunklen Doppelgänger, den er in sich trägt, um die Doppelwahrheiten seines Schriftstellerlebens. Es ist nicht so, dass allein das geschriebene Wort gilt, das ist Hesse wohl bewusst, aber dass es die Form ist, in der er der Wahrheit allein nahekommt, das unbedingt.
Zur persönlichen Krise kommt 1914 die welthistorische Katastrophe. Während des Ersten Weltkrieges (Hesse ist noch bis 1924 deutscher Staatsbürger) wird er der deutschen Gesandtschaft in Bern als Dienstverpflichteter zugeteilt und arbeitet für die »Deutsche Gefangenenfürsorge«, die Kriegsgefangene in Lagern mit Lektüre versorgt. Eigene schriftstellerische Arbeiten entstehen in dieser Zeit kaum. Unter dem wachsenden Druck der Umstände erleidet er 1916 einen schweren Nervenzusammenbruch, dem eine psychoanalytische Behandlung bei Josef Bernhard Lang (1881-1945) folgt. In dieser Zeit macht sich auch erstmals die manisch-depressive Erkrankung Mias bemerkbar. Die drei Söhne müssen die Last dieser schlimmen Entwicklung tragen.
Briefe sind Literatur unter Vorbehalt, bleiben Mischungen aus Lebensäußerung und bewusstem Ausdruck. Die Briefe Hesses an Martin (wie auch die an Bruno und Heiner) sind einerseits persönliche Zuwendung, das Sich-Einlassen auf das, was seine Söhne beschäftigt, worin sie dann auch Rat und Beistand erfahren – aber zugleich natürlich auch immer ein Teil der Vorarbeiten des Schriftstellers für jene Texte, die für die Veröffentlichung bestimmt sind. Hesses Briefe – im Unterschied etwa zu vielen Briefen Rilkes – sind nicht mit einem Seitenblick auf die Nachwelt geschrieben, sie bleiben persönliche Ansprache.
Aber gelegentlich passiert es Hermann Hesse doch, dass er ein Thema in einem Brief ausführlicher behandelt. So in einem Trostbrief an seinen ältesten Sohn Bruno (1905-1999), der beim Maler Cuno Amiet[5] , Hesses Freund seit Gaienhofen, aufwächst und selbst Maler wird. Doch an seiner Berufung als Künstler kann er nie ganz glauben – und Hesse steht ihm in einem langen Brief bei, in dem er den Zweifel an der eigenen künstlerischen Sendung zu einem Wesensmerkmal des echten Künstlers erklärt. Hinterher findet er, dieser Brief sei so gut geworden, dass man ihn veröffentlichen sollte – was dann auch geschieht.[6]
Damit müssen Künstlerkinder leben lernen: Sie sind, wie alles, das der Außenwelt angehört, künstlerisches Material! Doch prägend für Hesses Vater-Briefe ist dieser Egoismus nicht, er bleibt die Ausnahme. Vor allem schreibt er sie, um die verlorene, ihm im Alltag dauerhaft unmögliche Nähe zu seinen Söhnen auf eine ihm gemäße Weise neu herzustellen: mittels Briefen, oft auch von jenen kleinen Aquarellen geschmückt, die Hesse im Tessin anfangs aus Selbsttherapiegründen (später mit großer Lust am Meditieren in Form und Farbe) malt, denn auch er leidet unter Depressionen, unternimmt mehrfach Suizidversuche. Insofern erhofft er sich in seinen Briefen auch Zuwendung durch seine Söhne. Die braucht er, um das ihm oft allzu beschwerlich gewordene Leben auszuhalten.
II
Im Frühjahr 1919 hatte Hesse seine Familie verlassen, 1923 wird seine Ehe mit Mia geschieden.
Die verlassene Mia kämpft mit jener manisch-depressiven Krankheit[7] , die ein Erbe der Bernoulli-Familie in Basel ist, zu der berühmte Mathematiker gehören. Sie muss, nach heftigen Anfällen, die mit starken Aggressionen verbunden sind, immer wieder zur Behandlung in psychiatrische Anstalten. Bis ins hohe Alter (sie stirbt 1963 mit vierundneunzig Jahren) werden diese Anfälle wiederkehren.
Dauerhaft mit anderen zusammenleben will und kann Hesse nicht. Die Familie als »kleinste Zelle« der Gesellschaft hat Hesse selbst in seiner pietistischen Kindheit im buchstäblichen Sinne erlebt: als Gefangensetzung. Im Grunde war er lebenslang auf der Flucht vor dieserart Einbindung in die Gesellschaft, ein Eigensinniger, ein Anarchist aus elementarem Antrieb, ein Individualist, mitunter fast schon Eremit aus Passion (mit gelegentlichen exzessiven Anwandlungen wie in seinen Zürcher Wintern der 1920er Jahre).
Aber vergessen kann er Mia, Bruno, Heiner und Martin nicht, er hört auch nicht auf, sie zu lieben. Was Hermann Hesse bereits am 1. Juli 1909 in einem Brief an Franz Vetter schrieb, war aufrichtig gemeint: »Das Beste, was ich im Hause habe, sind aber meine Kinder. Ich habe seit ersten März einen zweiten Buben, der erste ist jetzt schon dreieinhalb und täglich viel bei mir, im Garten und draußen, ein gescheiter hellblonder Kerl und mein bester Freund.«[8]
Doch der Künstler ist wie der Verbrecher ein Feind des Bürgers, darüber wird er gleich zu Beginn seines neuen ungebundenen Lebens im Tessin in »Klein und Wagner« schreiben. Die moralische Ächtung durch die Gesellschaft muss er ertragen.
Hesse sorgt sich um all seine drei Söhne. Aber am meisten sorgt er sich um Martin, der ihm der verletzlichste, auch der gefährdetste unter den Brüdern scheint und bei dem die erbliche Vorbelastung des Manisch-Depressiven von Seiten der Bernoulli-Familie sich am stärksten manifestiert.
Was die Briefe, die für diese Ausgabe wegen ihres fast tausendseitigen Umfangs ausgewählt und teils stark gekürzt werden mussten, zu so einer besonderen Lektüre macht, ist die sich darin spiegelnde wachsende Intensität gegenseitiger Zuwendung. Es sind keine Alibibriefe, die ein von seinem Vater verlassener Sohn pflichtschuldigst abliefert. Nur ganz am Anfang klingen die Mitteilungen, die der achtjährige Martin an seinen Vater zu schreiben von seiner Pflegefamilie, den Ringiers in Kirchdorf an der Aare, angehalten ist, eher ratlos.
Bei dem mit Hesse befreundeten Landarzt Dr. Ernst Ringier war Martin, das häufig kranke Kind, in Behandlung gewesen, lebte seit 1914 teilweise bereits bei seinen Töchtern, der Krankenschwester Alice und der Lehrerin Johanna Ringier, die Martin auch bis zu seinem zehnten Lebensjahr privat unterrichtete.
In dem ersten erhaltenen Brief, vom 30. März 1919, an den Vater heißt es: »In Kirchdorf ist es schön. Ich danke dir vielmal für die Karte. Grüsse von Martin. Ein Kuss von Martin.« (Brief 3)
Wie wird sich angesichts dieses emotionalen Trümmerfelds, das er mitverursacht hat, Hermann Hesses Herz zusammengezogen haben! Doch er nimmt die Herausforderung an, will die Trümmer beiseiteräumen. Das Vater-Sohn-Verhältnis wird zur lebenslangen Baustelle.
Den beiden Brüdern geht es nicht besser. Bruno kommt, wie bereits erwähnt, mit vierzehn zu dem mit Hesse befreundeten Maler Cuno Amiet in Oschwand bei Herzogenbuchsee. Er studiert dann an der École des beaux-arts in Genf und von 1927 bis 1930 an der Académie Julian in Paris. Doch der Durchbruch als Maler gelingt ihm nicht. Ein schweres Thema, in dem ihm der Vater zum Partner wird, der versucht, ihm den Druck einer existenziellen Beweispflicht als Maler zu nehmen.
Lange ringt Bruno mit sich und seiner Berufung, arbeitet dann mehr und mehr als Rahmenmacher, Schnitzer und Vergolder, versöhnt sich im Alter mit seinem Scheitern.
Heiner Hesse, der nach Ninon Hesses Tod von 1966 bis zu seinem Tod 2003 Bevollmächtigter der Hesse-Erben war, hat mit zehn Jahren eine Odyssee durch Kinderheime vor sich, besucht später die Kunstgewerbeschule und wird Schaufensterdekorateur, er steht politisch sehr links, so dass er ab den 1930er Jahren vor allem Versammlungslokale der Kommunistischen Partei dekoriert.
Das Leben bei der Familie des Landarztes Ernst Ringier gefällt Martin. Dessen Frau Anna und die beiden Töchter Alice und Johanna, die als »Lehrere« eine große Rolle in Martins weiterem Leben spielen wird, sind ihm Familienersatz. Sie betreiben in Kirchdorf eine Art Pension für Alte und leicht Behinderte. Später wird sie Martin von »Lehrere« erben – und umgehend auflösen.
Auch zu Mia, die in Ascona ein Haus gekauft hat, kommt Martin regelmäßig. Wenn Mia nicht gerade einen Krankheitsschub hat, ist sie eine gute Mutter (wird das auch für ihre erwachsenen Söhne bleiben), eine unterhaltsame Gesellschafterin, die gern Klavier spielt, Geschichten erzählt und Radio hört – sehr zum Missfallen ihrer späteren Schwiegertochter Isabelle von Wurstemberger, die Radiogeräusche nicht erträgt. Als Mia nach der Heirat von Martin und Isabelle eine Zeitlang bei ihnen wohnt, führt das ständig laufende Radio beinahe zum Zerwürfnis, macht jedenfalls einen längeren Aufenthalt Mias unmöglich.
Als Kind ist Martin gern in Ascona, beschreibt dem Vater dann per Brief die gemeinsamen Unternehmungen. »Das Mutti« – so die schweizerdeutsche Koseform – ist für Martin, anders als der Vater, so oft es geht auch physisch anwesend – aber manchmal geht es bei Mia eben auch nicht.
All die kleinen Abenteuer, die der Elf- oder Zwölfjährige besteht, schildert er dem Vater. Egal, ob ihn eine wilde Katze gebissen hat, die dann erschossen wird, oder er ein Schaf kauft, das kurz darauf stirbt, der Vater hat teil daran. Ende Juni 1924 ist die neueste Sensation zu vermelden: »Gestern Morgen hat der Fuchs das wildbrütende Huhn geholt. Ich rannte in der ganzen Nachbarschaft herum, bis ich ein anderes Huhn fand, das ich [auf die Eier] setzen konnte. Ein Küken ist schon ausgekrochen.« Das klingt nach heiler Kinderwelt, und anfänglich scheint es auch so, als ob Martin ein ausgeglichenes Kind mit landwirtschaftlichen und handwerklichen Vorlieben sei. Er angelt viel, dann entdeckt er das Faltbootfahren und beginnt sogar, selbst Boote zu bauen und zu verkaufen. Eines Tages kauft er eine Hobelbank, dann einen Webstuhl. Er hat viele Talente und mitunter einen starken Ehrgeiz, der jedoch plötzlich ins Gegenteil umschlagen kann.
Am 4. Juni 1925 informiert Hesse seine von ihm getrennt lebende zweite Ehefrau Ruth (1897-1994) über die »Familientragödie« der Bernoullis, die auch ihn betrifft: »Vor einer Stunde habe ich an der Bahn meinen kleinen Martin verabschiedet, er ist mit seinem Rucksäckchen abgereist, zu Bekannten bei Bern [gemeint sind die Ringiers], und ist wieder für eine unbestimmte Zeit heimatlos, denn seine Mutter ist wieder geisteskrank, und zwar noch schlimmer als früher, sie hatte sogar entsetzliche Tobsuchtsanfälle.«[9]
Heiner Hesse berichtete, dass Mia während eines dieser Anfälle sogar versucht hatte, Martin zu erwürgen, ein anderes Mal habe sie während einer Bahnfahrt sämtliche Koffer aus dem Fenster geworfen.
Manchmal spürt Martin, wie sehr die Eltern fehlen. Etwa, als er im Sommer 1926 plötzlich starke Bauchschmerzen bekommt und ins Krankenhaus muss, wo ihm der Blinddarm, der zu platzen droht, herausgenommen wird. Das wird Martin nicht vergessen – im Unterschied zu Hermann Hesse, der viel später, als sein erwachsener Sohn über wiederkehrende Leibschmerzen klagt, mutmaßt, das könne von einem entzündeten Blinddarm herrühren. Kann es nicht!, weiß Martin. Der Vater war eben nicht dabei gewesen, als er damals in Gefahr war.
Nun aber will Hesse bei den wichtigen Lebensentscheidungen seiner Söhne dabei sein, sich als ein guter Vater, also lebenserfahrener Ratgeber erweisen. Martin hat viele schnell wechselnde Vorstellungen von einem künftigen Beruf. Am 20. November 1927 teilt der 16-Jährige seinem Vater mit: »Ich möchte dir nur sagen, dass ich Lust hätte, Mechaniker zu werden.«
Aber da zeigt sich bereits, wie wechselhaft Martin in seiner immer nur kurzlebigen hochfliegenden Begeisterung ist. Von Mechanik ist wenig später nicht mehr die Rede, dafür jedoch von Architektur. Hesse reagiert am 5. März 1928 moderat: »Im Ganzen aber bin ich nicht unzufrieden damit, wenn die Architektur statt der Mechanik Dein Beruf wird, vorausgesetzt, dass Du auch Freude dran hast.« (Brief 33) Er unterzeichnet den Lehrvertrag.
Bereits am 8. Mai 1928 erreicht Hesse jedoch ein weiterer Brief von Martin: »Ich möchte dir nur sagen, dass ich finde, dass der Beruf eines Bauzeichners nicht gut zu mir passt. Für einige Zeit geht es ja schon, aber 3 Jahre oder wenn möglich sein Leben lang auf einem Büro sitzen, ist nicht jedermanns Sache.« Vielleicht würde die Töpferei besser zu ihm passen? Hesse reagiert besonnen auf Martins rasch wechselnde Berufsvorstellungen. Er selbst hatte schon mit 14 Jahren beschlossen, Dichter und sonst nichts im Leben zu werden – und musste dann doch eine Lehre in der Calwer Turmuhrenfabrik Perrot absolvieren, für die er im Nachhinein dankbar war. Wahrscheinlich müssen seine Söhne ihre eigene, ihnen noch verborgene Berufung erst noch entdecken. Dem will er hilfreich zur Seite stehen, auch wenn es langwierig und kompliziert werden sollte.
Während Martin sehr direkt, oft wie übersprudelnd, dem Vater berichtet, was sich bei ihm zugetragen hat, schreibt Hermann Hesse nicht selten geradezu sentenzenhaft an seinen Sohn, der nun 18 Jahre alt ist und beginnt, seinen Militärdienst abzuleisten. Dieser zieht sich in der Schweiz Jahrzehnte lang hin, immer wieder müssen die wehrfähigen Männer für Tage oder Wochen zur Ausbildung und zu Übungen einrücken. Er ist nun also erwachsen und kann auch – zur eigenen Belehrung – an des Vaters Sorgen teilhaben. So erfährt Martin am 10. Mai 1930 nicht nur, dass bei Hesse der Gedanke wieder aufgetaucht sei, »ein Häuschen im Tessin zu bauen«, sondern auch etwas über die wachsende Verzweiflung in ihm: »Ich bin da in einer Notlage, die dir erspart bleiben wird: ich habe dummerweise eigentlich nichts andres in meinem Leben getrieben und gelernt, als Bücher zu lesen und zu verstehen, ich habe fast alles andere darüber ziemlich versäumt. Dabei hätte ich mich wohl befunden, wenn die Augen bis zu meinem Tod ausgehalten hätten. Aber jetzt habe ich seit Jahren nie mehr einen Tag ohne Augenschmerzen gehabt, und muss von Tag zu Tag mehr auf das Lesen verzichten, und jetzt zeigt es sich, dass die in Büchern studierte Weisheit gar nicht dazu genügt, mir das Leben ohne Lesen erträglich zu machen, sondern es fällt mir äusserst schwer, mich daran zu gewöhnen.« (Brief 58) Aber mit Ninon Dolbin (1895-1966) ist Rettung in Sicht, sie wird ihm bis zu seinem Tod täglich oft mehrere Stunden lang vorlesen.
1931, da ist Martin 19 Jahre alt, klingt Hesse fast schon ratlos: »Da du nicht die geringste Vorstellung davon hast, was du eigentlich willst, ist es schwierig, dir zu raten.« (Brief 71) Inzwischen ist Hesse zum dritten Mal verheiratet, mit Ninon Dolbin[10] , und gemeinsam beziehen sie die Casa Rossa, jenes Haus, das Hesses Mäzen H. C. Bodmer nach dessen Plänen bauen ließ und dem Dichter und seiner Frau zur lebenslangen Nutzung überlässt. Hesse, der Ehe-Skeptiker, schreibt an Martin, die »Bocciabahn« (ein Herzenswunsch von ihm, der dieses Spiel perfekt beherrscht) sei »wohl das Hübscheste am ganzen Haus«. Erstmals bittet nun Martin, der passionierte Naturmensch, seinen Vater, ihm einige Bücher, die er geschrieben hat, »zu verkaufen«. Hesse ist glücklich, spät kommt diese Bitte, aber nicht zu spät: »Das freut mich. Auch Bruno und Heiner haben, sobald sie erwachsen waren, mich um meine Bücher gebeten, und sie haben die meisten gelesen. … Ich habe schon einige Male gedacht, Du würdest vielleicht einmal Bücher von mir lesen.« (Brief 81) Natürlich verkauft Hesse seinem Sohn die Bücher nicht, er schenkt sie ihm – und fortan all seine Neuerscheinungen.
Hesse ist der Umzug in die Casa Rossa teuer gekommen, er klagt, es seien schlechte Zeiten für seine Bücher in Deutschland. Vor allem, weil es schlechte Zeiten für Deutschland sind; überall herrscht die Krise. Sein Verleger Samuel Fischer teilt ihm mit, er habe im ersten Halbjahr 1931 fast keine Bücher mehr von ihm verkaufen können. Martin berichtet derweil seinem Vater am 12. August 1931 von einer Wanderung in den Bergen: »Hier ist es prachtvoll – und billig zu leben.« (Brief 83) Für die Söhne sind Besuche beim Vater inzwischen eine Selbstverständlichkeit – jedoch nach genauer Planung und zumeist mit Übernachtung außer Haus. Vor allem – bis auf wenige runde Geburtstage – nie alle drei zusammen. Martin, seine Brüder Bruno und Heiner erhalten akribisch im Voraus geplante Einzelbesuchstermine.
Der Dichter hat Sorgen, die seine Söhne teilen. Denn Hermann Hesse drängt die drei Söhne, einem Erbvertrag zuzustimmen. Es geht dabei nicht nur um das Ninon zugesprochene Mobiliar des Hauses, sondern um mehr: »Der Sinn des jetzigen Vertrages ist nur der, dass Ihr die Leibrente, die ich jetzt für mich vom 60. Lebensjahr an errichte, und die nachher, etwas gekürzt, Ninon gehört, anerkennet und nach meinem Tod nicht etwa anfechtet.« (Brief 88) Die Söhne sind befremdet. Aber bald beruhigen sie sich wieder, denn Ninon ist offensichtlich nicht die raffgierige neue Frau des Vaters, sondern tatsächlich seine Stütze, dabei in allen Alltagsdingen überaus genau – auch, was die eigene Vorsorge betrifft.
Martin entwickelt zu Ninon eine besondere Beziehung, denn obwohl sie es nicht mag, fotografiert zu werden, interessiert sie sich doch sehr für Fotografie – auf ihren Reisen nach Griechenland fotografiert die passionierte Kunsthistorikerin selbst. Martin berät sie in fototechnischen Fragen. Auch in Liebes-, Ehe- und Automobilfragen führen beide ein Briefgespräch von besonderer Intensität.
Von den Distanz-Ritualen, die seinen Alltag durchziehen, weicht Hesse bis zu seinem Lebensende keinen Millimeter ab. Umso intensiver lässt er sich auf sein Gegenüber ein, wenn er Briefe schreibt. Dann versetzt er sich mit sicherem Instinkt in sie hinein.
Hesse ist niemand, der nur von sich und seinen Plänen – und den zunehmenden Sorgen – als Autor zu berichten weiß, sondern spricht von Tagen im Garten, von Besuchern und vor allem von seinen nie nachlassenden Schmerzen, die ihm seine schwachen Augen, seine Gicht oder seine Zähne bereiten.
Immer ist er in Sorge darüber, dass auch Martin ähnliche Beschwerden entwickeln könnte. Geh zum Arzt, lass dich untersuchen! Dabei bleibt es nicht, Hesse weiß stets einen Spezialisten (einen, der auch ihn behandelt), er macht Termine, bezahlt die Rechnungen und erkundigt sich eingehend nach Untersuchungsergebnissen und später nach Heilungsfortschritten (denn auch Martins Gesundheit ist fragil wie die des Vaters).
III
Im Februar 1932 meldet sich Martin im Bauhaus[11] in Dessau an – die Ausbildung dort ist vielgestaltig und gilt in der Welt als konkurrenzlos. Hermann Hesse hatte an den Leiter, Mies van der Rohe (1886-1969), geschrieben und um Martins Aufnahme gebeten. Er bezahlt auch das Schulgeld und die Aufenthaltskosten. Seinen ersten Brief aus Dessau an den Vater sendet Martin am 4. April 1932, den letzten kurz vor der Schließung des Bauhauses durch die Nationalsozialisten am 31. August 1932. Martins Eindruck von Dessau ist höchst zwiespältig. Die Eitelkeit und Wichtigtuerei sowohl der Lehrer wie der Schüler bei Kunstdebatten stößt ihn ab. Für ihn sei es schwierig da mitzukommen, nach 20 Jahren »unter Bauern«, wie er tiefstapelnd meint.
Derartige schroffe Widersprüche, wie sie hier herrschen, kannte er bislang nicht. Mies van der Rohe sei ein »fabelhafter Architekt, aber ein reaktionärer Mensch«, der mittels Überfallkommando Studentenvertreter verhaften lässt. Und Kandinskys abstrakte Kunsttheorie scheint Martin allzu verstiegen. Der Vater bestärkt ihn in seinem Vorbehalt gegen jede intellektuelle Anmaßung. Er spricht von der »geistigen Gerissenheit« und dem »raschen und hübschen Klugreden«, das ihm schon immer zuwider gewesen sei. Seine Abneigung gegen das Akademische gipfelt in der dem Sohn mitgeteilten Sentenz: »Gewiss, man soll Respekt vor dem Geist haben, aber vor dem, der etwas schafft, nicht dem, der bloss schwätzt …«
Den Schulbetrieb findet Martin schlicht »zum Kotzen«. Und doch entdeckt er hier auch etwas Neues, das ihn dann – im Unterschied zu manch anderer kurzzeitiger Faszination – lebenslang begleiten wird: die Fotografie. Vielleicht spielt dabei auch eine Rolle, dass seine Mutter Mia die erste Berufsfotografin der Schweiz war? Er wünscht sich umgehend einen Fotoapparat.
Martins Haltung in Dessau ist die eines Flaneurs, der kundtut, er wolle hier so viel wie möglich für sich mitnehmen, »bevor der Laden geschlossen wird«. – »Gegenwärtig ist im Landtag, der ja hauptsächlich aus Nazis besteht, eine Abstimmung, und viele sagen, dass es sich ums Bauhaus handelt.« (Brief 99)
Tatsächlich muss er dann dem Vater vermelden: »Das Bauhaus ist nun leider von den Nazis geschlossen worden.« (Brief 106)
Das Bauhaus hat Martin zum Fotografieren gebracht – und Hermann Hesse findet die Porträtfotos, die Martin von ihm macht, allesamt »originell«. Er bestärkt den Sohn in seinem Talent und bietet sich ihm gleichsam als Dauermodell an. Das Posieren vor der Kamera wird für ihn zu einem Spiel, das ihm gefällt. Aber Martin gelingen auch ganz ungezwungene Schnappschüsse. Hesse erkennt sehr wohl, dass das besondere Vater-Sohn-Verhältnis zwischen ihnen sich auf die Fotos überträgt. Und er lässt es zu, dass die dabei entstehende Intensität sichtbar wird. Man könnte auch sagen, dass Martin von seinem Vater zu seinem sehr persönlichen Fotografen erklärt wurde – denn Martins Fotos sind es, anhand derer wir uns heute ein Bild des Dichters Hermann Hesse machen. Gewiss ist, dass Martin in seinen Fotos dem Selbstbild des eigensinnigen Menschen und Autors Hermann Hesse so nahekommt wie kein anderer Fotograf.
Darum lässt sich Martin auf ein Leben mit Fotoapparat ein, obwohl er keine Menschen (außer seinen Vater und gelegentlich andere Familienangehörige) fotografieren mag und zudem farbenblind ist. Das prädestiniert ihn zur Schwarz-Weiß-Sachfotografie, vor allem zu Architekturaufnahmen, Bildern von Museumsbeständen und auch für Warenhauskataloge. Eine einsame, eine tote Welt aus lauter Gegenständlichkeit. Zeitweise ist er auch als Fotoreporter stark beschäftigt, aber da ist ihm auf die Dauer die Konkurrenz (und der Aktualitätszwang!) zu groß.
Also zieht er sich in sein eigenes Fotoatelier zurück, lebt viel zu viel in jener »Dunkelkammer«, die immer mehr auch seelisch von ihm Besitz zu ergreifen beginnt.
IV
Die Briefe aus den 1930er Jahren zeigen einen jungen Mann, der sich unsicher ist über seine Bestimmung in der Welt. Welchen Beruf er wirklich ausüben will, weiß er lange nicht. Am liebsten unternimmt er Wildwasserfahrten mit seinem Faltboot oder fährt Fahrrad (»Velo«), segelt, angelt und wandert in den Bergen. Die Natur ist ihm nahe, mit Tieren kann er besser umgehen als mit Menschen. Lange Zeit findet er keine Freundin, die ihm wirklich etwas bedeutet, möchte gern heiraten, aber weiß nicht, wen. Hesse ist für diese Fragen immer ansprechbar, erklärt dem Sohn, dass es ihm oft ähnlich gegangen sei und manchmal immer noch so gehe. Da wisse er auch nicht, wozu er auf der Welt sei, und heiraten sei ohnehin ein heikles Thema. Man müsse sich nicht binden, wenn man lieber ungebunden leben will!
Martins manisch-depressive Krankheit zeigt sich bereits in diesen Jahren. Hesse kennt von Mia her die Symptome. Auf Apathie und Antriebsschwäche folgen Erregung und aggressive Ausbrüche. Die Mitarbeiter in seinem Fotolabor entlässt Martin auffällig oft aus nichtigen Gründen; er kann höchst unduldsam und ungerecht sein. Der Vater versucht, ihn in solchen Phasen zu beruhigen. Er solle sich akzeptieren, wie er sei, und sich nicht so unter Erfolgsdruck setzen, das sei schädlich für ihn.
Martin strebt nach einer ungezwungenen Freiluft-Existenz. Hesse teilt das einerseits, andererseits betrübt es ihn, dass Martin die meisten seiner Bücher immer noch nicht kennt, überhaupt lange Zeit kein starker Leser ist. Oft bekommt er als Antwort auf seine Bücher-Gaben Ausflüchte zu hören wie: »Zum Lesen hatte ich keine Zeit, da ich gerade an der Überholung meiner Segeljolle arbeite.« (Brief 125)
Am 3. Dezember 1943, als er »Das Glasperlenspiel« beendet hat, schreibt Hesse über die Intention dieses anspruchsvollen Werks an Martin: »Für mich selber war das Buch in den mehr als elf Jahren, in denen es entstand, viel mehr als eine Idee und ein Spielzeug, es war mir ein Panzer gegen die hässliche Zeit und eine magische Zuflucht, in die ich, so oft ich geistig dazu bereit war, für Stunden eingehen konnte, und wohin kein Ton aus der aktuellen Welt drang.« (Brief 255) Hesse will, dass dieses Werk in Deutschland erscheint, als Verteidigung des Geistes gegen den Ungeist. Aber nur noch wenige Titel von ihm dürfen im von Peter Suhrkamp geleiteten S. Fischer Verlag gedruckt werden. »Das Glasperlenspiel« erhält keine Druckerlaubnis – und erscheint 1943 in der Schweiz bei Fretz und Wasmuth.
In diesen Jahren werden alle drei Söhne zu engen Gesprächspartnern Hesses. Bruno, Heiner und Martin sind überzeugte Schweizer Eidgenossen und ebenso überzeugte Antifaschisten. Besonders Heiner, der in dieser Zeit Kommunist ist, drängt den Vater zu unmissverständlichen Wortmeldungen gegen Nazi-Deutschland. Doch solch direkte Polemiken stehen in der Schweiz, die sich zur Neutralität verpflichtet hat, unter Strafe. Das vergessen jene, die Hesse seinen Rückzug auf unpolitisch-humanistische Positionen vorwerfen, als wären diese nicht gerade der stärkste, weil grundsätzlichste Einspruch gegen jede Barbarei.
Mit seinem »Rigi-Tagebuch«[12] stellt er sich unmittelbar nach Kriegsende sehr deutlich gegen jeden Nationalismus, in dessen Übersteigerung er die Ursache auch des verbrecherischen NS-Regimes erblickt.
Von manchen wird Hesse nach 1945 als »Leckerlifresser« angefeindet, als jemand, der es sich in der Schweiz bequem gemacht habe, während auf deutsche Städte Bomben fielen. Auch von anderer Seite kommt Kritik. Hans Habe etwa, Chief Editor der in der amerikanischen Besatzungszone erscheinenden deutschen Zeitungen, schreibt Hesse, er glaube nicht an seine Berechtigung, weiter zu den Deutschen zu sprechen. Denn anders als Thomas Mann oder Stefan Zweig habe er nicht laut genug gegen das Nazi-Regime protestiert.
Martin ist ob dieses ungerechten Vorwurfs empört – und gibt den Inhalt eines Briefes von Hesse an ihn der Presse weiter. Im November 1945 beichtet er dies dem Vater: »Ich habe dein Rigi-Tagebuch mit Interesse gelesen und mit einem Bekannten lange darüber gesprochen. Deine Haltung ist sicher die richtige, nur fällt sie nicht jedem leicht. … Du findest in der Beilage zwei Zeitungsausschnitte. Keine freudige Überraschung, ich weiss es. Sogar eine Indiskretion von mir.« (Brief 312)
Hesse reagiert mit milder Strenge auf diese, wie er schreibt, ihm »unbegreifliche Indiskretion«: »Ich muss dich vorher bitten, nie mehr Journalisten etwas aus Briefen von mir mitzuteilen, aber es war so schön und lieb von dir gemeint, dass ich's verstehe.« Das, was man heute einen »Shitstorm« nennt, bricht nun über Hesse herein. Der mediale Effekt: Plötzlich steht Hesse wieder im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Aber das will er gar nicht. Er hat sich längst im »Nichtdabeisein« bei den politischen Nachkriegsdebatten in Deutschland eingerichtet, sendet nur ab und zu seine Flugschriften über die Alpen gen Norden. Verwundert registriert er, dass »aus einem europäischen Literaten, eine Schweizer Berühmtheit« geworden sei.
Und Martin? Macht weiter Fotos, stürzt sich aber auch in Bauprojekte. Offenbar sucht er in körperlicher Arbeit jenes innere Gleichgewicht, das ihm zu entgleiten droht. Er bemüht sich darum, ein guter Ehemann und Vater zu sein – ein besserer, als es Hermann Hesse ihm war? Nein, das kann man so nicht sagen, Hesse ist als Vater jetzt viel präsenter in seinem Leben, als ein Vater es bei den allermeisten Menschen ist, wenn sie erwachsen geworden sind.
Doch da ist eine nie ganz verheilende Wunde bei allen drei Söhnen: die plötzliche physische Abwesenheit des Vaters in ihrer Kindheit, in der Zeit, wo man seinen Schutz braucht, um sich später im Leben sicher zu fühlen. Das, so weiß Hesse, hat er versäumt.
1944 heiratet Martin die Bibliothekarin Isabelle von Wurstemberger, 1945 wird die Tochter Sibylle geboren. Das manisch-depressive Erbe Maria Bernoullis macht sich nun bei ihm immer stärker bemerkbar und wird sich von Martin auch auf seine Tochter Sibylle weitervererben. Am 7. Februar 1944 schreibt er an seinen Vater: »Meiner Umwelt und mir mache ich mit meiner schlechten Laune das Leben schwer, ich bin so gründlich und gänzlich enttäuscht, dass ich in meiner ungeschickten Art zu reagieren, alles zusammenschlagen könnte.« (Brief 259) In Schweizerdeutsch kehrt jetzt oft, um das Schwere der Situation zu beschreiben, die Wendung wieder: »Wir haben's streng.«
Das Briefgespräch, das Vater und Sohn nun führen – Hesse wird siebzig, Martin ist Mitte dreißig –, gibt sich völlig frei von allen Äußerlichkeiten, zeugt von großem Vertrauen. So gesteht Hesse am 9. Juli 1947 Martin nach den opulenten Feiern zu seinem 70. Geburtstag: »Aus Deutschland kommen Berichte über Feiern, in Calw hat man mich zum Ehrenbürger gemacht und einen Platz nach mir genannt. Es wäre jetzt genug und ich hoffe, es habe nun sein Ende mit diesem Theater, ich komme mir dabei manchmal vor wie ein Affe, dem man eine Uniform angezogen hat.« (Brief 366)
In den 1950er Jahren verschlimmert sich die psychische Erkrankung Martins. Etwas, was man in dieser Zeit zumeist öffentlich nicht thematisierte. Solche Erkrankungen galten als Makel in der Familie, den man so gut es ging verbarg. Zudem verweigerte sich Martin jeder medikamentösen Behandlung, etwa mit dem damals neuen Lithiumsalz. Immerhin, mit seinem Vater konnte er offen sprechen – von den Ängsten, der Lähmung, der Dunkelheit, der plötzlichen Erregung und dem drohenden Kontrollverlust.
Und dann ereignet sich, ausgerechnet bei einer nächtlichen Armeeübung, die einer Reihe von schlaflosen Nächten folgte, ein dramatischer Zusammenbruch. Martin selbst schildert seinem Vater den Vorfall im November 1956. Soeben hat er einen verletzten Kameraden in die Krankenstube gebracht: »Dort fuhr der Blitz in mich, ich warf eine Wandlampe, die ich eben noch geholt hatte, um abends besser Karten zeichnen zu können, fort, ebenso mein Bajonett und riss meinen Kittel auf. I muess uf e Giubing, I muess uf e Giubing [Gipfel im östlichen Abschnitt des Gotthardmassives], schrie es aus mir, während ich umsank und Schreie ausstiess.« (Brief 563)
Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Man entkleidet ihn, legt ihn ins Bett, will ihm ein Schlafmittel verabreichen, das er abwehrt: »Ich stellte mich schlafend und als er [der Arzt] sich selber zu Bette gelegt, sagte ich, dass ich noch schnell verschwinden müsse. Im W. C. liess ich das Wasser so laut laufen, dass er das Öffnen der Haustür nicht hören konnte und rannte in Unterhosen und barfuss 5 Minuten weit zu meinen Kameraden.« (Ebd.)
In den Bergen fängt man ihn wieder ein und legt ihn mit einem starken Beruhigungsmittel ins Bett. Im Brief an den Vater reflektiert er diesen Moment, wo es über ihn kam: »Wahnsinn! Sagt der normale Gesunde. Für mich war das Rennen die höchste Wahrheit, die ich je im Leben gehabt. … Der Wahnsinn selber war für mich ein so wunderbares Fühlen des ewigen Stromes, dass ich dies Erleben trotz seiner unangenehmen Begleiterscheinungen um nichts in der Welt missen möchte und Gott dafür danke.« (Ebd.)
Welch ein schonungsloses Protokoll eines inneren Ausnahmezustandes, der ihn über die Grenze dessen, was als vernünftig gilt, hinwegträgt!
Den Brief schickt Martin erst nach einem mehrtägigen Zögern an den Vater und erbittet ihn, nachdem er ihn gelesen habe, wieder zurück. Hesse folgt dem und schreibt auf die Seiten: »Weil du es so willst, schicke ich dir den Brief zurück. Ich habe ihn in aller Herzensanteilnahme, aber auch mit Schrecken und Sorge gelesen. Ich sage nicht mehr darüber. Ich spreche natürlich mit keinem Menschen darüber.«
Wie Sibylle Siegenthaler-Hesse berichtete, habe sie lange gezögert, auch diesen Brief zu den anderen Briefen ihres Vaters zu legen, aber unterschlagen wollte sie ihn auch nicht.
Martins weiterer Weg ist von zunehmenden Stimmungsschwankungen bestimmt. Er weiß nicht, wie man sich im Leben befestigen soll, wenn man kein so großer Künstler werden kann wie Hermann Hesse, aber eben auch nicht ein bloßer Bürger sein will. Das scheint das Dilemma aller drei Hesse-Söhne. Der Vater leidet mit ihnen, auch er hat diesen Widerspruch durchlebt und ihn schließlich in eine Form bringen können. Nun hilft er mit Geld und guten Worten, die aus echter Anteilnahme kommen. Er ahnt, wie schwer es allen dreien fällt, ihren Platz im Leben zu finden, wohlwissend, dass er ihnen dabei letztlich nicht helfen kann.
V
Die letzten Briefe zwischen Vater und Sohn haben einen innigen Ton. Hesse, der an Leukämie leidet, schreibt nach seinem 85. Geburtstag, der stapelweise Post hinterlassen hat, im Juli 1962 an Martin: »Transfusionen habe ich seit dem Geburtstag schon wieder zwei bekommen, und in einigen Tagen gibt es wieder eine, es ist immer eine langweilige Sache, kostet fast einen ganzen Tag, ist eine unerwünschte Anstrengung für Ninon und ermüdet mich so, dass ich auch am nächsten Tag noch nichts leisten kann.« (Brief 672)
Anfang August 1962 schickt Hesse an Martin ein Päckchen mit dem kurz zuvor bei Suhrkamp erschienenen Buch »Gedenkblätter« und einem Brief, worin er sich um das Negativ des »Regenmacher« genannten Fotos, das Martin von ihm aufgenommen hatte, sorgt. Dieser letzte Brief des Vaters schließt mit einer Erinnerung an Martins Ziehmutter: »Die Frau Dr. Ringier ist eine der liebsten und gütigsten Frauen gewesen, die ich je gekannt habe. Addio! Dein Vater« (Brief 674)
Sein letztes Gedicht liegt der Sendung bei: »Knarren eines geknickten Astes«. Martin antwortet am 9. August 1962 – nicht ahnend, dass sein Vater an diesem Tag bereits gestorben ist, friedlich im Schlaf, nachdem er am Abend zuvor noch Musik seines Lieblingskomponisten Mozart gehört hatte. Martin schreibt, der »Regenmacher« sei »nicht wirklich verloren«, aber das Negativ fehle an seinem Platz.
Der Brief schließt: »Wundervoll und traurig ist dein Gedicht. Neulich träumte mir, dass lauter Verstorbene, alle doppelt so hoch wie ich mit mir an einem Essen waren, sich dann erhoben u. fort gingen, dann kam Dr. Sch. nach einer Weile zurück u. sagte er müsse noch einen mitnehmen u. ergriff meine Hand. Ich wusste es sei das Ende u. bedauerte nur, von meinen Lieben nicht Abschied nehmen zu können u. erwachte.
Hab tausend Dank für deine überreichlichen Gaben, du Lieber.
Ciao Martin« (Brief 675)
Sechs Jahre später wird sich Martin mit siebenundfünfzig Jahren das Leben nehmen[13] , seine beiden Brüder Bruno und Heiner werden uralt.
Diese Briefausgabe wurde nur möglich durch die jahre-, ja sogar jahrzehntelange Sammeltätigkeit der Familie Martin Hesses. Nach seinem Tod am 14. Oktober 1968 begann seine Frau Isabelle von Wurstemberger (1906-1990) damit, die Briefe zu sichten und zu ordnen. Die Hesse-Enkelin Sibylle Siegenthaler-Hesse (1945-2019) führte diese Arbeit weiter. Ihr Mann Hanspeter Siegenthaler sowie die Hesse-Urenkel Martin und Matthias transkribierten die Briefe und setzten ihre beratende und korrigierende Arbeit als Mitherausgeber dieser Ausgabe fort. Viele detaillierte Angaben zur Familiengeschichte sind allein ihnen zu verdanken. Die frühen Briefe liegen zumeist handschriftlich in Kurrentschrift vor, die späteren handschriftlich in lateinischer Schrift, sie wurden häufiger noch auf der Schreibmaschine geschrieben und nicht selten mit kleinen Aquarellen versehen.
Gunnar Decker
1. Hermann Hesse an Martin in Kirchdorf, Typoskript mit Aquarell
[Montagnola, Weihnachten 1918]
Mein lieber Brüdi!
Du hast mir mit deinem Geschenk und deinem Brief eine grosse Freude gemacht, dafür sage ich dir vielen Dank, mein lieber Bub. Das Körblein ist fein gemacht, auch die Malerei drauf ist so schön.
Das Mutti geht jetzt über die Weihnacht doch fort, und zwar nach Adelboden, und der Heiner[14] darf dort ein wenig bei ihr sein. Und ich komme also am Anfang Januar nach Bremgarten, und dann sehen wir einander wieder und wollen recht vergnügt sein! Darauf freue ich mich sehr.
Sage der Frau Doktor, dass ich ihr für ihren lieben Brief sehr danke.
Mit vielen Grüssen dein
Papi
2. Frau Dr. Ringier-Aebi[15] an Hermann Hesse in Montagnola, Handschrift
Kirchdorf, 19. Februar 1919
Sehr geehrter Herr,
Endlich kann ich Ihnen die Abrechnungen senden. Als Sie mir die Fr. 400.– zum Voraus gaben, dachte ich, sie würden ewig dauern, das Geld schlüpft einem nur so aus den Händen. Heute habe ich einen lieben Brief von Frau Hesse erhalten mit recht tröstlichen Berichten, Gottlob, dass sie schon so weit ist! So kann man hoffen, dass Ihre Prüfungszeit bald ein Ende nehmen wird.
Martin geht es gut, die Buben haben sich dies Jahr herrlich im Schnee tummeln können. Hoffend, sehr geehrter Herr, Sie befinden sich wohl und machen uns bald das Vergnügen Ihres Besuches, bitte ich Sie, unsere freundlichsten Grüsse zu empfangen.
A. Ringier-Aebi
3. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
Kirchdorf, d. 30. März 1919
Lieber Papi,
ich freue mich, dass du kommst. In Kirchdorf ist es schön. Ich danke dir vielmal für die Karte. Grüsse von Martin. Ein Kuss von Martin. Da schicke ich dir ein Büchlein.
Martin Hesse
4. Hermann Hesse an Martin in Kirchdorf, Handschrift mit Zeichnung
[Montagnola, im Jahr 1919]
Lieber Brüdi!
In diesem Häuschen im Tessin sitze ich in der Nacht beim Licht und schreibe dieses Brieflein an dich. Das Mutti hat mir geschrieben, dass du daheim in Bern gewesen bist und auch beim Zahnarzt. Tut es jetzt nicht mehr weh?
Hier haben wir einen kleinen Hund, der ist ganz alt und grau und heisst Rio, und hat lange wollige Ohren. Wenn ich spazieren gehe, kommt er immer mit. Aber er gehört gar nicht uns. Er gehört niemand, und von Zeit zu Zeit geht er in ein anderes Haus, und wenn er dort zu fressen kriegt, bleibt er ein paar Tage dort.
Lernst du viel in der Schule? Ich schicke dir ein Müntschi [einen Kuss], und viele Grüsse von allen im Haus. Dein Papi
5. Hermann Hesse an Martin in Kirchdorf, Handschrift mit Aquarell
[Montagnola, Anfang 1920]
Lieber Brüdi
Dieser schöne Vogel soll zu dir fliegen und dir einen schönen Gruss von mir bringen. Ich habe mich sehr über deinen lieben Brief aus Kirchdorf gefreut. Wahrscheinlich muss ich bald verreisen, um eine Kur zu machen. Ich habe jetzt eine kleine junge Katze im Haus. Sie ist aber jetzt krank und frisst fast nichts.
Viel herzliche Grüsse von
deinem Papi
6. Hermann Hesse an Martin in Ascona, Handschrift mit Aquarell
[Montagnola] Juli 1921
Lieber Brüdi!
Jetzt kommt dein Geburtstag, und du wirst schon zehn Jahre alt! …
Auch bei euch wird es jetzt gut warm sein, hoffentlich geht euch das Wasser nicht ganz aus, hier ist es ziemlich knapp geworden. Du kannst jetzt gewiss schon ein klein wenig Italienisch, oder noch nicht? Gewiss gehst du oft zum Baden an den See. Das Wasser ist aber so warm, dass bald auch die Fische schwitzen werden.
Herzlich grüsst und küsst dich
dein Papi
7. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
[Ascona, Juli 1921]
Lieber Papi
Ich danke dir vielmal für die schönen Geschenke. Ich fische manchmal, aber sie fallen mir meistens wieder ab. Ich bade fast alle Tage. Das Wasser ist warm. Was machst du immer. Die Marken hat Heiner geteilt. Ist es bei Euch auch so heiss? Jetzt kann man draussen in den Hängematten schlafen. Das ist schön.
Es grüsst dich
dein Martin
8. Hermann Hesse an Martin in Ascona, Handschrift mit Aquarell
Montagnola, 17. März 1922
Mein lieber Martin!
Du hast mir mit deinem lieben Brief eine Freude gemacht, auch mit der hübschen Seelandschaft, die du drüber gemalt hast. Und ich bin ganz erstaunt, dass du schon ein so grosses Buch wie den »Sigismund Rüstig«[16] gelesen hast.
Ich lege noch ein paar Marken für dich bei, darunter ist auch die grosse Schweizer Jubiläumsmarke, die es vor 22 Jahren gegeben hat, die ist selten, und auch ein paar andere alte Marken sind dabei. …
Herzlich grüsst dich
dein Papi
Die Marke von diesem Brief musst du auch aufbewahren, die werden später selten.
9. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
[Ascona, Ende Mai 1922]
Lieber Papi.
Ich freue mich, dass ich zu dir kommen kann. Weisst du, wir wollten schon lange Hühner eintun. Gestern ging das Mutti zu Frau Vester[17] , da sagte sie, sie verkaufe eine Glucke für Fr. 7.–, weil die anderen Hühner sie picken. Da kaufte sie das Mutti, aber es nahm sie nicht gleich mit. Zuerst kauften wir noch die Eier. Am Morgen holte ich die Glucke. Zuerst legte ich die Eier noch in das Nest. Eines war kaputt, da legte ich 12 Eier unter und dann die Henne darauf. Zuerst war sie noch ganz wild, und die 12 Eier wollten ihr nicht gefallen. Auf einmal legte sie ein Ei heraus. Das sagten wir unserem Nachbarn. Der sagte uns, man dürfe ihr nur eine ungerade Zahl Eier geben. Da machten wir es so, und nun brütet sie gut. Die Glucke brütet etwa 21 Tage lang.
Viele Grüsse von deinem Martin
10. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
[Ascona, Juni 1922]
Lieber Papi.
… Das Mutti hat die Glucke mit Schmierseife eingerieben, weil sie Läuse hat. Gleich als sie eingeschmiert war, wälzte sie sich im Dreck. Da hat sie das Mutti abgewaschen, jetzt hat sie keine mehr.
Vorhin ist ein Brett auf ein Hühnchen gefallen. Ich sah es nicht gleich, und als ich herzukam, hatte es die Beine und Flügel ausgestreckt und die Augen zu. Da hauchte ich es an. Da tat es sie auf und hüpfte wieder herum.
Viele Glückwünsche
von Martin
11. Hermann Hesse an Martin in Ascona, Typoskript mit Aquarell
Montagnola, 1. Juli 1922
Lieber Brüdi
Danke schön für deinen lieben Brief und deine Glückwünsche, und für deine Geschenke, die Schachtel ist sehr hübsch, und auch die bunten Papiere. Das war nett, dass das kleine Hühnchen, das unters Brett gekommen war, wieder zu sich gekommen ist!
Vorgestern habe ich hier in der Nähe auf der Matte einen jungen Vogel gefunden, der noch nicht recht fliegen konnte, ein Fink, und konnte ihn im Bach, wo er grad ertrinken wollte, retten. …
Viel herzliche Grüsse von
deinem Vater
12. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
[Kirchdorf, 21. Juli 1922]
Lieber Papi.
… Ich bin ein wenig in [Kirchdorf] in den Ferien. Ich hatte zwei Kaninchen, das eine hat sich vergiftet oder sonst so etwas, und das andere hüte ich immer im Garten. Wir haben viel Äpfel, das Röseli[18] hat gesagt, wenn ich heim gehe, so könne ich eine Kiste voll mitnehmen und vielleicht auch noch ein Oleanderstöcklein. Ich schicke ihm [Röseli] dann vielleicht andere Pflanzen. Das Mammi hat mir Trauben geschickt und mir geschrieben, dass der Marder ein Hühnlein geholt habe …
Viele Grüsse von deinem Martin
13. Martin an seinen Vater in [Zürich], Handschrift
Ascona, den 19. Dezember 1922
Lieber Papi.
Es tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Aber ich kann wirklich nichts dafür. Denn gerade als ich am Finkennähen [am Nähen von Hausschuhen] war, kam die wilde Katze wieder und wollte bei uns stehlen. Da machte ich die Türe zu. Da wurde sie aber ganz verrückt und sprang an den Fenstern herauf, und schliesslich sprang sie über den Spritapparat [einen mit Brennsprit betriebenen Kocher] und warf uns alle Pflanzen um. Da packte ich sie am Fell, liess sie aber gleich los, da sie mich fest in den rechten Zeigfinger biss. Da machte ich die Türe gleich auf, und die Katze sprang davon. Nachher wusch ich die Wunde aus, und Mutti machte mir einen Verband. Am Abend machte es mir auf einmal wieder weh, und als wir den Verband entfernten, war der Finger etwa doppelt so dick wie der andere. Wir badeten ihn gleich, aber das half nicht viel, und ich hatte fast die ganze Nacht Schmerzen. Am anderen Morgen wurde Dr. Friedeberg geholt, und der sagte, man müsse ihn 3 Mal täglich in heissem Seifenwasser baden, und dann Umschläge mit Essigsaurer Tonerde. Das Baden tat ziemlich weh. Ich musste längere Zeit das Bett hüten. Erst kam der Doktor zu mir, und später ging ich zu ihm. Der Finger ist immer noch nicht ganz gelenkig, sonst hätte ich dir schöner schreiben können. Hoffentlich hast du Freude am Lampion.
Viele Grüsse von deinem Brüdi
14. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
[Ascona, Juni 1923]
Lieber Papi.
… Letzthin war ich in Arcegno, um mir ein Schaf anzusehen, das ich kaufen möchte. Es war ein ganz weisses und erst ein paar Tage alt. Jetzt kann ich es in einem Monat holen. Einen Viertel daran habe ich schon verdient auf dem Markt. Ich habe Enziane verkauft. In letzter Zeit habe ich ziemlich viel Tröge für die Hühner geschnitzt und Lindenblüten abgelesen.
Hast du die Tessiner auch schon gesehen Kirschen ablesen. Hier schlagen sie sie mit Stangen herunter oder brechen die Äste ab. Ich habe im Garten Flachs gesät, jetzt blüht er. Die wilde Katze, die mich gebissen hat, ist jetzt erschossen. Bei uns ist ein Fuchs in der Nähe, der den Leuten viel Hühner holt. Es sind jetzt zwei Herren hier, die ihn schiessen wollen, aber ich glaube nicht, dass sie ihn schiessen können, weil der Fuchs ein schlaues Tier ist. Ich danke dir vielmals für die Pinsel und Bleistifte.
Viele Grüsse von
Martin
15. Hermann Hesse an Martin in Ascona, Typoskript mit Aquarell
Montagnola, 3. Juli 1923
Mein lieber Martin
…. Alles in deinem Brief hat mich sehr interessiert, und besonders das Schaf, das du kaufen willst. Dazu möchte ich auch einen Beitrag geben, ich lege dir ihn bei.
Ja, gelt, das ist komisch, wie die Tessiner mit ihren Kirschbäumen umgehen! Da habe ich auch sehr drüber gestaunt.
Ich hoffe sehr, dass Euer Fuchs niemals an deine Hühner geht. Aber dass er totgeschossen wird, das kann ich nicht wünschen, er täte mir leid, und so ein Fuchs ist ein feines, schönes und gescheites Tier, so gescheit ist mancher Mensch nicht.
Heut Nacht hatten wir hier ein fürchterliches Gewitter, die Blitze hörten zwei Stunden lang gar nicht auf, es war beständig hell, und der Regen goss wie ein Wasserfall, und zuletzt gab es auch noch Hagel. Das ist ein merkwürdiger Sommer. Für mich ist er auch nicht gut, ich habe immer Gliederschmerzen. …
Herzlich küsst dich
dein Vater
16. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
[Ascona, August 1923]
Lieber Papi.
Ich danke dir vielmal für das schöne Bildchen und das viele Geld. Das Schaf, das ich bekommen sollte, ist, nachdem es ein paar Tage alt war, gestorben. Jetzt kriege ich aber ein anderes.
Ich habe schon etwa 50 kg Heu gemacht für das Schaf, und im ganzen Winter frisst es etwa 200 kg Heu. Das neue Hühnerhaus ist jetzt fertig. Ich habe vor ein paar Tagen ein Lampion gemacht, das ich für Fr. 5.– verkaufen konnte. Wenn du willst, so mache ich dir auch wieder einmal ein Lampion.
Viele Grüsse von
Martin
17. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift mit Aquarell
[Ascona, Ende Juni 1924]
Lieber Papi.
… Gestern Morgen hat der Fuchs das wildbrütende Huhn geholt. Ich rannte in der ganzen Nachbarschaft herum, bis ich ein anderes Huhn fand, das ich [auf die Eier] setzen konnte. Ein Küken ist schon ausgekrochen.
Viele Grüsse von
Martin
18. Hermann Hesse an seinen Sohn in Ascona, Handschrift mit Aquarell
Baden, 20. Oktober 1924
Lieber Martin!
Schon seit mehr als zwei Wochen bin ich wieder in Baden und steige jeden Morgen in das heisse Schwefelwasser, wo ich eine ganze Stunde drinnen bleibe. Noch etwa eine Woche bleibe ich hier. Die ganze Zeit war recht schönes Wetter, aber die Weinernte war plötzlich, es gab fast gar nichts.
Gestern habe ich einen Radio-Apparat gehört, wo man drahtlos Musik und Reden aus weiter Ferne hören kann.
Die zwei jungen Marder, die früher hier im Haus waren, sind leider nimmer da, dafür aber ein halbes Dutzend Dachshunde, einige davon noch junge, die sehr nett sind.
Sage Grüsse von mir an Köbi[19] , und sei recht gesund und vergnügt! Ich bin die erste Hälfte des Novembers in Montagnola, dann gehe ich nach Basel. Im Dezember und Januar muss ich zu Vorträgen nach Deutschland.
Herzlich küsst und grüsst dich
dein Vater
19. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
Ascona, den 8. Februar 1925
Lieber Papi.
… Ich gehe jetzt in Locarno in eine Privatschule. Ich habe dann nur am Vormittag 3 Stunden Schule. Es gefällt mir gut. Wir sind im Ganzen 8 Kinder, aber jetzt sind 4 krank. Ich fange jetzt auch mit Französisch an.
Ich habe jetzt das alte und das junge Schaf verkauft, und Hühner haben wir auch nur noch zwei. Unsere Freundin Felicita ist in Arcegno letzthin gestorben. Mein Webstuhl ist jetzt bald fertig. Ich kann etwa 46 cm breit weben. Eine Weberin von Baronin Bock hat mir einen Zettel geschenkt, welcher einem Weber beim Bäumen verwickelte. Es sind im Ganzen 160 m. Jetzt muss ich ins Bett, denn ich muss morgen zur Zeit auf.
Viele Grüsse von Martin
20. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
Ascona, den 15. März 1925
Lieber Vater!
Ich habe mir jetzt eine Hobelbank gekauft. Sie gefällt mir gut, und ich kann gut darauf arbeiten. Ich habe sie bei einem Tessiner gekauft, bei dem sie auf dem Estrich stand und nie gebraucht wurde. Mein Webstuhl ist dann bald fertig, wenigstens der schwierigste Teil, nämlich die Lade ist gemacht. …
Viele Grüsse von
Martin
21. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
Kirchdorf, den 27. Juni 1926
Lieber Vater!
… Es tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe, ich kann aber nichts dafür, dass hier in der Zeitung stand, du seiest in Amerika. Ich bin jetzt in der 7. Klasse seit dem Frühling, jetzt gibt es dann schon bald Zeugnisse. Ich nehme jetzt auch Lateinisch. Meine Klasse ist mir aber ein Jahr voraus [im Latein], jetzt muss ich das nacharbeiten, aber es ist nicht so schlimm, ich habe schon die Hälfte nachgeholt. Meine Lehrer finden überhaupt, dass ich ein Talent für Sprachen habe und sie leicht erlerne. …
Das Wetter ist jetzt so prachtvoll, dass ich noch etwas hinaus will.
Viele Grüsse schickt dir dein Martin
22. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
[Montavon, Juli 1926]
Lieber Vater!
Wir sind auf unserer Schulreise, es ist in Montavon[20] , wo wir auf Stroh übernachten. 21.30 Uhr. Wir machen Musik und saufen Limonade. Martin
23. Hermann Hesse an Martin [in Oberdiessbach[21] ], Typoskript mit Aquarell
[Montagnola, Sommer 1926]
Mein lieber Martin
Soeben bekomme ich durch Mutti die Nachricht von deiner Erkrankung und Operation. Lieber Brüdi, da wünsche ich dir recht herzlich, dass du rasch und gut damit fertig wirst und wieder heim kannst. Ich denke heut den ganzen Tag an dich, und an unser letztes Zusammensein dort droben im Wald und bei der Kapelle von Breganzona[22] , dort habe ich dich zuletzt gesehen, wie du durch die Weinberge zur Bahn hinunter gestiegen bist.
Mit dem Blinddarm haben wir es scheints alle zu tun. Ich hatte jahrelang früher immer Geschichten mit dem Blinddarm und lag oft krank daran, dann wurde ich einmal auf einer Reise in Deutschland, noch ehe du auf der Welt warst, plötzlich wieder krank und wurde in einem Spital in Frankfurt operiert. Und einige Jahre später, in Bern, kam der Heiner an die Reihe, der damals noch ein kleiner Bub war, und musste auch operiert werden. Ich weiss den Morgen noch gut, an dem ich mit ihm und Mutti in Bern ins Spital gefahren bin.
Und jetzt bist du auch an die Reihe gekommen, und hoffentlich geht es auch bei dir gut und schnell vorbei. Die ersten Tage nach der Operation sind ja meistens sehr widerlich, wenigstens ging es mir so, ich musste tagelang immer erbrechen und hatte Schmerzen, aber nachher ist dann die Sache für immer vorbei, und man weiss, dass einem das nicht mehr passieren kann.
Mutti will dich besuchen, wahrscheinlich war sie schon bei dir. Grüsse sie, falls sie noch da ist! Und Grüsse auch die Fräulein Ringier von mir!
Herzlich denkt an dich und wünscht dir gute Genesung dein Vater
H. Hesse
24. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
[Kirchdorf, Sonntag, Sommer 1926]
Lieber Vater!
Ich danke dir vielmal für den Brief, welchen du mir ins Spital geschickt hast. Ich bin jetzt wieder zu Hause, und es geht mir sehr gut. Letzten Mittwoch machten wir den Ausflug ins Justistal[23] , als ich abends heimkam, bekam ich heftige Bauchschmerzen. Ich wurde sofort nach Oberdiessbach geführt und bald operiert, der Blinddarm war ganz entzündet, und im Bauch war eine braune Flüssigkeit. Der Doktor sagte, wenn wir bis am Morgen gewartet hätten, wäre die Sache dann schief heraus gekommen, d. h., der Blinddarm wäre aufgebrochen, und dann hätte ich noch lang damit zu tun gehabt.
Die ersten Tage waren dann etwas langweilig, besonders da ich nichts zu essen bekam. Jetzt werde ich dann bald wieder zur Schule gehen.
… Ich bin froh, habe ich den Blinddarm draussen. Jetzt kann ich Zwetschgen essen und Wasser drauf trinken so viel, wie ich will.
Viele Grüsse von mir, Tante Alice und Lehrerin sendet dir
Martin
25. Martin an seinen Vater in [Zürich], Handschrift
Kirchdorf, den 7. Dezember 1926
Lieber Vater!
… Ich gehe jeden Sonntag Fischen, wenn es nichts anderes zu tun gibt. Ich habe aber in letzter Zeit das Pech, fast nur Forellen, welche jetzt in der Schonzeit sind, zu fangen. Jetzt will ich dann das Hechtlen [Hechte-Fischen] probieren. Ich finde, dass das der interessanteste Fisch ist zum Fangen. Ein Hecht wehrt sich nämlich tapfer, wenn man ihn einmal an der Angel hat …
Ich danke dir noch vielmals für das Geld, das du mir neulich geschickt hast und den Brief. Ich bin jetzt so reich, dass ich mir im Frühling ein neues Velo leisten will.
Viele Grüsse schickt dir
dein Martin
26. Martin an seinen Vater in [Zürich], Handschrift
Kirchdorf, 4. Jan. 27
Lieber Vater!
… Ich danke dir vielmals für den Schiller, den du mir hierher geschickt hast. Er hat mir grosse Freude bereitet, ich hätte schon lange gern den »Wallenstein« von ihm gelesen. Auch für »Weihnachten im Tessin« danke ich dir vielmal. Im Tessin war sehr schönes Wetter, in unserem Garten blühten schon die Veilchen vereinzelt. Am letzten Tag waren wir noch auf der Roncoalp, dort droben ist noch ein Hirte mit Ziegen und Hühnern. …
Da ich noch bis Montag, den 10. Januar, Ferien habe, bleibe ich halt im Haus und lese. Ich werde mir jetzt dann auch ein Velo kaufen, da ich jetzt genug Geld habe.
Viele Grüsse sendet dir Tante Alice und Lehrerin
dein Martin
27. Brief von Hermann Hesse an Martin in Kirchdorf, Typoskript
Zürich, Schanzengraben 31, 18. Januar 1927
Lieber Martin
… Heute muss ich zu einer Vorlesung nach Zug fahren. Hier ist alles grippekrank. Gestern habe ich ein Chor-Konzert gehört, da fehlten im Chor wegen Grippe nicht weniger als 120 Leute! Meine Zürcher Freunde liegen auch alle krank.
Heiner war am Ende seiner Ferien zwei Tage hier. Wir müssen für ihn jetzt einen Beruf finden. Er hätte Lust gehabt, auf ein deutsches Schiff zu gehen und den Seedienst zu lernen; wir haben uns auch erkundigt, aber es scheint damit nichts zu sein, der Andrang ist gross, und sie nehmen auf den Schulschiffen nur ganz junge Leute.
Solltest Du für irgendeinen Beruf eine besondere Vorliebe haben, so sage es mir bitte bei Zeiten, ich würde mich darüber freuen.
Dem Bruno geht es gut in Genf, obwohl die Schule recht streng und zum Teil auch langweilig ist.
Lass Dirs gut gehen, Brüdi, und sei herzlich gegrüsst von Deinem Vater
H. H.
28. Martin an seinen Vater in Montagnola, Handschrift
Kirchdorf, den 14. März 27
Lieber Vater!