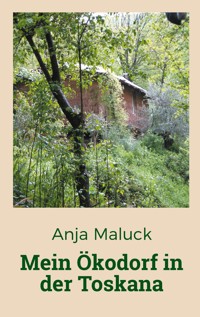
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Sojaspaghetti und Tofu-Lasagne? Weit gefehlt! Mit Leichtigkeit und Humor erzählt die deutsche Autorin ihren Ausstieg aus einem ganz normalen Leben als Übersetzerin, und den Einstieg in ein Gemeinschaftsprojekt in den Wäldern der nördlichen Toskana. Die Jahre des Verzichts auf jeglichen Komfort (aber nicht auf gutes Essen), das tiefe Eintauchen in eine fast unberührte Natur und der Zusammenprall von typisch deutschem Öko- und Organisationseifer mit italienischer Lebenskunst: All das bildet den Rahmen für die spannende und persönliche Erzählung eines großen Traums, mit den glücklichen und schwierigen Zeiten, die zu seiner Erfüllung führen. Ein Buch, das nicht nur Spaß sondern auch Mut macht, neue Schritte zu wagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Enzo
Inhaltsverzeichnis
Kolumbien
Solaria
Colleverde
Verein „Basilico“
Konkrete Schritte
Es geht los
Sommercamp
Quellwasser
Der Sommer klingt aus
Winter grau in grau
Endlich Frühling
Tiefgreifende Veränderungen
Jetzt erst recht
Strohballenhaus
Noch mehr Baupläne
Etwas bewegt sich
Frischer Wind
Neue Mitglieder
Das „Nr. 18“
Abschied
Alles fließt
Der Weg ist das Ziel
Kollumbien
«Und jetzt: Baden!»
Nackt wie ein junger, braungebrannter Gott sprang Miguel in das klare Wasser des tiefen Flussbeckens. Federica und ich tauschten begeisterte Blicke, zogen uns aus und sprangen hinterher, Tommaso wand sich am Ufer ein wenig und gab dann vor, jetzt nicht gleich baden zu wollen. Wir waren drei freiwillige Helfer aus Italien und hatten gerade unseren ersten Besichtigungsrundgang im Ökodorf Riserva Sasardì im Nordwesten Kolumbiens hinter uns. Wie alle Kolumbianer, die wir seit unserer Ankunft in Medellín getroffen hatten, hatte es uns Miguel mit seinem warmen Blick und strahlendem Lachen leichtgemacht, auf angenehmste Weise anzukommen.
Gott, war ich froh, dass ich auf diese Reise nicht verzichtet hatte! Ende der 1990er Jahre war Kolumbien noch ein gefährliches Reiseziel, und meine Eltern, sonst in Bezug auf Reisen wirklich an vieles gewöhnt, hatten mich inständig gebeten, auf diesen Trip zu verzichten. Aber das war mir gar nicht möglich gewesen; es war, als ob jemand anderes für mich entschieden hätte. Ich musste diese abgelegene Ecke mitten im kolumbianischen Urwald einfach erreichen!
Wir hatten eine tagelange Busfahrt ab Medellín hinter uns, waren mehrfach durch Militärpolizei kontrolliert worden, fuhren stundenlang mit dem Motorboot an der Nordwestküste entlang und kletterten schließlich zu Fuß in einem Flussbett bergauf – all das, um eine glasklare Nachricht zu erhalten, so klar, als hätte sie mir eine gute Freundin direkt ins Ohr geflüstert: «Das ist es, so will ich leben!»
Zu dieser Zeit lebte ich in der Nähe von Pisa, mitten in einer toskanischen Traumlandschaft, in einem alten Haus mit Cottoboden und Holzbalkendecke. Eigentlich hatte ich bereits das erreicht, was ich mir als junge Frau für mein Leben vorstellte und von dem viele Deutsche oft träumen: Ich lebte im Süden, arbeitete als selbständige Übersetzerin und Dolmetscherin, hatte viele gute Freunde – allerdings war ich seit ein paar Jahren wieder Single. Nicht gerade ideal für eine Frau Ende Dreißig mit Kinderwunsch, aber auch nicht wirklich schlimm, es würde schon noch klappen.
In dieser Zeit, in der ich mich viel mit mir selbst beschäftigte, geriet ich in eine Schnupperstunde „Biodanza, System Rolando Toro“ und entdeckte damit eine neue Leidenschaft: Eine Methode des Tanzes, der Bewegung und der Begegnung mit Anderen, die es erleichtert, Emotionen fließen zu lassen und ungestillte Bedürfnisse aufzuspüren. Auch jene, die im Laufe der Jahre aus unterschiedlichsten Gründen tief in innere Schubladen verbannt worden waren. In den folgenden Monaten, in denen ich regelmäßig den Biodanza-Kurs besuchte, spürte ich, dass es da so vieles gab, das mir wichtig war, dass gelebt werden wollte und das gar nicht so richtig zu dem Weg passte, den ich seit einiger Zeit eingeschlagen hatte. Ich tanzte und tanzte, war glücklich und traurig dabei, und gleichzeitig immer unzufriedener mit meinem Alltag und den Kompromissen, die ich seit meiner eher rebellischen Jugend eingegangen war. Ich wurde gierig, immer gieriger nach Neuem und eigentlich Altem, nach Intensität und Sinn, nach Etwas, auf das mein Innerstes antworten würde: Ja, das bin ich, das ist mein Platz in der Welt!
Ein fast vergessener Plan aus meiner Studentenzeit kam mir plötzlich wieder in den Sinn: als freiwillige Helferin eines Sozialprojekts nach Südamerika reisen, möglichst nach Nicaragua. Wenige Wochen später besuchte ich das Infowochenende einer italienischen Non-Governmental-Or-ganization über Einsätze in Südamerika, und kaum sah ich die Fotos des Ökodorfs in Kolumbien, hatte ich die Gewissheit: Da wollte ich hin! Im Sommer 2000 war es endlich so weit. Ich war auf dem Weg nach Kolumbien.
In einer Gemeinschaft leben – das hatte mich nie interessiert. Und jetzt befand ich mich plötzlich inmitten einer Gruppe junger Menschen aus kolumbianischen Großstädten, die in dieser abgelegenen Ecke ihre Utopie einer friedlichen Gesellschaft verwirklichen wollten, im Einklang mit der Natur und mit den hier ansässigen Ureinwohnern. Hier hörte ich zum ersten Mal den Begriff „Permakultur“. Hier erfuhr ich von der Existenz des „Global Ecovillage Network“, das weltweite Netz von Ökodörfern, mit Mitgliedern auch in Italien. Hier wurden wir von Jorge böse angeschaut, weil wir beim Basteln von Traumfängern ganz verschwenderisch mit dem aus der Stadt mitgebrachten kostbaren Faden umgingen, denn es gab keinen Shop um die Ecke.
Inmitten der vielen neuen Eindrücke war das Leben in der Riserva unbeschreiblich! Die unzähligen Bäder im Flussbecken nach dem schweren und körperlich überaus anstrengenden Roden des Bodens, nur um eine kleine Anbaufläche erhalten zu können; das Wohnen in Stelzenhäusern, umgeben von einer üppigen Flora und Fauna, in der Legionen von Insekten versuchten, sich in den Schlafsack zu drängen; gemeinsam nachts mit allen anderen auf einer Holzterrasse liegen und die grollenden, fiependen, schnurrenden, krächzenden, fauchenden Tierlaute zu hören … Tiefer als alles andere jedoch berührte mich in diesen vier Wochen Jorges in den Urwald hineinklingendes abendliches Flötenspiel, das von anderen Flötenspielern beantwortet wurde, von Nachbarn, deren Häuser selbst tagsüber inmitten des dichten Dschungels unsichtbar blieben. Ein musikalischer Dialog, fast eine sinnliche Erfahrung, dessen unendliche Harmonie die Utopie von einer ganz anderen Ebene erweckte, auf der wir Menschen miteinander kommunizieren könnten.
In meinem Überschwang hatte ich zwei Hektar Regenwald für die kolumbianische Riserva gekauft. Der Verkauf von Land an Freunde und Unterstützer der Riserva diente dazu, die Umgebung vor Übergriffen internationaler Konzerne zu schützen. Die Gruppe hatte mir versichert, ich könnte dort ein kleines Stelzenhaus bauen für die Zeit, die ich in Zukunft dort verbringen würde. Ich stellte mir vor, ein paar Wochen oder Monate im Jahr in Kolumbien zu sein, doch ich muss gestehen, dass ich in den inzwischen mehr als zwanzig vergangenen Jahren nie dorthin zurückgekehrt bin. Das Leben, das nach diesem Aufenthalt auf mich zukam, erforderte so viel Einsatz, dass an Reisen für lange Zeit gar nicht mehr zu denken war. Noch heute bin ich aber froh, mit dem Kauf des Landes etwas für ein Projekt getan zu haben, das maßgeblich zu einer grundsätzlichen Veränderung meines Lebens beitrug.
Solaria
Kaum hatten meine Füße wieder italienischen Boden berührt, setzte ich mich hochmotiviert in Bewegung. Das Ziel: eine Gemeinschaft gründen, ganz tief in der Natur. Oder mich einem bereits bestehenden Projekt anschließen, falls es so etwas in Italien bereits geben sollte.
Im Web gab es noch nicht viele Informationen. Ich blätterte zunächst in den wenigen italienischen Zeitschriften, die sich mit Ökologie und alternativem Lebensstil befassten. Eines Tages entdeckte ich folgende Annonce: Italienischer Verein für Umweltarbeit organisiert Kurse für Italiener im Energie- und Umweltzentrum in Springe bei Hannover. Das hatte zwar nicht viel mit meinen Absichten zu tun, konnte aber eine interessante berufliche Perspektive werden. Ich schickte eine Mail, um meine Dienste als Dolmetscherin anzubieten, und kaum fünf Minuten später klingelte das Telefon:
«Hallo, ich bin Paolo vom Verein P.A.E.A. Habe gerade deine Mail gelesen; wir suchen ganz dringend nach einer Dolmetscherin.»
«Ja super, das bin ich!»
Wenige Tage später kam Paolo mit seiner Freundin für ein informelles Vorstellungsgespräch nach Pisa. Wir unterhielten uns sehr angeregt und ich erzählte von meinen eigentlichen Zukunftsplänen. Paolo und Elisa sahen sich ungläubig an:
«Wie bitte, du möchtest in einem Ökodorf leben? Ja also, wir hätten da eins, und wir suchen jemanden, der Deutsch und Englisch spricht und sich um die Kontakte mit dem Ausland kümmert».
Manchmal geschehen solche Dinge im Leben, alles fügt sich fast wie von allein und ich hatte das erhebende Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.
Das besagte Projekt mit dem sinnigen Namen „Solaria“ befand sich viele hundert Kilometer von Pisa entfernt, in der nordwestlichsten Ecke Italiens, bei Ventimiglia in Ligurien. Nicht weit vom Meer! Ich zögerte nicht lange, vermietete meine Wohnung und packte die unglückliche Katze ins Auto. Meinen Job als Übersetzerin konnte ich zum Glück übers Internet weiter ausüben, damals eine revolutionäre Neuigkeit, auch wenn ich dafür jedes Mal ein Internet-Café aufsuchen musste.
Solaria hatte das ehrgeizige Ziel, eine Art Modellzentrum für Bioarchitektur und erneuerbare Energien zu werden, Themen, mit denen sich in Italien zu dieser Zeit kaum jemand beschäftigte. Es sollte ein Ökodorf für eine Gemeinschaft entstehen, die sich vom Eigenanbau ernährt und energetisch unabhängig ist, ein Ort, an dem „best practice“ direkt umgesetzt und für Besucher und Kursteilnehmer sichtbar und fühlbar gemacht werden soll.
Paolo hatte gute Kontakte nach Deutschland und von dort kam auch sehr viel „Entwicklungshilfe“. Die wenigen Bewohner waren allesamt Italiener, ich wurde sehr herzlich empfangen, und Simona und Ferdinando erkundigten sich:
«Was kannst du denn sonst noch außer Sprachen?» «Tja
… nicht so viel.»
«Vielleicht kochen?»
«Ja, ein bisschen kochen und backen kann ich schon, aber für so viele Leute? Das trau‘ ich mir nicht zu».
«Im Gemüsegarten arbeiten?»
«Nö, sorry.»
Ich konnte so gar nichts, nicht mal Holz in einem Ofen anzünden. Das war anfangs sehr frustrierend. Neben dem Erledigen der Korrespondenz und den Telefonaten mit Deutschland und der Welt habe ich also geputzt, viel geputzt, und Geschirr gespült. Aber in dem Jahr, das ich in Solaria verbrachte – in einem Mehrbettzimmer mit Etagenbetten, und im Sommer im Wohnwagen –, habe ich natürlich ganz viel gelernt: Brot backen, Feuer machen, im Gemüsegarten arbeiten und vieles mehr. Nur das Kochen … das ist auch heute noch nicht so mein Ding, außerdem schmeckt's bei Italienern ja sowieso immer besser.
Solaria war ein wirklich interessantes Projekt, aber ich hatte „Heimweh“ nach der Toskana. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte ich wieder, was dieses Wort bedeutet. Ich war bei Frankfurt am Main aufgewachsen und als ich dreizehn war, zog meine Familie nach Bayern. Anschließend wechselten meine Eltern noch mehrmals den Wohnort und ich hatte nirgendwo so richtig Wurzeln schlagen können. Erst in der „Valle Graziosa“ in der Nähe von Pisa fühlte ich mich wieder zu Hause. Heimweh nach Deutschland kannte ich nicht mehr.
Jetzt aber sehnte ich mich nach der sanften toskanischen Landschaft, ihrer typischen Vegetation, den Gerüchen, den Humor der Toskaner, nach meinen Freunden. Und nach Biodanza! In Ligurien gab es damals noch keine regelmäßigen Gruppen und ich war nicht bereit, auf diesen wichtigen Teil meines Lebens zu verzichten. Außerdem schien das Projekt Solaria etwas zu wackeln. Ich bekam eine erste Ahnung davon, dass auch der beste Wille und die größte Sympathie oft nicht ausreichen, um Konflikte in der Gemeinschaft zu verhindern, sondern dass viel Arbeit an sich selbst, an der Gruppe und an ihren Zielen nötig ist.
Inmitten dieser Zweifel und Überlegungen organisierten wir in Solaria einen Kurs: „Agricultura Sinergica“ mit Emilia Hazelip. Diese eklektische und faszinierende Spanierin, eine Art Mutter Erde, hatte eine Methode der Landwirtschaft entwickelt, bei der vollständig auf Dünger verzichtet wird und der Boden seine natürliche Fruchtbarkeit bewahrt, indem bestimmte Pflanzen miteinander kombiniert werden. Dazu kommen noch andere Techniken, beispielsweise ein sehr gründliches Mulchen und der Verzicht auf das Umgraben.
Beim Vorstellungskreis am ersten Kurstag wusste ich noch nicht, dass ich mit zwei der Menschen, die da neben mir auf dem Boden saßen, viele Jahre zusammenleben würde. Sonia und Lorenzo kamen aus Florenz. Evviva! So stellten sie sich vor:
«Wir sind hier, weil wir gemeinsam mit ein paar Freunden in der nördlichen Toskana ein verlassenes Landhaus in einer noch verlasseneren Gegend gekauft haben. Unser Traum ist eine Gemeinschaft, die diesen Ort wieder zum Leben erweckt. Eine Gemeinschaft, die es sich zum Ziel setzt, ihre Umwelt nicht zu schädigen, sondern zu bereichern und in einem fairen Austausch mit ihr zu leben».
Wow! Das klang wirklich sehr spannend. Und gleich anschließend der nächste Teilnehmer, Roberto:
«Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit Selbstversorgung, in jeder Hinsicht, und ich kenne Emilia schon lange. Meine Kinder sind fast erwachsen und ich möchte nun endlich den Sprung in die Utopie der Gemeinschaft wagen. Viele meiner Freunde haben ein ähnliches Ziel und seit ein paar Monaten haben wir uns zusammengetan, um gemeinsam zu planen. Wenn ihr den Ort habt, habe ich die Leute dafür.»
Unter diesen Voraussetzungen wurden die folgenden Tage natürlich unvergesslich, auch weil Emilia genau die Richtige war, um uns zu vermitteln, welch grundlegende Bedeutung die Gesundheit des Bodens für die Umwelt hat und was es für uns Menschen wirklich bedeutet, zurückzugeben, was wir täglich von der Natur erhalten. Sonia, Lorenzo, Roberto und ich saßen stundenlang zusammen, um uns kennenzulernen und erste Pläne zu schmieden.
Sonia und Lorenzo waren ein eher ungewöhnliches Paar: Sie eine schöne und elegante Frau mit schlohweißem Haar, von nobler sizilianischer Abstammung; Lorenzo, zehn Jahre jünger und ein echtes florentinisches Urgestein, war zutiefst stolz auf seine Herkunft aus einem Arbeiterviertel in Florenz und bezeichnete sich selbst als einen der letzten echten Ureinwohner dieser Stadt. Beide hatten pubertierende Kinder aus früheren Ehen und pflegten ihren gemeinsamen Traum vom Ökodorf in einer Wohnung in der Altstadt von Florenz, wo Sonia als freie Schriftstellerin und Lorenzo als Elektriker arbeitete.
Roberto aus Neapel wäre in den 1970er Jahren als „Aussteiger“ bezeichnet worden. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er längere Zeit in Indien gelebt und später mit ihren drei Kindern in Italien und Spanien, immer auf dem Land, auch an sehr abgelegenen Orten. Er konnte so ziemlich alles, was gebraucht wird, um in der Natur zu überleben, und wie alle Neapolitaner liebte er es, Witze und Geschichten zu erzählen, Pizza zu backen und Espresso zu kochen. Seine größte Leidenschaft aber war der Gemüsegarten, der „Orto“, und er war es schon lange gewohnt, seine Familie mit selbst gezogenem Gemüse zu versorgen.
Der Abschied nach einer Woche fiel nicht allzu schwer, denn einige von uns würden sich sehr bald in der Toskana wiedersehen.
Colleveerdee
Ungefähr zwei Monate später, im November 2002, kletterte ein kleines Grüppchen mitten im Wald einen steilen und von scharfen Felsen durchzogenen Weg hinauf, der entfernt an eine ehemalige Straße erinnerte. Sonia und Lorenzo hatten Roberto und mich in die Provinz von Prato in der Toskana eingeladen, um ihr Projekt, das Dörfchen Colleverde zu besichtigen.
Der Ort war am besten zu Fuß zu erreichen. Gleich anfangs galt es, einen Flusslauf zu überqueren, das Wasser war zum Glück nicht hoch, denn niemand von uns wäre bei diesen kühlen Temperaturen gern barfuß durchgewatet. Anschließend ging es fast eine Stunde bergauf. Wie herrlich, der Fluss, der Anstieg und die dichte wilde Vegetation, ich fühlte mich ein bisschen wie in Kolumbien, auch wenn die kalte Morgensonne das Laub in feurigen Herbstfarben schimmern ließ. Nerina und Dorina, Sonias Mischlingshunde, rannten glücklich voraus.
Plötzlich öffnete sich der Wald und gab den Blick auf die Überreste eines ehemaligen „Borgo“ frei, also ein Weiler, der hier aus drei Gebäuden bestand. Auf den ersten Blick waren allerdings nur zwei verfallene Häuser zu erkennen, eines davon noch mit Teilen des Dachs; das dritte war vollkommen unter dichtem Dornengestrüpp versteckt. Zwischen den Trümmern breitete sich ein großer Platz aus, die „Aia“, also die ehemalige Tenne, mit einer atemberaubenden Aussicht auf die umliegende Landschaft mit Hügeln und Wald und sonst nichts. Keine Häuser, keine Anzeichen von Zivilisation.
Was soll ich sagen … Colleverde war für mich Liebe auf den ersten Blick! Und ich lernte in den Jahren darauf zahlreiche Menschen kennen, die viel Zeit mit der Suche nach dem Ort ihrer Träume verbracht haben, daher empfinde ich es auch heute noch als großes Glück, dass meine Intuition und meine Emotionen mich damals nicht im Stich gelassen haben.
«Der Borgo wurde erst in den achtziger Jahren endgültig verlassen», erzählte Sonia.
«Unglaublich!», staunten wir, «Nur zwanzig Jahre und solch eine Verwüstung!»
«Wahrscheinlich wurden die Häuser schon zuvor nur schlecht instandgehalten. Nach einer Hippiekommune in den Siebzigern haben sich Schäfer aus Sardinien und Kalabrien hier angesiedelt. Es gibt eine Menge Legenden über Bandenkriege und Entführungen, die sich in dieser Gegend abgespielt haben sollen. Erst vor wenigen Jahren wurde der Industrielle Soffiantini von seinen sardischen Entführern hier in den Bergen versteckt. Seit längerer Zeit wirkt die Gegend eher abschreckend, daher konnten wir Colleverde auch so günstig kaufen».
Aha! Wir befanden uns also an einem der Schauplätze, an denen sich ein im Ausland wenig bekanntes Einwandererdrama abgespielt hat. Seit den 1960er Jahren hatten tausende Schäfer aus Sardinien mit ihren Familien ihre Insel verlassen, um auf dem Festland eine Möglichkeit zum Überleben zu finden. Ein Großteil von ihnen schaffte es, mit dem eigenen schweren Beruf den hervorragenden Ruf des italienischen Schafskäses aufrechtzuerhalten; andere fanden Arbeit in den Fabriken. Ein Bruchteil spezialisierte sich auf Entführungen, mit dem alleinigen Zweck, Geld zu erpressen, was in den Medien allergrößte Aufmerksamkeit fand. Auf diese Weise erwarben sich alle sardischen Schäfer den Ruf von Banditen, während ihre Kollegen aus Kalabrien unweigerlich mit der Mafiaorganisation „Ndrangheta“ in Zusammenhang gebracht wurden – ein weit verbreitetes Migrationsschicksal.
Jetzt lieferte uns Lorenzo mit seinem herrlich florentinischen Akzent eine äußerst anschauliche Beschreibung der Nachbarn von Colleverde. Eine Schäferfamilie aus Kalabrien bewohne den „Torre di Mezzana“, von hier aus gar nicht sichtbar, aber nur einen halben Kilometer entfernt. Das Anwesen bestehe aus einem mächtigen rechteckigen Gebäude, die Bezeichnung „Torre“, Turm, beziehe sich wahrscheinlich auf die erhöhte Lage, schmucklos und schlicht. Es würde auf einem kleinen, von Schafen kahlgefressenen Hügel thronen und von seiner riesigen Terrasse aus böte sich ein fantastischer Rundumblick auf den Apennin der Toskana und der Emilia Romagna.
Laut Lorenzo war mit dem alten Schäfer und Vater von neun Söhnen nicht gut Kirschen essen, und selbst die Carabinieri ließen sich nur ungern hier blicken. Außerdem sei die ganze nähere Umgebung von seinen Schafherden und freilaufenden Schweinen abgefressen, zertreten und zerwühlt, durchaus tierfreundlich, aber leider zerstörerisch für Pflanzen und Bäume.
Nun wollten wir aber erst mal Colleverde erforschen. Gemeinsam mit Freunden hatten Sonia und Lorenzo den Besitz bei einer Versteigerung der Region Toskana gekauft. Zum Weiler gehörte leider nur ein einziger Hektar Land und dabei handelte es sich um steile, dicht bewachsene Abhänge, durchzogen von Trampelpfaden, die wahrscheinlich von Jägern genutzt wurden. Die Gebäude bestanden aus breiten massiven Natursteinmauern, im Erdgeschoss des Hauptgebäudes befanden sich Ställe mit noch gut erhaltenen Steintränken, im ersten Stock ließen sich eine Küche mit großem Holzofen und gemauertem Spülbecken sowie mehrere weitläufige Räume ausmachen, in denen die Böden zum Teil noch erhalten waren. Über eine bröckelige Treppe ging es in einen zweiten Stock, der sich aber nur auf Balken balancierend besichtigen ließ. Bellissimo!
Gegenüber, auf der anderen Seite der Aia, befand sich ein sehr kleines und völlig verfallenes Gebäude, von dem nur noch die viereckigen Grundmauern übriggeblieben waren, das künftige „Numero Uno“, denn es würde das erste renovierte Haus des Ökodorfes sein.
Mittlerweile war es Mittag geworden, die Sonne erwärmte die Steine auf der Aia, und wir breiteten unsere mitgebrachten Köstlichkeiten für ein Picknick aus: Brot, Pecorino, Finocchiona – die toskanische Fenchelwurst – und natürlich Vino Rosso. Ich war aber auch ohne Wein wie berauscht von der Vorstellung, in der Zukunft womöglich an einem so wilden Ort zu leben und mit Freunden ein derart ehrgeiziges Projekt zu teilen. Denn dass Colleverde eine besondere Herausforderung darstellen würde, das war mir selbst in diesem eher romantischen und träumerischen Augenblick völlig klar.
Am Nachmittag streiften wir die Pfade rauf und runter und kämpften uns durchs Dickicht, bis wir den Bach gefunden hatten, der in der Nähe rauschte. Wir stießen auf Olivenbäume, Kirsch- und Nussbäume und Weinranken inmitten der Eichen, Ahornbäume, Eschen, Weißdorn und Schlehen. Bis Anfang der 1960er Jahre war diese Gegend ständig bewohnt und bewirtschaftet gewesen. Von Colleverde gibt es erste Notizen aus dem 15. Jahrhundert, die ersten Gebäude waren wohl Schweineställe, denn dank der vielen Eichen haben Schweine hier immer eine große Rolle gespielt. Ab dem 19. Jahrhundert wurden hauptsächlich Oliven, Wein und Getreide angebaut, außerdem gab es eine ausgedehnte Tierzucht, vor allem Schafe und Ziegen, aber auch Kühe und natürlich die besagten Rüsseltiere. Für den Gemüseanbau war dieser Boden nie besonders geeignet gewesen, wie wir noch schmerzlich erfahren sollten.





























