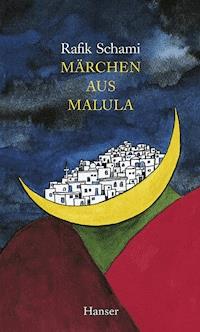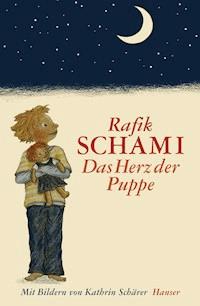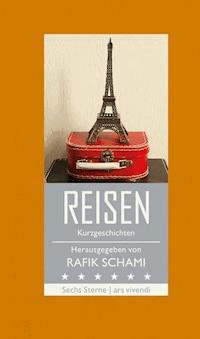Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KGHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Erzählen ist seine Leidenschaft – seine Kunst, dem Alltag ein Quäntchen Zauber hinzuzufügen.« (ZDF aspekte) – Neue Geschichten von Rafik Schami
Ob die Geschichten in Heidelberg, München oder Damaskus spielen, ob es um Geheimnisse, Reisen oder missglückte Geburtstage geht, überall wartet eine Überraschung: Da ist der Liebhaber, der zum Messer greift, als er die Geliebte in den Armen ihres Ehemannes sieht; eine Kreuzfahrt, bei der alle Männer ihr Geschlechtsteil verlieren; ein Klassentreffen mit Verstorbenen. In seinem unverwechselbaren Ton erzählt Rafik Schami von selbst Erlebtem und Gehörtem, von deutschen Lebenslügen und Emigranten, die vor Sehnsucht nach der Heimat den Verstand verlieren. Auch im tiefsten Ernst verlässt ihn nie der Humor, denn das Lachen ist, wie Schami schreibt, „der beste Schmuggler für Gedanken“.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ob die Geschichten in Heidelberg, München oder Damaskus spielen, ob es um Geheimnisse, Reisen oder missglückte Geburtstage geht, überall wartet eine Überraschung: Da ist der Liebhaber, der zum Messer greift, als er die Geliebte in den Armen ihres Ehemannes sieht; eine Kreuzfahrt, bei der alle Männer ihr Geschlechtsteil verlieren; ein Klassentreffen mit Verstorbenen. In seinem unverwechselbaren Ton erzählt Rafik Schami von selbst Erlebtem und Gehörtem, von deutschen Lebenslügen und Emigranten, die vor Sehnsucht nach der Heimat den Verstand verlieren. Auch im tiefsten Ernst verlässt ihn nie der Humor, denn das Lachen ist, wie Schami schreibt, »der beste Schmuggler für Gedanken«.
Rafik Schami
Mein Sternzeichen ist der Regenbogen
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Ein Film ohne Leinwand
Geburtstag
Mein Sternzeichen ist der Regenbogen
Salmas Plan
Geburtstag mit Nebenwirkungen
Die zwei Gesichter einer Medaille
Lachen
Oskar, der kleine Prophet
Die Entkopplung
Der Teufel war es nicht
Der kluge Teppichknüpfer
Galgenhumor
Ein Schmuggler namens Lachen
Reisen
Wie Herr Moritz die Welt bereiste
Zwei Reisen
Die fliegenden Händler der Insel
Reisen, was sonst!
Geheimnis
Emines geheimer Wunsch
Die alte Frau und der eigenwillige Geist
Geheimsprache
Kurt hat nichts zu verbergen
Die Geheimnisse einer Leiche
Geheimnisse im Wandel der Zeiten
Tiere
Die Augensprache der Hunde
Einsamkeit
Von Menschen und anderen Tieren
Sehnsucht
Ein Klassentreffen
Die merkwürdige Sehnsucht des Herrn Hamid
Das Ende einer Sehnsucht
Die letzte Burg
Nachbemerkung für Neugierige
Literaturnachweis
Für Root Leeb, Franz Hohler, Monika Helfer,
Michael Köhlmeier und Nataša Dragnić
für ihre anregende Reisebegleitung und viele Sternstunden.
Ein Film ohne Leinwand
Themen wie Geburt, Lachen, Sehnsucht, Tiere, Reisen oder Geheimnis durchziehen den größten Teil der Weltliteratur, und immer geht es dabei auch um Liebe. Der Geburtstag hat in Syrien eine andere Bedeutung als hierzulande, Geheimnisse um Liebe wie um Verbrechen spielen in der arabischen und in der westlichen Literatur eine zentrale Rolle, von der Sehnsucht können nicht nur die Romantiker, sondern auch alle Menschen im Exil ein Lied singen, und das Reisen beschäftigt die Literatur im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Auch die Reise durch diese Themen war für mich — erzählend und reflektierend — ein Erlebnis, ähnlich dem, einen Film anzuschauen, allerdings einen Film ohne Leinwand.
Dass die Geschichten, bei aller Tragik, oft zum Lachen animieren, hängt damit zusammen, dass ich das Lachen für den besten Schmuggler von Gedanken halte.
Rafik Schami
Sommer 2021
Geburtstag
Mein Sternzeichen ist der Regenbogen
Von der Schwierigkeit, ein Geburtsdatum herauszufinden
Es war Antoinette, meine erste Freundin, die mir zum ersten Mal die Frage stellte: »Wann bist du geboren?«
Ich war vierzehn Jahre alt, Antoinette sechzehn — und für mich eine einzige Verführung. Sie war mir mindestens ein Jahrzehnt voraus, aber wir liebten uns leidenschaftlich. Natürlich heimlich. Ihr Bruder Gibran, ein Arabisch sprechender Gorilla, hätte sonst aus mir einen um Gnade bettelnden Knetgummi gemacht. Ich versicherte ihr immer wieder, dass ich nicht nur bereit war, mich von ihrem Bruder walken, sondern auch kreuzigen zu lassen. Das hat ihr sehr imponiert.
In unserer christlichen Gasse war der freie Umgang zwischen Mädchen und Jungen erlaubt, aber sexuelle Regungen waren verboten, und erotische Gedanken wurden in eisernen Käfigen gefangen gehalten. Trotzdem war beides an der Tagesordnung. Man riskierte entweder die Befriedigung seiner Leidenschaften an einem verborgenen Ort, oder man vereinsamte mit seinen Wünschen und Fantasien. Mit Antoinette, der ich mich bereits mit zehn anvertraute, hatte ich Glück. Sie brachte mir alles bei, was sie bei ihren Eltern abgeguckt hatte. Oft führte ich nur wie benommen aus, was sie mir zeigte, aber ihr Geruch regte mich ungeheuer an, mehr als alle Schönheiten der Filmindustrie. Diesen Geruch gab es nur einmal auf der Welt, und er gehörte zu Antoinette. Eine Mischung aus Pistazien, Jasmin und frischem, knusprigem Brot. Unbeschreiblich.
Unsere Eltern waren nicht nur Nachbarn, sondern auch eng befreundet, und so erregte es keinen Verdacht, wenn ich bei Antoinette oder sie bei mir auftauchte. Und Verstecke gab es in beiden Häusern genug.
Ihr Bruder Gibran traute mir nicht zu, diese aufblühende Schönheit auch nur wahrzunehmen. »Ihr seid wie Geschwister, nicht wahr?«, fragte er bei jeder zweiten Begegnung und klopfte mir so fest auf den Rücken, dass meine Lungen am liebsten den Brustkorb verlassen hätten.
»Ja, klar«, hustete ich ängstlich und widerwillig.
Zurück aber zu Antoinettes Frage. Ich wusste schon, wie alt ich war, aber niemand, weder ich noch irgendjemand in meiner Familie oder im Freundeskreis, wusste von sich selbst, wann genau er oder sie geboren war. Der Geburtstag spielte in meiner Stadt Damaskus damals keine Rolle. Antoinette dagegen kannte zu den Geburtstagen ihrer Familienangehörigen auch noch die Sternzeichen, wie sie mir eines Tages erzählte.
Ich besaß keinen Ausweis, also eilte ich an jenem Tag nach Hause und schaute in das Familienbuch, das meine Eltern im Schrank aufbewahrten. Dort stand: 23.6.1946.
»Das hätte ich mir denken können«, sagte Antoinette bedeutungsvoll, »du bist typisch Krebs, und doch hast du einige andere Eigenschaften, die mit deinem Sternzeichen nicht harmonieren.«
Davon verstand sie etwas, die schöne Antoinette. Sie war die Tochter der besten Schneiderin im christlichen Viertel. Frauen aus allen Schichten trafen sich dort, und Antoinette hörte mehr Dramen, als das Nationaltheater aufführen konnte. Sie erfuhr durch die Kundinnen sehr viel über das Leben und seine Tücken. Bei ihrer Mutter lagen auch alle Mode-, Klatsch- und Familienzeitschriften aus. Antoinette studierte sie Woche für Woche und konnte besser als das Radio stundenlang von den Skandalen und Liebesaffären erzählen, doch fasziniert haben sie vor allem die Sternzeichen. Ich hatte keine blasse Ahnung davon.
Krebse mochte ich nicht. Nichts an diesen Tieren war mir sympathisch, und noch dazu hieß die Krankheit, die man bis dahin jene Krankheit genannt hatte, nun Krebs.
»Was heißt ›typisch Krebs‹?«, fragte ich also.
»Harte Schale, weicher Kern, gefühlvoll, aber schüchtern. Du hast etwas Kindliches. Fühlst du dich bedroht, so ziehst du dich zurück. Nicht von ungefähr geht der konfliktscheue Krebs seitlich, so wie du, wenn mein Bruder Gibran vor dir auftaucht. Aber wenn es darauf ankommt, ist der Krebs sehr wehrhaft. Du bist bereit, dich meinetwegen kreuzigen zu lassen. Und wenn man deine Hilfe braucht, bist du ein großartiger Beschützer. Deshalb mag ich dich sehr. Dein Planet ist der Mond, und so wie er wechselt, verändert sich deine Laune dauernd, und immer von jetzt auf gleich. Manchmal bist du so gesellig und trotzdem ausgeglichen, als wolltest du die Welt umarmen, um dich kurz darauf nervös in dein Kämmerlein zurückzuziehen. Du machst dir Sorgen um die Welt und bist immer skeptisch, und an jeder Sache siehst du zuerst den Haken. Aber inzwischen stört mich das nicht mehr. Du bist dafür ein wunderbarer Zuhörer, und treuer als du ist niemand in unserem Viertel, auch deshalb mag ich dich. Du bist auch eifersüchtig, obwohl du bei mir keinen Grund dazu hast. Aber dafür kannst du nichts. Das ist typisch Krebs!«
Ich atmete insgeheim auf, weil das Positive überwog, doch nach einer kurzen Pause sagte Antoinette: »Was mich aber irritiert, sind andere Eigenschaften von dir, die nicht zum Krebs passen: deine Herrschsucht und dein Hass gegen Verräter sind typisch für einen Skorpion, deine scharfe Zunge und deine Sturheit hat sonst nur ein Widder, dein Charme und deine Großzügigkeit, aber auch dein plötzlicher Mut sind typisch Löwe, deine Exzentrik ist typisch für einen Wassermann. Wer läuft in Damaskus außer dir in schwarzen Kleidern herum? Meine Mutter findet dich geschmacklos, aber mutig. Sie hat recht. Deine Arroganz und dein Sarkasmus sind typisch Schütze. Mein Sternzeichen ist die Jungfrau, und wir hätten super zueinandergepasst, wenn du ein normaler Krebs wärst, aber irgendetwas stimmt mit deinem Sternzeichen nicht.«
Sie küsste mich und eilte nach Hause. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Was war falsch mit meinem Sternzeichen oder meinem Geburtstag?
Am nächsten Tag fragte ich meine Mutter, ob mein eingetragenes Geburtsdatum wirklich stimmte.
»Ach woher!«, sagte sie und lachte. »Du bist Mitte März geboren, da standen die Aprikosen in voller Blüte. Das weiß ich, als wäre es gestern gewesen. An dem Tag nämlich besuchte mich meine Freundin Warde. Sie wollte sich bei mir über ihr bitteres Schicksal mit ihrem Mann ausweinen, der sie dauernd betrog, und da kamst du zur Welt, und sie vergaß ihren Kummer und half der Hebamme Sofia. Und dabei erzählte sie der weisen Frau flüsternd von der Untreue ihres Mannes, und diese gab ihr eine geheime Rezeptur, die jeden Mann gefügig macht, und von dem Augenblick an war ihr Mann nicht nur treu, sondern auch so brav, dass Warde manchmal Mitleid mit ihm hatte. Dennoch sagte sie bis zu ihrem Tod im letzten Jahr immer wieder, dass mit deiner Geburt das Glück zu ihr zurückgekehrt sei. Erinnerst du dich daran, wie gerne sie dich geküsst und innig gedrückt hat?«
Ich erinnerte mich nur an die feuchten Lippen der Frau und dass sie mich immer fast erdrückt hatte. »Also ist mein Sternzeichen Fische. Aber warum steht im Familienbuch dann das Datum 23.6.1946?«
»Das ist eine lange Geschichte, und dein Vater kann sie besser erzählen, weil er daran beteiligt war. Ich könnte mich totlachen, wenn ich daran denke, wie dieses Datum zustande kam.« Und sie fing zu lachen an.
Ich weiß es noch wie heute. Ich ging zu meinem Vater. Er spielte im Café Backgammon. Ich wartete still bis zum Ende des letzten Spiels. Er hatte gewonnen und strahlte vor Glück. »Bevor du gekommen bist, hatte ich schlechte Würfe, aber dann …« Er stockte, weil ich ihn bis dahin noch nie im Café aufgesucht hatte. »Ist was passiert?«, fragte er.
»Nichts Besonderes, aber ich will wissen, wann ich geboren wurde und wie das offizielle Datum zustande kam. Mutter sagt, das sei lustig gewesen.«
»Im Rückblick erscheint so manches lustig. Aber wie dem auch sei, du bist Mitte April geboren. Die Aprikosen waren bereits reif. Es waren schwere Zeiten. Eine Woche lang hatte es immer wieder Schießereien zwischen den syrischen Nationalisten und den französischen Truppen gegeben. Zwei Tage nach deiner Geburt, am 15. April 1946, sollte Syrien unabhängig werden, aber die französischen Kolonialisten wollten Damaskus nicht verlassen. Erneut kam es zu Kämpfen. Ich stand an jenem Tag in meiner Bäckerei und hörte besorgt die Schüsse, als unser Nachbar Musa angerannt kam, um mir die gute Botschaft zu überbringen. Er teilte mir mit, dass du gesund zur Welt gekommen warst und dass auch deine Mutter wohlauf war. Allerdings war sein Gesicht leichenblass, und er fuhr fort und erzählte, dass ein Muslim ihn gepackt und ihm ins Gesicht geschrien habe: ›Wir werden euch Ungläubige verbrennen, sobald die französischen Kreuzzügler das Land verlassen haben.‹
Musas Frau hatte das wenige, das sie besaßen, in zwei Koffer gepackt und wartete nun auf ihn. Sie wollten in ihr Dorf in den Bergen zurück, wo sie sich sicher fühlten.
Die Franzosen trieben damals als erfahrene Kolonialisten Keile zwischen die Religionsgemeinschaften. Sie privilegierten die Minderheiten, die Drusen, Aleviten, Juden und Christen, indem sie ihnen ein paar mehr Brösel von ihrem Tisch gönnten, um so das Rückgrat der sunnitischen Mehrheit zu brechen. Meine Eltern waren urchristliche Aramäer und hatten weder unter osmanischer noch unter französischer Besatzung Vorteile. Meine Vorfahren waren mehr oder weniger erfolgreiche Handwerker, Händler, Bauern, ja sogar Räuber gewesen, aber niemals hatte einer von ihnen in den letzten siebenhundert Jahren ein Amt innegehabt.
Ich war entsetzt. Warum sollten wir für die Politik der Franzosen büßen? Hatten sie mir jemals etwas geschenkt? Nein, im Gegenteil. Ich hatte eine Schlägerei mit einem Soldaten gehabt, der betrunken eine Frau belästigte. Ich kannte die Frau nicht, aber das Verhalten des Mannes war Barbarei und eine Demütigung. Also trat ich ihm in den Schritt. Augenblicklich ließ er von der Frau ab, um mich zu packen, da fuhr meine Faust an seine linke Schläfe, und er lag auf dem Boden. Ich verschwand schneller als der Wind.
Aber zurück zu jenen Tagen im April 1946. Ich wollte nicht fliehen, doch mehrere meiner Kunden drängten mich zur Flucht. Ich selbst nahm mir vor zu bleiben, aber dich, deine Mutter und deine zwei Brüder wollte ich unbedingt in Sicherheit bringen. Ich fuhr euch mit meinem kleinen Fiat nach Malula, zur Großmutter mütterlicherseits, denn deine Mutter und meine Mutter lebten in einem Dauerkrieg.
So brachte ich euch also in Sicherheit und kehrte noch in derselben Nacht nach Damaskus zurück. Das war meine Stadt gewesen, bevor die Franzosen und Osmanen und sogar die Araber einmarschiert waren. Meine Ururgroßväter, die Aramäer, hatten hier eine große Zivilisation aufgebaut. Ich musste mir nicht von irgendwelchen primitiven Halunken vorhalten lassen, dass ich ein Fremder sei. Aber die Zeit nach dem Abzug der Franzosen verlief friedlich, und die neue Regierung war eine vernünftige demokratische Regierung. Mitte September habe ich euch dann in die Stadt zurückgeholt. Das weiß ich, wie wenn es gestern gewesen wäre. Deine Großmutter hat, als ich ankam, gerade die Trauben geerntet. Also wart ihr insgesamt von Mitte April bis Mitte September in Malula.
Es war nun meine Pflicht, dich registrieren zu lassen. Ich nahm das Familienbuch und fuhr mit dem Bus zum Einwohnermeldeamt. Und wer sitzt neben mir? Azar, der Fischhändler. Kennst du ihn noch?«
Ich kannte ihn nicht.
»Und der erzählte mir, dass er eine saftige Strafe bezahlen musste, weil er seine drei Kinder nicht rechtzeitig hatte registrieren lassen. Ich trat also — Gott sei Dank — gut vorbereitet vor den Beamten. Er war ein kleiner stämmiger Mann mit finsterem Blick und einem Mundgeruch, der Fliegen und Mücken auf dreißig Zentimeter Entfernung killen konnte.«
Ich lachte bei der Vorstellung. »Lach nicht«, mahnte mich mein Vater, »die Viecher lagen in einem Kreis vor ihm, wie mit dem Zirkel gezogen. Er fragte mich, wann du geboren wurdest. Eine Wolke umgab mich, und ich hätte mich beinahe erbrochen. Es stank nach Verwesung, Käsefüßen und Schweiß. Ich weiß nicht, warum die Leute so viele Millionen für die Atombombe ausgeben! Drei solcher Männer, und der Feind ergibt sich.
›Vor kurzem‹, antwortete ich schlau.
›Was heißt vor kurzem?! Vor einem Tag, einem Monat oder einem Jahr? Uffff‹, fragte der Beamte routiniert. Sein langgezogenes Uffff aber war alles andere als von der Stange.
›Vor ein paar Tagen‹, antwortete ich und zitterte, weil ich gehört hatte, dass manch ein Beamter das Baby zu sehen verlangte. Ich hatte darüber mit meinem Freund Ali gesprochen, dem Schlosser, der uns die Metalltür in der Bäckerei in Ordnung brachte, doch dieser einfältige Bursche hatte mich beruhigt. Ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen, er könne mir Babys jeglichen Alters zum Vorführen zur Verfügung stellen. Pro Baby bekämen die Mütter eine Lira als Leihgebühr. Aber das ist eine andere Geschichte. Wo war ich stehen geblieben?«
»Du hast dem Beamten gesagt, dass ich vor kurzem …«
»Ja richtig. ›Das sagen doch alle‹, brummte der und blies mir dabei wieder sein Giftgas so heftig ins Gesicht, dass ich Zahnschmerzen bekam. Er nahm das Familienbuch in die Hand, in dem ein Zehn-Lira-Schein lag. Geschickt nestelte er das Geld heraus und ließ es in die halb offene Schublade segeln. Der Schein landete, als würde er sich bei dem Beamten auskennen, ganz elegant an seinem Platz. Der Mann lächelte und trug dein Geburtsdatum ein. Aber warum ausgerechnet der 23. Juni?«, kam mein Vater der Frage zuvor, die mir schon auf der Zunge lag. »Es war Willkür, wie alles, was unsere Beamten tun. Ich wollte den Grund nicht wissen. Ich suchte das Weite, um dem höllischen Gestank zu entkommen.«
In diesem Datum steckte somit unsere Misere. Nicht nur, dass man sogar mit Geburtsdaten Handel trieb, sondern auch die Angst, die Lüge und die Willkür.
Nach der Darstellung meines Vaters war ich also im Sternzeichen Widder geboren.
»Bist du sicher, dass ich Mitte April zur Welt kam?«
»So sicher, wie ich bin, dass du mein Sohn bist. Du kannst deine Großmutter fragen. Sie hat so ein gutes Gedächtnis, dass sich die Kamele schämen.«
Meine Großmutter Tekla war damals gerade zu Besuch bei ihrer Lieblingstochter, meiner Tante Hanan. Sie wohnte nicht weit von uns. Immer wenn Großmutter nach Damaskus kam, besuchte sie erst Tante Hanan, beschenkte sie reichlich mit Nüssen, trockenen Feigen und all den Leckereien aus dem Dorf, und kam dann, nach ein paar Tagen, mit leeren Händen zu uns oder zu Onkel Josef, dem Bruder meiner Mutter.
Eines Tages kam sie zu uns zum Mittagessen. Ich setzte mich neben sie. Es gab ganz besonders gutes Essen. Meine Mutter war schon immer eine exzellente Köchin gewesen, aber ich hatte das Gefühl, sie habe sich an jenem Tag selbst übertroffen, um vor der eigenen Mutter ein wenig anzugeben.
Ich nutzte die Gelegenheit und fragte Großmutter, ob sie sich erinnere, an welchem Tag ich geboren wurde.
»Und ob!«, rief sie. »Du bist am 15. September geboren worden, einen Tag nach dem Kreuzfest in Malula.«
Vaters Hand erstarrte auf dem Weg zu seinem Mund.
»Aber Mutter, was erzählst du da?«, fuhr meine Mutter die Großmutter an und nahm sich zu den grünen Bohnen mit Lammfleisch, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten einen großen Löffel Reis. »Immer wenn man dich nach irgendeinem Geburtsdatum fragt, nennst du den 15. September. Das war so bei Daniel, dem erstgeborenen Sohn unserer Nachbarin, meiner Freundin Warde, der zu Ostern geboren wurde, und sogar bei meiner Tochter Leila, die drei Tage nach Weihnachten zur Welt kam, hast du behauptet, sie sei am 15. September geboren.«
Ohne dass die Großmutter es merkte, machte meine Schwester Leila mir ein Zeichen, dass die alte Dame im Dachstübchen beschädigt sei: Sie verdrehte die Augen, ließ die Zunge aus einem Mundwinkel hängen und sah überzeugend idiotisch aus.
»Das ist so«, fuhr die Großmutter ihre Tochter hochnäsig an. »Was hast du gegen mein gutes Gedächtnis?«
»Nichts, Mutter, nichts, aber nicht alle später Geborenen müssen mit ihrem Geburtsdatum an den erstgeborenen Sohn deiner Lieblingstochter Hanan erinnern. Nur Milad, Mutter, nur Milad, dieser Nichtsnutz, wurde am 15. September geboren. Mein Sohn ist Mitte März geboren. Ich werde es ja wohl wissen. Und damit basta!«
Meine Mutter bebte vor Aufregung.
Mein Vater hatte sich, in weiser Voraussicht, mit dem Essen beeilt. Er starrte auf seinen Teller und wich meinem Blick aus.
»Ich weiß nicht, warum du so neidisch auf Hanan bist, aber das warst du seit ihrer Geburt.«
Meine Mutter reagierte nicht. Sie aß schweigend. Meine Großmutter rührte ihr Essen nicht an.
»Lassen wir die Geburtstage doch Geburtstage sein und essen wir, bitte«, forderte meine Mutter sie schließlich auf.
»Es schmeckt mir nicht«, log die Großmutter. Sie hatte noch nicht einmal den Löffel in die Hand genommen. Er lag glänzend neben der blanken Gabel.
Vater erhob sich. »Entschuldigt bitte meine Eile, heute müssen wir eine Hochzeitsfeier mit Brot beliefern, und zwei Arbeiter sind krank«, sagte er, nahm eine Banane vom großen Obstteller und eilte hinaus.
Als hätten Mutter und Tochter nur darauf gewartet, drehten sie jetzt erst richtig auf. Ein heilloser Streit brach aus, in dessen Verlauf alles auf den Tisch kam, was die beiden trennte.
Im Gegensatz zur braven Tante Hanan hatte meine Mutter den Mann geheiratet, den sie liebte, und nicht den, den ihre Eltern für sie ausgewählt hatten. Mein Vater stammte, anders als sie selbst, aus einer sehr reichen Familie. Seine Mutter würde meine Mutter bis zum Ende ihres Lebens hassen, weil diese hübsche, aber bettelarme Frau ihren erstgeborenen Sohn verführt hatte, der daraufhin die Cousine, der er versprochen war, vollkommen vergaß.
Statt stolz darauf zu sein, dass ihre Tochter einen jungen Mann aus einer angesehenen Familie heiratete, nahm ihre Mutter ihr das seltsamerweise übel. Als ob meine Mutter daran schuld wäre, dass mein Vater von seinen Eltern enterbt wurde, weil er statt dem Wunsch seiner Eltern der Neigung seines Herzens gefolgt war.
»Nein, das ist nicht der Grund«, sagte meine Mutter, wenn man sie auf diese seltsame Haltung ihrer Mutter ansprach. »Sie hat mir diesen mutigen, großzügigen und schönen Mann einfach nicht gegönnt. Hanan, ihr Liebling, hat einen langweiligen Beamten geheiratet, den ich nicht einmal als Lappen in der Küche gebrauchen könnte.«
Nach dem Streit mit meiner Mutter stand Großmutter empört auf und verließ unsere Wohnung, und es dauerte über drei Monate, bis die beiden sich wieder versöhnt hatten. Ich schwor mir, Großmutter nie wieder nach meinem Geburtstag zu fragen.
Aber was, wenn sie recht hatte?
Dann wäre mein Sternzeichen Jungfrau. Na gut. Mein Vater hatte jedoch erwähnt, dass Onkel Josef, der Bruder meiner Mutter, da war, als uns mein Vater zu Großmutter nach Malula gebracht hat. Also könnte ich auch ihn befragen.
Onkel Josef stand meiner Mutter sehr nahe. Zum Ärger meiner Großmutter blieb er sein Leben lang Junggeselle. Er besuchte meine Tante, seine Schwester Hanan, nur, wenn sie krank war, ansonsten konnte er sie nicht ertragen: »Sie ist mir zu betulich, und ihr Mann ist ein Trottel. Nach jedem Besuch brauche ich einen ganzen Tag, um meinen Kopf von seinem Müll zu reinigen. Und so viel Zeit habe ich nicht.«
Als ich ihm vom Streit zwischen Mutter und Großmutter erzählte, lachte er. »Deine Mutter hat recht. Hanan ist ihr absoluter Liebling. Wir haben beide darunter gelitten. Wir kamen uns vor, als wären wir die Haussklaven, und Hanan wäre eine Prinzessin. Dabei war sie immer hirnlos wie eine Gurke.«
Onkel Josef war bis in die Siebzigerjahre hinein ein bescheidener, aber zufriedener Bauer gewesen. Dann aber hatte er einen großen Fehler begangen, der ihn ruinierte. Er hatte nämlich auf die Regierung gehört und seine Obst- und Gemüsegärten in eine baumlose Tabakfarm verwandelt. Im ersten Jahr zerstörte ein Virus seine Ernte und die seiner Nachbarn, im zweiten Jahr, als er hoffte, seine Schulden begleichen zu können, sackte der Preis für Tabak durch das Überangebot plötzlich ab, und er musste seine Felder verkaufen, um die Schulden und die hohen Zinsen zu bezahlen. Er war gezwungen, nach Damaskus umzusiedeln, und wurde Pförtner bei einer staatlichen Fabrik, die Brot und süßes Gebäck produzierte. Er verdiente etwa 150 Lira im Monat und bestimmt doppelt so viel an Bestechungsgeldern dafür, dass er bei der Kontrolle an der Tür die kleinen Diebe mit ihrem Raubgut passieren ließ. Die großen Diebe dürfe er nicht kontrollieren, sagte er immer voller Sarkasmus.
»Und wann bin ich nun geboren?«, fragte ich ihn. »Wann hat uns Vater nach Malula gebracht? Meine Eltern waren sich einig, dass ich damals gerade eine Woche alt war.«
»Das war am Pfingstmontag, dem 10. Juni. Ich weiß es deshalb, weil wir an jenem Pfingstsonntag lange bei meinem Freund Ilija gefeiert hatten. Ich war fünfundzwanzig Jahre alt und total verliebt in seine Schwester Hanne, die leider kurz darauf mit nicht einmal zwanzig an Blutkrebs starb.
Meine Mutter weckte mich unsanft und befahl mir, den Koffer deiner Eltern heraufzutragen. Sie sollten ein Zimmer im ersten Stock unseres Hauses bekommen. Du warst, wie ich von deiner Mutter erfuhr, gerade eine Woche alt. Also bist du Anfang Juni geboren.«
Onkel Josef holte einen Karton herbei und kramte ein Schwarz-Weiß-Foto daraus hervor. Man sah meinen Vater, meine Mutter und auf ihrem Arm ein Baby vor dem Fiat 500, den mein Vater damals besaß. Die Hausmauer im Hintergrund ließ keine Rückschlüsse auf die Jahreszeit zu.
Auf der Rückseite stand nur »1946«.
»Ja, es steht da nicht genau.« Onkel Josef versuchte, meinen Zweifel zu vertreiben. »Aber man sieht es an den Kleidern, dass es warm war. Also bist du im Zeichen der Zwillinge geboren, und das passt zu deinem Charakter.«
Doch das konnte mich nicht überzeugen. Anhand der Kleider kann man den Monat nicht bestimmen. In Syrien ist es ab März und bis Oktober fast immer warm.
»Was für ein Charakter?«, fragte ich.
»Du bist kontaktfreudig, interessiert und vielseitig«, sagte Onkel Josef und zögerte ein wenig. »Aber«, fügte er dann hinzu, »du bist manchmal auch altklug, sprunghaft und vor allem wie deine Mutter, meine geliebte Schwester, aufsässig.«
Als ich nach Hause zurückkehrte, traf ich Antoinette auf der Gasse. »Bei welchem Sternzeichen bist du inzwischen?«, fragte sie, und ihre Stimme triefte vor Häme.
»Ich glaube, mein Sternzeichen ist der Regenbogen, von jedem Sternzeichen eine Farbe.«
»Das gibt es nur in deiner Fantasie«, sagte sie kalt. Sie hatte recht. Dieser Satz war mir gerade auf dem Weg eingefallen.
»Dann ist mein Sternzeichen der Pechvogel«, antwortete ich trotzig und ein wenig Mitleid heischend.
»Ein solches Sternzeichen gibt es nicht«, erwiderte sie pikiert. Und zum ersten Mal erzählte sie mir von dem Goldschmied Nabil. Er sei mit seiner Mutter zu ihnen zu Besuch gekommen. Seine Mutter sei, da sie großzügig bezahle, eine gern gesehene Kundin ihrer Mutter.
Ich hatte das Gefühl, als wollte sie mich beschwichtigen.
Eine Woche später sah ich Nabil, der diesmal allein kam, und bald stiegen die beiden in ein Taxi. Antoinette war geschminkt und übertrieben elegant angezogen. Mit ihren hochhackigen roten Schuhen wirkte sie fast zehn Jahre älter.
Am nächsten Tag beruhigte sie mich, Nabil habe auch ihre Mutter zum Essen in einem teuren Restaurant eingeladen, die sie aber nicht habe begleiten können, deshalb ging sie alleine mit ihm. Nabil sei sehr charmant und zurückhaltend, erzählte sie weiter. Und dann kam der Hammer: Sein Sternzeichen sei eindeutig Krebs.
»Was für ein Pechvogel bin ich!«, flüsterte ich in mein Kissen, bevor ich in jener Nacht nach langem Herumwälzen erschöpft einschlief.
Am nächsten Morgen schlenderte ich nach dem Frühstück zu dem kleinen Imbiss am Ende unserer Gasse. Dort konnte man für zehn Piaster Tee trinken und, war man hungrig, ein exzellentes Falafel-Sandwich für nur fünfundzwanzig Piaster genießen. Vor allem aber mochte ich Onkel Amin, den Betreiber, weil er ein weiser Mann war. Er war der Erste, der mir prophezeite, dass ich ein Erzähler werden würde. Ich solle so bald wie möglich abhauen und im Ausland mein Glück suchen. »Hier wirst du, wie ich, zehn Jahre im Knast sitzen, die Barbarei ertragen und am Ende Falafel verkaufen.«
Onkel Amin hatte in London Philosophie studiert und eine gute Stelle an der Uni angeboten bekommen, aber er wollte lieber zurückkehren und die Heimat aufbauen. Er hatte davon geträumt, Syrien würde eines Tages so demokratisch wie Großbritannien werden, und er wollte leidenschaftlich dazu beitragen. Am Anfang ging alles gut. Er hielt Vorlesungen über Hegel, Feuerbach, Marx, Kierkegaard und Sartre. Das war erlaubt, denn weder Marx noch Lenin noch Sartre hatten sich je mit der Herrschaft der Sippe in Syrien beschäftigt. Als Amin aber drei Jahre später in einem Lokal sagte, die Araber würden, solange die Sippe herrschte, nie etwas zur Zivilisation beitragen, verschwand er im Gefängnis.
Zehn bittere Jahre dauerte sein Martyrium an, zehn Jahre in einer Hölle, die dem Teufel die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Als er anfing durchzudrehen, warf man ihn am Rande der Wüste aus einem fahrenden Auto. Beduinen nahmen ihn aus Mitleid auf und pflegten ihn monatelang, bis er wieder sprechen konnte. »Ich will nach Damaskus«, waren seine ersten Worte. Die armen Beduinen gaben ihm Kleider und Proviant und brachten ihn zur Bushaltestelle in einer kleinen Stadt.
Als er in Damaskus ankam, waren seine Eltern gestorben. Seine Schwester nahm ihn liebevoll auf, und mit der Unterstützung des Schwagers konnte er diesen Imbiss eröffnen und davon leben. Es gab bei ihm nur Hummus, Falafel und Tee. Und alles war so gut, dass er die gesamte Nachbarschaft als Kundschaft gewann, unabhängig von jedwedem Mitleid.
Ich mochte ihn, weil er witzig und selbstironisch war, ganz anders als die eitlen Männer in unserem Viertel, die eine scharfe Zunge haben und immer nur gegen die anderen lästern. Aber am meisten schätzte ich ihn, weil er im Herzen jung geblieben war.
»Was haben wir für Kummer?«, fragte er, als er mein müdes Gesicht sah, und stellte mir ein dampfendes, exzellent duftendes Glas Tee hin.
»Ich bin ein Pechvogel. Alle Leute wissen, wann sie geboren sind, nur ich nicht. Das macht mich so wütend, verstehst du?« Meine Frage kam mir unpassend vor, denn ein sensibler Mensch wie Onkel Amin konnte so einiges verstehen.
»Nein, ich verstehe deinen Ärger nicht. Warum in aller Welt willst du deinen Geburtstag wissen? Sei doch vernünftig! Wenn man seinen Geburtstag kennt, wird man nur älter. Wenn wir aber das Datum nicht wissen, sind wir je nach Stimmung im einen Augenblick alt und im anderen jung. Schau mich an! Sehe ich wie ein Sechzigjähriger aus? Nein! Und warum? Weil ich heute Morgen einen Besuch bekommen habe, der mein Herz erfrischt hat und mir das Gefühl gab, ein Zwanzigjähriger zu sein. Du musst wissen, ich habe Maria schon als Jugendlicher begehrt. Als ich aber aus London zurückkam, war sie bereits glücklich verheiratet. Vor fünf Jahren starb ihr Mann. Ich versuchte, sie zu trösten, da ich sie immer noch begehrte, aber sie blieb verschlossen. Heute Morgen kam sie, um mir zu sagen, sie habe mich immer schon geliebt. Sie habe aber nicht auf meine Annäherungsversuche reagieren wollen, weil sie Angst hatte, dass ich noch einmal im Gefängnis landen würde und sie dann noch einmal bitter trauern müsste, so wie sie die letzten Jahre um ihren lieben Mann getrauert hat. Jetzt aber ist ihre Liebe so groß geworden, dass sie ihre Angst weggefegt hat.
Was sagst du dazu? Wäre ich sechzig, hätte ich kapituliert vor diesem Abenteuer und ihr womöglich gesagt, dass ich zu alt sei für eine leidenschaftliche Liebe. Aber nichts davon ist wahr. Ich fühle mich wie zwanzig, und heute Nacht wird Maria das spüren. O Gott, lass den Tag schneller vergehen, ich sterbe vor Sehnsucht nach ihr.
Geburtstag, Geburtstag! Wie leichtfertig zu glauben, dass unsere Geburt unser Leben beeinflusst. Wenn etwas uns und unser Leben bestimmt, so ist es der Tod und nicht die Geburt, mein Junge. Unsere Kultur ist überhaupt nur möglich geworden durch den Tod und die Beschäftigung mit ihm. Er, und nicht die Geburt, mahnt uns, so vollkommen zu sein wie er selbst. Kämpfe, mein Junge, dass dich jemand liebt, und lass nicht die Sterne entscheiden, ob du der Geeignete bist. Nur in den Herzen der Liebenden wird man unsterblich.
Der Geburtstag ist der erste Schritt zum Tod. Schade nur, dass wir Menschen die Weisheit des Lebens nicht erben. Den Tieren hingegen ist alles Notwendige für ihr Leben bereits von Geburt an eigen. Heute würde ich mit all dem, was ich gelernt habe, gerne noch einmal neu anfangen, aber das geht nicht. Vielleicht liegt die Weisheit darin, dass wir jeden Augenblick so intensiv leben sollten, als wäre er der letzte.
Vergiss die Sache mit dem Sternzeichen. Das hat mir in London überhaupt nicht gefallen. Die Briten wissen nicht nur den Tag, sondern die Stunde und Minute ihrer Geburt so genau, als wären sie am Bahnhof geboren. Sie wissen sogar ihr Geburtsgewicht aufs Gramm genau, als hätte ein Metzger sie gewogen.
Hör auf mich, mein Junge, wenn du Antoinette liebst, lass locker, du kannst sie lieben, ohne sie zu besitzen, so wie du die Schwalben, die kühle Brise im Sommer und den Duft der Jasminblüten liebst. Es fällt mir schwer, dir das zu sagen, da ja alle Welt weiß, wie sehr du sie liebst. Aber du kannst dich noch retten, wenn du lernst, sie zu lieben, ohne dass sie deshalb mit dir leben muss …«
Ich konnte seinen Ratschlag nicht befolgen. Ich trauerte umso mehr, je fester Antoinettes Beziehung zu diesem verfluchten echten Krebs Nabil wurde. Gerechterweise muss ich aber sagen, sie blieb sehr nett zu mir und versicherte mir unter Tränen, dass sie mich für immer ins Herz geschlossen habe. Aus Angst vor Armut würde sie jedoch den Goldschmied heiraten.
Mir kam ihre Rede vor wie ein Zitat aus einem kitschigen ägyptischen Film. Zu ihrer Hochzeit wollte ich meine Mutter nicht begleiten. Und bald danach verschwand sie aus meinem Gesichtsfeld.
Jahrelang hoffte ich, dass Antoinette erkennen würde, was für ein mieser Mann Nabil war, und dass sie irgendwann in unserer Gasse auftauchen und sich mit zerwühlten Haaren und einem blauen Auge weinend in meine Arme werfen würde. Das wiederum war nichts anderes als eine typische Kitschszene aus einem indischen Film. Antoinette lebte vergnügt mit ihrem Mann in Aleppo, und bald besaß sie dort auch als erste Frau den Führerschein. Sie schenkte ihrem Mann zwei süße Kinder und hielt, wenn sie nach Damaskus kam, freundlichen, aber distanzierten Kontakt zu mir. Mein innerer Neidhammel wuchs und wuchs, bis er Stiergröße erreicht hatte. Erst da merkte ich, dass Amin recht gehabt hatte. Der Neid schadete mir, dem Neider, mehr als Antoinette, der Beneideten.
Ich stand auf, machte mich schick und sah zu den Schwalben am blauen Himmel über Damaskus hinauf. »Ich wünsche dir alles Glück der Erde, Antoinette«, flüsterte ich. Mein Neidhammel brüllte vor Schmerz, aber bald darauf lag er tot vor mir.
»Du bist aber heute besonders gut gelaunt«, sagte der erfahrene Amin, als ich seinen Imbiss betrat.
»Ich habe meinen Neidhammel geschlachtet.«
Amin lachte. »Gut, dann bekommst du den Tee heute gratis, obwohl du mich nicht zum Grillfest eingeladen hast.«
Zwanzig Jahre später, an einem lauen Sommerabend in Heidelberg, meinte ein Bekannter, der das Datum meines Geburtstags von meiner damaligen Freundin erfahren hatte: »Bei dir ist es klar. Du bist typisch Krebs, keine Frage!« Er hatte sich seit Jahren mit Horoskopen beschäftigt.
Wir saßen in einer Bar in der Unteren Straße.
Ich lächelte ihn nur an, stand auf und ging.
Salmas Plan
oder Die unverhoffte Abrechnung
Salma war entschlossen: entweder jetzt oder nie! Das Geburtstagsfest, dachte sie, war der beste Augenblick, um den Tod ihrer Beziehung zu verkünden. Irgendwann reichte es. Habib war ein mieser Verräter. Die Affäre mit Viktoria ging nun schon seit drei Jahren. Zwanzig Jahre war Salma mittlerweile in der deutschen Fremde an seiner Seite, und dann das! Er ließ sich von ihrer Cousine Viktoria ködern. Eine dumme Pute, mit achtzehn hatte sie den dreißig Jahre älteren Fritz, einen Orientalisten, bei dessen Forschungsaufenthalt in Damaskus verführt, eine Schwangerschaft vorgetäuscht und ihn zur Ehe gezwungen. Damit gelangte sie nach Deutschland, wo sie dem Trottel so viele Hörner aufsetzte, dass er damit Handel treiben könnte. Und nun hatte sie Habib zwischen den Beinen, und er wurde ihr Sklave.
Am Anfang hatte er die Affäre verheimlicht, aber inzwischen war er so hemmungslos, dass er schon beim Frühstück von Viktorias Klugheit, ihrem Humor und ihrem Geschmack schwärmte. Wie dumm und wie rücksichtslos!
Zugegeben, dachte Salma, Viktoria ist fünfzehn Jahre jünger als ich. Bereits mit achtzehn hatte sie eine erotische Ausstrahlung wie eine Nachtlokaltänzerin gehabt, was eine normalsterbliche Ehefrau nie erreichte.
Warum aber diese primitive Reduzierung einer Frau auf ihre Rundungen, die von irgendwelchen männlichen Idioten zum Maßstab für Schönheit erhoben wurden? Viktoria hatte ihre schöne große arabische Nase gegen eine Hollywood-Stupsnase eingetauscht und die Brüste mit Silikon vollgepumpt. Was für Deppen sind die Männer, dass sie in Sand greifen und ihn für weibliche Schönheit halten!, dachte Salma.
Es sind die gleichen Männer, die muslimische Frauen mit so viel Stoff umwickeln, dass man nicht weiß, was für eine Frau dahinter verborgen ist und was sie denkt und fühlt …
Und es sind die gleichen Männer, die europäischen Frauen nahelegen, sie müssten sich so mit Schminke zukleistern oder gar operieren lassen, bis man ebenfalls nicht mehr weiß, wie diese Frau in Wirklichkeit aussieht, fühlt und denkt. Eine andere Form von Niqab.
Salma hatte in Damaskus Chemie studiert und als Lehrerin gearbeitet und fand kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland eine Stelle als Chemielaborantin, für die sie deutlich überqualifiziert war. Ihr Deutsch war gut, aber nicht gut genug, dass sie hätte unterrichten können.
Habib, ihr Mann, war Arzt, aber er hatte es all die Jahre nicht geschafft, sich selbstständig zu machen. Ihm fehlte jede Spur von Ehrgeiz. Seit zwanzig Jahren schob er eine ruhige Kugel als Stationsarzt und sprach so schlecht Deutsch wie nach dem Deutschkurs in seinem ersten Jahr in Mannheim. Er mogelte sich mit Sprüchen im Mannheimer Dialekt durch, damit gefiel er sich und den Patienten. Mit der Zeit merkte Salma, dass er insgesamt nur zehn Redewendungen auf Lager hatte, die er stets wiederholte. »Dem is was iwwers Newwele gekrawwelt« oder »Horsche mol, was isch da schun die gonz Zeit saage wollt«.
Er konnte keine Sprache wirklich gut, nicht einmal Arabisch, weil er schlecht zuhörte.
Und nun wollte er — wie die Deutschen — seinen sechzigsten Geburtstag feiern. Früher hatte man in Syrien nie Geburtstag gefeiert. Heute ahmt die junge Generation die Europäer nach. Die Kolonialherren sind vor einem halben Jahrhundert abgezogen, aber im Kopf sind wir nach wie vor kolonialisiert, dachte Salma.
Wie die Deutschen hatte Habib keine Hemmungen mehr, auch seine Geliebte samt Ehemann zum Fest einzuladen. Deshalb entschloss sich Salma, ihm seine Geschmacklosigkeit vor allen Leuten heimzuzahlen. Der Koffer mit ihren wichtigsten Sachen und Papieren stand bereits in der Pension, wo sie für mehrere Wochen ein Zimmer mit Bad angemietet hatte. Nach dem Fest wollte sie nicht mehr mit ihrem Mann nach Hause zurückkehren, sondern direkt in die Pension fahren und später in aller Ruhe eine Wohnung suchen und die Scheidung einreichen.
»Aber du bist sechzig«, mahnte ihre beste Freundin Claudia sie.
»Ja, und?«, erwiderte Salma. »Wenn ich sehe, wie ausgeglichen du ohne Ehemann lebst, dann gibt mir das Mut, und ich sage dir ganz ehrlich, auch mit siebzig würde ich in dieser Situation nicht aufgeben, sondern lieber neu anfangen.«
Salma konnte und wollte ihrer Freundin nicht beschreiben, wie tief die Wunde war, die Habib ihr mit seiner kaltschnäuzigen Untreue zugefügt hatte. Aber Claudia ihrerseits verriet nicht, wie tief die Verletzung war, die ihr Mann Klaus ihr durch seine Trennung und die Weigerung, darüber zu sprechen, geschlagen hatte. Es gibt Geschichten und Erlebnisse, die sich selbst unter Freundinnen weder verkürzt noch in voller Länge erzählen lassen.
*
Habib und Salma waren in Syrien einst jung und verliebt gewesen. Außerdem waren beide glücklich mit ihren Berufen, obwohl sie in Damaskus sehr wenig verdienten.
Habib allerdings benahm sich immer schon wie ein Berserker. Er hieb alles kurz und klein, was seinen Wünschen im Wege stand. Die Reparaturen überließ er dann Salma. Am Anfang hielt sie ihn für mutig, aber das war er nicht. Habib war einfach egoistisch. Er und nur er existierte auf dieser Welt. Nur sein Wille zählte … Salma glaubte nicht, dass man einen Egoisten auf Dauer lieben kann. Man kann ihm als Sklave dienen, man kann die Liebe zu ihm heucheln, man kann ihn verachten und betrügen, lieben aber kann man ihn nicht.
Heute war ihre Liebe nur noch eine Erinnerung an eine schöne Tote. Im Grunde war sie Stück für Stück erstorben wie ein von Wundbrand befallener Körper. Das erste Stück erstarb, als Salma ihrem Mann kein Kind schenken konnte. Das war noch in Syrien. Es hieß, es läge eindeutig an ihr. Habibs Cousin war Chefarzt der Frauenklinik in Damaskus. In Frankreich hatte er mehrere Preise für medizinische Neuerungen bekommen. Er selbst führte die Untersuchung durch. Die Diagnose würde Salma begleiten, solange sie lebte. Sie war der Beweis dafür, dass die Sippe bei den Arabern viel mächtiger ist als Wissenschaft, Vernunft und Gewissen. Das Ergebnis teilte Habibs Cousin Salma nur mündlich mit. Es war für sie ein Schlag ins Gesicht. Sie bot Habib die Trennung an, aber das wollte er nicht. Salma liebte ihn sehr für seine edle Haltung, doch von diesem Moment an sah sie den Vorwurf in seinen Augen. Dass er gerne sechs Kinder hätte wie sein Bruder, erwähnte er immer wieder. Seine Mutter nörgelte und jammerte. Gott sei Dank lebte sie in einem Dorf im Norden und kam nur einmal im Jahr nach Damaskus zu Besuch. Sobald sie da war, wurde Habib ihr Untertan und beklagte, dass ihn das Schicksal ereilt hatte, kinderlos zu leben. Salma fühlte in solchen Augenblicken eine bittere Einsamkeit: Er ließ sie im Stich und verschmolz mit seiner Mutter
Zusammen mit ihrem Mann wanderte Salma nach Deutschland aus, weil ein Freund eine gut bezahlte Stelle für Habib gefunden hatte. Salma wollte Damaskus nicht verlassen. Sie war sehr zufrieden damit, an einem Mädchengymnasium Chemie zu unterrichten. Salma liebte ihre Schülerinnen, und die erwiderten ihre Liebe mit Fleiß und Selbstdisziplin. Zehn von zweiundzwanzig Mädchen studierten später naturwissenschaftliche Fächer. Sie vermisste diese Zeit.
Habib hatte Salma vor die Alternative gestellt, entweder mit ihm auszuwandern oder der Scheidung zuzustimmen. Ihrer Freundin Claudia hat Salma erzählt: »Die Stelle in Deutschland war ihm wichtiger als meine Liebe. Das hat mich schockiert. Liebe macht Menschen oft mutig, mich machte sie feige. Habib meinte, er halte es in Damaskus nicht mehr aus. Warum? Das konnte er mir nie erklären. Auf einmal wurde meine geliebte Stadt Damaskus für ihn zu einem hässlichen Monster, das ihn aufzufressen drohte.«
So musste Salma ihre Freundinnen verlassen, ihre Schule, ihre Mutter und ihre Schwester Huda, die nach dem Tod des Vaters zur Mutter gezogen war, um ihr zu helfen. Huda machte ihr Vorwürfe, weil Salma sie mit der halb gelähmten Mutter alleinließ. Aber sie wollte Habib nicht verlieren. In einer dunklen Ecke ihres Herzens jedoch nahm sie es Habib übel, dass er ihr aus purem Egoismus das Leben schwer machte.
Und dann in Deutschland die Überraschung: Es stellte sich heraus, dass die Untersuchung in Damaskus gefälscht gewesen war. Nun hieß es, die Kinderlosigkeit liege mit absoluter Sicherheit an Habib. Seine Samenzellen seien nicht lebensfähig. Eine Mumpserkrankung in der Kindheit sei die Ursache! Vier ähnliche Diagnosen anderer Ärzte hatte Habib Salma verheimlicht. »Da wurde er in meinen Augen klein«, gestand sie ihrer Freundin Claudia. »Und ein Stück der Liebe bröckelte ab.« Erst jetzt verstand Salma, warum ihr der Cousin damals das Ergebnis nur mündlich gegeben hat. Eine schriftlich gehaltene Diagnose hätte ihn disqualifiziert. Sie schrieb einen bitterbösen Brief an den Cousin in Syrien. Als Habib einige Tage später nach Hause kam, war er außer sich vor Zorn. Sein Cousin habe ihn angerufen, Salma hätte ihn einen ehrlosen Verbrecher und einen primitiven Sklaven der Sippe genannt. Er ohrfeigte sie. Und ein weiteres Stück bröselte vom Obdach ihrer Liebe ab.
*
Salma wollte kein Fest feiern. »Du bist doch gar nicht sechzig«, sagte sie hilflos, als könnte sie mit dieser läppischen Feststellung den Plan ihres Mannes aufhalten. Habib war fast fünfundsechzig. Genau wusste er es nicht. Sein Vater hatte, wie viele Bauern damals, den Sohn erst mit fünf angemeldet, weil er sichergehen wollte, dass der Junge überlebte. Der Todesengel raubte das Leben vieler Kinder oft noch vor ihrem dritten Jahr. Die Gebühren und der Aufwand der Eintragung waren den Bauern lästig. Außerdem wollte der Vater auf diese Weise den Militärdienst seines Erstgeborenen so weit wie möglich hinausschieben. Die Bauern fühlten sich der verhassten Zentralmacht, die sie seit Jahrhunderten gedemütigt und ausgeraubt hatte, nicht verpflichtet. Dass viele Schüler damals offiziell vierzehn oder fünfzehn Jahre alt waren, als sie Abitur machten und bereits Schnurrbart trugen, wirkte einigermaßen lächerlich.
Nein, Habib wusste nicht einmal das Jahr, geschweige denn den genauen Tag, an dem er geboren war. Er bestand auf dem Fest, weil sein Chef und seine Kollegen ihn dazu drängten. Er wollte in einem Saal der Gemeinde feiern. Salma solle sich nicht anstellen, meinte er, ein syrischer Wirt würde das Catering übernehmen und zwanzig leckere syrische Spezialitäten servieren: Tabbuleh, Kebbeh, Safiha, gefüllte Weinblätter, Hummus, Mutabbal, Falafel usw.
An dem geplanten Termin war der Saal perfekt dekoriert. Die Tische für über zwanzig Personen hatte man hufeisenförmig angeordnet. Salma betrachtete das feierliche Arrangement mit einem Blick des Abschieds. Rosen schmückten die Tische. Rosen begleiten auch Särge, dachte sie.
In der Mitte des Tisches, der die beiden Seiten des Hufeisens verband, stand auf einer Tischkarte Habibs Name, links von ihm sah die Tischordnung Salma vor und rechts von ihm Viktoria.
»Hast du das so geplant?«
»Nein«, erwiderte er trocken und unterhielt sich weiter mit dem Koch über die Reihenfolge der Gänge sowie über die Getränke und die Musik. Im Geiste schritt Salma den Weg ab, den sie bei ihrem Abschied nehmen wollte, damit sie in der Aufregung des Augenblicks nicht verwirrt wäre und sich lächerlich machte. Sie würde aufstehen, ihm und seiner Geliebten Viktoria ihren Zorn an den Kopf knallen und den Saal durch die linke Tür verlassen. Ihr Auto hatte sie am Vormittag in der Nähe geparkt.
*
Ist es nicht merkwürdig, wie hässlich Menschen plötzlich erscheinen können? Die Männer, die zu Habibs Geburtstagsfest kamen, sahen aus wie heruntergekommene, schlecht verkleidete Gauner aus einem amerikanischen Billigkrimi, die Frauen waren übermäßig geschminkt und wirkten gekünstelt fröhlich, womit sie ganz gut zu den Männern passten. Nur Viktoria sah jung und schön aus. Fast majestätisch schritt sie an der Seite ihres mumienhaften Ehemannes Fritz in den Saal.
»Man kann es kaum glauben, dass Ihr Mann schon siebzig ist«, sagte Fritz, der alte Orientalist, scherzhaft zu Salma. Er selbst war über fünfundsiebzig.
»Er ist sechzig, aber vitaler, als Sie denken«, erwiderte diese bedeutungsvoll und fixierte Viktoria mit dem Blick der Wissenden. Sie können Ihre Frau fragen, hätte sie am liebsten hinzugefügt.