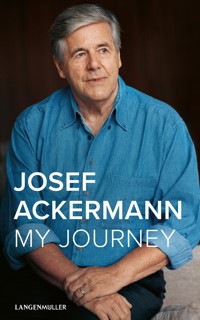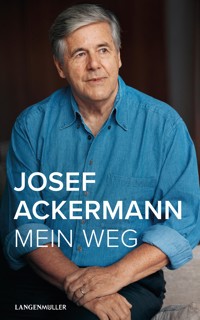
20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Josef Ackermann ist einer der international bekanntesten Topmanager. Berühmt und umstritten. Bankenboss, Krisenmanager, Reizfigur. Nach Studium und Militärzeit legte er eine rasante Karriere bei der SKA hin und wurde als erster Ausländer zum CEO der Deutschen Bank und an die Spitze des Weltbankenverbandes IIF berufen. Mit dem Ziel einer 25%igen Eigenkapitalrendite erregte Ackermann den Zorn von Politikern, Journalisten und Kirchenfürsten. Sein Victory-Zeichen während des Mannesmann-Prozesses sorgte für nationale Empörung. Ackermann ist aber weit mehr als das "kalte Gesicht des Kapitalismus". Er war Zeitzeuge der Terroranschläge 9/11, enger Berater von Bundeskanzlerin Merkel, in- und ausländischer Finanzminister und Politikern in den hochdramatischen Wochen der globalen Finanzkrise und trug entscheidend dazu bei, einen Kollaps des globalen Finanzsystems zu verhindern. Erstmals berichtet Ackermann, was hinter den Kulissen geschah und gewährt Einblicke in sein Privatleben, von den Kindheitstagen bis in die Welt der Hochfinanz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Für Pirkko, Catherine und Gregory
Every Man owes it as a debt to his profession to put on record whatever he has done that might be of use to others.
Francis Bacon (1561–1626)
Inhalt
Vorwort
Prolog
Ende einer Ikone
Kindheit und Jugend
Der Ratschlag
Schweizer Wurzeln
Glückliche Kindheit
Familienleben
Werte und Bodenhaftung
Schulzeit
Irreversibles vermeiden
Militärdienst und Studium
Armeezeit und Prägung
Gemeinsam im Feuer
HSG-Studium – Geld und Magie
Mentor und Promotion
Assistentenzeit – »Der Ritterschlag«
Jahre bei der Schweizerischen Kreditanstalt (SKA), 1977–1996
Berufseinstieg
SKA-Vorstandsassistenz
Traineezeit
Jazz und Kunst
Der kolportierte Irrtum
Das unsichtbare Netzwerk
Gestaltungswille
Privatsphäre
Präsident der SKA-Generaldirektion
Anti-Burn-out-Konzept
Der Bruch
Jahre bei der Deutschen Bank, 1996 – 2012, Finanz- und Schuldenkrise
Neuorientierung
Deutsche Bank – Der Einsteig
Kulturschock
Kommunikationsprobleme
Benjamin im Vorstand
Griff nach Bankers Trust
Der gescheiterte Coup
Terror, Tod und Verderben
Bilanz des Schreckens
Das Kirch-Drama
Mannesmann-Prozess – Der mediale GAU
The Big Job – CEO der Deutschen Bank
Führungsprinzipien und Leitlinien
Auf der Erfolgsspur
Renditeziel 25 Prozent – Gejagt, beschimpft und verdammt
Finanzkrise – Die Vorboten
Alarmzeichen
Das IKB-Desaster
Sachsen LB – Untergang einer Landesbank
Die Dominosteine fallen
Lehman Brothers – Kollaps einer Legende
Am Abgrund – Absturz der Hypo Real Estate (HRE)
Staatsgarantie für Sparer
Schande über mich
Eurokrise, Schuldenkrise, Rezession
Wachsende Schuldenberge
Risikomanagement
Bankster und Boni
Verzerrte Wahrnehmung
Buhmann der Nation – Die Rolle der Medien
Gute Geister im Backoffice
Bombenalarm
Abschied
Rückblick
Bilanz
Sprecher der globalen Finanzindustrie
Political Animal
Führungsrolle beim Weltbankenverband (IIF)
Zürich Versicherung und Bank of Cyprus
Zürich ruft
Tod des Finanzchefs
Im Land der Aphrodite
Anekdoten
Persönliche Begegnungen
WEF-Reminiszenzen
Ein Elefant im Zimmer
»Urban Age«-Projekt
Solar Impulse – Weltumrundung ohne einen Tropfen Sprit
Ursachen und Lehren aus der Finanzkrise
Credit Suisse – Der Untergang Ein Stimmungsbild
Ursachen von Finanzkrisen
Lehren aus den Finanzkrisen und Krisenprävention – Einige Gedanken
Lehren für die FINMA
Krisenprävention – Einige Vorschläge
Schlussbetrachtung
Die zehn Maximen eines guten Bankers
Nachwort
Medienverzeichnis
Literaturverzeichnis
Dr. Josef Ackermann
Bildteil
Vorwort
Die Welt wird unsicherer und fragiler. Seit Februar 2022 erleben wir durch die Invasion der Ukraine einen brutalen Angriffskrieg Russlands, der die europäische Friedensordnung bedroht. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz sprach zu Recht von einer Zeitenwende. Für viele war eine solche Entwicklung nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Kriegs undenkbar. Auch das Massaker der Terror-Miliz Hamas in Israel im Oktober 2023 und der harte Gegenschlag der israelischen Streitkräfte sowie andere regionale Konflikte haben einen Realitätsschock bewirkt. Der Politologe Francis Fukuyama schrieb zwar 1989 mit »Das Ende der Geschichte« einen Bestseller, doch dieses Ende ist vertagt beziehungsweise verjährt. Vielleicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.
Geschichte ist vergänglich. Und wir sind es auch. Vielleicht versuchen wir deshalb, auf den eigenen Spuren zu wandeln und Spurensuche zu betreiben.
Seit Jahren werde ich von Freunden und Bekannten dazu ermuntert, dieses Buch zu schreiben. Lange war das für mich kein Thema.
Weshalb habe ich mich umstimmen lassen? Ein Freund sagte mir einmal, dass eine Person, die jahrelang in der Öffentlichkeit stand, sich auch »öffentlich erinnern« dürfe. Wer oft genug im Rampenlicht der Medien unter dem Brennglas beäugt, gemustert, observiert, hart kritisiert oder gar beschimpft wurde, habe ein gutes Recht, sein Umfeld und sein kolportiertes Bild nachträglich manipulativen Kräften und Absichten zu entziehen. Und die Dinge so darzustellen, wie sie – frei nach Leopold von Ranke – eigentlich gewesen sind. Denn wenn selbst Jubiläumsbücher ohne Befragung der Zeitzeugen publiziert werden und vor Fehlern strotzen, empfindet man umso mehr das Verlangen, der Nachwelt die wahre Geschichte zu erzählen.
Dem will ich folgen, weil ich spüre, dass sich Geschichte und Geschichten verselbstständigen, vor allem dann, wenn man nicht mehr selbst dabei ist. Plötzlich tauchen Narrative auf, die nicht dem tatsächlichen Geschehen entsprechen. Mythen, Fantasien, Fabeln oder Legenden entstehen.
So ist bei mir ein starkes Bedürfnis entstanden, Erlebnisse und Fakten aus meiner persönlichen Sicht und Erinnerung zu schildern. Nebenbei erlaubt eine solche Zeitreise im Herbst meines Lebens einen Rückblick auf die herausragendsten Ereignisse und Begegnungen und eine persönliche Bilanz. Erfolge und Niederlagen, Hoffnungen und Enttäuschungen, Erfüllung und Freude wurden mir zuteil.
Dabei will ich mich gerne auch all jenen Kritikern stellen, die viele meiner Entscheidungen missbilligten, zerpflückten, verrissen oder verdammten. Im Übrigen habe ich bei vielen Kontroversen sehr viel mehr Unterstützung erfahren, als sich meine Gegner vorstellen können.
Um es direkt zu sagen: Dieses Buch ist keine Abrechnung! Es geht nicht darum, andere Personen zu schmähen, herabzusetzen, anzuschwärzen oder nachzutreten. Im Gegenteil, es ist vielmehr Anerkennung, Würdigung, Wertschätzung und Dank an all jene Menschen, die mich über die Jahre hinweg unterstützt, ermuntert und geachtet haben. In erster Linie sind dies meine Frau Pirkko und unsere Familie, der ich so viel zu verdanken habe und die mich mit unendlicher Geduld, Verständnis, Nachsicht und Zuwendung begleitet haben. Sie waren immer Ansprechpartner, Ratgeber, Vertraute und unverzichtbare Partner.
Auch vielen anderen Menschen möchte ich meine Bewunderung und großen Respekt zollen. Unvergessen sind meine Eltern und meine Freunde, ehemalige Mitarbeiter, Weggefährten und alle Helfer, die mir mit Inspiration, Kreativität, Fantasie, Ideenreichtum und Intuition zur Seite standen. Mein Dank gilt auch dem langjährigen ARD-Auslandskorrespondenten Hans-Jürgen Maurus sowie Sabine Sternagel vom Langen Müller Verlag für die intensive redaktionelle Mitarbeit, sie haben mein Projekt mit Engagement, Anregungen, Ideen und Widerspruch begleitet.
Menschen machen Fehler, ich ebenso. Aber manche können es nicht zugeben. Die folgenden Beobachtungen, Interpretationen, Einschätzungen und Schlussfolgerungen sind alle persönlicher Art. Sie sind subjektiv, fragmentarisch und daher unvollständig. Viele Ereignisse, Fakten, Entwicklungen oder Kontroversen sind kompakt, verkürzt und nur rudimentär dargestellt. Das liegt an der unglaublichen Menge des Materials. Die Kritiker werden das »Fehlende« herausgreifen. So sei es.
Heute wird vieles aus dem aktuellen Zeitgeist heraus interpretiert. Werte und Moral unterliegen einem Wandel. Begriffe und Worte »a posteriori« aus der heutigen Sicht und Normenwelt zu interpretieren und zu verdammen, ohne die vergangenen historischen Umstände oder Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, greift zu kurz. Ich habe Verständnis für Menschen, die sich in ihren Gefühlen verletzt sehen, doch individuelle Empfindlichkeiten zum Maßstab und zur Norm aller zu machen, ist gewagt und bedenklich. Für ein tieferes Verständnis von Entscheidungen oder Ereignissen in der Vergangenheit ist es sinnvoll, den Zeitgeist von damals als Erklärung für die Turbulenzen der jeweiligen Epoche heranzuziehen und zu verstehen.
Dieses Buch ist keine Geschichte der Deutschen Bank oder anderer Finanzinstitute, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Ich bitte auch um Verständnis, dass ich als Schweizer Banker einer Verschwiegenheitspflicht unterliege und nichts zu Bankkunden oder einzelnen Geschäftsbeziehungen ausplaudern oder ausposaunen möchte. Es geht vielmehr darum, die für mich wichtigsten Lebensabschnitte und Ereignisse zu beschreiben.
Dieses Buch ist auch an Menschen gerichtet, die im Alltag nicht dem hektischen Geschehen an den weltweiten Börsen, den Irrungen und Wirrungen der Finanzwelt folgen können oder das Fachchinesisch der Analysten kaum verstehen. Wenn es mir gelingt, eine Brücke zum gegenseitigen Verständnis, der Wahrnehmung und der Auslegung zu schlagen, wäre ich froh. Ich überlasse den Lesern das Urteil, ob dies gelungen ist oder nicht.
Mein Lebensweg war alles andere als monoton. Er war manchmal steinig, ab und zu mühsam und kräftezehrend, dann wieder inspirierend, reizvoll und großartig, stets faszinierend und intellektuell bereichernd – geprägt von einer dialektischen Auseinandersetzung zwischen Tradition und Innovation, zwischen Vertrautem und Fremdem. Oft hatte ich das Glück, am richtigen Ort zu sein und manchmal auch das Pech, nicht alle Fallstricke zu erkennen. Auf den Gipfeln meiner Wanderschaft entdeckte ich atemberaubende Aus- und Einblicke. Und Abgründe. Und manche menschliche Tragödie. Einzelne Pfade erwiesen sich als Sackgasse, Umwege waren erforderlich. Auch Abkürzungen gab es.
Es war eine weite Reise. Durch Gassen und Chausseen, Promenaden und Avenuen. Auch in die Zentren der Macht. Als Wanderer zwischen den Welten, diesseits und jenseits des Atlantiks, vom Nahen Osten bis Australasien, durfte ich Sinne und Wahrnehmung schärfen, Einblicke, Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln, die meinen Horizont erweiterten und manchen Blickwinkel und Betrachtungsweise veränderten.
Es waren bewegte Zeiten, mit Aufstieg und Übergängen, mit Fortschritt und Rückschritt, mit Gestalten und Problemlösungen. Mit Reformen, Umwälzungen und gewaltigen technologischen Revolutionen in der Bankenwelt. Vom Schalter zur App war erst der Anfang. Das Tempo der rasanten Digitalisierung nimmt weiter zu. Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und im Cyberspace schaffen neue enorme Herausforderungen.
Auf meinem Weg habe ich Spuren hinterlassen. Nicht immer freiwillig, manchmal kontrovers und im grellen Scheinwerferlicht der Medien. Stets begleitet von der Familie und guten Freunden. In diesem Buch schildere ich einfach meinen Weg, wie ich ihn erlebt habe, und lade ein, mich auf dieser Wanderung zu begleiten.
Auf Quellenangaben oder ein Namensregister habe ich verzichtet. Dies ist kein wissenschaftliches Werk und erhebt schon deshalb keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Viele Personen sind zwar erwähnt, aber es gibt weit mehr Wegbegleiter, die nicht im Buch erscheinen und gleichwohl eine Rolle in meinem Leben gespielt haben.
Noch ein Hinweis: Alle Inhalte stammen von mir und nicht von einem ChatGPT-Textroboter.
Während ich hier in der finnischen Heimat meiner Frau auf die raue Ostsee und die Inselgruppen um Helsinki schaue und dabei an die vielen Bootsausflüge samt tanzender Polarlichter denke, erinnere ich mich an meine Kindheit, als die Sommergewitter hinter Schloss Sargans gen Liechtenstein abzogen und noch eine Weile gewaltig blitzten und rumorten. Wir Kinder blickten dann wie gebannt in die Ferne. Ohne zu wissen, was die Zukunft bringt.
Josef Ackermann, im Februar 2024
Prolog
Ende einer Ikone
Sonntag, der 19. März 2023. Mein Namenstag. Ich bin ein paar Tage in Helsinki, um in aller Ruhe an meinem Buch zu arbeiten und verfolge gebannt am Fernsehgerät ein Drama, das seinem Höhepunkt entgegendriftet.
Es ist 19.30 Uhr. In Bern treten nach mehrtägigen Krisensitzungen und einem chaotischen Wochenende die wichtigsten Vertreter der Schweizer Regierung, der Notenbank, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) sowie die Verwaltungsratspräsidenten der UBS und Credit Suisse (CS) gemeinsam bei einer Pressekonferenz auf. Die Sitzung wird im Schweizer Fernsehen live übertragen. Die Journalisten vor Ort sitzen dicht gedrängt. Volles Haus.
Es ist ein historisches Ereignis, aber kein Freudentag. Die versammelte Prominenz, Bundespräsident Alain Berset, Finanzministerin Karin Keller-Sutter, Notenbankpräsident Thomas Jordan, die Präsidentin der FINMA Marlene Amstad, UBS-VR-Präsident Colm Kelleher und CS-VR-Präsident Axel Lehmann, schauen betreten drein. Sie geben das Ende einer Schweizer Ikone bekannt.
Die UBS, die größte Bank der Schweiz, wird die Credit Suisse, das zweitgrößte Finanzinstitut des Landes, für drei Milliarden Franken übernehmen. Nach 167 Jahren wird die Credit Suisse geschluckt. Es ist eine Notoperation, um das Finanzsystem nicht zu gefährden, denn die CS gehört zu den weltweit 30 wichtigsten systemrelevanten Banken. Sie ist »too big to fail« (TBTF) – zu groß, um sie in Konkurs gehen zu lassen.
Erstaunliches bekommen Bürger, Aktionäre, Anleihen-Besitzer, Kunden, Steuerzahler und Journalisten zu hören. Die Credit Suisse war in den Tagen zuvor in eine Art Todesspirale geraten. Nachdem das Finanzinstitut im letzten Quartal 2022 einen Geldabfluss von über 110 Milliarden Franken zu verkraften hatte und für das vergangene Geschäftsjahr einen Verlust von mehr als sieben Milliarden Franken einräumen musste, hatte sich die Krise weiter verschärft. Kunden zogen im Monat März weitere Milliardensummen ab. Der Aktienkurs brach ein und Hedgefonds wetteten einmal mehr gegen die CS, um kräftig abzusahnen. Am 6. April 2023 berichtet die Financial Times, dass Hedgefonds durch Short-Positionen allein bei der CS 684 Millionen USD kassiert haben. Ein lukrativer Leichenschmaus.
Auf der legendären Pressekonferenz am 19. März 2023 räumt Bundesrätin Karin Keller-Sutter ein, dass die Lage bei der CS bereits am Mittwoch, dem 15. März, kritisch war. Aufgrund der turbulenten Entwicklungen am Markt war »klar, dass die Liquidität der Credit Suisse nicht mehr gesichert ist«. Gleichwohl verbreiten FINMA und die Schweizer Nationalbank (SNB) noch am Mittwochabend eine Mitteilung, in welcher der CS bescheinigt wird, die »an systemrelevante Banken gestellten Anforderungen an Kapital und Liquidität« zu erfüllen. Die SNB werde »im Bedarfsfall der CS Liquidität zur Verfügung stellen«.
Am Donnerstag, dem 16. März 2023 war dieser Bedarfsfall gegeben. Im Bundeshaus in Bern herrschte »knisternde Anspannung«, berichtet der Zürcher Tages-Anzeiger, die Landesregierung traf sich zu einer Krisensitzung. Über den Inhalt des Treffens wird nicht informiert.
Doch an jenem Donnerstag haben Bundesrat, SNB und FINMA zwei Entscheidungen getroffen, wie Keller-Sutter erst am Sonntag bekannt gibt. Erstens: Der CS wird mit einer Liquiditätsspritze von 50 Milliarden Franken geholfen. Und zweitens: Es werden zusätzliche Ausfallgarantien von rund 100 Milliarden Schweizer Franken gewährt.
Allerdings wurde nur der erste Entscheid am Donnerstag bekanntgegeben, der zweite nicht. Und der Bundesrat hatte sich nicht einmal zu der ersten Liquiditätshilfe geäußert. Am Freitag lautete der Aufmacher im Tages-Anzeiger entsprechend: »50 Milliarden für die CS – Schweigen des Bundesrats löst Irritationen aus.«
Auf der Pressekonferenz sind die Journalisten und Beobachter geschockt. Wieso hatten die Krisenmanager am Donnerstag lediglich die erste Entscheidung kommuniziert, und den zweiten Beschluss verheimlicht? Auf Nachfrage erklärt Keller-Sutter, man habe die Informationen nicht scheibchenweise weitergeben wollen, weil dies die Märkte verunsichert hätte.
Das ergibt keinen Sinn, denn die Information über die Unterstützung der Credit Suisse mit 50 Milliarden Franken war ja gerade zur Beruhigung der Märkte veröffentlicht worden. Wieso dann eine »Bazooka«-Hilfe die Märkte verunsichern soll, ist ein Widerspruch und wenig glaubwürdig. Völlige Verwirrung herrscht, als SNB-Präsident Thomas Jordan auf Nachfrage zugibt, dass die gesamte Hilfe für die CS sogar mehr als 200 Milliarden Franken beträgt.
Ebenso merkwürdig ist die Analyse der Finanzministerin, dass die Übernahme kein »Bail-out« sei, sondern eine »kommerzielle Lösung« zweier Privatparteien. Das Internet-Portal Inside Paradeplatz fällt ein vernichtendes Urteil: »Muppet Show«.
Nach dem Ende der Veranstaltung bin ich fassungslos, wütend und schockiert, greife zum Telefon und bespreche das Ereignis mit Vertrauten und Kollegen. Alle sind außerordentlich erbost. Ich habe mit niemanden gesprochen, der nicht gesagt hat: »Das ist eine Schande für den Schweizer Finanzplatz!«
Noch nie habe ich mich so sehr geschämt wie an diesem Tag. Und ich gebe zu: In der nächsten Nacht habe ich schlecht geschlafen. Die Credit Suisse, mein erster Arbeitgeber, ist dem Untergang geweiht. Da ging etwas zugrunde, was mir sehr nahe war. Dazu später mehr.
Kindheit und Jugend
Der Ratschlag
Als ich zwölf Jahre alt war, gab mir mein Vater den wichtigsten Ratschlag meines Lebens. Er schrieb einen Vierzeiler des Dichters Christoph Martin Wieland auf ein Blatt Papier und reichte es mir:
»In andrer Glück sein eignes finden,
Ist dieses Lebens Seligkeit.
Und andrer Menschen Wohlfahrt gründen,
Schafft göttliche Zufriedenheit.«
Mit diesen Zeilen hat der Weimarer Aufklärer nicht nur eine allgemeine Lebensphilosophie, sondern auch eine spezielle Managementmaxime definiert. Für meinen Vater, einen leidenschaftlichen (Land-)Arzt, symbolisierte der Vers sein Berufsethos, denn wenn er anderen helfen konnte, fühlte er sich reich belohnt. Daher sein schlichter Rat an mich, mein Glück im Glück anderer zu suchen. Dies war allerdings kein einfacher Weg, wie ich im Laufe der Jahre feststellen musste.
Erst in der großen Finanzkrise 2008 und im Laufe von Jahrzehnten in der Finanzwelt habe ich die tiefe Weisheit von Wielands Spruch vollständig erfassen können. Der Blick in den Abgrund rund um den Zusammenbruch von Lehman Brothers und die potenzielle Gefahr eines Zusammenbruchs des Finanzsystems samt Weltwirtschaftskrise haben die Bedeutung von Eigenverantwortung konkretisiert, ebenso wie die gesellschaftspolitische Mitverantwortung von Topmanagern, Institutionen, ja, der gesamten Finanzbranche. Unternehmen existieren nicht um ihrer selbst willen, sondern haben auf Dauer nur Erfolg, wenn sie sich für die Allgemeinheit als nützlich erweisen.
Unternehmensführer dürfen dies nie vergessen. Ihre erste Aufgabe ist es nun mal, Gewinne zu erwirtschaften. Aber nicht wegen des Profits an sich. Erträge sind nur Mittel zum Zweck, damit Unternehmen wachsen, neue Produkte entwickeln, Arbeitsplätze schaffen und Steuern bezahlen können. Das schafft Wohlstand und politische Stabilität.
In der heutigen medialen Berichterstattung entsteht immer mehr der Eindruck, dass wirtschaftliche Mächte das Geschehen dominieren und kontrollieren. Dies hat zur Folge, dass Unternehmen und Wirtschaftsführer in ihrer Machtstellung immer kritischer hinterfragt werden. Da niemand unfehlbar, allwissend oder unanfechtbar ist, ist das auch gut so. Diese Lektion habe ich gelernt.
Schweizer Wurzeln
Heimat ist dort, wo man aufwächst, sich wohlfühlt, heimisch wird, wo es einen Bezug zur Sprache und Kultur gibt. Wo erste Erfahrungen und Erlebnisse entstehen. Daheim, in der Familie, Schule, in der Freizeit, beim Sport, bei Feiern, bei Traditionen wie dem Almabtrieb. Oder wenn man sich das erste Mal verliebt. So richtig daheim sein und sich wohlfühlen kann man nur dort, wo man als Kind alles miterlebt hat.
Meine Heimat ist die Schweiz. Im Kanton St. Gallen bin ich aufgewachsen. Das Elternhaus stand in Mels im Sarganserland, einer Gemeinde von mittlerweile fast neuntausend Einwohnern. Mels liegt am Rande des St. Galler Rheintals, das ist Heidiland. Viele Leser kennen bestimmt die Autobahn A3, die am Walensee entlang in Richtung Chur in die Skigebiete nach Graubünden und über den San-Bernardino-Pass ins Tessin Richtung Italien führt. Mels liegt am Weg. Auch eine wichtige Eisenbahnstrecke führt durch den Ort bis nach Chur.
Die Melser sind stolz auf ihre Geschichte und auf ein gewisses eigenwilliges, aufsässiges, widerborstiges, trotzköpfiges Selbstbewusstsein, das man auf Heimatverbundenheit und Bodenständigkeit zurückführen kann. Die Alemannen bildeten den Grundstock der Bevölkerung im weiten von Gebirgsketten umsäumten Weisstannental. Später kamen freie Walser aus den bündnerischen Walser Kolonien Davos und Rheinwald dazu. Irgendwo dort liegen die Wurzeln der Ackermanns, also meiner Familie väterlicherseits. Noch heute fahre ich gerne mit meiner Frau oder der ganzen Familie zum Skifahren auf den Pizol oder gehe im Naturschutzgebiet rund um den Chapfensee wandern.
Auf die Frage, was das Wichtigste für den Erfolg meiner Karriere gewesen ist, sage ich immer wieder: Grundvertrauen, ja sogar Urvertrauen. Dazu gehört das Wissen, irgendwo aufgehoben zu sein, eine Heimat zu haben. Ich wusste immer, dass ich nicht ins Leere falle, wenn etwas Schlimmes passieren würde. Das hat mich frei gemacht. Und sicher auch mutiger. Diese Gewissheit ist mir geblieben, auch dank meiner Eltern. Bis an ihr Lebensende im hohen Alter von über neunzig Jahren habe ich sie gerne regelmäßig zusammen mit meiner Frau und unserer Tochter besucht.
Glückliche Kindheit
Geboren wurde ich am 7. Februar 1948 per Kaiserschnitt im Klinikum in Walenstadt im Sternzeichen Wassermann. Meine beiden Brüder Karl und Daniel folgten jeweils ein Jahr später. Als Erstgeborener wurde ich praktisch von Anfang an in die Vorbildfunktion hineingedrängt. Karl studierte später Biologie und Daniel wurde ein bekannter Urologe. Ehrgeiz war uns in die Wiege gelegt.
Wassermänner gelten im Allgemeinen als kreativ, hilfsbereit und freiheitsliebend. Andererseits werden sie häufig als stur, ungeduldig und distanziert wahrgenommen. Das Streben nach Unabhängigkeit ist ein Charakterzug, den ich mir durchaus zueigen mache.
Ich kann ohne Wenn und Aber behaupten, dass ich eine glückliche Kindheit und Jugend hatte. Es herrschten geradezu idyllische Zustände auf dem Land, auch wenn an unserem Haus die Züge der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) vorbeidonnerten. Die Bahnstrecke und die nahe gelegene Autobahn ließen bei mir schon als Kind und noch mehr als Jugendlicher ein gewisses Fernweh aufkommen. Und Neugierde auf die Welt da draußen. Das Tor zur Welt stand offen für denjenigen, der es öffnen wollte.
Mels war ein überwiegend katholisch geprägtes einfaches Dorf. Nur wenige Bewohner hatten eine akademische Ausbildung oder verfolgten eine militärische Karriere als Offizier. Mein Vater war stets bemüht, uns neue Perspektiven aufzuzeigen: durch Reisen ins Ausland, internationale Kontakte, intensive Diskussionen.
Klar waren wir Teil der dörflichen Gemeinschaft, doch wurden wir ermutigt, über den sprichwörtlichen Tellerrand hinauszuschauen, zum Beispiel als Gastkinder bei anderen Familien oder über den Sprachunterricht in der Schule. So lernte ich bald ziemlich gut Englisch, Französisch und Italienisch und erwarb Grundkenntnisse in Spanisch.
Mit acht Jahren schickte man mich auf eine französische Sprachenschule. Meine Mutter Margrith sorgte als Westschweizerin dafür, dass wir zuhause auch teilweise französisch sprachen. Sie spornte uns stets mit dem Satz an: »Qui veut, peut.« (Wer will, der kann) und stärkte damit dieses Grundvertrauen.
Mein Großvater mütterlicherseits agierte ab und zu als Englischdolmetscher für verunglückte Skitouristen, die bei meinem Vater in der Praxis landeten. Er schärfte uns ein, Sprachen zu lernen, weil sie das »Tor zur Welt« seien.
Mein Vater litt Zeit seines Lebens darunter, nur rudimentäre Fremdsprachenkenntnisse zu besitzen. Das Medizinstudium an der Universität Zürich war zu seiner Zeit noch nicht so internationalisiert wie heute. Zudem entstammte mein Vater einfachsten Verhältnissen. Er war der Erste der Familie, dem man ein Studium ermöglichte. Sein Vater wiederum war Vorarbeiter bei den Schweizer Bundesbahnen (SBB) gewesen.
Mein Vater finanzierte sein Studium durch diverse Nebenjobs. Der exotischste Ausflug dürfte während der Semesterferien sein Einsatz als Viehhüter auf einer Schweizer Alm gewesen sein. Meine Eltern lernten sich während des Studiums im Zürcher Universitätsspital kennen, als meine Mutter dort eine sehr erfolgreiche Ausbildung als Krankenschwester durchlief. Nach Studienabschluss, Approbation und einem befristeten Engagement in der Psychiatrie ließ sich mein Vater 1947 in Mels als Allgemeinarzt nieder. Zu diesem Zeitpunkt war er 29 Jahre alt und baute aus dem Nichts eine eigene Praxis auf. Sein Fleiß und gute Verdienstmöglichkeiten verschafften uns recht schnell einen gewissen Wohlstand. Man kann sagen, dass wir für damalige Verhältnisse vermögend waren. Mein Vater arbeitete voll durch bis zum 65. Lebensjahr, dann spielte seine Gesundheit nicht mehr mit. Als Maxime seines aufopferungsvollen Arbeitslebens galt stets: »Entweder ist man ganz Arzt oder gar nicht.«
Als Landarzt war er nicht nur überall bekannt, sondern auch beliebt. Etwas zurückhaltend, ja fast schon schüchtern, hielt er gleichwohl Vorträge zu allgemeinmedizinischen Themen in der Gemeinde. Gesellschaftliche Verpflichtungen nahm aber meistens meine Mutter wahr.
Sie war eine ungemein attraktive, warmherzige und liebenswürdige Frau mit großem Herzen, die aufopferungsvoll die Praxis im administrativen Bereich führte und auch die Laboruntersuchungen betreute. Sie spann die Fäden im Hintergrund, sah sich als große Stütze im beruflichen Alltag ihres Mannes und ihre pragmatische zupackende Art sowie ihre Fachkenntnisse waren unentbehrlich. Mein Vater war gleichwohl unsere Leitfigur. So war das damals.
Als Großfamilie von drei Generationen lebten wir unter einem Dach. Der Haushalt wurde von den Eltern meiner Mutter geführt. Die Großeltern stammten aus dem Hotelfach und leiteten bis zu ihrer Pensionierung das Gastgewerbe auf Schloss Sargans. Das erklärt auch die wunderbaren Kochkünste meiner Großmutter, zu der ich ein besonders inniges Verhältnis hatte. Ihr köstlicher Schokoladenkuchen ist mir bis heute in nachhaltigster Erinnerung. Da ich lange Zeit ein heikler Esser war – statt Fleisch zog ich Vegetarisches vor –, wurde ich von der Großmutter häufig verwöhnt, was den Unmut meiner Brüder weckte. Sie werteten diese Vorzugsbehandlung als ungerechtfertigtes Privileg. Ich meinerseits habe es aber genossen, ein wenig mehr verwöhnt zu werden.
Die Arztpraxis meines Vaters erwies sich regelmäßig als internationale Kontaktbörse. Als ein paar Lehrer aus London mit ihren Schülern nach Mels zum Skilaufen eintrafen, war es bis zum ersten Ski-Unfall nur eine Frage der Zeit. Genauso kam es. Ein Schüler war gestürzt, die Bruchstelle wurde gegipst und mein Vater fragte den englischen Pädagogen so nebenbei, ob er eine gute Sprachschule in Großbritannien kenne. Die Antwort kam prompt: »Eine hübsche Idee. Unser Sohn kommt zu Ihnen und Ihre Söhne zu uns.«
So landeten wir nacheinander in den Sommerferien in einer Gastfamilie in Ickenham im London Borough of Hillingdon, einem Bezirk, den sicher viele durch den Heathrow Airport kennen. Wir wurden von der englischen Familie verwöhnt. Bootsfahrten auf der Themse, Fischen in Schottland und Rundreisen durch Südengland waren die Highlights. Das Oberhaupt der Familie war Major in der Royal Air Force, der Sohn Schlagzeuger, der bis spät in die Nacht seine »Drumsticks« wirbelte. Im Wohnzimmer gab es ein Klavier und wir kauften Noten für klassische oder Pop-Musik.
Damals begann die große Zeit der Beatles, Rolling Stones, The Who, The Small Faces, The Kinks, The Hollies, The Animals, Dusty Springfield oder Cliff Richard, die die Charts beherrschten. Wir tauchten in eine völlig neue Welt ein. »Swinging London« ersetzte die traditionelle »Stiff Upper Lip«-Kultur durch Rockmusik, provokante Texte und revolutionäre Modetrends, die von Supermodels wie Twiggy in ultrakurzen Miniröcken in die Welt hinausgetragen wurden. Es war eine Zeit des Umbruchs und neuer Freiheiten. Die Texte der Bands waren kühn, frech, respektlos, lümmelhaft, aber durchaus attraktiv und zusätzliche Motivation, die englische Sprache noch intensiver zu erlernen.
Bei einem lokalen Sportfest wurden wir eines Tages aufgereiht, hatten aber keine Ahnung wieso. Plötzlich tauchte ein Hubschrauber auf, der mitten auf dem Sportplatz landete. Dem Helikopter entstieg zu meiner Überraschung Prinz Philip, der Herzog von Edinburgh, der unsere Reihe abschritt und mit jedem ein paar Worte wechselte.
Ich war völlig perplex, als er vor mir stand, und schüttelte ihm wortlos die Hand. Als ich Jahre später im Buckingham Palast dem damaligen Thronfolger Prinz Charles und heutigen König von England vorgestellt wurde, erwähnte ich, dass ich aus der Schweiz käme. »That’s not your fault«, erwiderte seine Majestät mit dem ihm eigenen Humor. Doch ich schweife ab.
In England war das klassische englische Frühstück mit Eggs, Bacon oder »Kippers« am Anfang recht gewöhnungsbedürftig. Entschädigt haben mich Fish and Chips und der »Knickerbocker Glory«, die populärste Eisbombe Großbritanniens und ein Klassiker unter den »Sundaes«, bestehend aus Vanilleeis, Früchten, Meringue, Marshmallows und Sahne. Das Eishappening wird in einem hohen Glas mit einem langen Löffel serviert und ganze Generationen haben dieses glorreiche Dessert mit Hochgenuss verspeist.
Auch der Volkssport Darts hatte mich gepackt. Das Spiel mit den Wurfpfeilen faszinierte mich so sehr, dass ich mir Jahre später im Keller meines Hauses eine Zielscheibe einbauen ließ. Als ich aus England in die Schweiz zurückkehrte, war nicht nur mein Englisch deutlich besser, sondern auch meine Haare sichtlich länger. Ein »Pilzkopf« war ich aber nicht.
Das umliegende Skigebiet bescherte meinem Vater unfreiwillig viele neue Patienten und endlose Überstunden. Vor allem die Bereitschaftsdienste an den Wochenenden hatten es in sich. Mein Vater war 24 Stunden im Dienst, mit totalem Einsatz und Engagement. Während des ganzen Jahres wurde er außerdem Tag und Nacht je nach Notfall zu Hausbesuchen gerufen. Sein Einsatzgebiet umfasste nicht nur Mels, sondern auch die umliegenden voralpinen Weiler.
Als Arztfahrzeug diente ein alter VW Käfer, der bei Tag und Nacht und Wind und Wetter zum Einsatz kam. Bei Schnee mussten Ketten montiert werden. Als Ältester durfte ich ab und zu mitfahren, um bei Steigungen als zusätzliches »Lebendgewicht« hinten auf der Stoßstange dem Fahrzeug zu mehr Traktion zu verhelfen. Als Belohnung ließ mich mein Vater dann den Wagen im Hof der besuchten Weiler wenden. Bei einem nächtlichen Einsatz wäre ich dabei im Schneegestöber um ein Haar einen Abhang hinuntergerutscht. Eine Steinmauer hat mich gerettet.
Immer häufiger wurden während der Skisaison vor allem deutsche Patienten mit Beinbrüchen und Schulterluxationen eingeliefert. Meine Brüder und ich halfen ab und zu dabei, die Verunglückten in die Praxis zu tragen und auch mal einen Gips anzurühren. Der Vater renkte die Schultern ein und nebenbei versuchten wir, etwas über die politische Entwicklung in Deutschland zu erfahren. Das Interesse an Deutschland war so groß, dass wir zum Besipiel regelmäßig die Sonntagsdebatten des Internationalen Frühschoppens mit Werner Höfer verfolgten.
Manchen Eliten wird gerne vorgeworfen, dass »die da oben« ziemlich abgehoben, entrückt und ahnungslos im Elfenbeinturm sitzen und nicht wissen, wie es anderen Gesellschaftsschichten ergeht.
Wenn man wie ich in einer Arztpraxis aufgewachsen ist, hat man auch die Schattenseiten der Gesellschaft, Armut und Leiden vieler Menschen, hautnah miterlebt. Wenn nachts Telefonanrufe kamen und mein Vater zu Noteinsätzen ausrückte, bekamen auch wir Kinder einiges mit. Das hat für guten Schutz gesorgt, bei Erfolgen nicht zu triumphieren und bei Niederlagen nicht zu verzagen. Etwas Bescheidenheit und Demut steht jedem gut an. Dies gab uns Kindern gewiss auch die innere Kraft, aus kritischen Ereignissen gestärkt hervorzugehen, was auf Neudeutsch als »Resilienz« bezeichnet wird.
Familienleben
Weihnachten und Geburtstage waren Höhepunkte des Familienlebens. Dem Weihnachtsfest wohnte immer ein besonders geheimnisvoller Zauber inne. Der Weihnachtsbaum stand im Salon, direkt neben dem Klavier. Vor der Bescherung gingen wir Jungs mit unserem Großvater spazieren, was die Ungeduld und Spannung beträchtlich erhöhte, denn natürlich hatten wir dem Christkind eine Wunschliste geschrieben und den Brief auf einem Fenstersims deponiert. Das Ackermann-Trio der Söhne probte viele Wochen vorher diverse Musikstücke, die Teil des Weihnachtsmusikprogramms waren.
Die Bescherung war wie überall für die Kinder das Höchste. Eines der schönsten Geschenke für mich und meine Brüder war eine Märklin-Modelleisenbahn. Nicht irgendeine, sondern die Gotthardbahn mit der legendären »Krokodil«-Lok, die ich heute noch wunderschön finde. Meine zweite Lieblingslok war die V-200 der Deutschen Bundesbahn. Die Anlage wurde kräftig ausgebaut mit Bahnstationen, künstlichen Bergen, einer Seilbahn und Postauto. Noch heute gehe ich gerne in Spielzeugläden, finde es aber bedauerlich, wie sehr die Elektronik überhandnimmt.
Irgendwann schenkte uns der Vater einen Chemiekasten, wohl mit dem Hintergedanken, uns als kleine Chemiker oder künftige Mediziner zu einigen Laborversuchen zu ermutigen. Experimente folgten in der Tat, aber mehr auf der kulinarischen Seite. Bonbons aus karamellisiertem Zucker waren für uns das Größte. Das Familienoberhaupt war ob der Experimente sichtlich enttäuscht.
Mein Vater legte Wert auf Bescheidenheit und Bodenhaftung. Hohes Arbeitsethos wurde vorgelebt, jede Angeberei verschmäht. Die Eltern wollten Geldverschwendung vermeiden. Als wir eines Tages in Venedig nach langer Autofahrt müde in einem schicken Hotel abstiegen, fand mein Vater dies nach kurzer Zeit zu kostspielig. Daher wechselten wir ohne Umschweife das Quartier, obwohl wir uns dies eigentlich leisten konnten.
Unsere Eltern legten Wert auf Eigenständigkeit, Eigenverantwortung und gegenseitige Unterstützung. Geld zu verdienen sollte nicht mit Ansprüchen an den Staat verknüpft sein, sondern mit Arbeit und Leistung.
Kulturelle Themen und Reisen wurden von den Eltern systematisch gefördert. Schon als Kinder besuchten wir Theateraufführungen in München oder reisten nach Rom. Für den Pflichtbesuch des Forum Romanum hatte sich mein Vater intensiv mit der Lektüre von Cäsar beschäftigt und zwar im Original auf Latein. An den Ausflug in die »Ewige Stadt« denke ich heute noch, weil uns mein Vater neben den drei Säulen des Castor-und-Pollux-Tempels stehend mit lauter Stimme Textstellen aus Cäsars »De bello Gallico« (Vom gallischen Krieg) deklamierend das antike Rom näherbrachte.
Zuhause wurde regelmäßig gemeinsam musiziert. Wir drei Brüder spielten Cello, Geige und ich Klavier. Mein Vater konnte in einer wunderbaren Tenorlage singen, meine Mutter besaß eine auffallend schöne Sopranstimme. Sonntagmorgen nach dem Kirchgang wurde bei den Ackermanns gesungen und musiziert. Kammermusikstücke, Auszüge aus Mozarts »Zauberflöte« oder anderen Opern.
Die Liebe zur Musik hat mich mein ganzes Leben begleitet und war mir Quelle der Ruhe, Ausgleich vom Alltagsstress und Entspannung zugleich. Noch heute sitze ich gerne an meinem Steinway und singe dazu. Ich bin kein herausragender Pianist und mit dem Singen habe ich altersbedingte Defizite, doch beides zusammen genieße ich immer noch.
Sport war für uns außerordentlich wichtig. Meine Brüder waren alle sportbegeistert und wir spielten viel Fußball. Mein Augenmerk fiel dann aber auf die Leichtathletik, meine Lieblingsdisziplin waren der Siebenkampf und Speerwerfen.
Der Speerwurf (Akontion) war bei den antiken Olympischen Spielen eine Teildisziplin des Pentathlon und das Pilum (Wurfspeer) hat mich stets fasziniert. Diese Sportart wurde in der Mittelschule gefördert und sie lag mir. Durch intensives Training schaffte ich es bis zum Juniorenmeister im Kanton St. Gallen.
Die häufigen Trainingszeiten führten zu Konflikten zwischen Musizieren, Lesen und Sport. Meine Mutter erinnerte sich, dass wir Brüder einmal das »Erzherzog-Trio« von Beethoven übten und ich meinen Part recht lieblos und hastig herunterspielte. Und zwar so presto, dass ich früher als die anderen fertig war und fragte, ob ich jetzt zum Fußballspielen gehen könnte. Offenbar war ich damals doch kein hundertprozentiger Musensohn.
Politik und Zeitgeschehen wurden am Familientisch regelmäßig diskutiert, laut, emotional, aber immer versöhnlich. Kaum hatte mein Vater ein Thema gesetzt, gingen die Diskussionen los. Das war vermutlich einer der wichtigsten Aspekte des Familienlebens. Auch wenn wir Gäste hatten, wurde eifrig debattiert. Vor allem der junge US-Präsident John F. Kennedy hatte es uns angetan. Nach den Eisenhower-Jahren, die wir als graue bleierne Zeit wahrnahmen, stand der junge, sportliche, gut aussehende und dynamische Präsident für den Anbruch einer neuen Zeit.
Für uns junge Leute war JFK eine Identifikationsfigur. Während der geopolitischen Spannungen wie dem Bau der Mauer sowie der Kubakrise, die die Supermächte 1962 an den Rand eines Weltkriegs brachten, schien John F. Kennedy als Galionsfigur der freien Welt dem Kommunismus die Stirn bieten zu können. Ich erinnere mich, wie mein Vater bei der Verhängung der Seeblockade gegen Kuba meinte: »Endlich sagt einer: bis hierher und nicht weiter.«
Heute sieht man einiges anders, vieles wurde relativiert. Doch als Kennedy 1963 nach Berlin reiste, verfolgten wir fasziniert in jeder freien Minute seinen Deutschlandbesuch auf allen verfügbaren Fernsehgeräten. Als er im November 1963 in Dallas, Texas, von einem Attentäter erschossen wurde, waren wir zutiefst schockiert und wütend. Den ganzen Abend diskutierten wir das furchtbare Geschehen und fragten uns, wie man solche Anschläge verhindern könne.
Der Tod des Präsidenten war eines jener tiefgreifenden Ereignisse, die im Gedächtnis bleiben – und man weiß noch Jahre später, wo man sich damals aufgehalten hat. Ähnlich wie bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 oder dem Unfalltod von Lady Diana in Paris am 31. August 1997.
Von John F. Kennedy ist mir sein legendärer Satz im Gedächtnis geblieben: »Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.« Dem »Staat zu dienen« war mein Lebensmotto bei der Armee, während der Finanz- und Schuldenkrise oder in Zypern und auch der erste Teil der Kennedy-Losung gehörte bei der Entscheidung dazu, während der Finanzkrise keine Staatshilfe anzunehmen.
Der Kalte Krieg bestimmte immer wieder unsere Debatten, insbesondere der Volksaufstand in Ungarn 1956, die Hinrichtung des ehemaligen Ministerpräsidenten Imre Nagy 1958 und der Bau der Berliner Mauer 1961. Die Niederschlagung des Aufstands in Ungarn durch russische Panzer löste eine massive Flüchtlingswelle aus. 200000 Ungarn flohen damals in die Nachbarstaaten, rund 13000 in die Schweiz.
Als Achtjähriger lauschte ich stundenlang den aktuellen Nachrichtensendungen über die Ereignisse in Budapest, als Demonstranten Molotow-Cocktails auf russische Panzer warfen. Meine Mutter war über meinen Vater in die Aktivitäten des Roten Kreuzes eingebunden. In der Folge hatten wir viele ungarische Freunde, die uns über die Lage vor Ort informierten.
Von einem Tag auf den anderen hatten wir plötzlich in der regulären Klasse mit 70 Schülern zusätzlich mehrere ungarische Kinder, was für uns eine spannende Zeit war. In Erinnerung geblieben ist mir eine ungarische Familie, die nach Kanada auswandern wollte und hingebungsvoll und fleißig Englisch lernte. Mich packte daraufhin der Ehrgeiz und ich wollte Ungarisch erlernen. Die Wette, ob ich die Muttersprache meines ungarischen Schulfreunds in zwei Monaten ebenso schnell erlernen konnte wie er die englische Sprache, habe ich aber verloren.
Für uns Schweizer war die Dimension von Flucht und Vertreibung, Not und Heimatlosigkeit eine prägende Erfahrung. Dieses Thema ist heute leider aktueller denn je.
Von Wirtschaftspolitik hatte ich damals keine Ahnung. Im Alter von zwölf Jahren ist das wohl auch kein Wunder. Das Interesse kam erst deutlich später.
Werte und Bodenhaftung
Werte und Bodenhaftung haben meine Brüder und ich aus dem Elternhaus übernommen. Bescheidenheit war ebenso wichtig wie Respekt und Achtung vor anderen. Bildung war für meinen Vater außerordentlich wichtig und wurde großzügig gefördert. Da gab es nicht das geringste Zögern, ganz im Gegenteil. Er ermunterte uns, Abenteuerromane oder Biografien zu lesen.
Ich wählte Memoiren historischer Figuren wie Winston Churchill, Konrad Adenauer oder Charles de Gaulle. Mein Vater freute sich hinterher über eine positive Rückmeldung. Sein Verständnis wäre allerdings völlig ausgeblieben, wenn wir uns lediglich für Partys oder profane Dinge interessiert hätten.
Das heißt allerdings nicht, dass wir zur bildungsbürgerlichen Askese erzogen wurden. Wir lebten einfach, und ethische Fragen und Werte hatten schlicht großes Gewicht. Das kulturelle Angebot des Elternhauses war eine zentrale Orientierungsplattform für die Zukunft. Für mich war die pädagogische Leitlinie meiner Eltern ein »Fördern und Fordern«.
Natürlich kann man die damaligen Bildungsparadigmen infrage stellen. Manch einer wird sich fragen, ob wir einfach die Erwartungen unserer Eltern erfüllen wollten, um ihre Gunst und Zuneigung zu erhalten. Doch so einfach war das nicht. Klar ist, dass wir unsere Eltern nicht enttäuschen wollten. Außerdem machten die betreffenden Angebote wie der erwähnte Romausflug schlicht und ergreifend großen Spaß.
Das faustische »Erwirb es, um es zu besitzen« zog sich wie ein Leitfaden durch die Erziehung meiner Eltern. Gemeint war damit weniger Materielles als das Bewahren von Werten und kultureller Errungenschaften. Der Satz war im Übrigen das Thema meines Abituraufsatzes im Fach Deutsch, damals ein beliebtes Sujet.
Ich kann mich nicht erinnern, meine Eltern jemals enttäuscht zu haben, in dem ich eine gewisse Leistung nicht erbracht oder gar vermieden hätte. Weder im Sport noch in der Schule oder später im Berufsleben.
Das Prägendste meines Elternhauses war das stete Bemühen, Neues zu erlernen und zu verstehen. Ob Vorgaben und Ansprüche meiner Eltern etwas Elitäres hatten, überlasse ich der Beurteilung des geneigten Lesers, doch hat der Bildungsanspruch keineswegs zu Isolation in der dörflichen Gemeinschaft von Mels geführt.
Wir Brüder waren im örtlichen Turnverein, in der Pfadfinderbewegung und als junge Katholiken auch als Messdiener aktiv. Letzteres war besonders attraktiv, weil nach den Gottesdiensten in den Kapellen der Bergdörfer rund um Mels die Bäuerinnen das traditionelle Frühstück, ein »z’Morgen«, servierten. Dabei handelte es sich meist um Eier mit Speck und auf dem Holzofen gebratene Kartoffeln. Nur die guten Schüler durften mitkommen. Wer dabei war, musste erst um zehn oder halb elf in der Schule sein. Dieses legitimierte Zuspätkommen gefiel mir.
Ebenso die straff organisierte Pfadfinderbewegung. Wir erlernten dort interessante Fähigkeiten wie Knoten binden, Lagerfeuer aufschichten, Überlebenstechniken in der freien Natur und Orientierungsläufe. Als »Venner« (Gruppenführer) übernahm ich erste Führungsaufgaben.
Die internationale Ausrichtung fand ich geradezu aufregend. Einer der Höhepunkte des Pfadfinderdaseins sind die jährlichen Jamborees, bei denen sich Pfadfinder aus aller Welt treffen. Zuerst schien es ziemlich aussichtslos, dass ein 14 Jahre alter »Pfadi« aus Mels zum Jamboree nach Marathon in der griechischen Region Attika eingeladen würde. Doch ich bewarb mich einfach und wurde tatsächlich für die Schweizer Gruppe als Teilnehmer ausgewählt.
Wir fuhren nach Brindisi und setzten von dort mit einem richtigen »Seelenverkäufer« nach Patras über und reisten dann nach Marathon. Bei den sportlichen Wettkämpfen hatte ich allerdings keine Chance. Etliche Teilnehmer aus den USA und Afrika waren uns klar überlegen.
Dafür genossen wir umso mehr die Lagerfeuerromantik mit internationaler Besetzung. Als ich nachhause kam, fand ich Trost in Cäsars Worten »mallem hic primus esse quam Romae secundus« (lieber der Erste hier als der Zweite in Rom). Das war in gewisser Hinsicht auch mein Motto in der Schule.
Schulzeit
Die fünf Jahre Primarschule in Mels verliefen problemlos. Den Schulweg gestaltete ich auf meine Art. »Da läuft er wieder«, riefen mir die Leute lachend hinterher, da ich die einen Kilometer lange Strecke zur Schule und zurück meist im Laufschritt zurücklegte. Das war eine selbst gewählte sportliche Trainingseinheit.
Der Josef war »ein sehr ernstes Kind«, sagte meine Mutter einmal einem Reporter, »immer konzentriert und strebsam«. Die Leute im Dorf hätten ihr immer wieder erzählt, wie »höflich und hilfsbereit er ist«. Eine Nachbarin meinte sogar, ich würde mal Pfarrer werden. Klare Fehlprognose. Zumal ich eines Tages von einem Primarschullehrer während eines Gottesdienstes von hinten eine Ohrfeige kassierte, weil wir Buben gelacht und geschwatzt hatten.
War ich sonst ein Musterknabe? Meine Eltern müssen schon mal nachdenken, bis ihnen ein Streich einfällt. Beim Kugelstoßen im Garten habe ich es einmal übertrieben. Plötzlich klirrte es – erinnerte sich mein Vater – und ein großer Stein landete im Sprechzimmer. Niemand wurde verletzt. Ein andermal habe ich aus unerfindlichen Gründen ein Telefonbuch nach meinem Bruder geworfen – und eine weitere Fensterscheibe ging zu Bruch.
Die Kantonsschule (Gymnasium) in Chur war der nächste Lebensabschnitt. Die Aufnahmeprüfung schaffte ich ohne Schwierigkeiten. Meine Großmutter weckte mich morgens um 6 Uhr, dann schnappte ich mir nach dem Frühstück mein Fahrrad und radelte 20 Minuten zum Bahnhof Sargans. Die Abfahrtszeit Richtung Chur 7.02 Uhr habe ich bis heute nicht vergessen.
Kurz nach 8 Uhr war Schulbeginn. Eine Schuluniformmütze war Pflicht. Zu Semesterbeginn sangen alle Schüler in der Aula »Großer Gott wir loben Dich«. Warum erzähle ich das? Weil es eine unglaublich gute, natürliche und frühe Erfahrung war, von morgens um 6.30 Uhr bis abends um 19 Uhr bereits als Zwölfjähriger allein auf sich gestellt zu sein. Meine Brüder und ich wurden so zur Selbstständigkeit erzogen und wir fanden das gut.
In den Mittagspausen gingen meine Klassenkameraden und ich in die Stadt, kauften uns ein Sandwich oder saßen in einem der Kaffeehäuser, um eine Kleinigkeit zu essen. Am Morgen lernte ich im Zug und abends spielten wir auf der Heimfahrt Jass (Kartenspiel). Auch finanziell wurden wir von unserem Vater zur Selbstständigkeit erzogen. Da wir den ganzen Tag unterwegs waren, lernten wir schnell, mit dem Taschengeld im Schulalltag sinnvoll umzugehen.
Kontrolle durch die Eltern gab es keine. Es herrschte ein absolutes Vertrauensverhältnis. Die Enttäuschung der Eltern wäre aber deutlich zu spüren gewesen, wenn wir mit unseren Mitteln verschwenderisch umgegangen wären. Wir stellten schnell fest, dass mehr dabei herauskommt, wenn man sein Taschengeld, statt zu konsumieren, auf die Seite legt und es später sinnvoll investiert.
Die »Kanti«, wie wir die Kantonsschule nannten, hatte auch eine humanistische Ausrichtung. Es wurden sieben Jahre Latein und fünf Jahre Altgriechisch unterrichtet. In der Matura (Abitur) waren die Prüfungen in beiden Fächern Standard. Die intensive Beschäftigung mit der Antike führte dazu, dass wir als ein wenig hochnäsig angesehen wurden.
Die Popkultur der damaligen Zeit nahmen wir (außer bei meinem Englandaufenthalt) kaum wahr, sie erschien uns zweitrangig. Wir diskutierten primär über Homer, Cicero oder Sokrates, griechische und römische Philosophie und waren Teil dieser etwas abgehobenen Schulgemeinschaft. In gewisser Hinsicht waren wir Snobs.
In der Kleinstadt Chur, die die älteste Stadt der Schweiz ist, hatte man als Schüler der »Kanti« fast so etwas wie einen Studentenstatus. Wir waren zwar Gymnasiasten, trugen aber eine Mütze und tranken als Primaner kurz vor dem Heimweg auch schon mal ein Bier. Wir fühlten uns etwas elitär.
Wir hatten damals schon gemischte Klassen und freie Sitzplatzwahl. Ich setzte mich gerne zu den Mädchen in den hinteren Reihen. Klar, dass man damals auch schon zu flirten begann oder unsterblich verknallt war.
Meine beiden Schulfreunde Andres, Christian und ich bildeten einen besonders engen Kreis und der Klassenlehrer bezeichnete uns bald als »Les Coquins« (die Spitzbuben). So sonderten wir uns mal während eines Skiausflugs von allen anderen ab, um eine anspruchsvollere Abfahrt zu testen. Zur Strafe mussten wir an einem Samstagnachmittag für zwei Stunden in den Arrest und einen Aufsatz über Teamwork schreiben. Wir nahmen das Thema wörtlich und verfassten den Aufsatz gemeinsam. Dieser stille Protest blieb ohne Folgen.
Einer der beiden Freunde wurde später ein berühmter Anwalt, der andere ein bekannter Rechtsprofessor. Beide sind leider in den letzten Jahren verstorben. Gemeinsam redigierten wir die Schülerzeitung Sprachrohr. Insgesamt galt die Klasse als etwas hochmütig, denn wer Altgriechisch als Fach wählte, gehörte von Haus aus zu den besseren Schülern. Bei mir dank der Großmutter, die mir half, Vokabeln zu büffeln. Noch heute lese ich gerne altgriechische Sagen wie Odysseus, Iphigenie oder Prometheus.
Meine Freunde und ich waren politisch sehr interessiert. Nicht im »revolutionären« oder parteipolitischen Sinn. Wir führten eher intensive Debatten über die Philosophenherrschaft Platons oder den Marxismus, inspiriert durch die Beschäftigung mit der Antike. Vielleicht war es auch die von der Antike inspirierte Denkschule, die uns im Unterricht vermittelt wurde. Ich erinnere mich, wie ein Lehrer eines Tages eine Stunde lang über den Mischkrug referierte, einen in der Antike gebräuchlichen bauchigen Weinkrug zum Mischen von Wasser und Wein.
Heute würde man das wahrscheinlich als verschwendete Zeit abtun. Doch das war es nicht, denn wir lernten dabei nicht nur die Liebe zum Detail, sondern auch Erkenntnisse über moderne Malerei.
Nebenbei waren mir Grammatik und Struktur der lateinischen Sprache in späteren Jahren große Hilfen für logisches Denken.
Der Weg zur Reifeprüfung 1967 verlief ohne die geringsten Probleme. Hinter mir lag eine glückliche Schulzeit. Ohne Drogen, ohne Computer, digitalisierte Kommunikation oder Smartphones. Mädchen spielten natürlich eine große Rolle, doch die Zeit war deutlich unschuldiger. Der Gipfel der Verruchtheit war bereits erreicht, wenn ein Schüler lange Haare trug.
Irreversibles vermeiden
Recht früh hatte ich für mich die Handlungsmaxime »Tue nie etwas Irreversibles« entwickelt. Was meine ich damit? Entscheidungen können endgültige, unwiederbringliche, unumkehrbare oder unwiderrufliche Konsequenzen haben. So war ich zum Beispiel sehr froh, auf dem Gymnasium Altgriechisch lernen zu können, denn im späteren Berufsleben wäre die Chance sehr gering gewesen.
Immer wieder habe ich versucht, Alternativen zu entwickeln und mir Optionen offenzuhalten. Das war ab und zu mit unbekannten Risiken verbunden. Etwa bei der späteren Übernahme des Derivatehandels bei der Schweizerischen Kreditanstalt. Solche Situationen ergaben sich in meinem späteren Leben unzählige Male in vielen Varianten.
Zeit meines Lebens bin ich von Bedenkenträgern und gut gemeinten Ratschlägen begleitet worden. Bei der SKA hieß es, ich würde es als Katholik nie bis in die Chefetage schaffen. Vor gefährlichen Derivaten wurde gewarnt, und während der Finanz- und Eurokrise ermahnte man mich zur Zurückhaltung bei öffentlichen Auftritten, weil ich sonst das »Gesicht der Finanzkrise« würde. Das hat mich keinesfalls abgeschreckt, weil ich Herausforderungen stets als Chance und Verpflichtung betrachtet habe.
Manchmal muss man den Mut haben, mit Zuversicht und Selbstvertrauen Möglichkeiten auszuloten, neue Wege zu gehen und Chancen zu ergreifen, weil sie nie mehr zurückkommen. Ob ein Sprungbrett daraus entsteht oder ein persönlicher Absturz ist zweitrangig und nie garantiert. Wer aber die Chance ergreift, braucht später nie zu bereuen, eine Gelegenheit verpasst zu haben. Zudem sind positive oder negative Erfahrungen allemal kostbare Erkenntnisgewinne.
In diesem Sinne bin ich ein Pessimist mit Zuversicht, in dem ich stets auf das Beste hoffe, aber auch auf das Schlimmste gefasst bin.
Damals wie heute war der Schritt nach dem Abitur vorgezeichnet: Der Militärdienst rief. Und damit begann der nächste Lebensabschnitt. Nach der Klassenabschlussfahrt ins italienische Viareggio ging es direkt in die Rekrutenschule für all jene, die diensttauglich waren.
Militärdienst und Studium
Armeezeit und Prägung
In der Schweiz gibt es bis heute eine Militärdienstpflicht. Dazu gehört auch das bestens bewährte Milizsystem, das weltweit einmalig ist. Gemeint ist eine Struktur, die nicht nur die militärische Organisationsform umfasst. Die Schweizer Bürger leben das Milizsystem auch im politischen und gesellschaftspolitischen Bereich etwa über Ehrenämter oder Freiwilligendienste. Zudem ist es Teil der politischen Kultur und der direkten Demokratie. Die Schweizer Armee verfügt über ein Reservoir von stets präsenten Reservisten, die alle eine Grundausbildung durchlaufen. Deshalb liegt zuhause im Schrank die persönliche Militärausrüstung samt Sturmgewehr und Dienstpistole für Offiziere, um jederzeit einsatzbereit zu sein. Es handelt sich also um eine Art Volksarmee, die im Bedarfsfall schnell zu den Waffen gerufen werden kann. Diese rasche Mobilisierungsfähigkeit soll dazu führen, dass Angreifer im Falle eines Falles einen hohen Preis bezahlen müssen. Um dies zu gewährleisten, absolvieren die Armeeangehörigen nach der Rekrutenschule mehrere Wiederholungskurse, die in der Regel jedes Jahr stattfinden. Auch Berufstätige nehmen an den Kursen teil und müssen für diesen Zeitraum vom Arbeitgeber freigestellt werden.
Dass man den Militärdienst leistete, war bei entsprechender Gesundheit Pflicht. Für mich war zudem klar, dass ich auch die Offizierskarriere anstreben wollte. Es war einmal mehr für mich einer dieser irreversiblen Schritte, die man entweder macht oder nicht.
Zudem war damals mehr als heute das berufliche Fortkommen mit der militärischen Karriere verknüpft. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens wird beim Militärdienst ganz zwangsläufig ein Netzwerk geknüpft, das später in vielerlei Hinsicht sehr nützlich sein kann. Zum anderen erhält man ein Zeugnis, das diszipliniertes Arbeiten und Menschenführung bescheinigt. Der potenzielle Arbeitgeber darf nach einer erfolgreichen Militär- und Offizierskarriere eines Kandidaten eine gewisse Robustheit erwarten. Es wird angenommen, dass man unter widrigsten Bedingungen Entscheidungen treffen und Mitarbeiter auch in schwierigen Situationen motivieren kann.
Bei mir stellte ich fest, dass mich der bei Übungen häufig auftretende dauernde Schlafmangel zusätzlich abhärtete. Das gab mir später in beruflichen Krisensituationen die notwendige Kondition und Widerstandskraft. Während der Finanzkrise habe ich oft betont, dass Manager, die im militärischen Führungsrhythmus denken und agieren können, in schwierigen Zeiten Ruhe und Stabilität ausstrahlen und bewahren. Das Militär ist die beste Schule für Leadership-Qualitäten. Doch ich greife vor.
Nach meinem bestens bestandenen körperlichen Belastungstest wurde ich für 17 Wochen in die Rekrutenschule in Bière oberhalb von Lausanne aufgeboten. Während der infanteristischen Grundausbildung stellte ich beim Zerlegen des Gewehrs fest, dass gelernte Mechaniker viel geschickter und schneller vorgingen als der Altgriechisch-Schüler mit dem großen Latinum, der immense Probleme damit hatte. Doch die Kameraden halfen mir – eine schöne menschliche Erfahrung –, und so habe ich den mechanisch-technischen Teil der Waffenausbildung sukzessive mit Unterstützung anderer erlernt. Für mich war das eine Lektion, wo die eigenen Grenzen liegen. Das kameradschaftliche Zusammenwirken bewies zugleich, dass klassische Differenzierungsprobleme beim Militär einfach zu überwinden sind, denn bei der Armee spielt der soziale Status des Einzelnen kaum eine Rolle. Und stärkt somit die gesellschaftliche Kohäsion.
Gemeinsam im Feuer
Als Truppengattung hatte ich mir die Artillerie ausgesucht, obwohl man mir die Infanterie empfohlen hatte. Bei der Artillerie reizte mich die komplexe intellektuelle Herausforderung bei der Geschützführung. Seltsamerweise war den Aspiranten in der Offiziersschule verboten, Fußball zu spielen. Die Begründung lautete, Fußball sei für Artilleristen keine angemessene sportliche Betätigung. Leichtathletik, Schwimmen und Reiten waren dagegen erlaubt und empfohlen.
Vier Wochen lang absolvierte ich anschließend in Bière die Unteroffiziersschule, um nach weiteren 28 Wochen als Korporal abzuschließen. Für die anschließende Offiziersschule wurde man vorgeschlagen. Der Rang des Leutnants musste in weiteren 18 Wochen »abverdient« werden. Nach etlichen Wiederholungs- und Ausbildungskursen wurde ich zum Kommandanten eines Artillerieregiments im Rang eines Oberst befördert.
Meine aktive Militärzeit dauerte insgesamt vier Jahre. Eines Tages wurde ich als junger Major ausgewählt, auf einer Offizierstagung in Graz auf Einladung der Österreichischen Offiziersgesellschaft im Beisein des Generalinspekteurs einen Vortrag über das Schweizer Milizsystem zu halten. Am Ende kam der Moderator auf mich zu und beglückwünschte mich mit den Worten: »Herr Major, ganz herzlichen Dank, bei uns würden Sie jetzt sofort befördert.« In der Schweiz dauerte dies leider etwas länger. Über die Teilnahme an diversen Wiederholungskursen und Lehrgängen musste man sich erst »hochdienen«.
Wichtig war, wie schon erwähnt, dass der Arbeitgeber mitspielte, denn während der Dienstzeit musste man beurlaubt werden. Das Zusammenspiel von Beruf und Armee im Milizsystem war und ist eine einmalige Erfahrung. Auch als CEO der Credit Suisse nahm ich an Übungen teil. In einem Manöver war ich im Rang eines Oberst als Kommandant eines Regiments mit 54 Panzerhaubitzen tätig. Zusätzlich wurden mir weitere 18 Geschütze zugeteilt und der ehemalige Finanzminister Ueli Maurer mit seinem Radfahrerbataillon – einer Schweizer Spezialität – zur Zusammenarbeit zugewiesen.
Dann wurde es spannend. Wir saßen mit dem Regimentsstab im Keller und erhielten den Einsatzbefehl. Anwesend waren mehrere Beobachter der NATO und der OSZE. Ich studierte den Einsatzbefehl genau, machte eine Lageanalyse und diktierte meine Entscheidung. Anschließend gab ich dem Stab den Auftrag, den Befehl im Detail auszuarbeiten, um danach direkt nach Zürich an den Paradeplatz zu fahren. Dort wartete eine Sitzung der Geschäftsleitung auf mich. Zwei Stunden später kehrte ich ins Stabsquartier zurück, immer noch in Kampfuniform. Der Befehl war mittlerweile entsprechend meines Beschlusses ausgearbeitet worden. Ich versammelte alle Kommandanten zur Befehlsausgabe und dann wurde scharf geschossen. Hinterher zeigten sich die ausländischen Beobachter von der Flexibilität und Effizienz des Milizsystems schwer beeindruckt.
Mein engster Freundeskreis stammt aus der Jugendzeit, der Schule und dem Militärdienst. Meinen Spitznamen »Joe« erhielt ich als Alleinstellungsmerkmal, weil so viele »Josefs« mit mir in der Armee dienten.
Einen besonderen Stellenwert hat bis heute für mich die Mathematisch-Militärische Gesellschaft in Zürich. Diese ist eine Vereinigung ehemaliger hoher Offiziere und nur Mitgliedern vorbehalten. Man trifft sich in einem der traditionsreichen Zunfthäuser, in unserem Fall im Zunfthaus »Zur Meisen«. Dort werden von den einzelnen Mitgliedern Vorträge gehalten.
Noch heute nehme ich gerne Einladungen zu Militärübungen oder Flugshows an, um den Streitkräften Respekt zu zollen. In Deutschland war ich einmal von der Marine zu einer NATO-Übung eingeladen. Ein unvergessliches Erlebnis, als wir vom Hubschrauber auf eine Fregatte abgeseilt wurden und eine Nacht auf dem Kriegsschiff verbringen durften. Am Abend im Gespräch mit höheren Offizieren hatte ich den Eindruck, dass Militärangehörige in Deutschland weniger gesellschaftlichen Respekt genießen. Als Chef der Deutschen Bank habe ich daher stets darauf geachtet, bei öffentlichen Anlässen Vertreter der Bundeswehr einzuladen.
HSG-Studium – Geld und Magie
Die Studienwahl vor der Immatrikulation an der Universität St. Gallen (HSG) ist mir nicht leichtgefallen. Ich hatte vielfältige Interessen. Jura und Politikwissenschaften reizten mich. Auch spielte ich mit dem Gedanken, ein Medizinstudium zu beginnen.
Mein Interesse für die Ökonomie stieg mit zunehmender Lektüre des Wirtschaftsteils der NZZ und meinem politischen Interesse. Zuvor hatte ich mich primär den Sportseiten gewidmet. Nach und nach rückte das Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in den Fokus. Deshalb fiel die Wahl der Universität auf die HSG in St. Gallen.
Mein Mathematiklehrer aus dem Gymnasium in Chur fand diese Entscheidung schrecklich banal. Er fragte mich, wie man als mathematikinteressierter Schüler ausgerechnet ein Ökonomie-Studium erwägen könne. Das war ziemlich wirklichkeitsfremd, weil Ökonomie durchaus viel mit Mathematik zu tun hat. Für den Lehrer war die Lehre von der Wirtschaft lediglich eine »Handelswissenschaft«.
Das Studium an der HSG ist etwas Einmaliges: die Breite der Ausbildung und das gemeinsame Interesse, die Welt zu gestalten – und all das auf engstem Raum. Das prägt die Menschen wohl stärker als sie denken.
Schon damals war die HSG eine der ältesten Handelsschulen überhaupt und die erste ihrer Art in der Schweiz. Heute ist sie eine der renommiertesten Universitäten Europas und international ausgerichtet. Wenn ich die Homepage aufrufe, habe ich den Eindruck, dass sich der Kern der Universität trotz zahlreicher struktureller Veränderungen seit 1967 nicht stark verändert hat. Ein weitgefächertes Angebot an Vorlesungen, Seminaren oder Vorträgen mit erstklassigen Inhalten. Viele Erstsemester haben sich aus Karriereüberlegungen für diese Uni entschieden. Neben den ausgezeichneten Möglichkeiten zum Networking bei zahlreichen Veranstaltungen wie dem St. Gallen Symposium, das von den Studenten seit fünf Jahrzehnten allein organisiert wird, bietet die HSG eine großartige Auswahl an Partneruniversitäten. Auf dem Campus sind nicht nur Studierende aus der Schweiz anzutreffen, sondern auch aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland und Norwegen. Die Uni ist obendrein ein erstklassiger Ort, um Freundschaften zu knüpfen. Als Pluspunkt wird überdies die Größe der HSG genannt. Der eher kleine Campus wirkt einladend und vermittelt ein familiäres Flair.
Ich hatte, wie damals üblich, bei einer alten Dame ein Zimmer gemietet. Selbstverständlich war dort kein Damenbesuch erlaubt. Erst nach der Diplomprüfung leistete ich mir dank Nachhilfestunden für Kommilitonen und einer Assistenzstelle eine eigene Wohnung.
Wegen des Militärdienstes kamen einige Kommilitonen und ich einige Wochen zu spät ins Studium. Das war mit Anfangsschwierigkeiten verbunden, denn mit dem Abitur-Zeugnis eines altsprachlichen Gymnasiums in der Tasche hatte ich von Buchhaltung oder Volkswirtschaftslehre keine Ahnung.
Wir Neuankömmlinge belegten bei den Vorlesungen meist die hinteren Plätze und verstanden praktisch nichts von dem, was der Professor vorne vortrug. Das war ein Schock. Die deutschen Studenten, darunter einige aus Unternehmerfamilien, waren besonders eifrig und sachkundig und meldeten sich ständig mit Sätzen wie: »In unserem Unternehmen sehen wir das so und verfolgen diesen oder jenen spezifischen Ansatz.« Es war beeindruckend und spornte meinen Ehrgeiz enorm an.
Um aufzuholen belegte ich in den Semesterferien die notwendigen Buchhaltungskurse und bestand die obligatorische Buchhaltungsprüfung. Bei einem Vortrag auf einer HSG-Alumni-Konferenz Jahre später sagte ich, dass ich es mir damals als Erstsemester nicht einmal im Traum hätte vorstellen können, eines Tages Chef so mancher deutscher Hochschulabsolventen zu sein.
Zu meinem Freundeskreis zählte Hanspeter Danuser, der später in St. Moritz Kurdirektor wurde. Zudem lernte ich die Headhunter Bruno Slongo und Bjørn Johansson kennen, den Hamburger Spediteur Thomas Hoyer und Michael Hilti, den Chef des gleichnamigen Milliardenkonzerns in Liechtenstein. Die Freizeitgestaltung hat Johansson in einem Interview mit dem HSG-Magazin Prisma 2008 so beschrieben: »Wir haben viel Fussball gespielt und sind oft ausgegangen. Nach der Polizeistunde in St. Gallen haben wir den Abend manchmal im Appenzell fortgesetzt. Gelegentlich sind wir im Toggenburg Ski gefahren.«
Das Studium an der HSG dauerte vier Jahre mit vielen Zwischenprüfungen. Bummelstudenten gab es kaum. Das Studium war straff organisiert, wer die Leistungen nicht erbringen konnte, musste das Studium abbrechen. Der Lehrgang war recht breit angelegt. Nach zwei Jahren spezialisierte ich mich auf Bank- und Volkswirtschaftslehre, weil mich die praktische Anwendung theoretischer Konzepte und Theorien mehr ansprach als die rein akademischen Überlegungen. 1972 bestand ich die Diplomprüfung in der Fachrichtung Bankwirtschaft mit der Note »gut bis sehr gut«.
Mit dem Diplom in der Tasche gönnte ich mir erstmal eine Auszeit. Vor der Promotion brauchte ich dringend einen Tapetenwechsel und wollte mir mit einer USA-Reise einen lang gehegten Traum erfüllen. Sechs Wochen war ich unterwegs, bereiste Texas, Kalifornien, Arizona, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco und Boston. In New York besuchte ich die Börse und in Atlanta die ausgewanderte väterliche Verwandtschaft.
In Washington zählten zu den absoluten Highlights neben dem Weißen Haus und dem Capitol die Watergate Hearings, die damals nicht nur die Medien stark beschäftigten. Ein Bekannter hatte mir eine Eintrittskarte besorgt und ich folgte stundenlang den Anhörungen zum Watergate-Skandal. Ein Politthriller, der das Land erschütterte, die Washington-Post-Reporter Bob Woodward und Carl Bernstein weltberühmt machte und 1974 zum Rücktritt von US-Präsident Richard Nixon führte.
Besonders beeindruckt war ich damals von den Machtstrukturen der »Checks and Balances« in den Vereinigten Staaten, wonach auch der mächtigste Mann der Welt nicht über dem Gesetz steht. Eine weitere Erkenntnis damals: Eine gesunde Skepsis gegenüber obersten Entscheidungsträgern ist durchaus angebracht, auch im Bankensektor. Denn immer wieder hat man es mit Menschen zu tun, die Eindruck schinden oder andere manipulieren wollen.
Das half uns im Falle des 2009 verurteilten Finanz- und Börsenmaklers »Bernie« Madoff, der seine Kunden um rund 65 Milliarden USD geschädigt hat. Wir waren vorsichtig, als man uns Madoff Investments empfohlen hatte, und forderten zusätzliche Informationen, die nie geliefert wurden. Daraufhin beschlossen wir, die Finger davon zu lassen.
Mentor und Promotion
Nach meiner USA-Reise traf ich mich an der HSG mit meinem Doktorvater, Professor Hans Christoph Binswanger, eine Kapazität auf dem Gebiet der Geldtheorie. Ich spielte damals mit dem Gedanken, an die Wirtschaftsuniversität in Wien zu wechseln. Doch Binswanger bot mir eine Assistentenstelle an, die ich als »Ritterschlag« empfand und gerne annahm, zumal ich Binswanger sehr schätzte.
Der Professor war eine der herausragenden Persönlichkeiten an der HSG, ein kreativer Kopf und ein ausgesprochen liebenswürdiger Mensch. Binswanger war in Überlingen am Bodensee aufgewachsen und durch seine Originalität einzigartig. Er strahlte eine besondere Aura der Souveränität aus und war eines der seltenen Universalgenies.
Ursprünglich wollte er Filmregisseur werden, studierte dann aber Ökonomie. Sein Interesse und seine Kompetenz für den Film sind aber geblieben. Er war in Geschichte, Philosophie, Religion oder Literatur besonders gebildet und hat wahrscheinlich als erster Ökonom die ganze Ökologie-Diskussion initiiert. Dabei standen die Zusammenhänge zwischen Wachstum und Raubbau an der Natur im Vordergrund. Auch europäische Themen, Währungsfragen und die Geldtheorie, letzteres war seine Habilitationsschrift, interessierten ihn stark. Diese Vielseitigkeit zog mich an. So versucht er zum Beispiel in seinem 2005 erschienenen Buch »Geld und Magie« eine ökonomische Deutung von Goethes »Faust«. »Faust« war für meinen Lehrer, Mentor und späteren Freund von einer unglaublichen Aktualität und das modernste aller Dramen. Das Stück symbolisierte für ihn die Faszination, die von der Wirtschaft ausgeht.
Ihr »Gedeihen« oder Wachstum, schrieb Binswanger, ist längst zum einzigen verbindlichen Maßstab für die Entwicklung der Menschheit geworden. Goethe erklärt die Wirtschaft als einen »alchemistischen« Prozess, als die Suche nach dem künstlichen Gold. Eine Suche, die sich für die »Goldgräber« schnell in eine Sucht verwandelt. Wer die »Alchemie der Wirtschaft« nicht versteht, so lautet die Botschaft, kann das ungeheure Ausmaß der modernen Wirtschaft nicht erfassen. Diese gigantische Dimension etwa der Finanzmärkte ist heute aktueller denn je.
Für das eigentliche Anliegen der Alchemie im Sinne einer Vermehrung des Reichtums ist ja nicht entscheidend, dass Blei in Gold transmutiert wird, sondern lediglich, dass sich eine wertlose Substanz in eine wertvolle verwandelt. Beispielsweise Papier in Geld. Oder in Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds (IWF). Oder in das Schürfen von Kryptowährungen über riesige Server und Transaktionen via Blockchain-Technologie, um Banken als Vermittler auszuschalten.
Wir können den Wirtschaftsprozess als Alchemie deuten, wenn man an zu viel Geld ohne die entsprechende Anstrengung kommen kann. Wenn also eine echte Wertschöpfung ein ständiges Wachstum von Wirtschaft ohne Limits ermöglicht, welches sich immer schneller entwickelt und in diesem Sinne als Zauber oder Magie verstanden werden kann. Wer den »Faust« aufmerksam liest, wird klar erkennen, dass Goethe der modernen Wirtschaft einen solch alchemistischen Kerngehalt zuweist. Das verleiht der Wirtschaft ihre ungeheure Anziehungskraft, sodass sie allmählich auch alle anderen Lebensbereiche in ihren Sog zieht. Es geht um kontinuierliches Wachstum der Produktion ohne eine entsprechende Erhöhung des Leistungsaufwands.
Mit dieser Auffassung vom alchemistischen Kerngehalt der Wirtschaft stellt sich Goethe, der ja am Weimarer Hof als Minister für wirtschaftliche Fragen die Entwicklung der industriellen Revolution bewusst miterlebt hat, in einen diametralen Gegensatz zur klassischen Nationalökonomie. Nach dieser Lehre ist ausschließlich die Arbeitsleistung die Ursache von Wohlstand oder Reichtum. Sei es durch direkte Arbeit oder indirekte (durch Ersparnisse), die zu Kapital geworden ist.
Adam Smith, der Begründer der klassischen Nationalökonomie, schreibt 1776 in seinem Standardwerk über den Reichtum der Nationen: »Arbeit war der erste Preis oder ursprünglich das Kaufgeld, womit alles andere bezahlt wurde. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit Arbeit wurde aller Reichtum dieser Welt letztlich erworben.«
Diese Auffassung ist in der heutigen Nationalökonomie zwar dahingehend modifiziert worden, dass neben der Arbeit auch das Kapital und der technische Fortschritt als selbstständige Größen erscheinen. Alle drei Produktionsfaktoren aber werden als Resultat menschlicher Leistungen gedeutet: die Arbeit als Leistung des Fleißes, das Kapital als Leistung des Konsumverzichts (des Sparens) und der technische Fortschritt als Leistung des Lernens und Forschens. Im Grundsätzlichen ist daher bis heute die Nationalökonomie der klassischen Auffassung von der Wertschöpfung durch Leistung und nur durch Leistung treu geblieben. Demgegenüber enthält der zweite Teil des »Faust« die explizite Behauptung: Der Ursprung des Reichtums ist neben der Leistung auch die Magie, im Sinne der Schaffung von Mehrwerten, die nicht durch Leistung erklärt werden können.