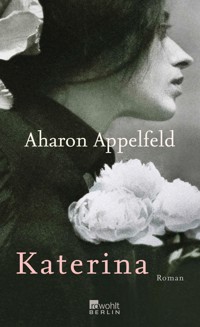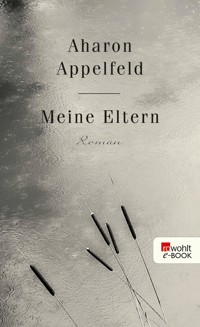
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Familienbild vor der Katastrophe: Aharon Appelfelds Roman über den letzten Sommer einer Kindheit August 1938: Am Ufer des Flusses Prut in Rumänien versammeln sich die Sommerfrischler, überwiegend säkularisierte Juden, darunter ein Schriftsteller, eine Wahrsagerin, eine früher mit einem Christen liierte Frau, die nun auf Männerschau ist. Auch der zehnjährige Erwin und seine Eltern sind hier, doch das Kind spürt, dass etwas anders ist: Hinter den Sommerfreuden, den Badeausflügen und Liebeleien geht die Welt, die alle kennen, zu Ende. Einige reisen früher ab, andere verdrängen die Nachrichten aus dem Westen. Spannungen bleiben nicht aus, auch nicht zwischen den Eltern, der Mutter, die Romane liest, an Gott glaubt und an das Gute, und dem Vater, dem Ingenieur, der alles rational und pessimistisch sieht. Als die Familie in die Stadt aufbricht, überfällt Erwin die Furcht. In der Schule wurde er geschlagen und als «Saujude» beschimpft – und er beginnt zu ahnen, dass an den unterschiedlichen Haltungen seiner Eltern noch viel mehr hängt: die Zukunft, das Überleben. Ein feinfühliger Roman, der seismographisch die Brutalität des heraufziehenden Krieges verzeichnet – und zugleich das Porträt einer bürgerlichen Welt vor der Katastrophe. Eines der persönlichsten Bücher von Aharon Appelfeld, direkt, ehrlich und doch auch kindlich-schön.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Aharon Appelfeld
Meine Eltern
Roman
Über dieses Buch
Familienbild vor der Katastrophe: Aharon Appelfelds Roman über den letzten Sommer einer Kindheit.
August 1938: Am Ufer des Flusses Prut in Rumänien versammeln sich die Sommerfrischler, überwiegend säkularisierte Juden, darunter ein Schriftsteller, eine Wahrsagerin, eine früher mit einem Christen liierte Frau, die nun auf Männerschau ist. Auch der zehnjährige Erwin und seine Eltern sind hier, doch das Kind spürt, dass etwas anders ist: Hinter den Sommerfreuden, den Badeausflügen und Liebeleien geht die Welt, die alle kennen, zu Ende. Einige reisen früher ab, andere verdrängen die Nachrichten aus dem Westen. Spannungen bleiben nicht aus, auch nicht zwischen den Eltern, der Mutter, die Romane liest, an Gott glaubt und an das Gute, und dem Vater, dem Ingenieur, der alles rational und pessimistisch sieht. Als die Familie in die Stadt aufbricht, überfällt Erwin die Furcht. In der Schule wurde er geschlagen und als «Saujude» beschimpft – und er beginnt zu ahnen, dass an den unterschiedlichen Haltungen seiner Eltern noch viel mehr hängt: die Zukunft, das Überleben.
Ein feinfühliger Roman, der seismographisch die Brutalität des heraufziehenden Krieges verzeichnet – und zugleich das Porträt einer bürgerlichen Welt vor der Katastrophe. Eines der persönlichsten Bücher von Aharon Appelfeld, direkt, ehrlich und doch auch kindlich-schön.
Vita
Aharon Appelfeld wurde 1932 in Czernowitz geboren. Nach Verfolgung und Krieg, die er im Ghetto, im Lager, dann in den ukrainischen Wäldern und als Küchenjunge der Roten Armee überlebte, kam er 1946 nach Palästina. In Israel wurde er später Professor für Literatur. Seine hochgelobten Romane und Erinnerungen sind in vielen Sprachen erschienen, auf Deutsch zuletzt «Ein Mädchen nicht von dieser Welt» und «Auf der Lichtung». Aharon Appelfeld, der unter anderem mit dem Prix Médicis und dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet wurde, lebt in Jerusalem.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
«Avi we-imi» Copyright © 2013 by Aharon Appelfeld
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung Tamás Miklya/EyeEm/Getty Images
ISBN 978-3-644-10054-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Im Lauf meines Schreibens kehre ich immer wieder in das Haus meiner Eltern in der Stadt und in das Haus meiner Großeltern in den Karpaten zurück, und auch an die anderen Orte, wo ich Zeit mit ihnen verbrachte. Ich sage, ich kehre zurück, aber das ist nicht ganz richtig. Denn die Häuser meiner Eltern und meiner Großeltern sind fast immer um mich, obwohl es sie schon lange nicht mehr gibt. Dies sind meine festen Orte, die ich immer um mich spüre, die ich aufleben lasse, und es gibt Tage, an denen das Bedürfnis, ganz dort zu sein, noch drängender wird: aus Müdigkeit, Niedergeschlagenheit und einem Gefühl des Ausgelaugtseins.
Die Rückkehr zu diesen Häusern, nach Hause, bereitet mir meist Freude, verbunden mit großer Erregung. Ich habe in meinem Leben in vielen Häusern gewohnt, doch die Sehnsucht nach dem Haus meiner Eltern ist immer gleich stark geblieben. Es gibt Tage, an denen ich mich im Haus der Eltern niederlasse, und es gibt Tage, an denen ich im Haus meiner Großeltern verweile. Die Fülle, die sie mir bieten, ist grenzenlos.
Diese Häuser stehen scheinbar noch so, wie ich sie vor langer Zeit verlassen habe, dem ist aber nicht so: Die Jahre haben alles Vorübergehende und Überflüssige von ihnen entfernt. Was blieb, ist der Junge, der sich über alles, was um ihn geschieht, immer wieder von neuem wundert, damals wie heute.
Die schöpferische Arbeit braucht diesen Blick des Kindes. Wenn du das Kind in dir verlierst, wird der Gedanke zur Gewohnheit, du entfernst dich unmerklich vom Staunen, vom ersten Blick, und das schwächt den schöpferischen Prozess. Ohne das kindliche Staunen wird man ernsthaft, und das Denken füllt sich mit Zweifeln: Alles wird penibel untersucht, gegen alles kann man Einwände finden, und am Ende bist du innerlich zerklüftet, nichts bleibt außer schartigen, schneidenden Worten.
Das erste Haus, die Rückkehr dorthin und der Aufenthalt in ihm, hat jedes meiner Bücher genährt. Ich schreibe keine Erinnerungsliteratur. Das Bewahren und Festhalten von Erinnerungen ist ein antikünstlerischer Ansatz. Zwar ist das, was ich in meiner Kindheit und frühen Jugend erlebt habe, der Boden, aus dem mein Schreiben erwächst. Diesen Erlebnissen füge ich immer andere Erfahrungen hinzu, aber ohne das erste Haus, ohne dessen Fundament und Dach, würde ich mich in einem Meer von flüchtigen Gedanken und Widersprüchen verlieren, und statt Literatur zu schreiben, versänke ich in Grübeleien und ziellosen Bemühungen. Nur mit dem geheimen Blick des Kindes kann man etwas erschaffen; und dieser Blick ist nicht etwa mit einem literarischen Trick zu verwechseln.
Der Moment, in dem der Blick des Kindes durch die Dunkelheit der vergangenen Jahre bricht, verspricht dir neue Einsichten, Klarheiten und Wortschöpfungen, die jahrelang in dir verborgen waren und die sich dir jetzt offenbaren. Das gespannte kindliche Staunen wischt plötzlich den Staub der Jahre von den Erscheinungen, von den Menschen, sie stehen dir vor Augen wie beim ersten Mal, und du wünschst dir aus ganzem Herzen, dass diese Gnade nie aufhören möge.
Das Schreiben eines Buchs ist eine lange Reise. Wie bei jeder Reise gehören Zweifel, Irrtümer, verzweifelte Gedanken und unruhiger Schlaf dazu. Schreiben ist die Berührung mit dir selbst und mit den Gestalten, die du getroffen hast, Menschen, die du gut kanntest, und andere, die mit einem Lächeln an dir vorbeizogen und wieder aus deinem Leben verschwanden, und es gibt Menschen in der Tiefe deiner Seele, die sich dir in den Wirren der Zeit nicht so gezeigt haben, wie sie es hätten tun sollen, die in der Vergessenheit versunken sind; aber keine Sorge, auf deinem Weg werden sie sich dir, wenn du Glück hast, zeigen und deine Welt erweitern.
Das Schreiben gleicht aus vielen Gründen den Reisen, die ich mit meinen Eltern im Sommer zu meinen Großeltern in den Karpaten unternahm. Alles, was ich sah, war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte, die Landschaft war anders, die Menschen waren anders. Die Bilder drangen von allen Seiten auf mich ein, und es war gut, dass meine Mutter einfach neben mir saß und mein Staunen begleitete, ohne meine Aufmerksamkeit auf irgendwelche Dinge zu lenken oder sie zu erklären. In ihrer Zurückhaltung erlaubte sie den Bildern, dass sie direkt in mein Inneres eindrangen. Durch die Stille nahm ich sie erst wahr. Die Stille ist das Geheimnis jeder Kunst. In der Stille sehen und hören wir mehr.
Nach etlichen Vorbereitungen machst du dich auf die Reise. Anfangs glaubst du, der Weg sei gut gebahnt und du würdest angenehm und mit Tempo vorwärtskommen. Doch es dauert nicht lange, da vergeht dir der Optimismus. Die ersten Sätze, die dir so leicht und flüssig in den Sinn kamen, wehren sich jetzt dagegen, in Buchstaben gefasst zu werden.
Schon bald wird dir klar, dass es nicht so leicht wird, die richtigen Worte für deine Gefühle zu finden, auch nicht für das Bild einer Landschaft und schon gar nicht für ein menschliches Gesicht. Du lernst von neuem, dass Worte keine Gefühle und keine Bilder sind, sie können höchstens auf sie hinweisen. Adjektive, von denen wir uns helfen lassen wollen, erweisen sich oft als Schabracken. Worte wie schön, wunderbar, großartig sind schnell Dekoration, werden fadenscheinig. Etwas zu beschreiben oder zu erzählen ist eine Aufgabe, die deine ganze Kraft erfordert. Deshalb spürst du nun plötzlich die Müdigkeit, schon zu Beginn der Reise. Die Zuversicht, dass du alles erzählen und mit den richtigen Worten beschreiben kannst, erweist sich als trügerisch.
Und trotz aller Irrtümer und Hindernisse versuchst du nun wieder, die Bilder in Buchstaben zu kleiden. Diese Sisyphusarbeit wird dich auf dem ganzen Weg begleiten.
Es gibt Wörter, die Licht in sich bergen, die helfen, das Bild zu erschaffen und die Vorstellung einer Sache wiederzugeben, und es gibt Wörter, die aus irgendeinem Grund Abfall sind, denen es an Lebendigkeit fehlt. Wenn du Glück hast, dann ebnen dir die erhellenden Wörter den Weg, aber meistens mischen sich die hellen und die wertlosen Wörter, und deshalb ist die Schreibarbeit schwer und voller Enttäuschungen.
Doch auf wunderbare Weise befreist du dich wieder von diesem Druck und gehst erneut los. Diesmal bewegst du dich vorsichtig vorwärts, mit einer Aufmerksamkeit, die jeden Moment angespannter wird; wie in deiner frühen Kindheit, wenn du aus der Seitentür des Hauses getreten bist, angezogen vom Anblick des dämmrigen Hains. Du hattest dich gar nicht weit entfernt, doch die wenigen Schritte, die du in den verdächtigen Schatten der Bäume gemacht hast, dieses wache Zögern kehrt jetzt zu dir zurück, wenn du am Beginn eines neuen Buchs stehst und dich ins Unbekannte aufmachst.
Vorsicht, Besorgnis und Furcht werden ab jetzt deine Begleiter sein: Was sollst du sagen, was nicht? Aus lauter Vorsicht radierst du auch das Nützliche weg. Mehr als einmal überfällt dich Mattigkeit mitten auf der Strecke – es ist keine Müdigkeit, sondern ein Gefühl des Versagens, der Verzweiflung. In dieser Mattigkeit prüfst du alles, was du getan und erzählt hast, wie mit dem Brennglas. Alle Schwächen und Ungenauigkeiten, alles, was du verheimlichen wolltest, tritt überdeutlich hervor, und es ist nur gut, dass in dem ganzen Durcheinander überraschenderweise eine breite, friedliche Grundlage erscheint: Es ist der Garten der Großeltern, mit Blumen und Gemüsebeeten, alten Obstbäumen, die jedes Jahr blühen und Früchte tragen. Und der Großvater und die Großmutter, die staunen, dass ich trotz aller Hindernisse zu ihnen gekommen bin. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich nach ihnen gesehnt habe.
Hier gibt es Dinge, die die Stadt nicht bietet: Erde, Gras, Tiere, fließende Bäche, hohe Bäume und den Himmel darüber. Und, noch wichtiger, den Glauben. Mein Großvater und meine Großmutter, die klein gewachsenen Gestalten, sie gleichen Kindern. Ihre Augen sind voll von Staunen. Mein Vater und meine Mutter wirken verlegen. Die Jahre in der Stadt haben ihnen die Naivität geraubt, die sie auch einmal besaßen. Ich bin so froh, dass wir angekommen sind, dass ich mich vor lauter Freude nicht von der Stelle rühren kann.
2
Diesmal kehre ich zu der Bauernhütte am Fluss Pruth zurück, die meine Eltern für den Sommerurlaub gemietet haben. Es ist ein bescheidenes Haus, in das wir jeden Sommer fahren, doch ist es kein zufälliger Ort. Jedes Jahr verbringen wir einen Monat dort, umgeben von einfachen und starken Bildern der Natur: ein Feld mit gelben Sonnenblumen, silbernen Pappeln, die Tag und Nacht säuseln, hohes, dichtes Schilf, in dem Vögel nisten, deren helles Pfeifen mich nachts weckt.
Die Hütte ist nicht groß: zwei kleine Zimmer, eine Küche, die auch als Esszimmer dient. Vor der Hütte liegt ein kleiner Hof, daneben ein Gemüsegarten, zwei Kirschbäume und ein Rosenbeet.
Früh am Morgen bringt uns der Besitzer ein rundes Bauernbrot, Eier, Milch und Käse. Der Gemüsegarten steht uns zur Verfügung, und meine Mutter stellt Gurken, Tomaten, Radieschen und junge Zwiebeln auf den Tisch, frisch aus dem Beet. Viele Geschmäcker und Gerüche haben meine Kindheit begleitet, doch an den Geschmack des Gemüses aus jenem Garten erinnere ich mich bis heute.
Die Zeit vom Morgen bis zum späten Nachmittag verbringen wir am Flussufer, schwimmen und lassen uns in der Sonne braun werden. Es gibt nicht viele Sommergäste außer uns, und die anderen sind leicht an ihrer bunten Erscheinung zu erkennen. Nur die jüdische Bürgerschicht kann sich einen Monat Urlaub in dieser ländlichen Gegend am Fuß der Karpaten erlauben.
Am frühen Abend sitzen wir vor der Tür der Hütte, trinken Kaffee und betrachten lange, wie die Sonne sinkt und es immer dunkler wird, bis tief in den Abend hinein. Die Abende sind lang zu dieser Jahreszeit, und sie bewahren einen Rest des Sonnenlichts bis nach Mitternacht. Die Dunkelheit ist grau, und das in ihr bewahrte Licht erlischt nicht ganz.
Abends gehen wir nicht zum Fluss, wir betrachten ihn nur von weitem, lauschen seinem Murmeln und lassen in uns nachwirken, was wir tagsüber gesehen haben. Gegen Mitternacht zerteilt meine Mutter eine Wassermelone, deren Farbe das Auge erfreut und deren Geschmack den Gaumen.
Die meisten Stunden des Tages verbringen wir am Ufer des Pruth. Der Fluss ist nicht breit und in dieser Jahreszeit auch nicht reißend, doch niemand sollte sich durch den friedlichen Anblick täuschen lassen: Nicht erst einmal ist hier ein Kind ertrunken.
Meine Eltern passen mit sieben Augen auf mich auf, doch diese Aufmerksamkeit hindert mich nicht daran, die große Frau zu betrachten, die sich am Ufer ausgestreckt hat, ein Sonnenbad genießt und sich fast nicht von ihrem Lager bewegt. Ihr Mann, viel kleiner als sie und sehr schmal, steht neben ihr und kredenzt ihr Limonade wie einem kleinen Mädchen.
Nicht weit von diesem Paar sitzt ein einbeiniger Mann. Den Bemerkungen meines Vaters habe ich entnommen, dass er über viel Besitz in der Stadt verfügt und an der Zuckerkrankheit leidet. Die Ärzte waren gezwungen, ihm das Bein abzunehmen. Er sitzt allein, weit entfernt von den anderen. Die Militärkappe, die er auf dem Kopf trägt, betont sein Einzelgängertum.
Um uns herum sind nur Berge und glänzendes Wasser. Manchmal ist mir, als würde ein Orchester gleich einen Walzer spielen, wie sonntagmorgens im Stadtpark, und die Leute würden zu tanzen anfangen.
Die meisten Menschen sind im Alter meiner Eltern, manche jünger, aber auch einige ältere waren schon hier; ihre Gliedmaßen haben schon einiges durchgemacht, weshalb manche hinken, an Krücken gehen oder im Rollstuhl gefahren werden. Das Wasser und die Sonne tun, wie sich herausstellt, den alten Leuten nicht gut, nach kurzer Zeit kehren sie mit ihren Helferinnen in die Stadt zurück.
Viele erstaunliche Menschen umgeben mich. Vor dem Schlafen habe ich noch ein paar von ihnen im Gedächtnis, die ich mir nun genauer anschaue. Der einbeinige Mann ist nicht etwa traurig, wie ich gedacht hatte. Er presst seine Lippen zusammen, schaut sich mit bitteren, manchmal verächtlichen Blicken um. Jedes Mal, wenn er die große Frau erblickt, der ihr Mann Limonade serviert, erfüllt sich sein Blick mit Abscheu.
Nachts, vor dem Schlafen, sieht alles anders aus als am Tag. Die Bilder drängen sich zusammen, nur die unterschiedlichen, erschreckenden Menschen bleiben an ihrem Platz. Nicht von ungefähr hat mir meine Mutter einen guten Schlaf ohne Albträume gewünscht und mich auf die Stirn geküsst. Doch dann wache ich aus einem Albtraum auf, schwitzend und zitternd. Meine Mutter hat immer wieder versucht, mich aus diesem Pfuhl herauszuziehen, doch die erschreckenden Menschen hören nicht auf, mich zu bedrängen.
Und da ist noch etwas. Oder eigentlich nichts: das Weinen. Ich weine nicht. Meine Mutter macht sich Sorgen, ich könne nie mehr weinen. Nicht einmal, wenn ich eine Spritze bekam, weinte ich. Mein Vater ist stolz auf meine Selbstbeherrschung. Ein weinender Mensch ist arm dran, er kann sich nicht zusammenreißen und erweckt nur Mitleid.
In seiner Kindheit weinte mein Vater oft, wie er uns gestand, doch er erzog sich selber, um damit aufzuhören. Meine Mutter fürchtet, mein Vater könne mir seine Entschlossenheit, das Weinen zu unterdrücken, vererbt haben. Sie hat nicht recht. Oft entdecke ich in den Augen meines Vaters etwas Feuchtes, und daran sehe ich, dass er den Tränen nahe ist. Als seine älteste Schwester Zila starb, sah ich Tränen in seinen Augen. Mehr als das erlaubte er sich nicht. Auch meine Mutter weint nicht laut, doch manchmal laufen ihr Tropfen über die Wangen, und sie wischt sie schnell weg.
Als ich in der zweiten Klasse war, schlug mich einer der starken Jungen und schrie: Und jetzt weine! Ich sagte mir, ich werde nicht weinen. Seither, glaube ich, kann ich das Weinen unterdrücken. Mehr noch, ich brauche es nicht. Wenn mir etwas weh tut, presse ich die Lippen zusammen oder balle die Hände zu Fäusten.
Meine Mutter macht sich trotzdem Sorgen. Sie sagt immer wieder: Kinder müssen weinen, wenn ihnen etwas weh tut, das Weinen erleichtert den Schmerz. Sie weiß nicht, dass sich das Kind in mir schon versteckt hat.
Doch die Träume kann ich nicht beherrschen, sie platzen in meinen Schlaf und erfüllen mich ganz. Solange keine Ungeheuer oder andere blutrünstige Geschöpfe auftauchen, träume ich ganz gern. Ich habe meine Mutter gefragt, ob man sich vor Träumen schützen könne. Diese Frage erschreckte meine Mutter, sie sagte: «Das können wir nicht. Über den Schlaf und über Träume haben wir keine Macht. Ein Mensch will nicht träumen, er träumt einfach.»
«Ist das ein Geschenk oder ein Fluch?», fragte ich.
«Der Traum ist ein Geschenk Gottes, wir sind damit gesegnet. Gott hat uns mit einer Fülle von Geschenken gesegnet: Wir sehen, wir hören, wir schmecken, wir riechen und wir träumen. Was täten wir ohne diese Geschenke?»
Meine Mutter spricht vor dem Schlafen oft über Gott, manchmal habe ich das Gefühl, als sei dies ein Geheimnis zwischen ihr und mir. Mein Vater benutzt das Wort Gott nicht. Unser Dienstmädchen spricht viel über Gott. In ihrem Sack hat sie eine Ikone, die sie auf die Kommode stellt, sich vor sie hinkniet, die Hände faltet und betet. Meine Mutter benutzt dagegen nie die Wörter und Sätze, die mein Vater oft sagt: Das ist der Beweis, der Beleg, es gibt ein Früher und ein Später. Unsere Vorväter haben geglaubt, was sie glaubten, und wir überprüfen nach und nach ihren Glauben.
Wenn mein Vater seine Grundsätze verkündet, betrachtet ihn meine Mutter, als wäre er nicht ihr Ehemann, sondern ein Verwandter, der sie immer wieder in Verwunderung versetze.
3
Jahre vergingen, bis ich mich dem Schlaf und dem zu ihm gehörenden Traum hingeben konnte. Mit der Zeit verstand ich, dass Schlaf und Traum mehr der Kunst als der Realität angehören. Die Realität ist voller Chaos, voller Widersprüche, und sie enthält zu viele Kleinigkeiten, die nicht alle Bedeutung haben.
Der Schlaf und der Traum sind Wegweiser für jeden Künstler, der sich aus dem Chaos ziehen will, das uns alle umgibt. Der Traum siebt die Realität und lässt die wichtigen, notwendigen Details zurück. Auch in der Kunst reichen ein paar richtige Details aus, um eine Figur zu erschaffen und ihr Leben einzuhauchen.
Jahrelang wurde der Traum als Durcheinander angesehen. Nur große Künstler wie zum Beispiel der, der die Geschichte Josefs geschrieben hat, wussten, dass der Traum keine Imitation der Realität ist, sondern ihr erst Bedeutung verleiht.
Mein Vater weigert sich, dem Traum eine Bedeutung zuzumessen. Bei dieser Diskussion wie bei anderen Auseinandersetzungen mit meiner Mutter bin ich schweigender Zeuge. Ein Streit, erhobene Stimmen, das bringt mich zum Schweigen. Nach lautem Reden fällt es mir schwer, einen Ton herauszubringen.
Oft geriet ich in den langen Jahren meines Schreibens in Schwierigkeiten, die rechten Worte zu finden, und stand so hilflos da wie in jener frühen Zeit, als ich gern etwas über mein Staunen und Erschrecken gesagt hätte, aber die wenigen Worte, die ich hatte, nützten mir nichts, und ich biss mir auf die Lippe und schwieg.
Sind die fehlenden Worte immer ein Nachteil? Manchmal, zu Beginn meines Schreibens, hatte mich das Fehlen der Worte regelrecht in Atemnot versetzt. Erst im Lauf der Zeit habe ich gelernt, dass Wortfindungsschwierigkeiten, Stottern, fehlerhafte Sätze, alle Mängel des schlechten Schreibens, zuweilen Vorteile bieten. Fließende und geschickte, lange Sätze verstecken manchmal nur die Leere. Eine Fülle an wohlgeordneten Worten enthält oft viel Überflüssiges.
Manchmal ist das Stammeln aus Not der wahre Ausdruck. Ich verdanke, wem auch immer, dass ich meine Kindheit unter nicht wenigen Menschen verbrachte, die sich schwerfällig ausdrückten, die stammelten und nach den richtigen Worten suchten. Sie waren es, die mir etwas über Bedrängnis und Not beibrachten, und auch etwas übers Schreiben.
Die Ferien, die wir am Pruth verbrachten, einen Monat lang und manchmal sogar länger, hinterließen mir eine Reihe von Bildern und Menschen, die mich sowohl an freudigen wie an traurigen Tagen begleiteten. Sie haben immer wieder mein Schreiben beflügelt, und jedes Mal, wenn ich einen Mangel an Worten empfinde, taucht ein Stück der Uferlandschaft vor mir auf oder ein Mann mit schmerzerfüllter Miene oder einer mit ironischem Gesichtsausdruck. Der schmerzerfüllte Mann presst die Lippen zusammen und bringt kaum ein Wort heraus. Der mit dem ironischen Gesicht verfügt über eine Fülle von Wörtern, er feilt sie, setzt sie aneinander, und am Schluss zieht er sie wie Schwerter aus dem Mund, als wäre er ein Zauberer.
Da ist der Blick des Besitzers der Hütte, Nikolai, der uns jedes Jahr bei der Ankunft erwartet. Ein Bauer mittleren Alters, misstrauisch. Er sagt immer: «Gut, dass ihr wieder zu mir gekommen seid», als habe unterwegs jemand versucht, uns eine bessere oder billigere Hütte anzubieten. Wir kommen zwar jedes Jahr zu ihm, doch das beschwichtigt sein Misstrauen nicht.
Einmal kam er mit seiner Frau: eine Schönheit und viel jünger als er. Er beschimpfte sie laut. Vermutlich misstraute er ihr, was weiß man schon. Doch ausgerechnet seine junge Frau, nicht er, erschien mir einige Male im Traum, in einem bunten Bauernkleid, sie lächelte mich listig an und sagte: «Beachte sein Schimpfen nicht. Ich tue, worauf ich Lust habe. Wenn du zu mir kommst, gebe ich dir was, das dir gefällt.»
Nikolai misstraute auch den Juden. Er glaubte, sie wollten ihn reinlegen, verbergen etwas vor ihm, zahlen ihm zu wenig. Das Misstrauen sah man schon in seinem Blick, und manchmal konnte er seine Zunge nicht zügeln und sagte zu meinem Vater: «Sie sind ein anständiger Mensch, aber die anderen Feriengäste betrügen uns immer.»
«Warum lassen Sie sich von ihnen betrügen?»
«Ich habe es bei Ihnen, Gott sei Dank, mit einem anständigen Mann zu tun, aber jeder Feriengast hier wird bei der richtigen Gelegenheit zum Verbrecher, vor dem man sich in acht nehmen muss.»
«Sie übertreiben, Nikolai», beschwichtigte mein Vater ihn wie einen alten Bekannten.
«Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen etwas im Namen meiner Vorväter sage. Mein Großvater, er ruhe in Frieden, meinte immer: ‹Verlass dich nie auf Juden oder Zigeuner. Sie legen dich immer rein und hauen dich übers Ohr.›»
«Nicht alle», sagte mein Vater mit einem Blick, der Nikolai ganz umfasste und die Diskussion beendete.
Die meisten Träume, da kann man nichts machen, sind nicht angenehm. Das Lachen der Frau, die P. heißt, die den ganzen Tag am Ufer liegt, ist im Traum wilder, als es war. Manchmal verwandelt sich ihr Lachen in ein ersticktes Husten, dann wird ihr Gesicht ganz rot. Der einbeinige Mann betrachtet sie, als wolle er ihr seine Hilfe anbieten. Zuweilen glaube ich, sie wisse Geheimnisse, und das sei der Grund für ihr Lachen.
Viele Geheimnisse verbergen sich hier: Da hat einer Konkurs gemacht und versinkt in Gram, der andere ist fröhlich wie ein schadenfroher Junge.
Einmal höre ich, wie sich der einbeinige Mann an einen anderen Feriengast wendet und sagt: «Sie leben in einer Scheinwelt. Bald werden Sie die Realität kennenlernen.» Der Mann hebt erstaunt den Kopf, erschrocken über den Schlag, der ihn da trifft.
Der einbeinige Mann redet in autoritärem Ton, als wisse er etwas, was die meisten anderen nicht wissen oder nicht wissen wollen. Seltsam: Niemand diskutiert mit ihm oder bringt ihn zum Schweigen.
4
Die Nähe zu meinen Eltern war nie unterbrochen, doch sie wirkten auf mich nie gemeinsam ein, sondern jeder für sich. Wenn ich eine Geschichte oder einen Roman schreibe, begleitet mich der Rhythmus der Stimme meiner Mutter zu den Toren der Phantasie. Wer meine Mutter kannte und sich an ihre Stimme erinnert, sagt, meine Stimme sei der ihren sehr ähnlich.
Der Rhythmus ist die wahre Kraft, die meine Finger über das Papier treibt. Wenn der Rhythmus schweigt, fehlt mir der Schwung, als wären meine Flügel gekappt. Manchmal kommt der Rhythmus schnell zurück, doch manchmal entzieht er sich für Tage oder gar Wochen.
Schreibblockaden machen mich unruhig. Mein Zimmer verwandelt sich in einen Käfig, ich renne in ein Café, um die Unruhe mit zwei Tassen Kaffee zu betäuben. Früher habe ich ein paar Gläser Cognac gebraucht. Doch wenn der Rhythmus zu mir zurückkehrt, kehren auch die Worte aus ihrem Exil heim, die Sätze fließen, und die Handlung setzt sich zusammen, auch die richtigen Wörter kommen aus ihrem Versteck und tun das ihre dazu.
Die Musik habe ich von meiner Mutter geerbt, sie hat immer leise vor sich hin gesungen. Ich habe ihr gern dabei zugehört. Erstaunlich, wie nahe ich mich ihr fühle, auch jetzt, da ich doppelt so alt bin, wie sie es damals war.
Einmal sagte ein Bekannter: «Ich habe keine Beziehung zu meinen verstorbenen Eltern.» Ich erschrak, wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Er kam mir wie ein Krüppel vor, dem man helfen musste. Plötzlich sah er mich an, als wolle er sagen: «Siehst du mir nicht an, wie sie mich verletzt haben? Ich habe Jahre gebraucht, die Wunden zu versorgen, die sie mir zugefügt haben. Jetzt sind sie verkrustet und vernarbt. Meine Eltern waren meine Feinde, und wenn ich an sie denke, erschrecke ich immer wieder.»
«Warum?», fragte ich.
«Das frage ich mich auch.»
An meinen Vater erinnere ich mich immer, wenn ich einen Essay schreibe. Für einen Essay braucht man klare Gedanken, die richtige Mischung von Tatsachen und Argumenten. Mein Vater schrieb keine Essays, doch ich spüre, dass diese Form zu ihm gepasst hätte, und es tut mir leid, dass er sein Wissen und sein Talent nie umsetzen konnte. Hätte er geschrieben, so scheint es mir, hätten sich die ständigen Wogen seiner Ironie und seines Sarkasmus beruhigt, und er hätte sich mit Leib und Seele der schöpferischen Arbeit hingegeben.
Was hatte meinen Vater davon abgehalten, weiterzukommen und sich hervorzutun? Meine Mutter, die ihn besser kannte als jeder andere, sagte, mein Vater habe schon in seiner Jugend viel zu hohe Erwartungen an sich selbst gehabt, und das habe ihn behindert. Und sofort fügte sie hinzu: «Wer kennt die Seele eines Menschen? Wir können nur Vermutungen anstellen, doch wir wissen nichts über unsere wahren Motive und unsere wahren Hemmnisse. Jedenfalls darf man den anderen nicht einfach verurteilen.»
Mein Vater hebt oft den Kopf, drückt den Rücken durch und bekennt: «Ich habe es versäumt, ich hatte ja Talente, aber ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ja, ich habe den Tadel verdient.»
5
Bis ich zehn Jahre alt war, also bis der Krieg uns erreichte, kehrten wir jedes Jahr in die Hütte zurück. Ich las in jenen Ferien sehr viel, vor allem Jules Verne. Seine Geschichten, die ich damals sehr aufregend fand, habe ich in den Jahren des Kriegs vergessen, nicht aber die Menschen, die ich am Ufer getroffen habe.
Die Frauen waren auffälliger als die Männer. Sie waren leidenschaftlich. Sie schmeichelten den Männern fast schamlos. Meine Eltern bemühten sich vergeblich, solche verbotenen Anblicke von mir fernzuhalten. Diese bürgerlichen Juden waren sonst in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend, doch an der frischen Luft und am Wasser wuchs ihre Lust, und sie ergriff nicht nur die jungen Leute.
Die Menschen fuhren weite Strecken, um hier ein wenig Ruhe zu finden, aber was konnte man machen, ausgerechnet das Ufer, die Sonne und das Wasser erweckten nicht nur die Erinnerung an Abenteuer aus vergangenen Tagen und verdrängte Kränkungen, sie kehrten auch den Hunger nach ungewohnten körperlichen Betätigungen hervor und auf Wörter und Ausdrücke, die man in keinem Wörterbuch findet. Ich verstand diesen Zusammenhang natürlich nicht. Mich bedrängten die Stimmen, und was ich da alles sah, erfüllte mich mit Bildern. Kein Wunder, dass ich nachts verschwitzt und verängstigt aufwachte.
Mein Vater betrachtet das, was am Ufer geschieht, eher mit ironischem Blick. Meine Mutter kennt keine Ironie. Sie sieht jeden Menschen mit weit geöffneten Augen an, als wolle sie ihm sehr nahe kommen. Menschen wecken Freude, Staunen, Erregung in ihr, aber nie Abscheu. Mein Vater kann seine Haltung nicht zügeln, und in seiner Haltung liegt stets ein leichter, etwas verächtlicher Spott. Auch ihm entgeht nichts, auch er nimmt jedes Detail wahr, wie zum Beispiel an den Frauen, die nicht nur ihre korpulenten Körper und üppigen Brüste darbieten, sondern auch allen Schmuck zeigen, den sie haben, und dazu passend: bunte Decken, Sonnenschirme, verschiedenste belegte Brote, Limonaden, Cremes für Hände und Füße. Sie stehen in ständiger Konkurrenz zu ihren Freundinnen, und die Konkurrenz beschränkt sich nicht nur auf Badeanzüge, Sonnenhüte, Kosmetik und Parfüms, sondern bezieht sich vor allem auf Männer. Meinem Vater entgeht, wie gesagt, nichts, und manchmal kommt es mir vor, als spotte er nicht nur, sondern genieße es auch.
Mein Vater ist von anderem Temperament als meine Mutter. Sie staunt, sie betrachtet die Menschen mit einem leichten Lächeln, auch wenn sie sich vulgär verhalten. Mein Vater erträgt weder neureiche Angeberei noch rücksichtsloses Verhalten. Meist verhält sich jeder auf seine Weise, ohne Diskussionen und ohne Zorn, aber manchmal entsteht Streit zwischen ihnen, wie ein Lauffeuer in einem trockenen Stoppelfeld.
Seit meiner Kindheit werde ich, vermutlich durch den Einfluss meiner Mutter, von Frauen angezogen, die gewisse Laster zeigen. Immer empfand ich ihnen gegenüber Nähe, nicht etwa Mitleid. Und die Lust, sie anzuschauen. Es ist leicht, die Schwächen eines Menschen zu entdecken, das Menschliche an ihm.
Die Frau, die wir P. nennen, beschäftigt sich vor allem mit sich selbst, glaubt, Talente zu haben, die sie nicht hat, und zieht deshalb Spott und Hohn auf sich. Ihr Lachen klingt wild, aber wenn sie hustet, stößt sie kehlige Laute aus, die unangenehm anzuhören sind. Früher oder später wird sie verletzt sein, einer ihrer Verehrer beleidigt sie schwer mit irgendwas, und sie wird auf dem Rücken liegen und mit den Beinen zappeln. Ihr Schicksal steht fest, doch sie hofft immer noch, dass einer der Kerle sich in sie verliebt. Sie ist eine Künstlerin darin, sich selbst zu betrügen: Unfähig, aus ihren Erfahrungen zu lernen, wiederholt sie die gleichen Fehler immer wieder.
Solche Menschen bringen meinen Vater aus der Ruhe. Für sie hat er nur einen Blick voller Abscheu. «Der Mensch kann sich ändern, wenn er nur will», das ist in Kürze seine Ansicht über den Menschen. Übermäßiges Essen und Trinken, Ichbezogenheit, einfach auf dem Rasen herumliegen, solche Dinge bringen meinen Vater oft zu Wutausbrüchen, und meine Mutter versucht dann vergeblich, ihn zu besänftigen.
Bei ihr weckt das Ufer hingegen großes Interesse. Sie betrachtet P. und sagt: «P. ist heute zufrieden. Ihr Lachen klingt leicht, sie hustet nicht. Vermutlich hat sie angenehm geträumt.» Sie geht zu ihr hinüber und fragt, wie es denn geht. P. ist gerührt darüber, dass meine Mutter zu ihr kommt, und vor lauter Aufregung steht sie auf, umarmt sie und sagt: «Bonja, ich mag Sie. Ich habe Sie immer gemocht, und ich konnte mich immer auf Sie verlassen.» Tränen steigen ihr in die Augen.
Meine Mutter versteht es, andere zu besänftigen. Deshalb mögen die Menschen sie. Sie vertrauen ihr, freuen sich über ihre Nähe. Sie teilt die anderen nicht ein in Gut oder Böse, und so kommt es, dass selbst Menschen mit einem zornigen Temperament sie zufrieden sehen wollen.
Mein Vater sagt wütend: «Die Juden wissen nicht, wie man ein normales Leben führt. Statt sich sportlich zu betätigen, liegen sie faul herum. Wozu kommen sie hierher? Um immer dicker zu werden?» Oft habe ich ihn sagen gehört: «Ich werde nicht mehr hierherkommen, es gibt eine Grenze für Fehler.»
Trotzdem schafft es meine Mutter jedes Jahr, ihn zu der Reise hierher zu bewegen. Er weiß vermutlich selbst, dass Ferien mit Nichtjuden noch schlimmer sind. Da würde man hinter deinem Rücken reden, und eines der Schandmäuler würde sagen: «Was wollen die Juden denn hier an unserem Ufer?»
Die Antwort meines Vaters ist, wie immer, lang und kompliziert: nicht mit Juden, aber auch nicht mit jenen, die keine Juden sind. Mein Haus ist meine Burg, in der ich sitze, ohne dass mich jemand stört.
Mein Vater ist ein Pedant. Wenn etwas nicht an seinem Platz liegt, gerät er außer sich. Und dann ist er auch noch ein Ästhet: Schlampige Kleidung, zu hohe Stimmen, unhöfliches Reden, krause Meinungen, aber auch Seelenergüsse sind seiner Meinung nach Schwächen, die man nicht einfach übergehen kann.
6
Als Kind stellte ich mir Gott als nachdenklichen alten Mann vor, der die Welt auf seinen Schultern trägt. Meine Mutter sagt, dass Gott überall sei, in jedem Menschen, in jedem Tier und in jeder Pflanze. Gott ist ein Geheimnis, aber er findet einen klaren, schönen und wunderbaren Ausdruck.
«Ist Gott gut?», frage ich.
«Nur gut», sagt sie, und ihre Augen strahlen.
«Und warum ist er dann auch in den Seelen böser Menschen?»
«Gott versucht, sie zu ändern.»
Meinen Vater frage ich, wie gesagt, nie nach Gott, doch wenn meine Mutter in seiner Anwesenheit über Gott spricht, verzieht er das Gesicht, als wolle er sagen: Das sind Hypothesen, und warum sprichst du mit solcher Gewissheit über sie? Ich achte Hypothesen, aber sie müssen im Rahmen bleiben.
Die Vernunft meines Vaters kennt kein Maß. Es ist schade, dass er sie auch gegen meine Mutter richtet. Wenn sie gut gelaunt ist, lächelt sie und sagt: «Jeder verhält sich nach seinem eigenen Gusto, du nach deinem und ich nach meinem.» Doch es gibt auch Tage, an denen seine Direktheit sie verletzt. Dann antwortet sie ihm nicht mehr, Tränen fließen, und sie verlässt den Raum.
Mein Vater weiß, dass meine Mutter den Glauben von ihren Eltern hat. Er mag meine Großeltern, ist aber weit entfernt von ihrer Überzeugung.
Wenn meine Mutter zu ihren Eltern geht, schließlich im Herzen der Karpaten ankommt, verändert sie sich plötzlich. Ihr Gesicht wird weicher, und oft umfasst sie, wenn sie neben ihrer Mutter sitzt, ihre Knie mit den Händen. Die beiden sehen sich dann erstaunlich ähnlich. Manchmal denke ich, wenn meine Mutter dort in den Bergen geblieben wäre, dann wäre auch ihr Glaube so stark, dass die Kritik meines Vaters und seine Pedanterie sie nicht immer wieder verletzt hätten.
Das Leben meiner Großeltern in den Bergen ist langsam, sie berühren die Dinge im Haus vorsichtig, und wenn meine Großmutter hinausgeht, um in den Beeten Blumen zu pflücken, erhellen die Blüten ihr Gesicht.
Manchmal ärgert sich meine Mutter über sich selbst, weil wir, statt den Sommer bei ihnen zu verbringen, an den Fluss fahren. Sie fühlt sich bei ihren Eltern sehr wohl, aber mein Vater wird dort nachdenklich, unternimmt allein lange Wanderungen. Und wenn er zurückkommt, sieht sein verspanntes Gesicht noch verspannter aus.
Vater tut sich schwer mit dem Glauben. Er weiß genau, was er verlangt. Manchmal wundert er sich darüber, dass es noch Menschen gibt, die glauben.
Wenn meine Mutter in die Berge fährt, verändert sie sich. Das Gesicht meines Vaters drückt aus: Ich verändere mich nicht. Ich wundere mich über meine Mutter, die zulässt, dass mein Vater sich quält, und nicht versucht, ihn zu beruhigen, nicht zu ihm geht, ihn nicht berührt.
Oft habe ich gesehen, wie meine Mutter darüber staunt, dass mein Vater gewisse Eigenschaften hat, die sie nicht hat.
Staunen ist kein geordnetes Betrachten, sondern die reine Freude an dem, was sich dem Auge bietet. Die Blicke meiner Mutter sagen: Das Leben bietet so viele Entdeckungen. Wenige liegen offen da, viele sind versteckt. Ich klassifiziere die Menschen nicht, gebe ihnen keine Noten. Ich nehme sie, wie sie sind. In jedem Menschen ist irgendetwas, was du nicht hast.
Abends lässt meine Mutter Bilder oder Eindrücke vom Tag vor sich vorüberziehen. Mein Vater analysiert, wie es seine Art ist, findet Widersprüche, ist zornig auf einen Menschen oder auf eine Handlung, und er verdüstert, ohne es zu wollen, die Stimmung meiner Mutter. Wenn er das tut, und er tut es oft, erschrickt meine Mutter, und Tränen treten ihr in die Augen.
7
Alle liebeskranken Frauen, die ich an jenem Ufer gesehen habe, kommen im Lauf der Jahre zurück, einige mit demselben Gesicht, doch die meisten mit Gesichtern, die alles Zeitbedingte abgelegt haben. Manche liebten aus verzweifeltem Schmerz, und es gab andere, in deren klarem Blick etwas wie Staunen lag, dass sich ihnen die Welt in ihrer ganzen Pracht zeigte.
Und es gab zornige Frauen, die sich weder mit ihrem Körper noch mit ihrer Seele abfinden konnten, die ihre Eltern beschuldigten, sie nicht auf das Leben vorbereitet zu haben, sie waren dumm, und sie trugen ihre Dummheit stets mit sich, sogar wenn sie im Wasser waren.
Mein Vater nannte den Fluss mit den Menschen darin die Arche Noah, weil sich hier alle Geschöpfe zur Schau stellen.
Damals verstand ich diese Verbindung natürlich nicht. Damals war die Welt in zufällige Bilder aufgespalten, erst allmählich, als ich anfing zu schreiben, tauchten die Männer und Frauen einer nach dem anderen wieder auf, und die zufälligen Bruchstücke des Lebens verbanden sich miteinander.
Meine Mutter sollte recht behalten: Was ich vor vielen Jahren mit den Augen eines Knaben gesehen hatte, versank in der Tiefe des Bewusstseins und wurde bewahrt.
Ich sitze an meinem Schreibtisch, und Bilder ziehen an mir vorbei. Ich spüre, dass sie interessant sind, vielleicht wichtig, doch sie haben keine wirkliche Verbindung zu meinem Inneren, auch nicht zu der Geschichte, die ich schreiben möchte. Es stellt sich heraus, dass es Bilder sind, die ich gestern oder vorgestern aufgenommen habe, oder vor einem Jahr – die Zeit hat sie noch nicht bearbeitet.
Plötzlich zeigt sich wie von selbst etwas anderes, und ich erkenne sofort: Das ist ein Bild, das ich vor langer Zeit gesehen habe. Alles ist umhüllt von Morgenlicht: Mein Vater, meine Mutter und ich auf dem Weg zum Fluss, und plötzlich taucht aus dem Dunst ein braun geflecktes Kalb auf. Ich gehe hin, um es zu streicheln. Das Kalb weicht nicht zurück. Ich betrachte es, und es betrachtet mich, und große Zärtlichkeit verbindet uns. Auch mein Vater und meine Mutter sind in diese Zärtlichkeit mit einbezogen. Die Stille dieses Bildes berührt mich, und ich weiß, dass es von weit her zu mir zurückgekommen ist, so frisch wie am ersten Tag.
Es liegt an meiner Mutter, dass Wunder auftauchen, wann immer ich mit ihr einen Spaziergang mache. Ihr fällt es leicht, Wunder zu entdecken. Da sind die Pilze, die unter einer Tanne wachsen. Wir ernten sie vorsichtig und legen sie in einen Korb. Auf einmal zieht meine Mutter die Brauen hoch: Zwischen den guten Pilzen verbirgt sich ein Giftpilz. Meine Mutter nimmt ihn heraus.
Alles, was meine Mutter tut, erfüllt mich mit Staunen. Sie vollbringt noch weitere Wunder, wenn wir allein auf dem Feld oder am Fluss sind. Schade, dass mein Vater nicht wahrnimmt, was meine Mutter sieht. Er kann seine Kritik nicht zügeln. Die Schwächen der Menschen regen ihn auf, und es ist gut, dass es ein paar Menschen gibt, die er mag. Sie bringen ihn dazu, sich selbst zu vergessen und eine kurze Zeit lang fröhlich zu sein.
8
Jedes Mal, wenn ich am Schreibtisch sitze und mich auf die Reise des Schreibens mache, ergreift mich die Angst, ich könnte mich verirren. Es gibt Momente, da bin ich ganz versunken in diese Reise, und nichts Äußerliches kann mich ablenken. Doch die Gefahr, vom Weg abzukommen, besteht immer. Umso größer ist die Freude, wenn ich vertrautes Territorium betrete, wenn ich ein Bild aus meiner Kindheit entdecke, zum Beispiel die schlanken Pappeln mir ihren silbrigen Blättern. Dann rücke ich den Stuhl zum Tisch, um näher an dem Bild zu sein, das sich vor meinen Augen auftut.
Oft ist es kein Bild, sondern ein kleines Stück: der Fuß einer jungen Frau mit grün lackierten Zehennägeln. Der Fuß ist schön und wohlgeformt, doch plötzlich krümmt er sich, als wolle er nicht mehr gesehen werden oder würde von einem plötzlichen Schmerz gepackt.
Dieser Fuß ist mir sehr kostbar. Je länger ich ihn betrachte, umso mehr zieht er mich an. Ich begehre ihn nicht, sondern er rührt mich zu Tränen, als handle es sich nicht um den Fuß einer Frau, sondern um die Entdeckung eines Geheimnisses, das bisher tief in meinem Inneren verborgen lag.
Ein aufregendes Detail aus den Kinderjahren ist oft der Grundpfeiler eines Kapitels, ein Stück vom Skelett der ganzen Geschichte. Was die Geschichte aus dem historischen Gefüge heraushebt, sind natürlich die Menschen, einzelne Charaktere, in denen sich die Zeit verkörpert. Doch das reicht nicht. Ohne diese verborgenen, durch die Zeit hindurch bewahrten Bilder, die dann verdichtet werden und neu, befreit auferstehen – ohne diese oft nebensächlichen Bilder, die nur kurz aufflackern, an ein Stück der Kindheit erinnern, gibt es keine Lebendigkeit in der Geschichte.