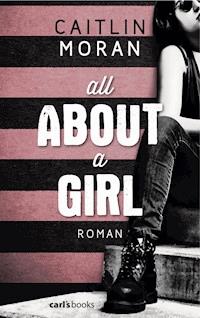7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Morag Narmo (15) hat keine Lust mehr auf Schule. Sie und ihre vier jüngeren Geschwister würden eher den Kopf in den Müllschlucker stecken, als sich weiter mit akademischen Inhalten zu quälen. Die fünf sind dann allerdings doch über alle Maßen erstaunt und beglückt zugleich, als ihre Eltern sie tatsächlich aus der Schule nehmen und sich mit ihnen in das Abenteuer Home- Schooling stürzen. Aber mit fünf Kindern, zwei schwer erziehbaren Haustieren, einigen sehr exzentrischen Marotten und einem immerwährend gähnenden Loch in der Familienkasse entwickelt sich das Unternehmen unweigerlich zum Totalchaos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Ähnliche
Caitlin Moran
Meine happy crazy Großfamilieoder
© Mark Harrison/Camera Press/Picture Press
Caitlin Moran, geboren 1975, wurde für ihre journalistische Arbeit bereits mehrfach mit dem British Press Award ausgezeichnet. Seit sie achtzehn ist, schreibt sie Kolumnen für die Times, und mit sechzehn verfasste sie ihre ersten Artikel für den Melody Maker. Mit fünfzehn legte sie ihren ersten autobiografischen Roman vor, »Meine happy crazy Großfamilie oder Mein erster Roman mit 15 ¾«. Er zeugt von ihrem außergewöhnlichen Talent, das sie zu einer der bekanntesten Kolumnisten Großbritanniens gemacht hat. Als das Buch 1992 veröffentlicht wurde, kommentierte Terry Pratchett: »Oh mein Gott, sie ist schon so gut und dabei erst fünfzehn.« Caitlin Moran lebt mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage 2017 Erstmals als cbt Taschenbuch Februar 2017 Copyright © Casa Bevron Ltd, 1992 Introduction © Casa Bevron Ltd, 2013 Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Chronicles of Narmo« bei Random House Children’s Publishers, UK, a division of The Random House Group Ltd © 2017 für die deutschsprachige Ausgabe cbt Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Aus dem Englischen von Ilse Rothfuss Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotive: © Shutterstock (Evgeniya Porechenskaya, Hayati Kayhan, Picsfive, secondcorner, Triff) TP ∙ Herstellung: sto Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-18492-6V002www.cbt-buecher.de
Für Gillian Anne Rowley, die wusste, dass ich weder Schauspielerin noch Ballerina werden würde und dass kein Mensch Karriere macht, nur weil er wie Nancy aus »Swallows and Amazons« ist. Ich wünschte, sie hätte das noch erlebt.
Vorwort
Wenn man körbeweise Bücher gelesen hat, bekommt man irgendwann Lust, selbst eins zu schreiben. Nach der Devise: Jetzt bin ich an der Reihe, denn Lesen und Schreiben sollten keine Einbahnstraßen sein, sondern sich gegenseitig ergänzen.
Mit dreizehn hatte ich schon Unmengen von Büchern verschlungen. Lesen war eines meiner drei wichtigsten Merkmale, neben a) meinem unvermeidlichen Strohhut (einer von der Sorte, wie Strandesel ihn tragen), und b) meinen langen Haaren, die mir bis zur Hüfte reichten. Beides – schwache Versuche, mich vor der Sonne zu schützen – trug dazu bei, dass ich wie eine leicht abgewandelte Version von Cousin It aus der Addams Family aussah. Ich wollte blass sein. Alle meine Leseerfahrungen hatten mich darin bestärkt, auf Blass zu setzen. Ich wollte blass sein wie ein Mumin, blass wie der Ziegenkäse in »Heidi«, wie der Eissplitter in Kais Auge in »Die Schneekönigin« oder die Unterröcke in der obersten Schublade von Katy Carr in »What Katy did«. Blass wie eine Buchseite.
Tag für Tag setzte ich meinen Hut auf, ging zur Stadtbücherei und kehrte eine Stunde später mit einem Rucksack voller Bücher zurück. Ich las überall: auf dem Fußboden, im Klo, im Auto, so lange, bis mir schlecht wurde. Ich las im Haselnussbaum in unserem Garten, auf der obersten Astgabel, gut zwei Meter vom Boden entfernt, und ging erst ins Haus zurück, wenn es zu dunkel oder zu kalt wurde.
Ich hatte mir sogar einen Trick ausgedacht, wie man beim Kartoffelschälen lesen kann: Ich klemmte einfach mein Buch hinter den Wasserhahn und machte das Abendessen fertig, während ich durch Narnia, Fantasia oder Mordor spazierte.
Neben meinem Bett lag eine Liste aller Bücher, die ich je gelesen hatte: 311 erzählende Bücher und 390 Sachbücher. In beiden Kategorien wäre ich locker auf die doppelte Zahl gekommen, wenn ich nicht alles, was ich in der Grundschule gelesen hatte, großzügig als »zu leicht« aussortiert hätte. Zum Beispiel »Wesen vom Wunderweltenbaum« und »Dolly«. Oder »Die Abenteuer der Familie Ruggles« und andere Anfängerbücher aus den unteren Regalen der Bibliothek. Stattdessen stieg ich direkt bei »Die Eisenbahnkinder« und »Anne auf Green Gables« ein, bei Autoren wie James Herriot, Spike Milligan und Terry Pratchett und bei »Vom Winde verweht«.
An der Schriftgröße erkannte ich, welche Bücher für »reifere« Leser bestimmt waren und welche nicht – die Buchstaben wurden nämlich immer kleiner, je älter die Zielgruppe war, an die das Buch sich richtete. Die »Wesen vom Wunderweltenbaum« waren beispielsweise in einer einfachen runden 22-Punkt-Schrift für Achtjährige gedruckt, »Der Doktor und das liebe Vieh« in einer viel erwachseneren 14-Punkt-Schrift, vermutlich ein Trick, um den Umfang geringer zu halten, damit der Text besser in die Tasche viel beschäftigter Tierärzte passte.
»Vom Winde verweht« dagegen präsentierte sich in einer engen, netzhautschädigenden 10-Punkt-Schrift, auf so hauchdünnem Papier, dass die nächste Seite durchschimmerte, wenn man mit dem Finger draufdrückte.
Um meine Netzhaut noch mehr zu schädigen, las ich bei »Nachtlicht« – einer Lichterkette aus fünfzehn bunten Lämpchen, die noch von Weihnachten übrig war. In dem magischen rosa Schimmer verschlang ich alle Brontë-Romane in kaum sechs Wochen, was meine Augen so strapazierte, dass ich im Zeitraffertempo zu einer hässlichen Kassenbrille kam, mit der ich Alan aus »My name is Alan« zum Verwechseln ähnlich sah, wie ich frustriert in meinem Tagebuch vermerkte.
Ich hatte also eine Nerdbrille auf der Nase und 601 klein gedruckte Bücher im Kopf (zumindest theoretisch), als ich den Entschluss fasste, selbst eins zu schreiben.
Es war Zeit, dass ich etwas zurückgab. Dass ich die Seiten wechselte und vom Leser zum Autor wurde.
Und hier eine Liste, was ich alles nicht wusste, als ich im Juli 1988 mein Buch – dieses Buch – zu schreiben begann.
Ein Buch entsteht nicht an einem Tag. Das war ein schwerer Schlag für mich, da ich felsenfest davon überzeugt war, genau das zu schaffen. Ich brauchte doch auch nur einen Tag, um ein Buch zu lesen – warum sollte es also länger dauern, eins zu schreiben?
Um zehn Uhr morgens setzte ich mich mit einem Becher Kakao und einem Erdbeermarmeladenbrot an den Tisch und nahm mir die erste Seite vor – Bleistift auf liniertem DIN-A4-Papier –, in der Erwartung, dass ich meinen ersten Roman fix und fertig in der Hand halten würde, wenn ich gegen sechs Uhr abends wieder vom Tisch aufstand.
Nach einer Weile sah ich auf die Uhr und konnte es nicht fassen: 11.04! Um diese Zeit wäre bereits das vierte Kapitel fällig gewesen, und ich hatte gerade mal zwei Seiten gefüllt! Wie war das möglich? Warum hinkte ich so weit hinter meinem Zeitplan her? Ich hatte ja nicht mal eine kleine Pause eingelegt, um mit meinem heiß geliebten Magnetschach zu spielen. Selbst den Gang zur Toilette hatte ich mir verkniffen, wie es in meiner Vorstellung die echten Hardcore-Autoren machten, zum Beispiel Charlotte Brontë und Jilly Cooper.
Was jetzt? Ich war ratlos. Am Ende sah ich nur eine Möglichkeit: Um mehr Zeug (also Wörter) aus mir herauszuquetschen, musste ich logischerweise zuerst etwas einwerfen. Ich schmierte mir noch drei Marmeladenbrote und machte mich wieder an die Arbeit. Meiner Schätzung nach musste diese Kalorienzufuhr ausreichen, um mich ruck, zuck bis Kapitel zwei zu katapultieren.
Als ich das nächste Mal hochsah, ganz benommen und zittrig vor Anstrengung und etwas klebrig von den Marmeladebroten, zeigte die Uhr 11.47. In dieser Zeit hatte ich genau 101 Wörter geschrieben und eine brillante Zeichnung von einer Katze mit einem Zylinder gemacht, so ähnlich wie der von Slash von Guns’n’Roses.
Inzwischen war mir klar, dass ich meinen ursprünglichen Plan, fünfzehn bis dreißig Bücher im Jahr zu produzieren, nicht einhalten konnte. Ich musste also meine Erwartungen stark zurückschrauben.
Mein Buch wurde schließlich im Sommer 1990 fertig – zwei Jahre später. Was zum Teil daran lag, dass es
nichts schaden kann, wenn man als Autor weiß, wie die Geschichte endet, bevor man zu schreiben anfängt. Oder wer darin vorkommt. Im Ernst: Ein paar der wichtigsten Charaktere sollte man schon im Kopf haben, wenn man sich an den Schreibtisch setzt.
Leider wusste ich vom Schreiben nur, was ich beim Lesen aufgeschnappt hatte. Und welcher Autor verrät schon gleich zu Anfang: »Hey, ich weiß genau, was in dieser Geschichte passiert! Hab mir’s schließlich SELBST AUSGEDACHT! ICH KENNE ALLE CHARAKTERE VON A–Z! Genial, wie ich das hingekriegt habe, was?«
Mir als Leserin kam es eher so vor, als würde der Autor alles erst in dem Moment aufschreiben, in dem es tatsächlich passierte. Leser und Autor erfuhren also praktisch zur gleichen Zeit, was als Nächstes kam, und der Autor spann die Geschichte einfach fortlaufend weiter. Im Prinzip glaubte ich an einen allwissenden Bibliotheksgott, der den Schriftstellern alle Bücher, vielleicht sogar ihre Autobiografien, in die Feder diktierte, während der Autor still am Schreibtisch saß und mitschrieb. So ähnlich wie ein Bauer, der mit aufgehaltenem Hut unter einem Pflaumenbaum steht und darauf wartet, dass ihm die reifen Früchte hineinfallen.
Ergo saß ich still und brav an meinem Schreibtisch und wartete darauf, dass mir mein Buch in den Schoß plumpste.
Im Frühjahr 1991 saß ich immer noch da und wartete. Aber irgendwann wurde es mir zu dumm, und ich bequemte mich zähneknirschend dazu, die Geschichte selbst in Gang zu bringen – mit meinen eigenen Erlebnissen (oder denen der Menschen in meiner Umgebung, nur ganz wenig verfremdet). Wutschnaubend machte ich mich an die Arbeit.
»Euch zeig ich’s, verfluchte Bibliotheksgötter, auch wenn ihr gar nicht existiert, wie ich gerade bewiesen habe«, tobte ich in meiner Festung aus Marmeladenbroten, die sich fast einen halben Meter hoch auf meinem Schreibtisch türmten. »Ich schreibe jetzt alles SELBST, damit ihr es wisst! VERPISS DICH, leerer Himmel! LECK MICH! Ich mach das ALLEIN!«
Muss man das fertige Buch, das einen (kein Witz) fast das Leben gekostet hätte, hinterher auch durchlesen. Man muss Hände voller Wörter ausrupfen, nein, ganze Sätze, die man unter Qualen (schlimmer als Ohren- oder Zahnschmerzen) geschrieben hat … und sie einfach wegwerfen. Mit anderen Worten, man muss gnadenlos töten.
Ich war noch ein Kind, als ich mit vierzehn diesen Bearbeitungsprozess in Angriff nahm.
»Mum!«, jaulte ich. Meine Mutter, die damals meine Lektorin war, strich kopfschüttelnd ganze Textseiten mit ihrem fiesen Rotstift durch. »Mum! Für diese Seite hab ich einen GANZEN TAG gebraucht! Das ist praktisch ein Fünfzehntel meiner Lebenszeit! Du kannst doch nicht einfach MEIN GANZES LEBEN in den PAPIERKORB schmeißen!«
»Mal angenommen, jemand trägt sich mit dem Gedanken, dein Buch zu kaufen. Soll er es dann auf dieser Seite aufschlagen?«, fragte Mum unbeirrt. »Willst du danach beurteilt werden? Soll das vielleicht irgendwann auf deinem Grabstein stehen?«
»Ähm, nein – aber guck mal, auf der nächsten Seite kommt noch was richtig Gutes«, protestierte ich und zeigte darauf.
»Ja, aber was nützt es dir, wenn deine potenziellen Leser gar nicht bis zur nächsten Seite umblättern, weil die hier so schlecht ist?«, sagte Mum weise – und warf das Blatt auf den Boden.
In den ersten beiden Tagen sammelte ich jede weggeworfene Seite sorgfältig wieder ein und stopfte sie in den Text zurück – den Tränen nahe, dass Mum etwas ablehnte, das mich so viel schweißtreibende Mühe gekostet hatte.
Am dritten Tag sah ich ein, dass sie recht hatte. Ich rupfte jetzt selber missratene Wörter, Sätze, Abschnitte oder ganze Seiten aus – Fäuste voll, geradezu zwanghaft, so wie man verfilzte Haarbüschel aus dem Fell einer Katze zieht, die gerade ihren Winterpelz verliert.
Am Ende dieser Prozedur war ich erwachsen. Nicht etwa, weil es zwei volle Jahre gedauert hätte – obwohl es mir manchmal so vorkam, wenn wir verbissen um Wörter und Sätze rangen. Sondern weil man ungeahnte Kräfte entwickelt, wenn man frühzeitig lernt, ohne Angst den Rotstift anzusetzen und wieder ganz von vorne anzufangen.
Anfänger neigen dazu, alles, was sie sich unter Qualen abgerungen haben, verbissen zu verteidigen, auch wenn es noch so banal ist. Aber wenn man um jeden Preis an etwas festhält, wird man irgendwann engstirnig.
Wer dagegen alles radikal niederbrennt und jeden Tag wieder neu anfängt, wird schnell so größenwahnsinnig wie Aragorn in »Herr der Ringe« oder die Komplett-Aussteigerin Lucy Irvine in »Die Insel«. Warum auch nicht? Egal wie viele Wörter im Papierkorb landen, es finden sich immer neue. Was kann einem also passieren? Man muss nur auf seinem Stuhl sitzen bleiben und weitermachen.
Oder manchmal auch vom Schreibtisch aufstehen und weitermachen. Ich tippte mein endlich fertiges Buch in unseren Computer ein, druckte es aus – 300 doppelzeilige Seiten, wie im »Style Guide« von Writers’ and Artists’ Year Book empfohlen – und schickte es an fünf Verlage, die ich ausgesucht hatte, weil dort einige meiner Lieblingsbücher erschienen waren (auch das ein Tipp aus Writers’ and Artists’ Year Book).
Dann stand ich auf der Post an, meinen fetten Wälzer in fünf Kopien, jeweils in braunem Packpapier im Arm, alle mit der Aufschrift »London« in dickem schwarzem Filzstift oben drauf – mein ganzes Herzblut steckte darin, meine Zukunftshoffnungen, alles auf eine Karte gesetzt – und gab ein Viertel unserer wöchentlichen Familieneinkünfte für das Porto aus.
»Das macht nichts«, sagte Mum tapfer, obwohl wir jetzt mehr oder weniger dem Hungertod ins Auge blickten. »Ist schließlich deine große Chance.«
In den nächsten drei Wochen schickten mir vier Verlage mein Manuskript zurück. Die Türklingel weinte vor Mitleid und der Postbote drückte mir die dicken braunen Päckchen in die Hand wie überfahrene Katzen, die er auf der Straße draußen aufgelesen hatte. Ich sah förmlich die erstarrten Schwänze an den Seiten herausragen. Tote Katzenbücher. Bücher, die so was von tot waren …
»Wir danken Ihnen herzlich für die Einsendung Ihrer Geschichte, aber leider …« Mit diesen Worten fingen alle vier Begleitbriefe an. Ich schluchzte hysterisch. Es war, als hätte ein böser Dämon sämtliche Eisenbahnlinien und Autobahnen, die von Wolverhampton wegführten, in die Luft gesprengt und mir eröffnet, dass ich nun für immer dableiben müsse. Nie würde ich meinen Traum von London verwirklichen können, wo ich zehn Zentimeter größer und superschlank werden und in einem Apartment in der Rosebery Avenue in Farringdon wohnen wollte. Diese Straße war mir in »London A–Z« ins Auge gefallen, als ich meine Zukunft minutiös geplant hatte. London A–Z war auch eines der Bibliotheksbücher, die ich an einem Tag verschlungen hatte. Im Anhang waren praktischerweise alle Londoner Kirchen aufgelistet, falls man sich mal verirrte und um den richtigen Weg beten musste.
Aber der fünfte … der fünfte Verlag rief einen Monat später an. Ich wurde ans Telefon gerufen, vor der versammelten Familie, die mich mit aufgerissenen Mündern umringte wie ein stummer Chor.
Hey, da rief jemand aus London an, mein Manuskript vor sich auf dem Schreibtisch, und starrte auf meine Wörter und Sätze! Nein, las sie! Womit er mich zur Autorin machte, weil er ja mein Buch las!
Als ich den Hörer endlich weglegte, herrschte Totenstille im Raum.
»Sie nehmen es!«, sagte ich, nachdem ich tief Luft geholt hatte. »Sie nehmen es! Ich bin Schriftstellerin! Ich bin Schriftstellerin! Ich habe ein Buch geschrieben!«
Ich war fünfzehn und erhielt einen Scheck über 1500 Pfund. Ich gab das Geld für Stockbetten und einen neuen Hut aus. Und für Bücher. Bücher, die ich im Buchladen kaufte – so wie ihr jetzt meins.
Ich war Leserin und Schriftstellerin in einem – mit fünfzehn! Ich hatte bewiesen, dass man beides sein kann!
Caitlin Moran
Kapitel 1
»Weihnachten war seit zwei Tagen aus, es langweilte sich das ganze Haus, bis hin zur mickrigsten Küchenmaus …«
Am ersten Werktag nach Weihnachten:
Der eine Sale beginnt.
Der andere endet.
Das kaputte Super-Constructor-Spielzeug landet im Müll.
In der Crackerdose sind nur noch ein paar staubtrockene Wassercracker.
Morag Narmo schlurfte in dem schäbigen roten Morgenmantel, der praktisch mit ihrem Körper verwachsen war, die Treppe hinunter und wühlte die Bumper-Schoki-Festtagsauswahl nach Curly Wurlys durch, als ob ihr nicht schon schlecht genug gewesen wäre.
Der einzige aufgeblasene Luftballon, der noch an der Decke klebte, schnurrte mit einem wehmütigen kleinen Seufzer zusammen. Ein Stanniol-Weihnachtsmann fiel unter depressivem Geraschel vom Weihnachtsbaum herunter.