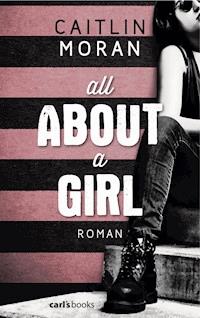
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: carl's books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Bestsellerautorin, Feministin - Fuck! Was für eine Autorin!
England in den 90ern, die Happy Mondays sind in den Charts, Margaret Thatchers Regierungszeit als Premierministerin neigt sich dem Ende zu, und das Land ächzt unter der Arbeitslosigkeit: Wie soll man bloß in einer Sozialsiedlung in Wolverhampton inmitten einer chaotischen Familie erwachsen werden – mit einem Vater, der seit zwanzig Jahren von einer Karriere als Rockstar träumt und einer Mutter, die, obwohl sie schon drei Kinder hat, eine erneute Schwangerschaft bis zum Geburtstermin als Magenverstimmung deutet?
Wird Johanna Morrigan mit Hilfe von schwarzem Eyeliner, Doc Martens, derben Sprüchen, einem wilden Partystil und ihrem Wissen über Popmusik endlich Sex haben und ihre Familie retten?
Ein intelligenter und witziger Roman über das Erwachsenwerden, trügerische Geschlechterrollen und das Glück, ein Kind der 90er zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen. Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
»How to Build a Girl« bei Ebury Press, an imprint of Ebury Publishing, a Random House Group Company, London.
1. Auflage
Copyright © 2014, Caitlin Moran
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by carl’s books, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15384-7V002www.carlsbooks.de
Für meine Eltern, die mit den Eltern im Buch zum Glück keinerlei Ähnlichkeit haben – und die mir alle
ERSTER TEIL EIN UNBESCHRIEBENES
01
Ich liege im Bett, neben meinem Bruder Lupin.
Er ist sechs Jahre alt und schläft.
Ich bin vierzehn und schlafe nicht. Ich masturbiere.
Im Grunde tue ich es nur ihm zuliebe, aus reinem Edelmut, denn schließlich liegt ihm mein Glück doch am Herzen.
Er hat mich gern und würde nicht wollen, dass ich gestresst bin. Ich habe ihn auch gern – bloß nicht gerade beim Masturbieren. Es wäre nicht richtig, dabei an ihn zu denken. Dabei kann ich keine Geschwister gebrauchen. Zwar lasse ich ihn heute bei mir schlafen – er ist um Mitternacht weinend aus dem Etagenbett geklettert und zu mir unter die Decke geschlüpft –, aber in meinem sexuellen Hinterland hat er nichts verloren. Ich kann ihn in meinen Gedanken nicht brauchen.
»Da muss ich alleine durch«, sage ich energisch – wenn auch nur im Stillen – zu ihm und baue, um meine Privatsphäre zu schützen, ein Kopfkissen zwischen uns auf. Unsere eigene kleine Berliner Mauer. Geschlechtsreife Jugendliche auf der einen Seite (Westdeutschland), sechsjährige Knaben auf der anderen (Ostblock). Grenzübertritte müssen verhindert werden. Das gehört sich so.
Kein Wunder, dass ich Hand an mich legen muss – ich habe einen furchtbar stressigen Tag hinter mir. Unser alter Herr ist – mal wieder – nicht berühmt geworden.
Nachdem er zwei Tage verschwunden war, kreuzte er heute nach dem Mittagessen wieder auf, Arm in Arm mit einem ramponierten Streuselkuchengesicht im abgewetzten grauen Anzug mit rosa Schlips um den Hals.
»Dieser Sack«, verkündete Dad frohgemut, »ist unsere Zukunft. Sagt unserer Zukunft guten Tag, Kinder.«
Höflich sagten wir dem Sack, unserer Zukunft, guten Tag.
Eingehüllt in eine Wolke aus Guinness-Dunst ließ Dad uns wissen, dass es sich bei dem jungen Mann vermutlich um den Talentscout einer Plattenfirma aus London namens Rock Perry handelte. »Kann aber auch sein, dass er Ian heißt.«
Wir lugten aus der Diele ins Wohnzimmer. Rock hockte auf unserer durchgesessenen rosa Couch und hielt sich den Kopf. Er war knülle. Man hätte meinen können, der Schlips wäre ihm von einem Feind umgebunden worden, um ihn zu erdrosseln. Er sah nicht wie die Zukunft aus, sondern nach 1984. Was im Jahr 1990 sehr vorgestrig war – sogar oben bei uns in Wolverhampton.
»Wenn wir unsere Trümpfe richtig ausspielen, sind wir bald Millionäre«, flüsterte unser Vater weithin hörbar.
Lupin und ich rannten in den Garten, um zu feiern. Wir schaukelten zusammen auf der Schaukel und schmiedeten Zukunftspläne.
Mutter und unser großer Bruder Krissi blieben stumm. Sie hatten schon zu oft mit ansehen müssen, wie die Zukunft bei uns im Wohnzimmer Platz nahm – und wieder entschwand. Auch wenn sie jedes Mal einen anderen Namen und andere Klamotten trägt, läuft ihr Besuch immer nach dem gleichen Schema ab: Sie lässt sich stets nur angetrunken bei uns blicken und darf unter gar keinen Umständen wieder nüchtern werden, weil wir sie mit List und Tücke dazu bringen müssen, uns mitzunehmen, wenn sie wieder geht. Wir müssen uns wie Kletten in ihren Pelz hängen – alle sieben – und uns aus unserer armseligen Hütte bis nach London tragen lassen, wo Ruhm, Reichtum und rauschende Feste auf uns warten. Wo wir hingehören.
Es hat noch nie geklappt. Bis jetzt ist die Zukunft noch immer ohne uns aus dem Haus gewankt. Und wir sitzen seit dreizehn Jahren in einer Sozialsiedlung in Wolverhampton fest und warten, fünf Kinder – die Zwillinge kamen erst vor drei Wochen überraschend dazu – und zwei Erwachsene. Wir müssen hier raus. So schnell wie möglich. Viel länger halten wir es nicht mehr aus, arm und verkannt zu sein. Die 1990er sind kein gutes Jahrzehnt für Leute ohne Geld und Ruhm.
Wieder im Haus, geht auch schon alles den Bach runter. Der geraunte Wunsch meiner Mutter – »Ab in die Küche, kipp noch ’ne Dose Erbsen in die Bolognesesoße! Wir haben Besuch!« – ist mir Befehl. Mit einem Knicks reiche ich Rock den Teller. Verzweifelt schaufelt er die Nudeln in sich hinein, um wieder nüchtern zu werden. Wobei zarte Hülsenfrüchte leider keine große Hilfe sind.
Mit dem heißen Teller auf dem Schoß sitzt Rock in der Falle. Dad hat sich leicht schwankend vor ihm aufgebaut und rührt die Werbetrommel. Wir kennen seine nun folgende Ansprache auswendig.
Worauf es dabei ankommt, hat er uns oft genug erklärt: »Man darf nicht kleckern, Kinder. Man muss klotzen. Eigenwerbung stinkt nicht – wenn man von seinem Produkt überzeugt ist. Von seiner Sache, seinem Anliegen. Man muss bloß laut genug auf die Pauke hauen, dann wickelt man jeden um den Finger.«
Über unseren Gast gebeugt, schwenkt Dad eine Kassette.
»Sohn«, sagt er. »Kumpel. Please allow me to introduce myself. I’m a man of wealth and taste. Nun ja, momentan hapert es noch ein bisschen am Reichtum. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, hä, hä, hä. Und ich habe dich heute in mein Haus geladen, um dir eine große Wahrheit zu verkünden. Es gibt drei Männer, ohne die wir heute alle nicht hier wären«, fährt er fort, während er mit dicken Fingern an der Kassettenhülle rumfummelt. »Die Heilige Dreifaltigkeit. Das Alpha, Epsilon und Omega aller Menschen mit Verstand. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die einzigen drei Männer, die ich je geliebt habe. Die drei Bobbys: Bobby Dylan. Bobby Marley. Und nicht zuletzt Bobby Lennon.«
Rock Perry glotzt zu ihm hoch – genauso verdattert wie wir damals, als wir diesen Spruch zum ersten Mal hörten.
»Und jeder Musiker auf der Welt hat nur einen einzigen Wunsch«, fährt Daddy fort. »Eines Tages will er sich im Pub vor diesen dreien hinstellen können und zu ihnen sagen: ›Ich höre dich, Kumpel. Ich höre dich. Aber hörst du mich auch? Du bist der Buffalo Soldier, Bobby. Und du bist Mr. Tambourine Man, Bobby. Und du bist das gottverfluchte Walross, Bobby. Das weiß ich. Aber ich – ich bin Pat Morrigan. Und was ich bin, ist das hier.‹«
Damit hält er Rock Perry die Kassette, die er endlich doch noch aus der Hülle gepfriemelt hat, unter die Nase.
»Weißt du, was das ist?«, fragt er.
»Eine C90er?«
»Das sind die letzten fünfzehn Jahre meines Lebens, Sohn«, antwortet Daddy. Er nötigt Rock die Kassette auf. »Fühlt sich nicht so an, was? Hättest du nicht gedacht, dass du mal ein ganzes Menschenleben in den Händen halten würdest, oder? Aber so ist es. Demnach bist du also ein Riese. Was ist das für ein Gefühl, ein Riese zu sein?«
Rock Perry starrt dumpf die Kassette an. Er wirkt vor allem riesig verwirrt.
»Willst du dich auch noch wie ein König fühlen?«, fragt Daddy. »Soll ich dir verraten, wie das geht? Du brauchst bloß diese Kassette auf CD rausbringen und zehn Millionen Stück davon verkaufen. Es ist die reine Alchemie. Du und ich, wir können unser Leben verwandeln – in eine fette Monsterjacht, einen Lamborghini und Weiber bis zum Abwinken. Musik ist wie Magie, Kollege. Musik kann dein Leben verändern. Aber bis dahin – Johanna, geh und hol unserem Gast was zu trinken.«
Das gilt mir.
»Was zu trinken?«, wiederhole ich.
»Aus der Küche, aus der Küche«, antwortet er gereizt. »Die Getränke sind drüben, Johanna.«
In der Küche schuckelt Mum einen Zwilling. »Ich gehe ins Bett«, sagt sie müde.
»Aber Daddy kriegt doch gleich einen Plattenvertrag!«
Mum gibt das Geräusch von sich, mit dem – Jahre später – Marge Simpson berühmt werden wird.
»Ich soll Rock Perry was zu trinken holen«, sage ich mit all dem Nachdruck, den die Situation meiner Meinung nach erfordert. »Aber wir haben nichts da, oder?«
Mit todesmatter Geste zeigt Mum zum Sideboard, auf dem zwei halb volle Gläser Guinness stehen.
»Die hat er aus dem Pub mitgebracht. In den Jackentaschen«, sagt sie. »Und ein Billardqueue.«
Das Queue aus dem Red Lion lehnt am Elektroherd. In unser Haus passt es ungefähr genauso gut wie ein Pinguin.
»Das hatte er in der Hose. Ich weiß wirklich nicht, wie er das macht«, seufzt sie. »Außerdem haben wir doch schon eins.«
Das stimmt. Wir besitzen bereits ein geklautes Queue. Da wir keinen Billardtisch haben – das zu klauen schafft noch nicht mal Daddy –, wird es von Lupin, wenn wir Herr der Ringe spielen, als Gandalfs Zauberstab zweckentfremdet.
Unser Gespräch über Queues wird jäh durch laute Musik aus dem Wohnzimmer unterbrochen. Ich erkenne das Stück sofort – »Dropping Bombs«, Daddys neuester Demosong. Anscheinend hat das Vorspielen bereits begonnen.
»Dropping Bombs« war bis vor Kurzem eine schunkelnde Ballade, bis Daddy auf seinem Yamaha-Keyboard die Reggae-Einstellung entdeckt hat: »Der Bob-Marley-Knopf! Jawoll! Jetzt geht die Post ab!«
Es ist einer von Dads Politsongs und wahnsinnig bewegend: Die ersten drei Strophen sind aus der Sicht einer Atombombe geschrieben, die auf Frauen und Kinder in Vietnam, Korea und Schottland abgeworfen werden soll. Völlig ungerührt stellt sie sich die Verwüstungen vor, die sie anrichten wird – und die Daddy mit einer Roboterstimme auflistet.
»Eure Haut wird verbrennen/Und die Menschen werden rennen/Nichts macht mehr Sinn/Die ganze Ernte ist dahin«, sagt die Roboterstimme blechern.
Aber in der letzten Strophe kommt die Bombe plötzlich zur Einsicht. Sie rebelliert gegen das amerikanische Militär, das sie gebaut hat, und beschließt, in der Luft zu explodieren. Auf die verängstigten Menschen gehen Regenbögen nieder.
»Einst flogen Menschen in die Luft – und jetzt nur bunte Farben«, lautet der letzte Vers, begleitet von einem gespenstischen Riff auf dem Yamaha-Keyboard-Knopf 44: »Orientalische Flöte«.
Daddy hält es für seinen allerbesten Song. Früher hat er ihn uns jeden Abend vorgespielt, bis Lupin Alpträume von brennenden Kindern kriegte und anfing, wieder ins Bett zu machen.
Als ich die halb vollen Gläser – mit einem Knicks – ins Wohnzimmer bringe, erwarte ich natürlich, dass Rock Perry vor Begeisterung über »Dropping Bombs« ganz aus dem Häuschen ist. Stattdessen wird er zur Schnecke gemacht.
»So nicht, Freundchen!«, brüllt Daddy so laut, dass er sogar die Musik übertönt. »So nicht!«
»’tschuldige«, antwortet Rock kleinlaut. »Ich wollte dich nicht …«
»Nein.« Daddy schüttelt bedächtig den Kopf. »Nein. Das kannst du nicht sagen. Da hört sich alles auf.«
Krissi, der auf der Couch die Stellung gehalten hat – mit der Ketchupflasche in der Hand, für den Fall, dass unser Gast Tomatensoße möchte –, bringt mich flüsternd auf den neuesten Stand. Anscheinend hat Rock Perry »Dropping Bombs« mit »Another Day in Paradise« von Phil Collins verglichen, worauf Daddy in die Luft gegangen ist. Komisch, eigentlich. Im Grunde mag er Phil Collins doch.
»Aber er ist kein Bobby!« Daddy schäumt vor Wut. »Ich rede von Revolution. Da reicht es nicht, dass Phil Collins den … Krawattenzwang ablehnt. No Jacket Required, so ein Bullshit! Was gehen mich irgendwelche verdammten Krawatten an? Ich besitze noch nicht mal eine. Und es ist mir auch scheißegal, ob du eine trägst.«
»’tschuldige … ich wollte ja bloß … ich mag Phil Collins doch …«, stammelt Rock geknickt. Aber da hat Daddy ihm schon den Teller mit den Nudeln aus der Hand gerissen und schubst ihn in Richtung Diele.
»Zieh Leine, du Saftsack«, sagt er. »Los, raus. Verpiss dich, Arschloch.«
Rock bleibt schwankend in der Tür stehen. Er weiß nicht so recht, ob nicht vielleicht doch alles nur ein Witz sein soll.
»Los, verpiss dich«, wiederholt Dad. »Veldünnisiel dich.«
Keine Ahnung, wieso er dafür einen chinesischen Akzent anschlägt.
Mum kommt aus der Küche. »Es tut mir so leid«, sagt sie mit routinierter Freundlichkeit.
Irgendwie will sie Rock den Rauswurf versüßen. Ihr Blick fällt auf einen Bananenkarton, und sie fischt ein Bündel raus. Wir kaufen Obst immer in größeren Mengen. Dad hat einen gefälschten Einkaufsausweis für den Großmarkt, auf dem steht, dass der Inhaber des Ausweises in Trysull einen Dorfladen betreibt. Dad betreibt keinen Dorfladen und schon gar nicht in Trysull.
»Bitte, für Sie.«
Rock Perry starrt entgeistert auf das Bananenbündel, das Mum ihm hinhält. Hinter ihr steht Daddy, der die Stereoanlage, Regler für Regler, genüsslich bis zum Anschlag aufdreht.
»Eine vielleicht?« Rock Perry möchte nicht unverschämt sein. »Bitte, nehmen Sie sie.« Mum drückt ihm das ganze Bündel in die Hand. Rock Perry ist viel zu verdattert, um sich zu wehren, und stolpert mit seiner Beute aus dem Haus. Er hat es noch nicht mal ganz bis zum Gartentörchen geschafft, als Dad vor die Tür tritt.
»DAS IST NÄMLICH MEIN LEBEN!«, brüllt er.
Rock schwingt die Hufe. Das Bananenbündel unter den Arm geklemmt, hastet er über die Straße.
»DAS IST MEIN LEBEN! DAS HIER BIN ICH!« Die Gardinen der Nachbarn bewegen sich. Mrs. Forsyth schaut mit der üblichen verkniffenen Miene zur Tür raus. »DAS IST MEINE MUSIK! DAS IST MEINE SEELE!«
Rock Perry, der inzwischen die Bushaltestelle erreicht hat, geht langsam hinter einem Busch in Deckung. Da bleibt er hocken, bis der 512er kommt. Das weiß ich deshalb so genau, weil Krissi und ich schnell auf unser Zimmer gelaufen sind und ihn von oben durchs Fenster beobachten.
»Sechs Bananen für die Katz«, mault Krissi. »Davon hätte ich mir jeden Tag eine ins Müsli schnippeln können. Spitze. Wieder eine Woche bloß langweilige Körner zum Frühstück.«
»MEIN HERZ!«, posaunt Dad dem davonfahrenden Bus hinterher. Er trommelt sich auf die Brust. »Weißt du eigentlich, was du hier mit Füßen getreten hast? MEIN GOTTVERFLUCHTES HERZ!«
Eine halbe Stunde später – nach dem triumphalen Zwölfminutenfinale von »Dropping Bombs« – geht Dad noch mal weg, in denselben Pub, in dem er Rock Perry aufgegabelt hat. Zur Therapie seines wehen Herzens.
»Vielleicht will er gucken, ob er einen Zwilling von Rock Perry findet, um ihn ebenfalls fertig zu machen«, ätzt Krissi.
Unser alter Herr kommt erst um ein Uhr nachts zurück. Wir merken es daran, dass er in der Einfahrt mit dem Bully in den Fliederbusch rasselt. Mit einem unverwechselbaren Knall springt der Gang raus. Das Geräusch kennen wir nur allzu gut. Wir haben es schon oft genug gehört.
Am nächsten Morgen steht ein großer Fuchs aus Beton im Wohnzimmer. Ohne Kopf.
»Ein Hochzeitstagsgeschenk für eure Mutter«, erklärt Dad, der qualmend auf der obersten Stufe der kleinen Gartentreppe hockt. Er trägt meinen rosa Morgenrock, der ihm viel zu klein ist. Seine Eier hängen unten raus. »Ich liebe dieses Weib.«
»Eines Tages gehört uns die Welt.« Er sieht zum Himmel. »Ich bin der Bastard von Brendan Behan. Eines Tages werden die Drecksäcke vor mir zu Kreuze kriechen.«
»Und was ist mit Rock Perry?«, frage ich, nachdem Krissi und ich uns diese Zukunft ein, zwei Minuten lang ausgemalt haben. »Meinst du, der meldet sich noch mal?«
»Mit Dummschwätzern geb ich mich nicht ab, Kurze«, sagt Dad und zieht sich energisch den Morgenrock über die Eier.
Von Onkel Aled, der jeden kennt, erfahren wir später, dass Rock Perry tatsächlich Ian heißt und kein Talentscout für eine Plattenfirma ist, sondern ein Besteckwarenvertreter aus Sheffield. Das einzige Angebot, das er uns hätte machen können, wäre ein Sonderpreis von 59 Pfund für ein achtundachtzigteiliges galvanisiertes Tafelbesteck, zu einem effektiven Jahreszins von 14,5 Prozent.
Deshalb also liege ich hier neben Lupin im Bett und mache ein bisschen an mir rum. Aber nicht nur aus Stress, sondern auch aus Spaß an der Freude. Ich bin nämlich, wie ich meinem Tagebuch anvertraut habe, »eine hoffnungslose Romantikerin«. Wenn ich schon nichts mit einem Jungen anfangen kann – und mit meinen vierzehn Jahren hatte ich noch kein einziges Date –, muss ich mich eben mit mir selbst vergnügen.
Ich denke dabei an Herbert Viola aus Das Model und der Schnüffler, der so sein freundliches Gesicht hat. Als ich fertig bin, ziehe ich mein Nachthemd runter und gebe Lupin ein Küsschen. Dann schlafe ich ein.
02
Donnerstag. Als ich aufwache, starrt Lupin mich mit seinen blauen Kulleraugen an. Er hat riesige Augen. Halb so groß wie das Zimmer. Wenn ich nett drauf bin, erzähle ich ihm immer, dass sie wie zwei blaue Planeten sind, die durch die Galaxie seines Schädels wandern, und dass hinter seinen Pupillen Satelliten und Raketen vorbeizischen.
»Da! Und da ist noch eine! Ich sehe Neil Armstrong! Er hat eine Fahne in der Hand! Gott schütze Amerika!«
Wenn ich fies drauf bin, behaupte ich, er habe ein Schilddrüsenleiden und sehe aus wie ein irrer Frosch.
Lupin ist ein kleiner Schisser. Wenn er mal wieder einen Alptraum hat, klettert er aus dem Etagenbett, das er sich mit Krissi teilt, und krabbelt zu mir unter die Decke. Ich habe nämlich ein Doppelbett! Wie es in meinen Besitz kam, kann ich nur mit einem lachenden und einem weinenden Auge schildern.
»Deine Granny ist tot – du erbst ihr Bett«, verkündete Dad mir im letzten April.
»Granny ist tot!«, schluchzte ich laut. »Granny ist TOT!«
»Ja, aber du erbst ihr Bett«, wiederholte Dad geduldig.
Die Matratze hat in der Mitte, wo Oma immer gelegen hat und am Ende auch gestorben ist, eine tiefe Kuhle.
»Die Mulde, in der wir schlafen, stammt von ihrer Aura«, denke ich in meinen rührseligeren Momenten. »Mein Ruhelager ist ein Todesnest.«
Ich stehe nämlich auf Romane aus dem neunzehnten Jahrhundert. Als ich einmal von meiner Mutter wissen wollte, welche Aussteuer ich bei meiner Verehelichung zu erwarten hätte, kriegte sie einen Lachkrampf.
»Auf dem Speicher steht noch ein Müllsack mit zwei alten Vorhängen rum, die kannst du gerne haben«, sagte sie und wischte sich die Tränen aus den Augen.
Damals war ich noch jung. Solche Fragen stelle ich heute nicht mehr. Inzwischen begreife ich unsere »finanziellen Verhältnisse« viel besser.
Noch in Nachthemd und Schlafanzug gehen Lupin und ich nach unten. Es ist elf Uhr, und wir haben schulfrei. Krissi ist auch schon auf. Er guckt The Sound of Music. Liesl macht gerade im Gewitter mit Rolf rum, dem blonden Jungnazi, der die Telegramme bringt.
Weil ich gerade nichts Besseres zu tun habe, stelle ich mich vor den Fernseher und versperre ihm den Blick.
»Geh mir aus der Pupille, Johanna. Aber FLOTT!«
Wie schon gesagt, Krissi ist mein großer Bruder und der Mensch, der mir von allen auf der Welt der Liebste ist.
Ich fürchte allerdings, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Wir kommen ungefähr so gut miteinander aus wie die beiden Hunde auf der Geburtstagskarte, die ich mal gesehen habe. Ein großer Bernhardiner drückt einem kläffenden Welpen die Pfote ins Gesicht, und darunter steht: »Weg da, du Winzling!«
Krissi ist so ein Bernhardiner. Erst fünfzehn Jahre alt, aber schon über eins achtzig groß, ein schwerer, massiger Junge mit weichen Pranken und einem blonden Afro, für den er auf Familienfeiern immer gehänselt wird.
»Ah, da ist ja unser ›kleiner‹ Michael Jackson!«, sagt zum Beispiel Tante Lauren, wenn Krissi ins Zimmer kommt, vornübergebeugt, um sich kleiner zu machen.
Weder seine Persönlichkeit noch seine feinen Gesichtszüge passen zu einem Eins-achtzig-Hünen. Mit der blassen Haut, den blassblauen Augen und den hellen Haaren kommt er ganz nach unserer Mutter, die so gut wie überhaupt keine Pigmente besitzt. Er hat einen kleinen Mund und eine zierliche Nase – wie die Stummfilmdiva Clara Bow. Ich hab ihn sogar mal darauf angesprochen, aber dieser Versuch ging ziemlich in die Hose.
»Komisch, du hast eine richtige Männervisage, aber deine Nase und der Mund sind echt mädchenhaft«, hab ich gesagt. Ich fand, es wäre ein interessantes Thema, über das wir uns gepflegt unterhalten könnten.
Er war offensichtlich anderer Meinung. Mit einem hingerotzten »Verpiss dich, du Stinkstiefel« ließ er mich einfach stehen.
Dass wir uns nicht über ein Gesprächsthema verständigen können, ist mit ein Grund dafür, warum ich bei Krissi so unbeliebt bin. Ich sage immer das Falsche zu ihm. Wobei man aber fairerweise nicht verschweigen darf, dass er Menschen sowieso nicht leiden kann. Er hat auch keine Schulfreunde. Von David Phelps und Robbie Knowsley wird er wegen seiner weichen Hände, der krausen Locken und seiner eingefleischten Abneigung gegen Sport dauernd gepiesackt. Sie locken ihn auf dem Schulhof hinter die Müllcontainer und machen ihn fertig, wie zwei kleine Terrier, die einem Elch in die Waden beißen. Und sie beleidigen ihn als Schwuchtel.
Darüber kann ich mich tierisch aufregen: »Aber du bist doch überhaupt nicht schwul!« Worauf er mir einen merkwürdigen Blick zuwirft. Krissi sieht mich oft so komisch an.
Genau den gleichen Blick ernte ich jetzt wieder. Dann schmeißt er eine Babypuppe nach mir und trifft mich voll im Gesicht. Für einen Jungen, der lieber George Orwell liest, als sich sportlich zu betätigen, hat sein Wurf ganz schön Schmackes. Ich halte mir das Kinn, gehe zu Boden und spiele Toter Mann.
Früher, mit zehn oder elf, hab ich mich oft tot gestellt. Heute mache ich es nur noch selten. Erstens bin ich reifer und vernünftiger geworden, und zweitens fällt kaum noch einer darauf rein.
Als ich damit das letzte Mal Erfolg hatte, lag ich unten vor der Treppe und tat so, als ob ich mir das Genick gebrochen hätte. Mum bekam einen Schreikrampf, als sie mich fand.
»PAT!«, kreischte sie panisch. Ihre Angst machte mich ruhig, glücklich. Und es störte mich auch nicht, dass Dad nur meinte: »Sie grinst sich eins, Angie. Tote grinsen nicht. Und ich muss es schließlich wissen, ich hab schon mehr als genug Leichen gesehen. Tote sind was Grauenvolles. Manche sind so furchterregend, dass einem die Eingeweide im Leib gefrieren – und man Schnee scheißt.«
Mir wurde ganz warm ums Herz, als sie so über mich redeten. Ich fühlte mich sicher und geborgen. Jetzt wusste ich wieder, dass sie mich lieb hatten.
Heute tut Mum so, als ob es ihr nichts ausmacht, als sie mich tot im Wohnzimmer liegen sieht.
»Johanna, denk an meinen Blutdruck. HOCH MIT DIR!«
Ich klappe ein Auge auf.
»Mach dich nicht zum Affen. Kümmere dich lieber um Lupins Frühstück«, raunzt sie mich an und geht wieder in die Küche. Die Zwillinge schreien.
Ich rapple mich hoch. Bei Lupin wirkt mein Toter Mann immer noch. Er starrt mich mit großen Augen an.
»Jojo geht’s schon wieder besser«, sage ich tapfer und setze mich zu ihm auf die Couch, um mir eine Schmuseeinheit abzuholen. Als ich ihn auf den Schoß nehme, klammert er sich an mich. Er steht noch immer ein bisschen unter Schock. Ich kriege eine richtig feste Umarmung ab. Je schlimmer kleine Kinder sich fürchten, desto kräftiger wird man von ihnen gedrückt.
Derart gestärkt hole ich die Großpackung Rice Pops, die Zuckertüte, drei Schüsseln und drei Löffel aus der Küche. Die Vierliterflasche Milch muss ich mir irgendwie unter den Arm klemmen.
Ich stelle die Schüsseln in einer Reihe auf den Fußboden, löffle die Flocken rein und kippe die Milch drüber. Hinter mir rubbelt Maria die durchgeweichte Liesl trocken, der die nassen Klamotten am jungen Leib kleben.
»Essen fassen!«, trällere ich.
»Nimm die Rübe weg!« Krissi fuchtelt wild mit den Händen, damit ich ihm aus dem Bild gehe.
Lupin schaufelt sich methodisch einen Löffel Zucker nach dem anderen auf die Rice Pops. Als die Schüssel randvoll ist, kippt er um und streckt alle viere von sich.
»Ich bin tot«, sagt er.
»Mach dich nicht zum Affen«, antworte ich streng. »Iss dein Frühstück.«
*
Zwanzig Minuten später langweile ich mich bei The Sound of Music fast zu Tode. Nachdem der Hauptmann und Maria geheiratet haben, zieht sich der Film wie Kaugummi, auch wenn ich darin einiges aus eigener Erfahrung wiedererkenne. Weil ich zum Beispiel selber aus einer kinderreichen Familie komme, kann ich es total verstehen, dass es schon des drohenden Anschlusses Österreichs an Nazideutschland bedarf, damit Maria es schafft, allen Kindern die Schuhe anzuziehen und eine Bergwanderung mit ihnen zu machen.
Ich verziehe mich in die Küche und fange schon mal mit dem Kochen an. Heute Mittag gibt es Hackfleischpastete. Dazu braucht man einen Riesentopf Kartoffeln. Wir vertilgen große Mengen davon. Im Grunde leben wir von Kartoffeln.
Unser alter Herr hockt mit einem Brummschädel hinten auf der Treppe, noch immer in meinem rosa Morgenrock, aus dem ihm die Klöten unten raushängen. Dass ihm der Schädel brummt, ist kein Wunder. Letzte Nacht war er so prall, dass er einen Betonfuchs geklaut hat.
Nachdem er seine Kippe auf der obersten Stufe ausgedrückt hat, kommt er mit munter unter dem Saum hervorbaumelndem Gehänge ins Haus.
»Pat mit Kaffee«, erläutert er, während er sich einen breiigen Pulverkaffee anrührt. Manchmal spricht er nämlich Deutsch. Seine alte Band ist in den Sechzigerjahren in Deutschland auf Tour gewesen. Die Geschichten, die er uns darüber erzählt, enden immer mit »… und dann haben wir ein paar nette Frauen kennengelernt, die sehr freundlich zu uns waren«, worauf meine Mutter ihm einen halb tadelnden, halb wuschigen Blick zuwirft – dass diese Storys sie auch antörnten, dämmerte mir erst Jahre später.
»Angie!«, brüllte er nach oben. »Wo ist meine Hose?«
Mum brüllte aus dem Schlafzimmer zurück: »Du hast keine!«
»Wie? Ich hab keine?«
Sie schwieg. Er musste schon allein auf des Rätsels Lösung kommen.
Ich vertiefte mich wieder ins Kartoffelschälen. Ich bin verliebt in das Schälmesser. Es liegt so gut in der Hand. Zusammen müssen wir schon tonnenweise Kartoffeln geschält haben. Wir sind ein klasse Team. Wie König Artus und sein Excalibur.
»Heute ist mein großer Tag, da brauche ich meine Hose.« Dad nippt an seinem Kaffee. »Ich muss mal wieder vorsprechen. Für meine Paraderolle – Pat Morrigan, demütiger Krüppel.«
Er stellt die Tasse weg und übt schon mal hinken, einmal durch die Küche und wieder zurück.
»Wie war ich?«, will er hinterher wissen.
»Besser kann man gar nicht hinken, Dad!«, sage ich, ganz die brave Tochter.
Er probiert eine andere Version – diesmal mit nachgezogenem Fuß. »Das ist mein Richard III.«, lässt er mich wissen.
Das Training geht weiter.
»Ich glaube, deine Hose ist in der Maschine«, sage ich.
»Wie wäre es mit Soundeffekten?«, fragt er. »Im Stöhnen macht mir so leicht keiner was vor.«
Dad fiebert den Terminen beim Amtsarzt regelrecht entgegen. Sie sind seine Highlights des Jahres.
»Ich spiele mit dem Gedanken, mir auch noch einen kaputten Rücken zuzulegen«, meint er. »Wenn ich seit zwanzig Jahren so hinken würde, wäre mein Rücken doch garantiert längst im Eimer. Kleine Wirbelsäulenverkrümmung. Nichts Dramatisches.«
Es klingelt an der Haustür.
»Das ist bestimmt die Hebamme!«, ruft Mum von oben.
Vor drei Wochen hat sie die Überraschungszwillinge bekommen, nachdem sie den ganzen Herbst über ihr Gewicht gejammert und ihr sowieso schon wahnwitziges Lauftraining noch gesteigert hatte – erst von fünf auf sieben und dann sogar auf zehn Meilen am Tag. Bei Schnee und Regen zog sie ihre Runden durch die Siedlung – ein großer weißer Geist, so blass wie Krissi, einen dicken Bauch vor sich hertragend, der einfach nicht wieder weggehen wollte.
An Weihnachten erfuhr sie dann, dass sie Zwillinge erwartete. »Der Weihnachtsmann ist ein perverser Scherzkeks«, sagte sie, als sie Heiligabend vom Frauenarzt zurückkam. Dann legte sie sich auf die Couch und starrte stundenlang an die Decke. Sie stieß so tiefe, heftige Verzweiflungsseufzer aus, dass das Lametta am Weihnachtsbaum flatterte.
Jetzt leidet sie an einer Wochenbettdepression, aber das wissen wir noch nicht. Daddy sucht die Schuld für ihr »Stimmungstief« bei ihren entfernten Vorfahren, die von den Hebriden stammen. »Das liegt in deinen Genen. Tut mir leid, aber wer Papageientauchern den Kragen umdreht, um sie zu verspeisen, ist von Natur aus selbstmordgefährdet.« Was sie natürlich nur noch schwermütiger macht.
Als wir vor zwei Tagen keinen Käse mehr im Haus hatten, hat sie eine geschlagene Stunde auf einen der Zwillinge runtergeweint.
»Die Taufe können wir uns jetzt sparen, du hast ja seinen Kopf schon völlig durchtränkt«, witzelte Dad, um sie aufzuheitern.
Sie weinte weiter. Da ist er schnell losgelaufen und hat ihr eine Schachtel Pralinen gekauft. Wo der Pseudogeschenkanhänger mit »VON« und »FÜR« aufgedruckt ist, kritzelte er ICH LIEBE DICH hin. Und während sie schniefend Denver Clan guckte, hat sie die Schachtel tatsächlich leer gemacht.
Bevor Mum die Überraschungszwillinge bekam, war sie eine sehr lustige Mutter. Sie kochte leckere Suppen und spielte Monopoly mit uns, und wenn sie ein bisschen was getrunken hatte, zwirbelte sie sich die Haare rechts und links zum Knoten hoch und spielte Prinzessin Leia aus Star Wars. (»Hol mir noch ein Glas, Pat. Du bist meine einzige Hoffnung.«)
Aber seitdem wir die Zwillinge haben, sind Mums Lippen nur noch ein dünner Strich. Sie kämmt sich nicht mehr und redet kaum ein Wort, höchstens was Sarkastisches oder »Ich bin so müde«. Deshalb haben die Überraschungszwillinge auch noch keinen Namen. Deshalb weint Lupin so oft, und deshalb verbringe ich, obwohl ich mich viel lieber mit Romanen aus dem neunzehnten Jahrhundert oder Masturbieren beschäftigen würde, wahnsinnig viel Zeit mit Kartoffelschälen. Wir haben keine Mutter mehr. Wo sie bis vor Kurzem noch gewesen ist, klafft ein großes Loch.
»Ich bin zu müde, um mir Namen für sie auszudenken«, antwortet sie, wenn wir sie fragen, wie die Zwillinge heißen sollen. »Reicht es nicht, dass ich sie gemacht habe?«
Krissi, Lupin und ich nennen die beiden jetzt einfach »David« und »Mavid«.
»Dann pack ich wohl mal lieber mein Gehänge weg.« Dad wickelt den Morgenrock fester um sich. »Ich hab keinen Bock auf eine kostenlose Eierbeschau.«
Mavid, der in der Diele im Zwillingswagen geparkt ist, fängt an zu quengeln. Ich nehme ihn auf den Arm und gehe mit ihm zur Tür.
Die Hebamme ist neu, ich kenne sie noch nicht. Mavid schreit und wird ein bisschen geschuckelt.
Ich begrüße die Frau mit einem fröhlichen »Bei uns ist alles im Lack!«.
»Guten Morgen.«
Sofort besinne ich mich auf meine guten Manieren: »Möchten Sie ins Wohnzimmer durchtreten?« Ich will ihr zeigen, dass die Säuglinge gut versorgt werden – und zwar von der gesamten Familie. Auch wenn ihre Mutter zurzeit nur ein Geist ist.
Krissi und Lupin sind über die Störung nicht besonders entzückt. Krissi muss erst mal übertrieben umständlich auf der Fernbedienung nach der Pausentaste suchen. Das Geträller der Trapp-Familie bricht mitten im »Edelweiß« ab.
Nach kurzem Grollen rücken meine Brüder auf der Couch ein Stückchen zusammen, damit die Hebamme auch noch Platz hat. Sie zieht sich den Rock über die Knie.
»Wie geht es denn der jungen Mutter?«, will sie wissen.
»Körperlich … ganz gut«, antworte ich. Und bis auf den Blutdruck geht es Mum gesundheitlich wirklich nicht schlecht. Aber der ist meine Schuld, weil ich mich tot gestellt habe. Deshalb behalte ich es lieber für mich.
»Und die Zwillinge schlafen gut?«
»Doch, ja. Nachts kommen sie zwar ein paarmal, aber was will man machen? Das liegt nun einmal in der Natur des Neugeborenen«, sage ich. Wahrscheinlich ist die Frau schwer beeindruckt, was für eine fürsorgliche große Schwester ich bin. Und natürlich auch, wie gewählt ich mich ausdrücken kann.
»Bekommt die junge Mutter auch genug Schlaf?«
»Nun ja, es geht so. Man muss natürlich zwischendurch immer mal wieder nach den Kleinen sehen.«
»Und wie macht sich die Naht?«
Damit hat sie mich voll auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß zwar, dass meine Mutter nach der Entbindung mit zweiundvierzig Stichen genäht werden musste und dass sie die Naht jeden Tag mit warmem Salzwasser spült – weil ich ihr immer die Schüssel nach oben schleppen muss –, aber sehr viel mehr hat sie mir über den Zustand ihrer Fortpflanzungsorgane nicht anvertraut. Doch nachdem ich in dem Buch Spirituelle Hebammen von Ina May Gaskin gelesen habe, dass sich Frauen nach der Geburt gegenüber den Jungfrauen des Stammes über die Einzelheiten der Niederkunft häufig bedeckt halten, mache ich mir deswegen keinen großen Kopf. Aber das bisschen, das ich weiß, will ich der Hebamme gern mitteilen.
»Wird jeden Tag mit warmem Salzwasser gewaschen!«, antworte ich mit unerschütterlicher Fröhlichkeit.
»Und die Naht verursacht keinerlei Beschwerden?«, hakt die Frau nach. »Sie blutet oder nässt nicht?«
Jetzt bin ich langsam doch überfragt.
»Oder möchten Sie lieber nicht vor den Kindern darüber sprechen?«
Meine Brüder, die sich auf der Couch fläzen, staunen Bauklötze.
»Kinder, lasst ihr eure Mummy und mich bitte einen Augenblick allein?«, wendet sich die Hebamme an sie. »Wir möchten gern kurz unter vier Augen miteinander reden.«
Atomblitzartig geht mir ein Licht auf.
»Wow, das ist ja ein Ding«, sagt Krissi. »Ein neues Zeitalter bricht an.«
»Aber ich bin hier doch gar nicht die Mutter!«, rufe ich entsetzt. Glaubt sie allen Ernstes, ich hätte fünf Kinder in die Welt gesetzt? Das kann doch wohl nicht wahr sein!
»Die Zwillinge sind nicht von mir!« Ich sehe auf Mavid runter. Der kleine Kerl ist rot angelaufen. Er hat sich mit den winzigen Fingern in einer Schlaufe des mädchenrosa Babydeckchens verfangen.
»Aber sind Sie denn nicht Angie Morrigan?« Die Hebamme wirft einen panischen Blick in ihre Unterlagen.
Ich kratze meine letzten Reste an Würde zusammen. »Nein, ich bin Johanna Morrigan, ihre vierzehnjährige Tochter.«
Da endlich kommt meine Mutter ins Wohnzimmer. Sie geht mit ganz kleinen Schritten, wegen der zweiundvierzig Stiche – die sie hat und nicht ich.
Wie von der Tarantel gestochen springt die Hebamme auf. »Mrs. Morrigan, bitte entschuldigen Sie. Es hat da ein kleines Missverständnis gegeben.«
Krissi und Lupin verdünnisieren sich schneller als ein Furz im Wind. Nachdem ich Mavid an meine Mutter abgegeben habe, gönne ich mir noch eine letzte spitze Bemerkung – »Mein kleines Brüderchen war bei mir in den allerbesten Händen« – und mache mich ebenfalls aus dem Staub.
Wir laufen in den Garten, klettern hinten über den kaputten Zaun und stürmen auf die Wiese, wobei Krissi die ganze Zeit laut aaaaaaaaaaaaaah jault.
Erst als wir im hohen Gras sitzen und vom Haus aus nicht mehr zu sehen sind, hängt er an das Aaaaaaaaaaah schließlich noch ein »Du bist unsere MAMA!« hinten dran.
Die beiden können sich überhaupt nicht mehr einkriegen vor Lachen, bis Lupin irgendwann losflennt, weil es ihm zu laut ist. Ich schmeiße mich mit dem Gesicht ins Gras und mache »GRRR!«
Das liegt alles nur daran, dass ich dick bin. Bei einer dicken Jugendlichen verschätzen sich die Leute oft mit dem Alter. Wer einen 85D-BH trägt, gilt automatisch als sexuell aktiv. Jeder geht davon aus, dass man auf irgendeiner verwilderten Industriebrache mit häufig wechselnden Alphamännchen Geschlechtsverkehr hat. Tja, schön wär’s. Mich hat bis jetzt noch nicht mal einer geküsst. Dabei würde ich es so wahnsinnig gern versuchen. Ich bin stinksauer, dass mich noch keiner geküsst hat. Ich glaube nämlich, dass ich im Knutschen eine Eins wäre. Wenn ich erst mit der Küsserei anfange, muss sich die Welt warm anziehen. Sie wird nicht wiederzuerkennen sein. Ich werde fürs Küssen das sein, was die Beatles für die Musik waren.
Stattdessen traut man mir, ungeküsst, wie ich bin, die unbefleckte Empfängnis von fünf Kindern zu. Dagegen sieht die Jungfrau Maria mit ihrem Einzelkind ganz schön alt aus. Ich hab eine ganze Brut von Jesussen an der Backe – und muss mich von ihnen auch noch auslachen lassen.
»Mummy, Mummy, darf ich mal nuckeln?«, fragt Lupin und schmeißt sich an mich ran, damit ich ihn stille. Diese Schmach wäre mir erspart geblieben, wenn ich so dünn wäre wie meine Cousine Meg. Meg ist schon fünfmal »gefingert« worden. Das hat sie mir im Bus nach Brewood selber erzählt. Was »fingern« genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich hab bloß irgendwie das ungute Gefühl, dass einem dabei einer an den Hintern grabschen will. Aber Meg trägt immer Latzhosen. Wie soll da also überhaupt einer drangekommen sein?
»Mummy, lässt du mich wieder rein?« Lupin rammt mir den Kopf in den Schoß. Alles prustet vor Lachen. Mir ist die ganze Geschichte so peinlich, dass ich sogar das Fluchen verlernt habe.
»Himmel, Arsch und … Arsch!«, brülle ich. Meine Brüder johlen nur noch lauter.
Ein Ruf hallt durch den Garten, über die Wiese, bis zu uns. Es ist unsere Mutter. Unsere echte Mutter, die tatsächlich fünf Kinder zur Welt gebracht hat, steht am offenen Badezimmerfenster und ruft: »Kann mal einer eurem Dad helfen, seine Hose zu suchen?«
Eine Stunde später fahre ich mit meinem Vater durch die City von Wolverhampton. Wir haben seine Hose dann doch noch gefunden. Sie lag unter der Treppe. Unter dem Hund.
Wolverhampton im Jahr 1990 sieht so aus, als wäre hier ein großes Unglück geschehen.
»Und das Unglück hat sogar einen Namen«, sagt Dad, während wir die Cleveland Street runterfahren. »Thatcher.«
Mein Vater hasst Margaret Thatcher aus tiefster Seele. Für mich klingt das immer so, als ob sie meinen Vater irgendwann mal im Kampf besiegt hat und er nur um Haaresbreite mit dem Leben davongekommen ist. Und dass bei ihrer nächsten Begegnung mit Sicherheit einer von beiden auf der Strecke bleiben wird. So ähnlich wie bei Gandalf und dem Balrog.
»Ich könnte das Weib umbringen«, hat er früher immer gewütet, wenn im Fernsehen über den Bergarbeiterstreik berichtet wurde. »Und es wäre blanke Notwehr. Sie hat diesem Land die Eier abgerissen und lässt es verbluten. Um ihren Willen durchzuboxen, wäre Maggie Thatcher imstande, euch das Brot aus dem Mund zu nehmen, Kinders. Aus dem Mund!«
Und falls wir dann zufälligerweise gerade Brot aßen, riss er es uns aus dem Mund, um uns am eigenen Leib zu veranschaulichen, was er damit meinte.
»Thatcher!«, rief er mit vor Wut glühenden Augen, während wir weinten. »Verdammte Thatcher. Wenn es jemals einer von euch wagen sollte, mir zu sagen, dass er die Torys gewählt hat, kriegt er von mir einen Tritt in den Arsch, dass ihm Sitzen und Stehen vergeht. Wir wählen Labour.«
Das Stadtzentrum ist verödet, als wäre die Hälfte der Bevölkerung weggezogen. Aus den Dachfenstern viktorianischer Häuserblocks wachsen Fliederbüsche. Auf dem Grund des Kanals stapeln sich alte Waschmaschinen. Straßenweise stehen die Fabriken leer – Eisenhütten, Stahlwerke und sämtliche Schlossereien, außer Chubb. Die Fahrradfabriken: Percy Stallard, Marston, Sunbeam, Star, Wulfruna und Rudge. Die Werkstätten für Edelstahlschmuck und Japanlack. Die Kohlenhändler. An unser Oberleitungsbussystem – früher das größte weltweit – erinnert nur noch das verblasste Aderngeflecht auf alten Stadtplänen.
Als Kind des Kalten Krieges und der ständig drohenden Gefahr einer nuklearen Apokalypse hatte ich immer das unbestimmte Gefühl, die Katastrophe hätte bereits stattgefunden – und zwar genau vor unserer Haustür. Wolverhampton ist wie die verfallene Zitadelle aus Das Wunder von Narnia (C. S. Lewis). Eine Stadt, die, als ich noch sehr klein war, ein schweres Trauma erlitten haben muss, von dem heute keiner mehr redet, weil sich die Gemeinde als Ganzes für ihren Tod verantwortlich fühlt, als hätte sie nicht gut genug auf sie aufgepasst. Sterbende Industriestädte riechen nach Schuld und Angst. Bis heute bittet die ältere Generation die jüngere stumm um Vergebung.
Während der Fahrt betet Dad seinen üblichen Monolog runter.
»Als ich noch ein Kind war, hörte man um diese Uhrzeit nur das Stiefelpoltern der Männer, die in die Fabrik stapften«, sagt er. »Die Busse waren brechend voll, auf den Straßen wimmelte es von Menschen. Wer hier Arbeit finden wollte, brauchte keine zwei Tage nach einer Stelle zu suchen. Und heute? Sieh dir doch an, was aus dieser Stadt geworden ist.«
Ich sehe es mir an. Von polternden Arbeiterstiefeln keine Spur. Und auch Männer sehen wir erst, als wir am Arbeitsamt vorbeikommen, wo sie in einer langen Schlange geduldig anstehen, alle mit den gleichen dünnen Beinen in den gleichen engen Billigjeans, die Haare unterschiedlich lang, eine Selbstgedrehte im Mund.
Als Dad an der Ampel anhalten muss, kurbelt er das Fenster runter. Er hat einen der Wartenden erkannt. Der Mann ist so um die vierzig und trägt ein verwaschenes Simply-Red-T-Shirt.
»Macks! Na, alles fit im Schritt?«
»Alles senkrecht, Pat«, antwortet Macks ruhig. Er hat noch ungefähr zwanzig Mann vor sich.
»Dann bis später, im Red Lion«, sagt Daddy, als die Ampel auf Grün umspringt.
»Bis denne. Und hau nicht vorher alles auf den Kopf.«
Wir umkurven den Queen Square, das Herz von Wolverhampton, Treffpunkt der Jugendszene – unser linkes Seine-Ufer, unser Haight-Ashbury, unser Soho. Rechts fünf Skateboarder, links drei Goths, die um das Reiterstandbild rumhocken. Der Mann auf dem Gaul ist unser einziges Wahrzeichen – die Freiheitsstatue von Wolverhampton.
Dad kurbelt wieder das Fenster runter.
»Kopf hoch, Leute. Vielleicht fällt der Weltuntergang ja aus«, ruft er den Goths zu, während er mit vierzig Meilen durch die Zwanzigerzone brettert.
»Klaro, Pat!«, ruft die Kleinste aus der Gruppe zurück. »Und übrigens, ich glaub, deine Kupplung ist im Arsch.«
Lachend fährt Daddy weiter. Ich bin baff.
»Sag bloß, du kennst die?«, frage ich. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Goths auf dieser Daseinsebene überhaupt irgendwen kennen. Dass sie zum Beispiel Nachbarn haben.
»Das war deine Cousine Ali«, antwortet Dad und kurbelt das Fenster hoch.
»Tatsache?« Ich verrenke mir den Hals nach der kleinen Goth-Gestalt, die mir vollkommen fremd vorkommt.
»Tatsache. Ist letztes Jahr auf Goth umgestiegen. Eins kann ich dir flüstern – du brauchst keine Angst zu haben, dass du in dieser Stadt mal ohne freakige Verwandtschaft dastehst, Kurze.«
Wir fahren weiter. Obwohl mein Vater acht Geschwister und siebenundzwanzig Neffen und Nichten unterschiedlichster Art und Intelligenz hat – Cousin Adam ist zum Beispiel berühmt dafür, dass er mal auf einer Familienfeier eine kleine Glühbirne verschluckt hat –, habe ich bis jetzt nicht gewusst, dass auch eine Nichte dazugehört, die zur Gegenkultur übergelaufen ist. Wir haben nicht viel Kontakt zu Onkel Aled. Er wohnt in Gosnell und hat Dad mal beim Verkauf eines gebrauchten Aquariums über den Tisch gezogen.
Ich finde es richtig spannend, eine Goth-Cousine zu haben. Die anderen, die ich kenne, tragen alle rosa Latzhosen und stehen auf Rick Astley.
Wie Daddy schon sagte: Heute muss er mal wieder für seine Paraderolle vorsprechen: Pat Morrigan – demütiger Krüppel. Dabei ist er tatsächlich behindert. Manchmal schafft er es kaum, aus dem Bett aufzustehen. Aber wie sagt er so richtig? Zu behindert kann man gar nicht sein. Behinderungen werden unterschiedlich wahrgenommen. Dad hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Behinderung so überzeugend darzustellen, dass nicht mal der pingeligste Prüfer auf die Idee käme, weitere Untersuchungen anzuordnen. Dann würde uns das Sozialamt nämlich erst mal die Invalidenrente streichen und eine siebenköpfige Familie gewissermaßen ins Armenhaus verfrachten.
»Ich werde jeglichen Zweifel im Keim ersticken«, sagt er, als er den Bully vor dem Amt auf dem Bürgersteig parkt.
Bei dem Termin heute geht es darum, ob seine Behindertenplakette – ein Strichmännchen im Rollstuhl auf knallorangenem Grund – wieder um ein Jahr verlängert wird. Damit darf er so ziemlich überall parken, im Halteverbot, auf dem Bürgersteig, auf den Privatparkplätzen anderer Leute. Als wäre er ein Royal, ein Promi oder ein Superheld. Wir Kinder sehen Dads Behinderung ganz klar als Auszeichnung an. Und wir sind stolz darauf.
Bedächtig hinkt er über den Vorplatz. »Man weiß nie, ob man nicht beobachtet wird«, sagt er und deutet mit dem Kopf auf die Fenster im oberen Stock. »Womöglich haben sie mich schon mit ihrem Zielfernrohr ins Visier genommen, wie im Schakal. Ich muss hinken bis zum Umfallen.« Und bis zu seiner Sachbearbeiterin im Civic Centre.
Das Civic Centre ist das Bettelzentrum von Wolvo. Wohngeld, Sozialhilfe, Trouble mit der Bürokratie – hier gibt es eine Lösung für alles. Wer dieses Gebäude betritt, will darin irgendwem irgendwas aus den Rippen leiern.
Deshalb vermittelt der Bau den Eindruck einer mittelalterlichen Trutzburg inmitten eines ausgesprochen lustlosen passiv-aggressiven Belagerungsrings. Statt die anrückenden Truppen mit siedendem Öl zu übergießen, begräbt man sie unter einem Berg unverständlicher Formulare und Anträge. Oder man schickt sie weiter. Oder man sichert ihnen einen schriftlichen Bescheid binnen vierzehn Tagen zu. Man lässt sie gegen eine Gummiwand laufen. Ich muss dabei oft an den Rat denken, den Graham Greene in Die Reisen mit meiner Tante von Tante Augusta bekommt: Er soll jede Rechnung mit einem Brief beantworten, der folgendermaßen beginnt: »Bezugnehmend auf mein Schreiben vom 17. Januar …« Wobei es ein solches Schreiben natürlich gar nicht gibt. Aber die grenzenlose Verwirrung, in die man den Feind damit stürzt, verschafft einem den vielleicht alles entscheidenden Vorteil.
Dad begegnet hier jedem mit der überschwänglichen Jovialität eines Fernsehstars: »Gern, Barb. Wird gemacht, Ron. Super, Pamela!« Ein Auftreten, das er eindeutig dem Sozialschmarotzer Joey Boswell aus Bread abgeguckt hat.
Aber ganz egal, woher er es hat, er unterscheidet sich damit deutlich von den anderen Antragstellern, deren Haltung von »unterwürfig« über »mutlos« bis »wütend« reicht – und manchmal sogar bis zu: »Ich bin am Ende. Wenn nicht bald das Wohngeld kommt, lade ich meine Kinder bei Ihnen ab und gehe anschaffen.« Als wäre das nicht schon schlimm genug, sitzen hier und da auch noch verwirrte Rentner oder häuslich betreute Psychiatriepatienten herum, die leise vor sich hin weinen.
Mein Vater dagegen strahlt eine zen-mäßige, hoheitsvolle Ruhe aus. Für jeden hat er ein Lächeln übrig. Er betritt das Gebäude wie ein König.
»Ohne Leute wie mich wären die Schreibtischhengste arbeitslos«, sagt er. »Wenn man so will, bin ich ihr Arbeitgeber.«
Da ich mich in der Stadtbibliothek inzwischen bis zur Abteilung »Philosophie« vorgearbeitet habe – genauer gesagt, bis zum Thema »Kausalität« –, erörtern wir kurz die temporale Logik seiner Aussage.
»Es wird immer arme Leute geben, Johanna«, führt er aus. »Vor dem großen Sozialreformer Nye Bevan war meine Mum mit ihren neun Kindern auf Almosen angewiesen. Die anderen Dorfbewohner fanden es so deprimierend, sie um Brot betteln zu sehen, dass sie, kaum war der Zweite Weltkrieg vorbei, ruck, zuck für den Wohlfahrtsstaat gestimmt haben. Es erniedrigt eine Gesellschaft, wenn Teile von ihr auf willkürlich verteilte milde Gaben angewiesen sind, Johanna. Stell dir doch mal vor, wir müssten einmal die Woche bei Mrs. Forsyth anklopfen und sie um … was weiß ich … Schinken bitten.«
Mrs. Forsyth ist unsere Nachbarin von gegenüber und eine Respektsperson, ein dauergewellter Dragoner von einem Weib, das die Hausarbeit in Pantoffeln erledigt. Sie war die Erste in unserer Straße, die dem Wohnungsamt ihr Häuschen abgekauft hat, und sie hat als Erste den gesamten Vorgarten asphaltieren lassen. Was eine Schande ist, weil da der Strauch mit den leckersten Himbeeren in der ganzen Siedlung wuchs.
Dad hat vollkommen recht. Mrs. Forsyth würde sich schön bedanken, wenn wir alle naselang bei ihr aufkreuzen würden, um Essen zu schnorren. Oder Klopapier.
»Die Menschen wollen auf dem Weg zum Supermarkt eben nicht über einäugige, flennende Waisenkinder stolpern. Das ist für eine Gesellschaft nicht gerade der Bringer. Arme Leute, die Not leiden, hat es immer schon gegeben, Johanna. Der Wohlfahrtsstaat lässt es sich ein hübsches Sümmchen kosten, dieses Problem unter den Teppich zu kehren. Keine halb erfrorenen Mädchen mit Schwefelhölzern in den Ladeneingängen mehr. Das verbessert die Stimmungslage. Du kennst doch deinen Charles Dickens, oder?«
»Nur Die Muppets-Weihnachtsgeschichte«, sage ich unsicher.
»Na also«, antwortet er. »Dann weißt du ja, was sich gehört. Man schenkt den ärmsten Leuten den größten Truthahn, der beim Metzger im Fenster liegt. Und meinen Truthahn hol ich mir jetzt ab.«
Während er dem medizinischen Dienst medizinisch zu Diensten ist, sehe ich mir die Leute im Wartebereich an. Ich überlege mir, welchem Promi sie am meisten ähnlich sehen und ob ich auf dieser Grundlage mit ihnen schlafen würde.
Noch mehr als der industrielle Niedergang Wolverhamptons liegt mir nämlich meine Entjungferung am Herzen. Das Thema brennt mir derart auf den Nägeln, dass schon die ganze Familie darunter leidet. Ich bin fest entschlossen, vor meinem sechzehnten Geburtstag Sex zu haben. Zu warten, bis es legal ist, kommt mir geschummelt vor. Ab sechzehn ist es doch keine Kunst mehr. Aber für Vierzehnjährige – allein unter Brüdern und in Mutters BH – ist Sex in etwa genauso wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto.
Ich unterziehe alle Männer im Wartebereich meinem »Sex-Test«. Der in der Thermoweste hat Ähnlichkeit mit Dr. Alban – nein. Der mit den Troddelschuhen erinnert mich an John Cleese von Monty Python – auch nicht. Der, dem die Haare aus der Nase sprießen, sieht aus wie eine Karikatur von Spike Milligan – nie im Leben.
Fünf Männer könnten glatt als Doppelgänger von Freddy Mercury durchgehen. In Wolverhampton gelten Schnurrbart und Lederjacke 1990 immer noch als ausgesprochen heterosexueller Look. Ich würde mit keinem dieser Typen Sex haben wollen. Es sei denn natürlich, einer von ihnen würde mich ganz nett fragen. Aber das ist wohl kaum zu erwarten.
Wie an jedem anderen Tag werde ich auch heute wieder als vollschlanke Jungfrau schlafen gehen, deren Tagebuch aus fiktiven Briefen an den knackigen Gilbert Blythe aus Anne auf Green Gables besteht.
Gilbert spukt mir immer noch im Kopf herum, als ich Stunden später mit unserer Schäferhündin einen Spaziergang mache. Anders als ihre Vorgängerin ist Bianca zu nervös, um sich Kindersachen anziehen oder Stofftiere auf den Rücken binden zu lassen, die wie Jockeys auf ihr reiten. Ich liebe sie trotzdem.
»Du findest doch auch, dass wir Seelenverwandte sind, oder?«, frage ich sie, während wir die Enville Road runtergehen.
In meinen Romanen aus dem neunzehnten Jahrhundert kommt es oft vor, dass die junge Heldin ein wildes Tier adoptiert – einen Wolf, Fuchs oder Falken beispielsweise –, mit dem sie sich auf geradezu telepathische Weise verbunden fühlt.
Auch Bianca und ich kommunizieren ohne Worte, nur in Gedanken.
»Ich kann es kaum erwarten, nach London zu ziehen«, sage ich zu ihr, als sie im Rinnstein hockt und angestrengt ihr Geschäft verrichtet. Um ihre Intimsphäre zu wahren, wende ich rücksichtsvoll den Blick ab. Ich habe das Gefühl, da legt sie Wert drauf. »Wenn wir erst in London wohnen, kann ich endlich anfangen, ich selbst zu sein.«
Wie genau das aussehen soll, weiß ich auch nicht. Dafür gibt es noch kein Wort. Ich habe kein konkretes Ziel, das ich anpeilen kann. Was ich sein will, ist noch nicht erfunden worden.
Obwohl mir dazu das eine oder andere natürlich schon einfällt: Vor allem will ich es in London so richtig krachen lassen. Ich stelle mir London wie einen großen Saal vor. Wenn ich hereinkomme, klappt der ganzen Stadt die Kinnlade runter, wie Sid James in den Ist-ja-irre-Filmen beim Anblick einer drallen Oberschwester. Das will ich. Männer, Frauen, Minotauren – ich lese gern griechische Sagen und nehme, was ich kriegen kann – sollen mit mir Sex haben wollen. An den sexysten Orten und so sexy wie möglich. Das ist meine wichtigste Mission. Meine Hormone sind außer Rand und Band, in mir geht es zu wie in einem brennenden Zoo. Ein Mandrill mit loderndem Kopf sperrt die Käfige der anderen Tiere auf und kreischt: »HOSSA – AUF INS GEWÜHL!« Ich bin ein sexuelles Notstandsgebiet! Ich reibe mir die Finger wund, bis auf die Knochen.
Neben heißer Erotik wünsche ich mir noch … Edelmut. Ich möchte ein durch und durch edelmütiger Mensch sein und mich einer guten Sache verschreiben, meinen Beitrag leisten. Mich wie eine Ein-Frau-Armee in den Kampf stürzen. Mit vollem Körpereinsatz. Sobald ich endlich was gefunden habe, woran ich glauben kann, werde ich meine Überzeugung überzeugender vertreten als jeder andere Vertreter einer anderen Überzeugung. Mit Inbrunst.
Ich habe allerdings nicht vor, mir dabei noble, engagierte Frauengestalten aus der Geschichte zum Vorbild zu nehmen. Mit den meisten von ihnen hat es das Schicksal nicht gerade gut gemeint, entweder wurden sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt, siechten an Schwermut dahin oder mussten sich von einem Grafen in einem Turm einmauern lassen. Ich will mich nicht für etwas opfern, nicht für etwas sterben. Ich will auch nicht im strömenden Regen einen Berg rauflaufen, sodass mir der Rock an den Beinen klebt. Ich möchte lieber für etwas leben – wie ein Mann. Ich will Spaß haben. So viel Spaß wie sonst keiner. Ich will feiern, als wäre es schon 1999 – neun Jahre zu früh. Will mich von meinem Ziel begeistern lassen. Mich dem Vergnügen hingeben. Die Welt verbessern, irgendwie.
Nachdem ich den Saal – London – betreten habe und alle Anwesenden mit Maulsperre dastehen, soll ein Beifallssturm losbrechen, wie bei Oscar Wilde, wenn er am Premierenabend ein Restaurant betritt. Ich male mir aus, dass sich alle Menschen, die ich bewundere – Douglas Adams, Dorothy Parker, French & Saunders, der alte Labour-Kämpe Tony Benn – um mich scharen und mir zuraunen: »Du bist einzigartig, Darling! Wie machst du das nur?«
Gute Frage. Noch hab ich ja selbst keine Ahnung, wohin mit meinen kribbeligen, hibbeligen Gefühlen. Hauptsache, es läuft irgendwann darauf hinaus, dass ich, von einem Kreis schmauchender Bonvivants umgeben, Anekdoten zum Besten gebe, bei denen kein Auge trocken bleibt. (Stephen Fry und Hugh Laurie, die sich die Tränen abwischen: »Du bist köstlich. Gibt es in Wolverhampton noch mehr von deiner Sorte? Sprudelt dort ein Quell der Heiterkeit?« Ich: »Nein, Stephen Fry und Hugh Laurie. Ich bin die Einzige. Die Jungs an meiner Schule haben mich ›Trampeltier‹ genannt.« Stephen Fry: »Unterbelichtete Windbeutel, mein Herz. Gib dich nicht mit ihnen ab. Noch ein Schlückchen Schampus?«)
Bis jetzt ist mir als einziges Ziel die Schriftstellerei eingefallen. Anders als Choreografie, Architektur oder die Eroberung von Königreichen kann man sie nämlich auch betreiben, wenn man arm und einsam ist. Man braucht nicht mal eine besondere Infrastruktur dafür, wie beispielsweise eine Balletttruppe oder Kanonen. Schreiben kann man auch ohne Geld. Das Schreiben ist eine der wenigen Tätigkeiten, bei denen Armut oder Vitamin-B-Mangel kein Hindernis sind.
Um die endlosen leeren Stunden des Tages totzuschlagen, habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben. Es handelt von einem dicken Mädchen, das auf einem Drachen durch die Zeit reitet und überall auf der Welt gute Taten vollbringt. Im ersten Kapitel reist sie ins Jahr 1939. Durch eine flammende Rede gelingt es ihr, Hitler zur Einsicht zu bringen. Unter Tränen gelobt er ihr, sich zu bessern.
Außerdem habe ich schon einige Seiten über den Schwarzen Tod fertig. Ich verhindere den Ausbruch der Pest, indem ich in den größeren britischen Häfen strenge Quarantänevorschriften für einlaufende Handelsschiffe erlasse. Ich finde nämlich, wenn man Missstände beseitigen will, sollte man auf Anordnungen von ganz oben setzen. Damit lassen sich die Dinge am einfachsten verändern.
Vor drei Tagen habe ich eine Liebesszene zwischen einem Mädchen und einem heißen jungen Zauberer geschrieben, auf die ich ungemein stolz war – bis ich feststellen musste, dass das Manuskript offenbar Krissi in die Hände gefallen war. Er hatte nämlich »Was für ein elendes Geschwurbel!« an den Rand geschrieben. Krissi ist ein ebenso strenger wie ungebetener Lektor.
»Spätestens wenn ich sechzehn bin, sind wir sowieso aus Wolverhampton weggezogen«, vertraue ich Bianca an. »Bis dahin habe ich die Lektionen in Armut und Schande, die das Leben mir so freundlich erteilt, so weit verinnerlicht, dass ich bei der Oscar-Verleihung mit einer erfrischend neuen Perspektive aufwarten kann. Durch mein heiteres, edles Gemüt werde ich die anderen Stars beeindrucken – und bestimmt auch mit einem von ihnen im Bett landen.«
Ein lautes »OI!« reißt mich rüde aus meinem erotisch besinnlichen Tagtraum.
Ich überhöre es geflissentlich. Ein Oi bedeutet nichts Gutes. Das hat Daddy uns beigebracht: Wenn du ein Oi hörst, geh weiter. Und zwar flott.
»Oi!«, tönt es noch einmal. »Du TÖLE!«
Ich drehe mich um. In einem Vorgarten steht ein wütender Mann im Wolverhampton-Trikot.
»DEINE TÖLE!«
Von Bianca ist keine Spur zu sehen.
»DEIN DRECKSKÖTER IST IN MEINEM GARTEN!«
Mist. Jetzt hab ich doch glatt die geistige Verbindung zu Bianca unterbrochen, weil ich ans Vögeln gedacht habe. Wo steckt sie bloß? Als ich nach ihr pfeife, kommt sie aus dem Garten des Krakeelers gesprungen.
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung!« Hoffentlich bringe ich ihn mit meinem Akzent nicht noch mehr auf die Palme. Ich rede nämlich haargenau wie meine Mutter, mit einer kristallklaren Aussprache, die man in unserer Sozialsiedlung nur selten zu hören kriegt. Dass ich vor Nervosität quäke, macht die Sache auch nicht besser.
»Es tut mir unendlich leid. Das war unverzeihlich von mir. Aber ich darf Ihnen zu Ihrer Beruhigung versichern, dass Bianca eine sehr sanftmütige …«
»Ich hol gleich meine Axt und schlag dem Vieh die Rübe ein!«, brüllt er.
Schlotternd gehe ich weiter, auf dem schnellsten Weg zu meiner Freundin Violet. Ich bin völlig durch den Wind, dass man mich mit einer Axt bedroht hat, und muss unbedingt mit jemandem reden. Violet ist meine neueste und beste Freundin – und auch die einzige, bis auf Emily Pagett, die mich an Baba aus denFünfzehnjährigenvon Edna O’Brien erinnert. Sie verbreitet nämlich oft Lügen über mich. Das lasse ich mir nur deshalb gefallen, weil sie mich dafür mit spannendem Tratsch über andere Leute entschädigt, den sie sich ebenfalls aus den Fingern saugt. Letzten Endes amüsiert sich eben jeder, so gut er kann.
Also ab zu Violet. Sie ist zweiundsiebzig und wohnt mit ihren Siamkatzen Tink und Tonk am Ende unserer Straße.
Seit einigen Monaten besuche ich Violet ein-, zweimal in der Woche. Es gibt wohl kaum etwas Reizenderes als eine Teenagerin, die den freundschaftlichen Kontakt zur älteren Generation sucht.
»Sie lässt die Vergangenheit wieder lebendig werden«, denke ich mir. Allerdings stimmt das nur eingeschränkt, denn sie ist Witwe. Ihr Mann ist tot.
Violet besitzt eine Keksdose in Form eines Schweins, randvoll mit köstlichen Markenplätzchen. Ich will nicht abstreiten, dass auch sie ein Grund für meine Besuche sind. Einmal war die Dose leer – kein einfacher Nachmittag für uns beide.
Heute jedoch ist alles im Lot. »Tee und Kekse?«, fragt Violet, während sie den Tisch deckt. Ich greife in das Schwein. Es grunzt – bei jedem Plätzchen. Selbst ich in meinem jugendlichen Überschwang kann die Ohren nicht davor verschließen, dass in seinem Grunzen ein leichter Tadel mitzuschwingen scheint. Aber was soll’s?
»Herrliches Wetter«, sagt Violet.
»Wie wahr«, antworte ich. »Es ist ungemein milde.«
Tink und Tonk kommen herein und schlängeln sich wie brauner Rauch um meine Stuhlbeine.
»Mochte Dennis milde Temperaturen?«, frage ich.
In Vielleicht ist der Mond nur ein Luftballon von David Niven habe ich gelesen, dass es für einen verwitweten Menschen nichts Schlimmeres gibt als die Scheu der anderen, den Verstorbenen zu erwähnen.
Ich habe mir fest vorgenommen, diesen Fehler von David Nivens Hollywoodfreunden nicht zu wiederholen – wobei ich Clark Gable ausnehmen muss. Er traute sich, über Nivens verstorbene Frau zu sprechen, weil er selbst erst wenige Monate zuvor bei einem Flugzeugabsturz seine eigene Frau, die sexy Komikerin Carole Lombard, verloren hatte. Jedenfalls beziehe ich Dennis deshalb immer in die Unterhaltung mit ein, wenn ich bei Violet bin, damit sie ihre Erinnerungen an ihn pflegen kann.
Das ist manchmal gar nicht so einfach. Als sich unser Gespräch einmal um Leute drehte, für die ich schwärme, habe ich versucht, ihn einzubauen.
»Ob mir Dennis wohl gefallen hätte?«, fragte ich.
Als Violet mir daraufhin ein Foto von ihm zeigte, war ich dermaßen geschockt, dass mir sichtbar die Gesichtszüge entgleisten. Dieser Mann törnte mich nicht an, sondern ab. Und zwar gründlich.
Statt der Schwarz-Weiß-Aufnahme eines schneidigen Fliegers aus dem Zweiten Weltkrieg, der lässig an einer Spitfire lehnt, lag ein Urlaubsfoto neueren Datums vor mir, ein Schnappschuss aus einem walisischen Ferienpark, auf dem Dennis aussah wie der Riese mit den Segelohren aus Sophiechen und der Riese von Roald Dahl. Bei aller Freizügigkeit meinerseits: Beim Anblick seiner schwabbelnden Frühstücksspeckohren verging mir alles.
An dem Tag weinte Violet, und ich hatte keinen Appetit auf ihre Plätzchen. Ich brachte nur einen einzigen Keks runter.
»Dennis liebte die milden Temperaturen!«, antwortet sie jetzt. »Ich würde sagen, ihm gefielen von allen Temperaturen die milden am besten.«
Zufrieden beiße ich in mein Kokosplätzchen. Die milden Temperaturen gefielen Dennis am besten. Ich bin dieser trauernden alten Frau mit der Schweinekeksdose wirklich eine große Stütze. Dann hat der Tag ja doch noch ein gutes Ende genommen.
Keine halbe Stunde später hetze ich im Eilschritt nach Hause.
Die letzten zehn Minuten waren so seltsam, dass ich wie benebelt bin – als wäre mein Kopf tatsächlich ein Luftballon. Es würde mich nicht wundern, wenn er sich jeden Augenblick losreißt und davonfliegt und ich dann in Zeitlupe auf dem Bürgersteig zusammensacke.
Mir ist so hundsmiserabel zumute, dass ich mich erst mal auf den Grünstreifen hocke und den Kopf zwischen die Knie klemme.
»Ich habe gerade den größten Fehler meines Lebens begangen«, denke ich.
Dabei war bis dahin alles prima gelaufen. Während wir so friedlich und gemütlich beisammensaßen, dass Violet zwischendurch sogar ein paarmal wegdöste, überkam mich plötzlich der verhängnisvolle Drang, sie zur Abwechslung auch mal an meinem Leben teilhaben zu lassen. Also erzählte ich ihr von der Hebamme, die dachte, ich hätte eine genähte Vagina, von der Fahrt zum Sozialamt und davon, dass ich noch immer ungeküsst durch die Welt ging. Und dass ein Mann gedroht hatte, Bianca mit einer Axt den Schädel zu spalten.





























