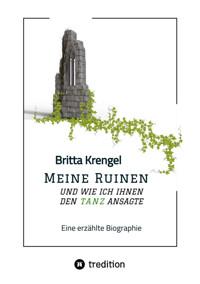
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was tun, wenn die eigenen Eltern zusehends in endzeitliche Glaubensvorstellungen abdriften und die Familie unaufhaltsam auf eine Katastrophe zusteuert? Was tun, wenn man als Heranwachsende durch eine radikale Lebensentscheidung der Eltern plötzlich sein Zuhause verliert und alles ins Wanken gerät? Wenn die Apokalypse ausbleibt, aber alle Gewissheiten in sich zusammenstürzen? Britta Krengel findet ihre sehr persönliche Antwort auf diese Katastrophe im Schreiben. "Meine Ruinen und wie ich ihnen den Tanz ansagte" ist eine packende Geschichte von Glück und Verlust. Das autobiographische Buch erzählt mitreißend, wie die Autorin als Heranwachsende eine existentielle Krise meistert. Prägnant, in kurzen Kapiteln führt es hinein in eine unbeschwerte, behütete Kindheit im Rheinland der 70er Jahre. Der Vater, ein rheinisches Original, ist von Beruf Kunst- und Werklehrer, der mit viel handwerklichem Geschick am Eigenheim der fünfköpfigen Familie baut. Doch mit dem elterlichen Hausbau beginnt auch die spirituelle Suche der Eltern. Sie werden fündig erst in esoterischen Kreisen, dann in Uriellas "Orden Fiat Lux“ und wenden sich schließlich einer noch radikaleren endzeitlichen Glaubensgemeinschaft zu. Was harmlos beginnt, spitzt sich bald dramatisch zu. Auch die drei Kinder wachsen zunächst wie selbstverständlich in die elterlichen Glaubensvorstellungen hinein. Mit zunehmendem Alter aber erwachen in ihnen erste Fragen und Zweifel und die Emanzipation von dem vorgezeichneten Weg beginnt. Als die Eltern entscheiden, das geliebte Haus zu verkaufen und in die Glaubensgemeinschaft zu verziehen, wird die Familie vor die Zerreißprobe gestellt. Der Fall landet schließlich vor Gericht und führt zum Auseinanderbrechen der Familie. Jahre später gelingt aber eine vorsichtige Annäherung beider Parteien, der Eltern und Kinder. Bei aller Tragik der Geschehnisse kommt die Geschichte leichtfüßig daher, unterhaltsam im Ton und niemals klagend. Eine außergewöhnliche Familiengeschichte, unsentimental und mit feinem Humor erzählt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Britta Krengel
Meine Ruinen und wie ich ihnen den Tanz ansagte
Über die Autorin:
Britta Krengel, 1970 in Bonn geboren, ist im Rheinland aufge-wachsen.
Sie studierte Deutsch und Katholische Theologie auf Lehramtsowie Theaterpädagogik in Heidelberg und promovierte an-schließend in Literaturwissenschaft an der Universität Bochum. Nach kurzer Lehrtätigkeit im Studiengang Theaterpädagogik ander Pädagogischen Hochschule Heidelberg zog sie der Liebewegen in den Norden. Seit 2001 ist sie im schleswig-holsteini-schen Schuldienst tätig.
Heute lebt sie mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern und ihrerHündin auf einem Dorf im Kreis Plön.
Britta Krengel
Meine Ruinen
und wie ich ihnen den
Tanz ansagte
– eine erzählte Biographie –
Dies ist eine wahre Geschichte. Zum Schutz von Personen wurden jedoch Namen teilweise verändert.
© 2025 Britta Krengel
Coverdesign von: Britta Krengel
Covergrafik von: Pixabay
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich ge-schützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Ver-wertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: Dr. Britta Krengel, Seestr. 2, 24321 Giekau, Germany.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
für André und Tina
Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär …
(Else Lasker-Schüler)
The Waltz
Auch wenn man meint, dass alles zu Ende ist und in Scherben liegt, beginnt nach einer Weile doch wieder diese hoffnungsvolle Melodie, die alles ertragen lässt … Ich widme dieses bittersüße, tröstende Stück allen, deren Welt schon einmal zerbrochen ist und die erleben durften, dass sie sich dennoch weiter dreht …
(André Krengel in „Head, Heart & Hands“)
Inhalt
1.Auftakt................................................................................
2.Kanada................................................................................
3.Laisser-Faire.......................................................................
4.Geschwister........................................................................
5.Das Haus............................................................................
6.Achtmorgenweg.................................................................
7.Erstkommunion..................................................................
8.Die Sauna...........................................................................
9.Die Grünen.........................................................................
10.Dachausbau......................................................................
11.Die Kur.............................................................................
12.Der Gebetskreis................................................................
13.Der Hund..........................................................................
14.Fiat Lux............................................................................
15.1984..................................................................................
16.Das schönste Schaf in der Herde......................................
17.Die Bieberauer Schule......................................................
18.Taizé.................................................................................
19.Die Gnadenfrist................................................................
20.Der Schülerbibelkreis.......................................................
21.Die Kassetten.................................................................... 22.Zwiespalt..........................................................................
23.Das Abenteuer..................................................................
24.Entspannungspolitik (Gnadenfrist II)...............................
25.Der Weltenuntergang........................................................
26.Vor Gericht.......................................................................
27.Ruinen..............................................................................
28.Postskriptum: Viele Grüße aus der Ferne.........................
29.Schlussakkord...................................................................
30.Nachwort..........................................................................
Dank......................................................................................
Nachweise.............................................................................
1. Auftakt
Ich kann mich nicht beklagen. Meine Eltern haben mich geliebt. Sie sind verrückt geworden, aber sie haben mich geliebt.
Dabei hatte alles so gut angefangen.
Mein Vater und meine Mutter begegneten einander zum ersten Mal im Museum. Es geschah im Museum Schnütgen in Köln, in der Sammlung mittelalterlicher Kunst. Sie stol-perten übereinander, genauer: Meine Mutter stolperte über meinen Vater. Der, kaum dass er sie erspäht, schon wusste: „Die wird meine Frau!“. Er hatte sich ins Halbdunkel ge-kniet, vorgebend, ein Gemälde zu skizzieren, so dass meine Mutter über ihn stolpern musste. Interessiert beugte sie sich über die Skizze des jungen Kunststudenten und so kamen sie ins Gespräch …
Mein Vater war ein waschechter Rheinländer. Schon qua Geburt – dabei fehlte am Beginn alle rheinische Leichtigkeit: Mitten im Krieg, im Oktober 1942, wurde er in Bonn geboren, als Sohn einer Krankenschwester und eines verhinderten Mönchs.
Mein Vater war ihr zweites Kind. Der Kleine wurde, gut katholisch, auf die Namen Bernhard Peter Franziskus Maria getauft und war der ganze Stolz seiner Eltern. Das Klärchen, seine fünf Jahre ältere Schwester, wurde für ein paar Wochen weggegeben, als er, der ersehnte Filius, auf die Welt kam. Die resolute Mama wollte es so.
Mit fünf Jahren trat mein Vater selbst eine tapfere Reise an. Einen l a n g e n Sommer lang wurde er in die Schweiz
verschickt. Dort sollte er, wie viele andere dauerhungrige Nachkriegskinder auch, ordentlich aufgepäppelt werden. Am Abfahrtstag hatte er ein Schild mit seinem Namen um den Hals, saß ordentlich gescheitelt und mit klopfendem Herzen im Abteil, um ihn herum ein Pulk fremder Kinder. Sonst nur die große dunkelhaarige Frau vom DRK. Der Zug setzte sich in Bewegung. Als die Schweiz aber nicht, wie verheißen, hinter der nächsten Kurve anfing, quollen die Tränen.
Bei der Ankunft in Goldau, x Stunden später, fragte die neue Tante am Bahnhof: „Woher kummsch, Bub?“ „Bonn“, piepste der verschüchterte Fünfjährige „Jo, jo, i weiß scho, dass d’ vo dr Bohn kummsch, aber woher kummsch?“, insistierte Tante Rosi. „Aus Bonn.“ „Jo, i weiß …“ Das war die erste Begegnung mit der neuen Sprache; sie barg ein Quell von Missverständnissen. Aber bald wurde ihm ihre Melodie vertraut.
Die Sommermonate verbrachte der Junge bei Tante Rosis Schwester auf der Alm. Dem Kleinen wurden schon verschiedene Aufgaben anvertraut: den Kuhstall ausmisten, die Hühner-Küken hüten. Das mochte er besonders. Dabei konnte er den vorbeiziehenden Wolken hinterherblicken und seinen Tagträumen nachhängen. Der kleine Bernd liebte die majestätischen Berge, den Geruch der Almwiesen, die köstliche, würzige Butter und er fürchtete die Gewitter in den Alpen. Da half nur miteinstimmen in die Fürbitten der Erwachsenen, die gegen die Angst und den Donner anbeteten: den Alpsegen. Ihr Singsang, wie Rosenkranzgeleier, geleitete ihn hinüber in einen unruhigen Schlaf.
So trat ein weiterer Dialekt neben das Rheinische.
Meine Großeltern waren ein ungleiches Paar. Da war mein stiller Großvater Josef, der, wie schon erwähnt, als Mönch gescheitert war. Das lag nicht nur daran, dass er sich in meine Großmutter, die lebenstüchtige Elisabeth, Kinderkrankenschwester am Bonner Uni-Klinikum, verliebt hatte. In erster Linie lag es an seinem Nicht-Reden-Können.
Vor dem Krieg hatte mein Großvater auf Wunsch seines eigenen Vaters in den Orden der Steyler Missionare jenseits der holländischen Grenze eintreten müssen. Es kam die Zeit: Der Novize sollte nun die Kanzel erklimmen und predigen, den Mund auftun und Zeugnis ablegen von seinem Glauben – doch die Zunge gehorchte nicht. Kurz vor der Primiz bekam mein Großvater kalte Füße, verließ den Orden und ehelichte lieber meine Großmutter. Das war im November 1932.
Der Krieg ließ ihn noch mehr verstummen. Stattdessen sprach die Psoriasis: Sie kündete in großen roten Flecken von Todesangst und Gewissensnöten; die schuppige Botschaft verbreitete sich rasch über den ganzen Körper, juckend und pisackend. Später erzählte man sich im Kreise der Familie, Josef hätte im Angesicht des Feindes sein Gewehr weggeschmissen, weil er niemanden hatte erschießen wollen. So viel zumindest ist sicher: Er kam in der Tat seinerseits mit einer leichten Schussverletzung von der französischen Front auf Heimaturlaub. Und meine tatkräftige Großmutter versteckte ihn daraufhin kurzerhand bis Kriegsende bei einer Freundin im Westerwald. Sie war selbst mit den beiden Kindern dorthin evakuiert worden, als im Oktober 1944 der Fliegeralarm immer häufiger, die Aufenthalte im Bunker immer länger und die Bombardierung der Stadt immer heftiger geworden waren.
Sie blieben dort zusammen auf dem Dorf bis Kriegsende und versteckten ihren Josef vor den einrückenden Amerikanern im Keller. Einer stand plötzlich, auf der Suche nach Deserteuren, vor der Tür – Josef konnte gerade noch in die Truhe im Keller schlüpfen – und wollte wissen: „Nix Soldat?” Das Klärchen rief aufgeregt: „Nehmen Sie nicht meinen Papi weg!”. Doch zum Glück verstand der Soldat nicht allzu viel Deutsch und ging wieder.
Bei ihrer Rückkehr nach Bonn im Mai 1945 fanden sie die elterliche Mietwohnung in der Noeggerathstraße vom Bombardement stark getroffen vor: Die Küche war nur noch halb, es klaffte ein riesiges Loch zur Straße hin, die Treppe ins Obergeschoss und ein Nebenzimmer waren zerstört. Nur ein Eckzimmer war anfangs noch bewohnbar, keine Heizung, kein Essen … Nach dem Bombenhagel vom Oktober 1944 lag die gesamte Bonner Innenstadt in Schutt und Asche.
Und während die Erwachsenen die Trümmer beseitigten und sich mit Hilfe der Alliierten an den Wiederaufbau machten, wurden die Kinder auf den Schutthaufen groß, welche ihre Spielplätze zwischen den Ruinen waren.
Nach dem Krieg war mein Großvater Josef in der Versiche-rungsbranche untergekommen. Der Deutsche Herold, der 1947 von Berlin an den Rhein gezogen war, bot der kleinen Familie die äußere Sicherheit eines monatlichen Ein-kommens.
Und innerlich? Was half meinem sensiblen Großvater bei der Rückkehr ins zivile Leben, nach der Erfahrung von Schuld und Tod, nach dem Zivilisationsbruch durch das Nazi-Regime?
Vielleicht bot der Glaube, aufgerichtet an den katholischen Dogmen, meinem Großvater eine Stabilität, die es sonst in seiner Welt in Trümmern nicht mehr gab. War es eine innere Notwendigkeit, umso starrer an den moralischen Prinzipien und unverbrüchlichen Glaubenssätzen der katholischen Kirche festzuhalten? Oder wollte er nur nach innen, in seine kleine Familie hinein, missionierend wirken – wo es ihm schon nicht gegeben war, als Mönch draußen in der Welt zu missionieren?
Jedenfalls laborierte er bei seinen Kindern an einer streng katholischen Erziehung.
Mein Vater berichtet in seinen Kindheitserinnerungen, dass er jeden Sonntag die Heilige Messe besuchen musste. Zu Hause hatte er dem Vater im Anschluss Rapport zu geben: Wer hatte die Messe gelesen? Welches war der Predigttext? Was hatte der Pfarrer dazu verlauten lassen? Nach einer Weile hatte mein Vater das Timing raus: Er spazierte im Sonntagsstaat vorne durchs Eingangsportal hinein und verließ die Kirche unauffällig im nächsten Augenblick wieder durch das Seitenportal. Wenn er im Gefühl hatte, dass der Pfarrer mittlerweile bei der Predigt angelangt sein musste, so stahl er sich heimlich hinein, lauschte einige Minuten und verschwand wieder ebenso leise. – Ein kleiner anarchischer Triumph.
Mit 16 Jahren nahm das Leben meines Vaters eine erste entscheidende Wendung. Bis dahin hatte nämlich sein ganzer Eifer dem Barren, den Ringen und dem Trampolin gegolten: Mein Vater war Teilnehmer der deutschen Jugendmeisterschaften und führte die Turnerriege der Unterstufenschüler an seinem Gymnasium an. Es war ein Turnunfall, der nun abrupt seine vielversprechende Turnerkarriere beendete. Ein misslungener Salto setzte
allen diesbezüglichen Hoffnungen ein jähes Ende: Bernd kam unglücklich zwischen zwei Matten zur Landung und statt beim Aufkommen elegant in den Spagat zu gleiten, rutschte die vordere Matte weg und sein rechter Unterschenkel schlug nach oben durch, das Knie splitterte …
Durch seine Knieverletzung war mein Vater Wochen lang ans Bett gefesselt und musste schließlich ganz neu gehen lernen. Auf dem Krankenlager aber entdeckte er Bleistift und Papier. Er begann zu zeichnen. Im Sitzen, das kranke Bein hochgelagert, entwickelte er sein neues Talent; skizzierte, porträtierte seine Eltern, bannte seine Umgebung aufs Papier. Dieser gefielen die Ergebnisse; die Eltern bewunderten und sein Kunstlehrer förderte ihn. Und so hatte ihn sein Weg nach dem Abitur schließlich an die Kunstakademie in Düsseldorf geführt.
Meine Mutter Inge war ein Flüchtlingskind. Wenige Tage vor ihrem fünften Geburtstag, im Januar 1945, verlor sie ihr Zuhause; ihr oberschlesisches Zuhause nahe Breslau. Dort führte mein Großvater Willi in der kleinen Stadt Rosenberg eine Zahnarztpraxis, in der auch meine Großmutter Maria, die bei allen nur Mucki hieß, zunächst ausgeholfen hatte. Ursprünglich hatte sie Lehrerin werden wollen. Sie hatte in Graz und Wien Englisch, Französisch, Geographie und Sport auf Lehramt studiert; drei Semester lang, bis ihren Eltern, die noch sechs weitere Geschwister zu ernähren hatten, 1932 das Geld ausgegangen war. Nach der Hochzeit im Jahr 1936 arbeitete Mucki aushilfsweise in der Praxis ihres Mannes mit, bis sich 1937 der erste Sohn, Wolfgang, ankündigte. Ihm folgten 1940 meine Mutter Inge und 1942 der jüngste Sohn Horst.
Mitten in die Geburtstagsvorbereitungen für die kleine Inge platzte nun die Nachricht von den herannahenden Russen. „Aufbruch in einer Stunde!“, hatte es geheißen. Für die kleine Inge bedeutete dies: Ein einziges Mal mit der Puppenstube spielen, die eigentlich Geburtstagsüberraschung für sie hätte werden sollen, indes meine Großmutter in aller Hektik die Papiere und ein paar Kleider und Wertsachen zusammenrafft.
Mein Großvater hatte bis zuletzt noch praktizieren dürfen, um in Rosenberg die zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Doch jetzt hieß es auch für ihn im „Volkssturm“ an die Front.
Da stand er nun am Gartenzaun und sah seiner Frau und seinen drei Kindern hinterher; sein letzter Anblick brannte sich der kleinen Inge ins Hirn: Seine Augen schwarz vor unheilvoller Ahnungen, wurde er immer kleiner und kleiner – bis er schließlich nach der ersten Kurve ganz verschwand.
Dann die Flucht, in viel zu engen Schuhen, bei Eiseskälte. Das Mädchen hatte in der Eile die alten Schuhe angezogen bekommen, während die schönen neuen unnütz und verloren mit den übrigen Geschenken zurückgeblieben waren.
Den wichtigen Koffer musste der große Bruder Wolfgang tragen, dazu noch den Schultornister mit dem Familiensilber auf dem Rücken, – viel Gewicht für einen Jungen von sieben Jahren. Die Mama hielt an der einen Hand die kleine Inge und auf dem Arm trug sie, in einen Pelz eingewickelt, ihren Jüngsten, den zwei Jahre alten Horst.
Mehrere Wochen waren sie so unterwegs: mal Fußmärsche durch Schnee und Eis, mal voll gedrängte Abteile, inmitten
von vor Angst halb wahnsinnigen Menschen. Die kleine Inge weinte viel, die Füße schmerzten und alles andere auch. Da drohte einer: „Wenn du nicht aufhörst, werf’ ich dich aus dem Fenster!“
Ein freundlich aussehender Mann im Zug forderte Wolfgang auf, seinen schweren Tornister abzulegen. Kurz darauf war der nette Mann verschwunden und mit ihm der Tornister.
Am 10. Februar 1945 erreichten sie glücklich den überfüllten Hauptbahnhof Dresden. Hier konnten sie das erste Mal seit Beginn ihrer Flucht wieder ein Bad nehmen, sich aufwärmen und erhielten richtige Verpflegung. Wegen der vielen neu ankommenden Flüchtlinge wurden sie aber von den Behörden weitergeschickt und kamen in das zwanzig Kilometer von Dresden entfernt gelegene Borstendorf.
Taghell war die Nacht in Borstendorf am 13. Februar, vom Bombenfeuerschein. – –
Und weiter, bloß weg vom Inferno, ging es, gen Westen. Meine Großmutter hatte mit ihren beiden Schwestern verabredet, sich nach Hannoversch Münden durchzu-schlagen. Ein erster Anlaufpunkt war dort die Familie eines Schwagers. Allerdings wurden die Flüchtlingsfamilien auch hier wieder auf die Bauernhöfe in den umliegenden Dörfern verteilt. So strandeten die Schwestern mit ihren Kindern in dem kleinen Örtchen Meensen, wo sie das Kriegsende durch die einrückenden Amerikaner erlebten. Doch meine Großmutter zog es weiter zu den Verwandten ihres Mannes nach Westfalen. Ihre beiden Schwägerinnen Maria und Regina lebten dort angesehen auf einem kleinen Dorf bei Lippstadt und gewiss würde auch mein Großvater
versuchen dorthin zu gelangen, sobald es ihm möglich wäre.
Also machte sich Mucki mit den drei Kindern erneut auf den Weg – ohne zu wissen, dass der Wechsel von der ame-rikanischen in die britische Zone mittlerweile nicht mehr ohne Weiteres möglich war: Wer keine Zuzugserlaubnis hatte, wurde zurückgeschickt. Die besaß meine Großmutter aber nicht.
Da war es ein Glück, dass sie so gut Englisch sprach! Unterwegs im Zug – einem leeren Kohletransportwagen – hatte sie von einem amerikanischen Begleitsoldaten beiläufig in Erfahrung gebracht, dass in Lippstadt die Zuzugsgenehmigungen kontrolliert würden. Um nicht in Schlamassel zu geraten, mussten die vier daher schon vor Lippstadt, in Büren, ihren Waggon verlassen und die letzten acht Kilometer wiederum zu Fuß zurücklegen.
Ein halbes Jahr nach dem Aufbruch aus Rosenberg kam die kleine Familie also schließlich, kohlegeschwärzt, bei den Schwägerinnen in Westfalen an. Die beiden unverheirateten Schwestern lebten in dem beschaulichen Ort Oestereiden zusammen unter einem Dach. Maria, die ältere der beiden, war hier schon seit 1923 Dorfschullehrerin. Sie hatte ein angeborenes Hüftleiden und außerdem war sie sehr streng.
Aber sie war auch eine aufrechte Person, das musste man ihr zugutehalten. Ihre Schüler hatte sie immer mit den Worten „Heil, Kinder!“ begrüßt. Und sie hatte sich 1936, wie viele andere auch, geweigert, der Aufforderung des Gauleiters Folge zu leisten, das Wandkreuz aus ihrem Schulraum zu entfernen. Der Bischof von Münster, genannt der Löwe, hatte gegen das 1000-jährige Reich angebrüllt und das stärkte ihr den Rücken.
Die ersten paar Tage im Dörfchen Oestereiden konnten die Geflüchteten bei den Schwestern in der Schulwohnung unterkommen. Dann wurde ihnen eine kümmerliche Behausung bei einem Bauern zugewiesen. Das Zimmer, das die vier dort bezogen, war eine umfunktionierte Räucherkammer. Es gab kein fließend Wasser und abends nur stundenweise elektrisches Licht. Im Winter glänzte der Raureif an den Wänden, Eisblumen machten sich am Fenster breit. Ein im Ofen aufgeheizter Backstein wärmte notdürftig das Bett. Der halbe Zentner Briketts pro Monat wurde sorgsam eingeteilt.
Das ihnen zugeteilte Stückchen Land entpuppte sich als harter Lehmboden. Immerhin, nach der Ernte durften die Flüchtlinge zur Nachlese auf die Felder, Kartoffeln und Ähren aufsammeln. Die studierten Hände meiner Groß-mutter leisteten mehr schlecht als recht die schwere Feld-arbeit. Beim Rüben Verziehen war sie, die genuine Stadt-pflanze, immer die Letzte. Aber die drei Kinder mussten ja irgendwie durchgefüttert werden.
So bald wie möglich gab meine Großmutter nebenher auch Flöten- und Gitarrenunterricht im Dorf, brachte anderen die Wandervogellieder ihrer Jugend bei.
Meine Großmutter und die Kinder versuchten sich auf den wenigen Quadratmetern zu arrangieren. Nach vorn zu schauen. Auf die Heimkehr des Mannes, des Vaters hoffen. Doch immer wieder gab es Rückschläge. Meine Mutter wäre fast gestorben: eine Blinddarmentzündung mit Komplikationen; zweimal musste sie notoperiert werden. Der Eiter quoll den Ärzten beim zweiten Schnitt entgegen. Das Mädchen überlebte knapp.
Dann kam die Nachricht. Wenige Tage nach Kriegsende, die Alliierten hatten schon gesiegt, da war mein Großvater noch in einem Lazarett bei Berlin gestorben. Lungen-durchschuss. Ein Kamerad hatte sich durchgeschlagen und überbrachte nun den Ehering und das zerschossene Sold-buch.
Das war zu viel. Meine Großmutter wusste nichts mehr, wusste nichts mehr von sich, wusste nichts mehr von ihren Kindern, nicht ihren Namen, wusste nicht mehr, dass sie Mutter war.
Nach ihrem Zusammenbruch kam sie in die Psychiatrische Klinik Gütersloh, wo sie mehrere Monate blieb. Die Kinder kamen zu Tante Maria. Außer Wolfgang; der Älteste kam erst bei Nachbarn unter. Später wurde er ins Internat gesteckt.
Bei Tante Maria war das Leben hart. Der Unterricht auch. Die Geschwister bekamen mit dem Rohrstock auf die Hand – genauso wie alle anderen Kinder. Tante Maria hielt auch nichts von arischen Vornamen. Wolfgang wurde kurzer-hand in Johannes umbenannt; aus Horst wurde Wilhelm – nach dem Vater. Meine Mutter hieß nun Agnes. Dabei hatte sie mit ihren fünf Jahren auf die Frage „Wie heißt du?“ immer voller Begeisterung geantwortet: „Ingeborg Char-lotte Pudding!“. So gerne mochte sie Vanillepudding, so lecker war ihre Leibspeise, dass sie selbst so heißen mochte – und jetzt: so sehr entbehrt, so weit entfernt.
Schließlich kehrte meine Großmutter zurück ins Leben. Ganz langsam hatte sie sich erholt, ganz allmählich ging es aufwärts. Inge durfte wieder Inge heißen, durfte von der Volksschule auf das Gymnasium in Lippstadt wechseln.
Fast zehn Jahre waren seit dem ersten Tag der Flucht vergangen, als die Familie im Dezember 1954 endlich eine Wohnung dort in Lippstadt beziehen konnte, endlich ein eigenes Badezimmer mit fließend Wasser und eigener Toilette! Und noch einmal vier Jahre später war meine Großmutter imstande ein schmales Reihenhäuschen zu erwerben, finanziert durch unzählige Nachhilfestunden in Englisch und Französisch, als kleines Zubrot zur Witwen-rente.
Lippstadt wurde für die Familie zur neuen Heimat. Doch der Makel, das Manko kein Vater!, dieses Manko blieb. Trotzdem hat meine Großmutter alle ihre drei Kinder alleine durchgebracht, hat es sogar geschafft, allen dreien ein Studium zu ermöglichen. Und so war meine Mutter nach dem Abitur an die Pädagogische Hochschule nach Bonn und schließlich nach Köln gekommen, um das Lehramt für Deutsch und Geschichte zu studieren.
Nun also lernten sich meine Eltern im Museum kennen, in einer Ausstellung zu mittelalterlicher Kunst. Mein Vater wusste seine zwei Freunde, die ihn begleitet hatten, abzuschütteln, und machte
sich mit seinen Waffen,
Zeichenblock und gespitztem
Bleistift, an die Eroberung der
sanften Schönen mit den
dunklen Augen …
Im Leben meiner Mutter gab
es damals noch zwei Konkur-
renten, Tanzstunden-Dieter
aus Lippstadt, Student der
Anglistik und der Geographie,
Verlobung 22.6.1968
und Schwaben-Volker, der Kunstgeschichte studierte. Das jedoch schien meinen Vater nur mehr anzuspornen. Tanzen konnte er zwar nicht mit seinem zusammengeflickten Bein, aber sein Werben war hartnäckig. Meine Mutter schwankte eine Zeitlang zwischen den drei Anwärtern. Doch schließlich erlag sie dem Charme meines Vaters – „Wir haben gut lachen … denn wir haben uns verlobt“ – und entschied sich für den Rheinländer.
1968 erklangen die Hochzeitsglocken und anderthalb Jahre darauf wurde ich geboren.
Es ist fotografisch dokumentiert, dass mein Vater an diesem Tag – meine Mutter presste mich im Kreißsaal des Bonner Venuskrankenhauses gerade auf die Welt – die elterliche Mülltonne mit wilden weißen Schwüngen verzierte, die ihm seine Aufregung diktierte. Heraus kam ein weißes Ethno-Muster auf schwarzem Grund.
2. Kanada
Im Sommer 1971, ich war fast anderthalb Jahre alt, da reis-ten wir nach Kanada zur Schwester meines Vaters. Vancouver war das Ziel.
Während des Fluges – meine Eltern hatten Mühe, ihren kleinen Wildfang auf dem Platz zu halten – stapfte ich auf kurzen Beinen schier unermüdlich den Mittelgang entlang und juchzte mit Begeisterung die neu gelernten Worte: „Heita Kanada! Heita Kanada!“
Auf dem Flughafen in Vancouver wurden wir mit freund-lichem Lachen empfangen. Sichtlich erheiterte Blicke trafen uns. Man amüsierte sich: Bei der Gepäckausgabe, in der Wartehalle, am Ausgang, überall grinsten und kicherten die Leute. Dort, wo das junge Pärchen mit dem Kind auf dem Arm und den beiden Koffern auftauchte, schüttelte sich bald alles vor Lachen. Die Umstehenden deuteten auf die Koffer und ihr Gelächter schallte durch die Halle. Mein Vater hatte nämlich die Initialen unserer Vornamen groß auf die beiden Gepäckstücke gepinselt: BIB stand da in weißen Lettern und sorgte für allgemeine Erheiterung. Endlich erschien meine Tante, um uns abzuholen, und klärte meine leicht verwirrten Eltern auf und sie begriffen: Was da ihre zwei großen Koffer zierte, hieß zu Deutsch LÄTZCHEN.
Ganz so viele Lätzchen brauchte ich für diesen Aufenthalt dann wohl doch nicht, auch wenn das Essen auf dieser Reise noch eine wesentliche Rolle spielen sollte.
Meine Tante Klara war 1958 nach Kanada ausgewandert, um der Enge ihres Elternhauses und dem Muff der 50er Jahre zu entfliehen. Auch meinen Onkel Paul hatte es
fortgetrieben. So hatten sich zwei Flüchtige zusammen-getan und die halbe Erdkugel zwischen sich und ihre Eltern gelegt.
In Vancouver versuchte mein Onkel als Immobilienmakler Fuß zu fassen, meine Tante arbeitete zeitweise als Sekre-tärin, häufig unterbrochen allerdings durch Zeiten im Mutterschutz.
Bis zu unserem Besuch hatten die beiden mittlerweile fünf Kinder bekommen. Die zwei jüngsten waren zweieiige Zwillinge, beides Mädchen, Blondschöpfe – der eine ge-lockt und glatt der andere – nur zwei Monate älter als ich. Zu dritt saßen wir im Kinderwagen und hätten ebenso gut als Drillinge durchgehen können. So wurden wir durch Hastings und China Town kutschiert und durch Downtown und Stanley Park geschoben, vorbei an den Totem Poles. Mein Vater fotografierte begeistert, fasziniert von den Kon-trasten der Kulturen und dem Nebeneinander von Holz-bauten und Hochhäusern. Hin und wieder machte er sich auch nützlich und half seinem Schwager Paul auf dem Bau, denn mit dem Personenzuwachs musste das Häuschen der Familie vergrößert werden. Der Rohbau war fast fertig und während mein Vater mit Rigipsplatten hantierte, übte meine Mutter mit der kleinen Karen, dem gelockten Drilling, das Laufen. Und zwischendrin schlug meine Tante regelmäßig vor: „Let's do some Yoga!“ Meine Eltern hatten in ihrer Bonner Zeit bereits mit Yoga angefangen und ließen sich nicht lange bitten und so praktizierten sie alle zusammen, die Erwachsenen und die großen Kinder, Freiluft-Yoga im Garten.
An einem Wochenende stand auch San Francisco auf dem Programm. Meine Eltern flogen mit meiner Tante in die Staaten. Mich ließen sie in der Obhut meines Onkels.
Onkel Paul blieb also mit uns sechs Kindern allein zurück und sollte uns alle versorgen.
Ich muss meine Eltern vermisst und ziemlich oft geschrien haben. Denn jedes Mal stopfte mein Onkel mir den Mund mit Banane – er wusste sich seiner drei Schreihälse wohl nicht anders zu erwehren. So kam es, dass meine Eltern mich kaum wiedererkannten, als sie von ihrem kleinen Trip zurückkehrten: Rund und speckig war ich geworden. Und mochte für lange Zeit keine Bananen mehr. Aber auch meine Eltern sollte diese Reise nachhaltig verändern. Meine Tante achtete sehr auf eine gesunde Ernährung: wenig Zucker, wenig Fleisch, viel Rohkost, immer frisches Obst und Gemüse. Der Salat wurde im Kopfkissenbezug trockengeschleudert. Es gab – nebst Bananen – Mais und Melone, Hüttenkäse und Haferbrei. Ein einziges Mal wurde ein Turkey aufgetischt, den alle Kinder gerne aßen. Auch wir Drillinge mühten uns mit je einer Keule; das Fett troff und rann uns über die kleinen Finger, aber wir kauten voller Wonne.
Meinem Vater, der immer gerne und viel Fleisch gegessen hatte, imponierte diese gesunde Ernährungsweise. So kamen meine Eltern mit vielen guten Vorsätzen von der Reise zurück und beschlossen, unsere Ernährung ebenfalls umzustellen. Zucker wurde durch Honig ersetzt. Der Fleischkonsum wurde reduziert. Nur Opa Josef zuliebe, der gerne Rheinischen Sauerbraten aß, wurde die Ofenröhre hin und wieder, am Feiertage, eingeheizt.
Es begann die Zeit der Vollwertkost.
Mein Vater betrat zum ersten Mal in seinem Leben ein Reformhaus. Von dort schleppte er die gelben 5kg-Eimer Honig nach Hause. Zwei Jahre später tat er in der Nähe von Remagen einen Bio-Bauern der ersten Stunde auf: Heinz Erven, ein gottesfürchtiger Öko-Pionier, der seinen Grund
und Boden „Paradies“ taufte und auf seinem Ackerland eine kleine Kapelle errichtete. Von ihm bezogen wir fortan unser Obst und Gemüse, klein und schrumpelig, aber ohne Gift.
Mein Vater las Schriften von Dr. Bruker wie „Zucker und Gesundheit“ und „Unser täglich Brot und der Zucker als Hauptursache für die modernen Zivilisationskrankheiten“. Bald prangte an unserer Wohnungstür (vermutlich zur Aufklärung der Nachbarn) ein selbst geschriebenes Schild:
ZUCKER ZERSTÖRT ZÄHNE
ZUCKERKONZENTRATION VON MEHR ALS 50 %
(ALSO BONBONS, SCHOKOLADE,
MARMELADE, SIRUP USW.) WIRKEN
BESONDERS ÜBEL. SIE DRINGEN RASCH IN
DEN ZAHN EIN UND BILDEN DORT MIT DEM
KALK DES ZAHNES WASSERLÖSLICHE
KALZIUM-SACCHARATE. DER SO
„VERZUCKERTE“ ZAHN LÖST SICH IM
SPEICHEL AUF!!! DESHALB ZERSTÖRT DER
ZUCKER ZÄHNE DORT AM SCHNELLSTEN, WO
IM MUNDE SÜSSIGKEITEN GELUTSCHT
WERDEN. ZERSTÖREN SIE NICHT DIE ZÄHNE
UNSERER KINDER!
Damit hatte es sicher eine gewisse Berechtigung, denn ich hatte ziemlich schlechte Milchzähne und fürchtete die Besuche beim Zahnarzt, obwohl ich die kleinen bunten Gummitierchen schätzte, von denen ich mir nach überstandener Pein immer nur eins aus dem großen Glas angeln durfte.
Als ich mit drei Jahren in den Kindergarten kam, da verfügte mein Vater, dass ich dort keinerlei Süßigkeiten bekommen sollte. Stattdessen bekam ich eine liebevoll mit Marienkäfern beklebte Pappdose, randvoll gefüllt mit Studentenfutter, die im Kindergarten verwahrt wurde. Jedes Mal, wenn nun ein Kind seinen Geburtstag feierte und Schokolade oder andere leckere, begehrenswerte Dinge austeilte, so dass alle Augen groß wurden und wir ungeduldig auf unseren Stühlchen hin und her rutschten, dann nahm mich meine Kindergärtnerin beiseite, griff in die besagte Dose und reichte mir eine Handvoll Studentenfutter. – Da beschlich mich erstmals das seltsame Gefühl, wie es ist, anders zu sein.
3. Laisser-Faire
In meinem jungen Dasein blieb diese Essensvorschrift allerdings vorerst die einzig spürbare Einschränkung durch meine Eltern. Ja, man kann sagen: Wir lebten im Übrigen durchaus gemäß dem rheinischen Motto „Jede Jeck is’ anders“ – und das nicht nur zu Karneval. (Wobei mein Vater ohne jeden Zweifel janz besonders jeck war. Karneval gehörte schließlich unbedingt zur Krengelschen Familientradition und mein Vater beherrschte schon seit seiner Jugend den ein oder anderen Karnevalsschlager, den er gern auf seiner selbst zusammengezimmerten Gitarre zum Besten gab.)
Meine Eltern hatten mittlerweile eine kleine Mietwohnung in Rheinbach bezogen und sie mit weiß-orangen Möbeln
bestückt. Dem schmalen Geldbeutel Rechnung tragend, hatten sie selbst Hand angelegt: Meine Mutter hatte die Küchenvorhänge in grob gemustertem Orange genäht, mein Vater Tisch und Stühle weiß lackiert und die Tischplatte mit oranger Klebefolie bezogen. Und im ansonsten weiß möblierten Wohnzimmer hing über dem hölzernen Couchtisch ein aus weißen Plastikbechern kugelförmig zusammengeklebter Lampenschirm.
Meine Mutter hatte ihren Beamtenstatus aufgegeben, weil man sie von ihrer Schule in Anröchte bei Lippstadt nicht nach Bonn hatte wechseln lassen wollen. Von Bonner Schulen hatte sie dann allerdings nur Absagen erhalten. „Sie schickt der Himmel!“, begrüßte sie hingegen Schwester Romana, die Rektorin eines Rheinbacher Mädchengymnasiums, das bis kurz zuvor ausschließlich von Nonnen geführt worden war. Nun unterrichtete meine Mutter also am katholischen St. Josephs-Gymnasium in Rheinbach, während mein Vater sein Referendariat als Kunst- und Werklehrer an einer Bonner Realschule absolvierte.
Meine Mutter hatte nach meiner Geburt gleich wieder angefangen zu arbeiten; denn obwohl man im Kollegium mit einigem Entzücken auf das erste Lehrerbaby reagierte, plagte sie doch ein schlechtes Gewissen ob ihrer ungeplanten Schwangerschaft so kurz nach Stellenantritt.
Ich war inzwischen zwar getauft worden, in der ka-tholischen Pfarrkirche St. Bernhard in Bonn-Auerberg, der meine Großeltern angehörten – besser gesagt: ich und mein Schnuller; denn erst war der Schnuller bei der Prozedur irgendwie zu Boden gefallen und dann im Becken ebenfalls einer Taufe unterzogen worden: Taufpate Onkel Horst, als
Arzt stets auf Hygiene bedacht, reinigte den Schnuller im Taufbecken fachgerecht in aller Seelenruhe, derweil der Täufling zum Gotterbarmen schrie, bis ihm der Schnuller wieder verabreicht worden war. Die anschließende Fami-lienfeier hatte dann im Garten bei Patenoma Lisbeth und Opa Josef stattgefunden, ganz ohne Gebrüll. – Getauft also war ich, aber ansonsten hatte mein Vater „mit Kirche nichts am Hut“, wie er zu sagen pflegte. Seinen Glauben an Gott hatte er mittlerweile über Bord geworfen – schon um sich von seinem Vater zu emanzipieren, war ihm gar nichts anderes übrig geblieben –, und nun segelte er ohne Karte und Kompass durchs Leben, aber mit Enthusiasmus auf jeder neuen Welle reitend. Der Geist der 68er vibrierte noch in der akademischen Luft. Überall war Rebellion. Man schnitt alte Zöpfe ab, man demonstrierte mit dem Kind auf den Schultern gegen den Vietnamkrieg, man machte sich durchaus Gedanken über den Lauf der Welt, man pflegte einen gemäßigten Atheismus, man gab sich antiautoritär. Mein Vater sagte im Unterricht gerne „Scheiße!“ und ließ sich von seinen Schülern duzen.
Ich meinerseits hatte im Kindergarten erklärt, dass ich kei-ne „Mama“ und keinen „Papa“ hätte, nur „Inge und Bernd“.
Der Karneval war quasi in der Pädagogik angekommen. Und ich genoss viele Freiheiten.
Mein Patenonkel beispielsweise kam einmal mit gänzlich falschen Erwartungen den weiten Weg aus Holzkirchen bei München angereist. Man hatte sich zum Abendessen in Rheinbach verabredet.
Gegen 18.00 Uhr betrat Onkel Horst also zusammen mit seiner Frau, Tante Dörthe, die Wohnung. Es gab zur Feier
des Tages Krustenbraten mit viel Knoblauch. Und ich durfte selbstverständlich die ganze Zeit mit dabei sein. Es wurde spät und später. Etwas verwundert mussten die Besucher registrieren, dass die jungen Eltern keinerlei Anstalten machten, ihren Sprössling ins Bett zu bringen. Sie versuchten es gar nicht erst. Man wartete, bis das Kind von selbst müde würde.
Das aber dachte nicht im Traum daran, müde zu werden. Putzmunter saß ich erst am, dann auf dem orangen Küchentisch und experimentierte mit den Lebensmitteln. Ich fand einigen Gefallen daran, Zucker auf den Käse zu streuen. Schließlich warf ich mit den Resten umher. Meinem Onkel, der einen Einwand wagte, mich vielleicht gar tadeln wollte, wurde beschieden, ich müsse von allein herausfinden, dass man so etwas nicht macht. Eine Unterhaltung kam nicht zustande. Es muss weit nach Mitternacht gewesen sein, als die übermüdeten Gäste schließlich aufbrachen.
Häufig zu Gast bei uns in Rheinbach war indessen Inges Mutter: meine Oma Maria, von uns liebevoll Oma Mucki genannt. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie nicht wieder geheiratet und verbrachte viel Zeit bei uns. Oma Mucki konnte wunderbar spielen! Wir hatten ein Lieblingsspiel (wobei ich im Nachhinein nicht ganz sicher bin, ob sie es auch so gern spielte wie ich): Wir bauten ganze Städte mit Bauklötzen, inklusive Krankenhäuser, wo meine Puppen stets notfallmäßig versorgt werden mussten. Stundenlang hockte sie mit mir am Boden und half mir, umgestürzte Klötze wieder aufzuschichten und meine Puppen zu verarzten … – Nur hinterher aufräumen mochte ich nicht. Meiner Oma, die mich zum Aufräumen animieren wollte, unterbreitete ich meine erste onto-
logische Erkenntnis: „Die Kinder sind zum Spielen da und die Erwachsenen zum Arbeiten!“
Ich hockte mich nackig auf meinen runden Spiegel, denn ich wollte wissen, wie ich unten herum aussah. Später übte ich vor demselben orange gerahmten Spiegel: „Ssumm, ssumm, ssumm, Bienchen ssumm herum!“, um mein Lispeln los zu werden.
Ich malte gern und viel. Stifte und Farben waren immer reichlich vorhanden. So förderte man meine Malkünste, vor denen nichts sicher war, nicht die Möbel, nicht die Bücher, nicht einmal ich selbst: Mein Bett bemalte ich mit einem Selbstportrait, den Einband der guten gebundenen Jubiläumsausgabe von Wilhelm Buschs Humoristischem Hausschatz, die meine Eltern zur Verlobung geschenkt bekommen hatten, verzierte oder verschmierte ich mit schwarz-weißer Ornamentik und mir selbst gönnte ich hin und wieder eine Indianerbemalung …





























