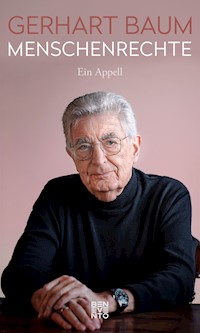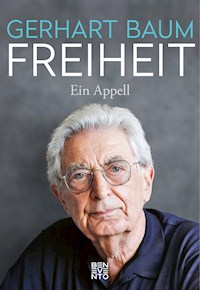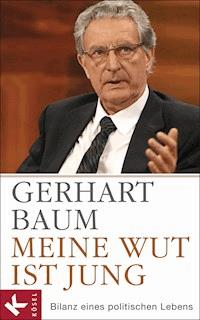
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die Sehnsucht nach Orientierung in gesellschaftlichen und politischen Fragen ist groß – echte Leitsterne gibt es wenige. Einer ist der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum, der am 28.10.2012 seinen 80. Geburtstag feiert. Anlass für eine Rückschau auf sein politisches Wirken und eine Einschätzung der gegenwärtigen Lage der Bundesrepublik.
Gerhart Baum ist politisches Urgestein. Er nimmt auch heute noch zu wichtigen gesellschafts-, rechts- und sicherheitspolitischen Fragen engagiert Stellung. Neben seiner Zeit als Minister – Baum hat entscheidend dazu beigetragen, die RAF-Diskussion zu versachlichen – gehören seine vier erfolgreichen Verfassungsbeschwerden (u.a. gegen den „Großen Lauschangriff“ und gegen das Luftsicherheitsgesetz) zur respektablen Bilanz eines leidenschaftlichen und zugleich besonnenen Bürgerpolitikers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Ähnliche
Gerhart Baum
Meine Wut ist jung
Bilanz eines politischen Lebens
im Gespräch mit Matthias Franck
Kösel
Copyright © 2012 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlag: WEISS WERKSTATT MÜNCHEN
Umschlagmotiv: Marcel Mettelsiefen © picture alliance/dpa
ISBN 978-3-641-08945-0
www.koesel.de
Für Renate
»Von seinem sanft-gewaltigen Willen gehe etwas in uns ein: von seinem Willen zum Schönen, Wahren und Guten, zur Gesittung, zur inneren Freiheit, zur Kunst, zur Liebe, zum Frieden, zu rettender Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst.«
Thomas Mann, 14. Mai 1955 in Weimar - aus: Versuch über Schiller. Zum 150. Todestag des Dichters - seinem Andenken in Liebe gewidmet
Vorwort - Meine Begegnung mit Gerhart Baum
Die erste Begegnung mit Gerhart Baum und seiner Frau Renate war ganz privater Natur. Meine Frau Monika Lüke hatte ihn über ihr gemeinsames Engagement zum Thema Menschenrechte kennen- und schätzen gelernt. Wir trafen uns privat zum Abendessen und verstanden uns sofort. Sympathie und Vertrauen dieses ersten Abends sollten der Anfang anregender und immer wieder von beiden Seiten sehr genossener Begegnungen werden.
Von einem Buch war da noch lange nicht die Rede, aber der 80. Geburtstag im Oktober 2012 machte Lust auf mehr, auf eine Bilanz eines politischen Lebens, das niemals abgeschlossen war. Bald überlegten wir Themenfelder, verabredeten uns in der Baumschen Dachwohnung in der Nähe des Savignyplatzes. Die Gespräche wurden intensiver, strukturierter und mir wurde rasch klar, hier entsteht etwas ganz Besonderes. Nach zwei, drei Stunden gingen wir meistens für einen kleinen Lunch um die Ecke. Zurückgekehrt, konnte schon mal eine kleine Zigarre die Entspanntheit symbolisieren, die eine solche Begegnung immer wieder und nicht nur intellektuell zum Vergnügen machte.
Nie habe ich einen Menschen getroffen, der so intensiv am kulturellen Leben teilnimmt. Er kennt die neuesten Filme, geht oft ins Theater und in die Oper, besucht Ausstellungen und Festivals und hat nicht zuletzt durch seine Frau Renate sein kulturelles Spektrum großzügig erweitert. Seine Begeisterungsfähigkeit ist ansteckend und ich habe mich manchmal wie ein Kulturbanause gefühlt, weil ich vieles im Gegensatz zu ihm verpasst habe.
Zusätzlich zu meinen vorbereiteten Fragen hatte Gerhart Baum immer wieder handgeschriebene Zettel dabei, die Nummern trugen und mit Ergänzungen, Vertiefungen, Zitaten oder Fakten versehen waren, die auf keinen Fall fehlen durften. Immerhin waren wir unterwegs durch viele Jahrzehnte Nachkriegsgeschichte bis in unsere Tage. Es gab kein einziges Treffen, wo wir das Band nicht anhalten mussten, weil Journalisten ein Interview führen wollten, nach einem Statement fragten oder ihn in eine Talkshow einluden. Mir wurde jetzt erst richtig klar: Gerhart Baum ist gefragt. Aber er mischt sich auch ungefragt ein. Mit Entsetzen verfolgte er den Absturz seiner Partei, die kaum noch einen wie ihn in seinen Reihen hat. Sozialliberale und linksliberale Ideen sind in einer Steuersenkungspartei nicht gefragt. Doch Gerhart Baum hat keine Lust auf die Rolle des passiven Zuschauers. Er meldet sich per Leserbrief, er schreibt Kommentare. Mit seiner Freundin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und auch Jüngeren in seiner Partei pflegt er einen regen Gedankenaustausch. Mit Hans-Dietrich Genscher telefoniert er fast täglich. Gerhart Baum bietet als kritischen Beitrag seine Einsichten an, ermutigt, mahnt zur Rückkehr liberaler Werte, unterdrückt nicht seinen Zorn und spricht dabei nicht wie ein Großvater, sondern eher wie Kassandra. Es erfüllt ihn mit Genugtuung, dass seine Rolle in und für die Partei wieder stärker wahrgenommen wird.
Baum ist Baum. Er hat sich nie von dem Glauben verabschiedet, dass Politik etwas verändern kann. Dass man nicht schweigen darf, denn wer schweigt, kann sich auch schuldig machen. Politische Leerformeln sind nicht seine Sache. Immer wieder fragt er, ob man das nicht besser und zugespitzter, mutiger formulieren kann. Mit Respekt erkenne ich bei jeder Begegnung: Er hat sich nicht verbiegen lassen. Er weiß, auf welcher Seite er steht.
Gerhart Baum verkörpert mehr als ein halbes Jahrhundert Zeitgeschichte. Wer ihm gegenübersitzt, spürt rasch: Hier spricht einer, der weiß, was er sagt. Einer, der was zu sagen hat, der noch immer gefragt wird. Gerhart Baum gehört zu denen, deren Stimme zählt, auch wenn sie sich längst als Privatperson und kritische Zeitgenossen zu Wort melden. Was in diesem Land und weit darüber hinaus politisch entschieden wird, was gesellschaftlich jeden Einzelnen von uns betrifft, bewegt ihn genauso wie in den Jahren seiner aktiven Zeit in Partei und Regierung. Für die Grundrechte einzutreten, eine menschliche Gesellschaft mit aller Kraft zu ermöglichen und zu verteidigen, ist für Gerhart Baum noch immer erste Bürgerpflicht. Hier kennt er, der so differenziert zu argumentieren weiß, keine Kompromisse. Oder besser gesagt, hier entlarvt er alle noch so raffinierten Ausflüchte. Diese Überzeugung vermittelt er jedem, der mit ihm zu tun hat. Und je länger man mit ihm spricht, umso deutlicher wird: Hier hat jemand aus seiner eigenen bewegten Geschichte und der unseres Landes gelernt.
Wer wie er die Anfänge unserer Republik als junger Mensch miterlebt und sehr bald auch mitgestaltet hat, weiß, was auf dem Spiel steht. Das Grundgesetz und die damit verbundenen Wege in eine freie Bürgergesellschaft sind für ihn Chance und Verpflichtung zugleich. Immer wieder wird deutlich, dass es ihm ein Anliegen ist, dies im Bewusstsein zu halten. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Gerhart Baum, der in diesem Jahr 80 Jahre alt wird, ist ein Mann mit großer Ausstrahlung und einem beneidenswerten analytischen Verstand. Wer ihn ruhig sprechen und lächeln sieht, spürt genau, was er meint mit dem Satz: »Meine Wut ist jung.«
Bei allem kritischen Diskurs über die wechselvolle Geschichte seiner Partei, über die Verpflichtung eines verantwortungsvollen Staatsbürgers oder das mit wacher Distanz zu verfolgende Handeln von Regierung und Verwaltung nimmt er auch mit dem Herzen Anteil an all diesen Themen. Immer wieder hatte ich nach unseren Gesprächen das Gefühl, es ist eine wunderbare Erfahrung mit jemandem zu sprechen, der Mut machen kann. Er hat die Fähigkeit, seine Zuhörer, seine Leser dafür zu begeistern, dass man seinen Überzeugungen treu und ein Leben lang ein politisch denkender Mensch bleiben sollte. Ich jedenfalls habe durch unsere Gespräche viel dazugelernt und bin mir sicher, das war nur der Anfang einer Reihe anregender Begegnungen, die uns noch oft zusammenführen wird.
Ich danke Renate Liesmann-Baum, Monika Lüke und Wolfgang Weismantel für ihre Unterstützung.
Berlin, im Oktober 2012
Matthias Franck
»Wir wollten, dass die Barbarei der Nazis sich niemals mehr wiederholt«
Kindheit, Jugend und der Weg in die FDP
Was ist Ihre erste, prägende Erinnerung als Kind?
Auf den Fotos meiner Kindheit sehe ich mich geschniegelt und gebügelt neben meiner Mutter, einer sehr schönen, attraktiven Frau. Wir leben mit meinem Vater und meinen beiden jüngeren Geschwistern in Dresden und reisen gerne ins Erzgebirge, nach Bad Elster oder an die Ostsee. Doch als ich neun Jahre alt bin, verändert ein Ereignis mein Leben und es wird mir nie mehr aus dem Kopf gehen: die Abreise meines Vaters an die Front.
Er war Rechtsanwalt in Dresden und hatte sich geweigert, in die Kriegsgerichtsbarkeit zu gehen. Daraufhin wurde er eingezogen und als Schütze Baum am Hauptbahnhof in Dresden verladen. Meine Mutter, meine Geschwister und ich haben ihn dort verabschiedet. Das sehe ich heute noch vor mir, wenn ich in Dresden ankomme. Schütze Baum - feldgrau eingekleidet, mit Gewehr, Gasmaske und Gepäck, so ging er von uns. Abgesehen von einigen Urlaubstagen sollte es ein Abschied für immer werden. Ich ahnte nicht, was ihn erwartete. Ich wusste nichts von den Grausamkeiten des Krieges. Aber ich spürte, dass Schlimmes bevorstand. Vater wirkte todtraurig und ich hatte ihn von diesem Moment an als Vater verloren. Das ist meine Erinnerung.
Was bekamen Sie als kleiner Junge vom Krieg und dem Leben im NS-Staat mit?
Vom Krieg selbst haben wir in Dresden nicht viel gespürt. Bombensplitter waren eine Rarität. Wir sammelten sie wie Preziosen und legten sie in Watte gepackt in irgendein Döschen. Bis Februar 1945 blieb die Stadt ja weitgehend verschont. Doch es war keine heile Welt. Wir wussten, dass Krieg war. Auf Landkarten markierten wir Kinder den Frontverlauf mit Wollfäden und Stecknadeln - erst den Vormarsch und dann den Rückzug. Auch erinnere ich mich an Menschen, die einen Judenstern trugen. Zum Beispiel sehe ich noch ein älteres Ehepaar in Dresden im Park auf einer Bank. Viele Jahre später - bei der Lektüre der Tagebücher von Victor Klemperer - erinnerte ich mich an dieses Bild. Bei Gesprächen im Elternhaus war in dunklen Andeutungen von »Lagern« die Rede, in die Freunde der Familie gebracht worden waren. Bei einem Besuch der Familie der Großmutter in Lodz erfuhr ich von dem dortigen Ghetto.
Gelang es Ihrer Familie, sich der NS-Gesellschaft zu entziehen, oder war das im Alltag nicht möglich?
Sich entziehen - das war natürlich nicht wirklich möglich. Schon in der Grundschule mussten wir den Lebenslauf von Hitler auswendig lernen. Später im Vitzthum’schen Gymnasium war die Indoktrination nicht so stark. Welchen Druck meine Eltern auszuhalten hatten, weiß ich nicht. Die Atmosphäre in meinem Elternhaus war liberal-großbürgerlich. Um die Lebensumstände kurz zu umreißen: Mein Vater hatte eine angesehene Kanzlei am Altmarkt. Die Familie bewohnte eine großzügige Wohnung am Münchner Platz. In der Prager Straße besaßen wir ein Geschäftshaus. Die auf den Höhen über Dresden gelegene wunderschöne Jugendstilvilla meines Großvaters ging in der Inflation der 1930er-Jahre verloren. Mein Großvater war sehr geachtet als königlicher Geheimrat und Anwalt in Dresden und ist im Ersten Weltkrieg gleich zu Beginn gefallen.
Als ich zehn Jahre alt wurde, musste ich zum sogenannten Jungvolk, obwohl meine Mutter mich gern ferngehalten hätte. Also musste ich exerzieren und an Geländespielen teilnehmen. Das alles waren Vorbereitungen zum Kriegsdienst. Kurz vor Kriegsende wurde ich als 12-Jähriger für den sogenannten Volkssturm - Hitlers letztes Aufgebot - gemustert. Nach dem Angriff auf Dresden wurde daraus nichts mehr. Sehr gut erinnere ich mich an die Tage nach dem 20. Juli 1944, dem gescheiterten Attentat auf Hitler. Es gab eine große Kundgebung auf den Elbwiesen gegenüber dem Schloss. Eine Treuekundgebung mit dem Jungvolk und Tausenden von Leuten, die man zusammengekarrt hatte, um der sogenannten Vorsehung zu danken, dass Hitler überlebt hatte. Alle machten mit und ich verstand noch wenig von dem, was sich da wirklich abspielte. Die Massenaufmärsche aber waren mir zuwider wie auch die ganze Selbstdarstellung des Nazi-Regimes.
Wie erlebten Sie die Bombardierung Dresdens und den Verlust Ihrer Heimat?
Das Kriegsgeschehen war an Dresden ja eigentlich vorbeigegangen. Wir hielten den Krieg für so gut wie beendet. Umso einschneidender war dann der 13. Februar 1945, als in einer einzigen Nacht die ganze Stadt vernichtet wurde. Dresden wurde nicht durch punktuelle Bombardierung - wie andere Städte - im Laufe von Jahren zerstört, sondern in einer einzigen Nacht, auch durch die Entfesselung eines unvorstellbaren Feuersturms. Die Strategie der feindlichen Angreifer war, eben durch diese Feuerwalze die Stadt unbewohnbar zu machen, was auch gelang. Die meisten Menschen erstickten, weil sie keinen Sauerstoff mehr bekamen. Wir retteten uns im letzten Moment in den Luftschutzkeller, während unser Haus über uns niederbrannte. Das war Krieg pur und danach war nichts mehr so wie vorher.
Meine Mutter, ich und meine sechs Jahre jüngeren Zwillingsgeschwister verließen mit drei Koffern Dresden. Meine Mutter war Russin, in Moskau geboren und mit ihrer Familie während der Revolution nach Berlin geflohen. Sie wollte mit den nun anrückenden Russen nichts zu tun haben. Aber sie bewahrte bis zu ihrem Lebensende ihre Identität als Russin. Vergeblich versuchte sie allerdings, mich für die russische Sprache zu begeistern. Ich sah damals für mich darin keinen Nutzen - leider.
Unser Fluchtziel waren Freunde in Bayern. Und so fuhren wir mit dem Zug unter Tieffliegerbeschuss zunächst nach München, wurden dort erneut von Bombenangriffen bedroht, und dann an den Tegernsee. Dort erlebten wir vorerst eine reine Idylle. Kein Krieg, »nur« zahlreiche Lazarette, später den Einmarsch der US-Truppen, die Besatzerzeit. Für die nächsten fünf Jahre wurde der Tegernsee meine Heimat. Ich entwickelte Sympathie für die bayerische Lebensart und fand unter den Mitschülern Freunde fürs Leben. Die Zeit der amerikanischen Besatzung habe ich in guter Erinnerung, auch wenn es eine Notzeit war: die Winter waren bitterkalt; wir hatten wenig zu essen und zu heizen, oft halfen nur Schulspeisung und Lebertran.
Womit verbinden Sie Ihren Neuanfang mit Mutter und Geschwistern am Tegernsee?
Wenige Wochen nach Kriegsende besuchte uns in unserer neuen Heimat ein Kamerad meines Vaters und brachte uns sein Soldbuch, seine Erkennungsmarke und ein paar persönliche Habseligkeiten. Meine Mutter rief uns Kinder zusammen und überbrachte die Nachricht, dass Vater tot sei. Ich war tief erschüttert. Doch zwei »Ersatzväter« halfen mir, zwei ganz unterschiedliche Typen. Einer der beiden war ein Freund meiner Mutter, ein weltläufiger, kunstbegeisterter Mann, der in Dresden den Malern der »Brücke« nahegestanden hatte. Fritz Naumann war Architekt und sehr an Musik interessiert. In Dresden hatte er regelmäßig Hauskonzerte veranstaltet. Der andere »Vaterersatz« war ein Privatgelehrter, ein hagerer, asketischer und ganz der Wissenschaft zugewandter Mann, der mich sehr geprägt hat und zu dem ich eine lebenslange Freundschaft hatte. Adolf Grote, geboren 1890, stand der Widerstandsbewegung nahe und war für kurze Zeit einer meiner Lehrer am neu gegründeten Gymnasium in Tegernsee. Ich erinnere mich, wie er versuchte, in der Schule 1948 eine Erinnerungsfeier für die ermordeten Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 zu organisieren. Diese wurde von der Schulleitung verboten und ich begriff, was das bedeutete: Die Nazis waren noch unter uns! Grotes wissenschaftliches Lebensthema war die Revision des deutschen Geschichtsbildes, das heißt, die Aufdeckung von Fehlentwicklungen, die zum welthistorischen Skandal des Hitlerismus führten. Dessen Ursachen waren aus Grotes Sicht nicht machtpolitische Zufälle, sondern Strukturfehler in der deutschen Geschichte bis hin zur Bismarck’schen Staatskonstruktion. Sein Hauptwerk erschien 1960 unter dem Titel »Unangenehme Geschichtstatsachen - Zur Revision des neueren deutschen Geschichtsbildes«.
Was haben Sie für sich selbst von Ihren »Ersatzvätern« mitgenommen?
Von Naumann viele musische Impulse und Lebensart. Von Grote Impulse auf zahlreichen intellektuellen Feldern. Da er eine riesige Bibliothek besaß, hatte ich schon früh Zugang zu vielen Büchern. Er prägte mich politisch. Zum Beispiel, indem er mir klarmachte, dass mit Revanchismus ein neues Europa nicht aufgebaut werden kann. Jahre später sollte mich diese Erkenntnis veranlassen, auf FDP-Parteitagen für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze zu kämpfen. Er hat mich auch geprägt in Sachen Marktwirtschaft. Wir lasen die Bücher des sozialliberalen Wirtschaftstheoretikers Wilhelm Röpke. Grote stand dem Stefan-George-Kreis nahe. Wir lasen neben George auch viel Rilke und Hofmannsthal. Vor allem aber hat er mir Thomas Mann nahegebracht, der mit seinem Werk und als Repräsentant des anderen, des humanen und gesitteten Deutschland mich bis heute begleitet. Ich erinnere mich, wie Grote mir und meinem engsten Freund Franz Negele an kalten Winterabenden »Tonio Kröger« vorlas. Er hat mich später auch veranlasst, nach Lektüre des Doktor Faustus einen Brief an Thomas Mann zu schreiben. Dieser Roman interessierte mich besonders, weil er sich mit den Deutschen und ihrem Schicksalsweg bis hin zur Katastrophe auseinandersetzte. In gestelztem Schülerdeutsch gab ich meine Zweifel zum Ausdruck und meine Befürchtung, dass die Höllenfahrt des Doktor Faustus als eine deutsche Höllenfahrt noch nicht überwunden sei. Thomas Mann antwortete tatsächlich auf meine Zeilen, kurz, aber freundlich und zustimmend.
Beide väterlichen Freunde haben mich geprägt - jeder auf seine Weise. Sie verstanden sich auch untereinander gut. Grote an meiner Seite zu wissen, war ein besonderer Glücksfall, das spüre ich bis heute. Er hat auch meine musische Seite geweckt, meine Liebe zur Kunst und Musik, die Affinität zu Büchern, die mich später durch die Antiquariate streifen ließ. Und mein Interesse an Politik. Wir haben sehr viel über Politik diskutiert. Diese Gespräche haben mein Leben stark beeinflusst.
Wie ist Ihre Mutter mit der Herausforderung fertiggeworden, in dieser schwierigen Zeit für die Familie zu sorgen?
Sie war die verwöhnte Tochter eines russischen Fabrikanten, wuchs in einem Mädchenpensionat auf und hatte nichts gelernt, was beruflich verwertbar gewesen wäre. 1945 stand sie dann da mit drei Kindern, alles, was wir hatten, befand sich in drei Koffern. Bis zur Währungsreform ging es einigermaßen gut. Allerdings gab es Phasen, in denen wir wirklich hungerten. Meine Mutter musste Geld verdienen. Der Grundbesitz in Dresden, das Haus, alles war verloren. Doch Mutter erwies sich als lebenstüchtig und auch als finanziell sehr geschickt. Sie nutzte Möglichkeiten wie den Lastenausgleich und die Witwenrente. Weil das nicht reichte, um die Familie zu ernähren, übernahm sie eine Vertretung für medizinische Geräte und verkaufte in der ganzen Republik »Eiserne Lungen« an Krankenhäuser. Sie war eine sehr attraktive und kommunikative Frau. Das half in einer männlich dominierten Welt. Während dieser Zeit hatte ich meine beiden Geschwister zu versorgen. Ich war sechs Jahre älter und sorgte dafür, dass sie in die Schule gingen, Schularbeiten machten, zu Bett gingen, aßen, all das, was eben Eltern machen. Das Geldverdienen vom Tegernsee aus wurde wegen der ländlichen, abgeschiedenen Lage schwieriger und meine Mutter zog 1950 mit uns und ihrem Freund Naumann nach Köln. Dort baute sie ein kleines Haus und begann eine Maklertätigkeit. Sie entwickelte Projekte mit Eigentumswohnungen. Im Großen und Ganzen erfolgreich, dennoch gab es Phasen der Existenznot. Aber sie war eine Kämpfernatur und gab niemals auf.
Was haben Sie von Ihrer Mutter für Ihren Werdegang mitgenommen und wie kam es dazu, dass Sie Jurist wurden?
Ich habe von meiner Mutter sicherlich ihre Zähigkeit und auch Lebenstüchtigkeit geerbt. Nach dem Jurastudium war ich erst als Rechtsanwalt in einer Kanzlei und dann als Mitglied der Geschäftsführung der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber tätig. Ab 1972 wurde ich Berufspolitiker. Meine anwaltliche Tätigkeit nahm ich Ende der 1980er-Jahre wieder auf. Aber letztendlich war mein Jurastudium ursprünglich eine Verlegenheitsentscheidung. Die familiäre Anwaltstradition von Vater und Großvater gab wohl den Ausschlag für diese Entscheidung.
Mit welchen Zielen verbanden Sie die Anfänge ihres politischen Engagements?
Ich war durch den väterlichen Freund Grote politisch hoch motiviert und wir hatten durchaus Zweifel, ob das »Projekt Demokratie« gelingen könnte. Als Student an der Universität in Köln trat ich dem Liberalen Studentenbund bei. Mir war der liberale Grundgedanke wichtig, auch die damals heftig umstrittene soziale Marktwirtschaft. Rasch stieg ich in eine Führungsrolle auf. Wir pflegten einen politischen Stammtisch und beteiligten uns an den Uni-Wahlen. Unser Gegenpol waren die Burschenschaften, die wir als Reaktionäre bekämpften. Ich erinnere mich noch an eine Veranstaltung, die wir zum damals sehr aktuellen Thema Wiederbewaffnung organisierten. Wir hatten den Ex-General Hasso von Manteuffel eingeladen und befürchteten, dass man uns die mit Besuchern überfüllte Mensa auseinandernahm. Da konnte ich früh mein Geschick als Versammlungsleiter erproben.
Warum führte Sie dieser Weg gerade in die FDP?
Ein guter Freund sagte, jetzt sei es doch eigentlich konsequent, in die FDP zu gehen, um auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen zu können. Ich war zunächst dagegen, denn die FDP in Nordrhein-Westfalen war mir nicht geheuer. Sie war noch durchsetzt von braunen Netzwerken. Ich wurde deshalb erst einmal Mitglied der Deutschen Jungdemokraten, der Jugendorganisation der FDP. Auch hier wurde ich sehr schnell zum Vorsitzenden in Köln gewählt, der ich dann fünf Jahre blieb. Nach einiger Zeit hatte ich mich dann doch entschieden, der FDP beizutreten, obwohl die FDP in NRW immer noch keine durch und durch liberale Partei war. Die alten Nazis und ihre Sympathisanten waren noch einflussreich. Da gab es zum Beispiel schwarz-weiß-rote Fahnen bei Partei-Veranstaltungen. Aber ich orientierte mich an Persönlichkeiten wie Theodor Heuss, Reinhold Maier, Thomas Dehler und anderen herausragenden Liberalen in der ganzen Republik.
Und die anderen Parteien waren keine Alternative?
Die Sozialdemokraten waren auf strikt sozialistischem Kurs und mir von ihrem Programm her fremd. Die Christdemokraten in Köln waren sehr konservativ, sehr »katholisch«. Bei Kandidaturen wurden Protestanten benachteiligt. Die Konfessionsschule, gegen die meine Freunde und ich heftig angingen, wurde verteidigt. Also blieb mir nichts anderes als die FDP übrig, wenn ich politisch tätig werden wollte - und das wollte ich.
Was genau waren Ihre programmatischen Ziele?
Während der zehn Jahre, die ich Vorsitzender des Kreisverbandes der FDP in Köln war, habe ich nicht nur intensiv Kommunalpolitik betrieben, sondern den Verband auch in eine sozial-liberale Richtung geschoben. Ein Höhepunkt war die von uns 1969 mit betriebene Wahl Gustav Heinemanns zum Bundespräsidenten.
Wir wollten den Mief der Adenauerzeit beenden. Wir kämpften gegen autoritäre Strukturen, die überall in der Gesellschaft bis in Familien hinein noch lebendig waren. Ein Hauptanliegen war die neue Deutschland- und Ostpolitik. Wir haben den Vietnamkrieg abgelehnt und die Notstandsgesetze. All diese Themen, die viele junge Menschen damals beschäftigten, waren auch unsere. Wir hatten enge Kontakte zu Ralf Dahrendorf und zu Ulrich Klug, der später Justizsenator in Hamburg wurde und ein überzeugter liberaler Strafrechtslehrer war. Und natürlich zu den beiden liberalen Vordenkern Werner Maihofer und Karl-Hermann Flach, dessen Thesen für eine Reform des Kapitalismus unsere Zustimmung fanden. Zu Dahrendorf hatte ich immer wieder Kontakt bis zu seinem Tod im Jahr 2009. Er hat die Leidensgeschichte der Freiheit in Deutschland und den Nationalsozialismus als ein deutsches Phänomen sehr genau analysiert. Immer ermunterte er uns, konfliktbereit zu sein, auch auf den Parteitagen, wo wir oft für gemeinsame Ziele eintraten. Und wir suchten die Verbindung zu Liberalen in Hamburg, Bremen und in Baden-Württemberg. Uns trieb damals wirklich die Sorge um, der braune Ungeist könne in Gestalt neuer Rattenfänger - möglicherweise begünstigt durch eine Wirtschaftskrise - den demokratischen Aufbau der Republik infrage stellen. Die Bundesrepublik Deutschland war keineswegs so gefestigt wie heute. Dass dieses keine abseitige Meinung war, belegt die Rede, die Thomas Dehler 1966 unmittelbar nach Bildung der Großen Koalition im Deutschen Bundestag gehalten hat. Er sagte: »Ich bin nur skeptisch, Herr Schmidt, dass die Demokratie in unserem Volke, ich glaube, Sie sagten: verankert oder tief verwurzelt sei. Ich glaube es nicht.« Der spätere Bundeskanzler Schmidt erwiderte in einem Zwischenruf: »Fester als vor einer Generation!« Das ist nicht zu bestreiten und das hat Dehler auch nicht gemeint.
Die Gefahren von rechts wurden von der Gesellschaft eher verharmlost und weckten weit weniger Bereitschaft zum Widerstand als der Kampf gegen den Linksextremismus. Lange Zeit wurde der eher links-liberale Kölner Verband in der NRW-FDP wie eine aussätzige Minderheit behandelt. Aber wir haben gekämpft und uns am Ende durchgesetzt.
Leitbild war für uns das Verhalten kämpferischer Liberaler direkt nach dem Krieg in der späteren DDR. Sie hatten es - im Gegensatz zu uns - mit einem Unrechtsregime zu tun. So beschrieb es Karl-Hermann Flach: »Die liberale Jugend ging lieber ins Zuchthaus oder nach Sibirien, ehe sie Verrat an der Freiheit übte.« Einige dieser Liberalen - wie Arno Esch - wurden für ihre Überzeugungen hingerichtet.
Woher bezogen Sie Ihre Ideale und an wem orientierten Sie sich damals?
Wir verstanden uns als Liberale in der Tradition des Hambacher Festes (1832) und der Paulskirchenverfassung von 1848. Wir wollten unser freiheitliches Lebensgefühl auf allen Feldern der Politik einbringen. Thomas Dehler, Jahrgang 1897, war für mich damals ein väterlicher Freund. Dehler galt als unbequemer und sehr selbstbewusster Hitzkopf, der in seiner rigorosen Liberalität und als Justizminister eine große Strahlkraft auf mich und andere ausübte - bei aller Kritik an ihm war er ein Glücksfall für die FDP. Bei der Vorbereitung dieser Gespräche habe ich festgestellt, dass Dehlers Reden heute noch eine wahre Fundgrube für liberale Grundüberzeugungen sind. Unsere Gegner waren u.a. die Anhänger von Erich Mende. Wir standen an der Seite von Liberalen wie Theodor Heuss und Hildegard Hamm-Brücher, von Walter Scheel, Karl-Hermann Flach, Wolfgang Rubin und nicht zuletzt Hans-Dietrich Genscher. An einige Kölner Mitstreiter aus dieser Zeit erinnere ich mich gern - u.a. an Klaus Schumann, Fritz Gericke, Bernhard Piltz und Peter Finkelgrün. Auf Bundesebene waren es vor allem Heiner Bremer und Günter Verheugen.
Welche politische Grundstimmung prägte die 1960er-Jahre, in denen Sie Ihre Überzeugungen durchsetzen wollten?