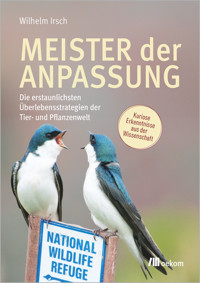
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wussten Sie, dass Bären im Winterschlaf keine Thrombose bekommen können, helle Städte die Augen von Vögeln schrumpfen lassen und das Hakenblatt bei Phosphormangel zum Fleischfresser wird? Orang-Utans leisten sogar medizinische Hilfe, indem sie Wunden mit dem Saft von Blättern behandeln, die uns aus der traditionellen Medizin bekannt sind. All dies sind faszinierende Phänomene, mit denen Wildtiere und Pflanzen ihr Überleben sichern – auch in einer sich rasch wandelnden Welt. Wilhelm Irsch enthüllt in diesem Buch die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft über Flora und Fauna und taucht ein in die verborgenen Mechanismen der Natur, von denen wir Menschen noch vieles lernen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Irsch
Meister der Anpassung
Die erstaunlichsten Überlebensstrategien der Tier‐ und Pflanzenwelt. Kuriose Erkenntnisse aus der Wissenschaft
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2024 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
www.oekom.de
Layout und Satz: le tex, xerif
Umschlaggestaltung: Sarah Schneider, oekom verlag
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9783987263842
DOI: https://doi.org/10.14512/9783987263859
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Tiere – wie sie über‐ und zusammenleben
Kapitel 1:
Vom Maulwurfshirn und trächtigen Fledermäusen
Kapitel 2:
Von Haien im Atemstillstand bis zu den Salamandern der Götter
Kapitel 3:
»Gerechte« Mäuse, harte Bären, Bienen‐ und Schlangengift
Kapitel 4:
Wie der Ruderfußkrebs fastet und Tintenfische sich tarnen
Kapitel 5:
Wie Bärtierchen im Eis überleben und höhere Temperaturen den Fadenwurm nerven
Kapitel 6:
Ameisen – fleißige Arbeiterinnen, soziale Helfer
Kapitel 7:
Von Orang‐Utans, Schimpansen, Pavianen, Gorillas und Co.
Kapitel 8:
Soziale Hierarchien in der Savanne – der Machtverlust der Hyänen
Kapitel 9:
Der Ton macht die Musik
Kapitel 10:
Nicht nur der Nase nach …
Kapitel 11:
Lebensraum City – Refugien und Experimentierfelder der Evolution
Kapitel 12:
Die magische Kraft des Lichtes
Pflanzen unter Stress
Kapitel 13:
Der Kirschlorbeer drängt in mitteleuropäische Wälder
Kapitel 14:
Zur Not auch Fleisch
Über den Autor
Literatur
Tiere – wie sie über‐ und zusammenleben
Kapitel 1Vom Maulwurfshirn und trächtigen Fledermäusen
****************************************************************
Europäische Maulwürfe überleben den Winter nur, weil sie ihr Gehirn verkleinern. Im Winter hat es der Europäische Maulwurf nicht leicht. Sein Stoffwechsel, einer der höchsten unter den Säugetieren, fordert ständig große Mengen an Futter. Da er keinen Winterschlaf halten oder wegziehen kann, löst er dieses Problem auf seine Art: Er schrumpft sein Hirn.
Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) verkleinert seinen Schädel und damit sein Hirn im Winter um elf Prozent, um ihn bis zum Sommer wieder um vier Prozent zu vergrößern. Das sogenannte Dehnel‐Phänomen, eine reversible Größenveränderung des Gehirns, wurde erstmals in den 1950er‐Jahren bei Rotzahnspitzmäusen (Sorex monticolus) beschrieben. Der Kleinsäuger wird dabei nicht nur durch Nahrungsknappheit angetrieben, sondern auch durch die kalten Winterbedingungen. Das Phänomen tritt bei allen Spitzmäusen auf und ist inzwischen auch von Hermelinen (Mustela erminea) und Wieseln (Mustela nivalis) bekannt, die einen extrem hohen Stoffwechsel haben und das ganze Jahr über in kalten Klimazonen aktiv sind. Ihre winzigen Körper sind wie turbogeladene Porsche‐Motoren, die ihre Energiespeicher in wenigen Stunden aufbrauchen. Die Tiere können durch das Schrumpfen von energieaufwändigem Gewebe, wie dem Gehirn, ihren Energiebedarf senken und dadurch auch in schwierigen Zeiten überleben. Wenn es nur eine Frage der Nahrung wäre, dann müsste der Europäische Maulwurf im Winter schrumpfen, wenn die Nahrung knapp ist, und der Iberische Maulwurf (Talpa occidentalis) im Sommer, wenn die große Hitze und Trockenheit die Nahrung knapp machen. Dem ist jedoch nicht so. Dass drei Taxa von Säugetieren, Spitzmäuse, Wiesel und Maulwürfe, Knochen‐ und Hirngewebe schrumpfen und wieder wachsen lassen können, hat enormes Potenzial für die Erforschung von Krankheiten wie Alzheimer und Osteoporose.
Die Gehirne von Nutztieren sind kleiner als die ihrer Vorfahren. Schafe, Schweine und Rinder haben im Vergleich zu ihren wilden Artgenossen durch den Domestizierungseffekt eine geringere relative Gehirngröße. Das Dehnel‐Phänomen ist eine Umkehr des Domestizierungseffekts. Der Amerikanische Nerz (Neovison vison) hat im Laufe der Domestikation seine relative Gehirngröße verringert. Populationen, die von aus Gefangenschaft entkommenen Tieren abstammen, haben innerhalb von nur 50 Generationen fast die volle Gehirngröße ihrer Vorfahren wiedererlangt. Wenn das Gehirn von Tieren im Laufe der Domestizierung kleiner wird, gilt dies meist als Einbahnstraße. Sogar wilde Populationen von ehemals domestizierten Tieren, die seit Generationen in freier Wildbahn leben, scheinen fast nie die relative Gehirngröße ihrer Vorfahren wiederzuerlangen. Körperteile, wie bestimmte Gehirnregionen sind, wenn sie im Laufe der Evolution verloren gehen, endgültig weg und können nicht wiedergewonnen werden.
Der Amerikanische Nerz stammt aus Nordamerika, wird seit über einem Jahrhundert in Europa für den Pelzhandel gezüchtet und besitzt die bemerkenswerte Fähigkeit wie seine Verwandten die Gehirngröße saisonal zu verändern. Während andere domestizierte Tiere beim Verringern der Gehirngröße anscheinend manche Hirnregionen dauerhaft verlieren, ist es möglich, dass Nerze, die aus Farmen entwichen, ihre ursprüngliche Gehirngröße wiedererlangen können, weil noch eine flexible Gehirngröße genetisch programmiert ist. Diese Flexibilität könnte den Tieren, als sie dann wieder in die freie Wildbahn kamen, Vorteile gebracht haben.
Fazit: Die Schädel von in Gefangenschaft gezüchteten Nerzen sind um 25 Prozent geschrumpft. Die Gehirne wild lebender Nerze wuchsen jedoch innerhalb von 50 Generationen wieder auf fast die Größe ihrer wilden Vorfahren an.
Die evolutionsbiologische Erklärung: Wenn man aus der Gefangenschaft zurück in die Natur flieht, braucht man ein voll funktionsfähiges Gehirn, um die Herausforderungen der freien Wildbahn zu meistern.
Die größte Flughundkolonie der Erde
Palmenflughunde (Eidolon helvum) aus ganz Afrika sammeln sich einmal im Jahr drei Monate lang in einer Baumgruppe im Kasanka‐Nationalpark in Sambia und bilden somit die größte Flughundkolonie des Kontinents. Mit 750.000 bis 1 Million Tieren ist sie hinsichtlich ihrer Biomasse die größte Fledermauskolonie weltweit. Zoologen beeindrucken die Tiere, da sie Schätzungen zufolge zu den am häufigsten vorkommenden Säugetieren Afrikas zählen und zudem mit bis zu zweitausend Kilometern pro Jahr die längste Strecke aller Flughundarten zurücklegen. Zudem betätigen sie sich als Förster von abgeholztem Land, indem sie während ihres Langstreckenfluges zur Verbreitung von Samen beitragen. Damit sind sie die heimlichen Gärtner Afrikas die den Kontinent auf eine Weise verbinden, wie es kein anderer Samenverbreiter tut.
Doch die Kasanka‐Kolonie ist durch Landwirtschaft und Lebensraumverlust bedroht. Wenn die Ökosystemleistungen der Flughunde als »Gärtner« erhalten bleiben sollen, darf ihre Population nicht schrumpfen. Der Verlust der Kolonie wäre für ganz Afrika verheerend.
Schwangere Fledermäuse »sehen« schlechter
Nachtaktive Fledermäuse wie Kuhls Zwergfledermäuse (Pipistrellus kuhlii) nutzen Echolot zur Orientierung, um im Dunkeln zu navigieren und Beute zu jagen. Ihre Rufe werden von allem, was sich in der Nähe befindet, reflektiert: Die Echos werden von den Fledermäusen genutzt, um die Umgebung wahrzunehmen – ein Vorgang, der als Echoortung bekannt ist. Je schneller eine Fledermaus ruft, desto besser kann sie ihre Umgebung erkennen. Schnelle Rufe aber erfordern ein tiefes Durchatmen, was durch eine Schwangerschaft erschwert wird.
Schwangere Zwergfledermäuse rufen während sie trächtig sind weniger. Eine Schwangerschaft – die zur Folge hat, dass eine sieben Gramm schwere Kuhlsche Zwergfledermaus ein ganzes Gramm zunimmt und die Lunge nach oben drücken kann – beeinträchtigt die Echoortung.
Fledermäuse, die nicht trächtig waren und bei der Suche nach einer Plattform, auf die sie zuvor geschult wurden, sie zu finden und auf ihr zu landen, tätigten im Durchschnitt etwa 130 Rufe. Trächtige Fledermäuse machten dagegen nur rund 110 Rufe, also 15 Prozent weniger, was die Jagd behindern könnte. Eine Computersimulation bestätigt, dass werdende Mütter 15 Prozent weniger Insekten fangen als nicht trächtige Fledermäuse. Dies könnte erklären, warum einige Fledermausarten größere und langsamere Beute jagen, sobald sie schwanger sind, und ihre Energie auf leichter zu erkennende Nahrung konzentrieren.
Paarung auf Umwegen – geheimnisvolle Breitflügelfledermaus
Das Fortpflanzungsverhalten in der Tierwelt ist äußerst vielgestaltig. Bei Säugetieren ist beim Paarungsverhalten ein Eindringen des Penis in den weiblichen Genitaltrakt üblich. Nicht jedoch offenbar bei Fledermäusen, einer Gruppe von Säugetieren, über deren Sexualverhalten immer noch wenig bekannt ist. Bei der Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), einem insektenfressenden Nacht‐ und Dämmerungsjäger, der in Europa, dem Nahen Osten und Asien vorkommt, ist der erigierte Penis im Vergleich zur Größe der Vagina des Weibchens viel zu groß. Die Männchen benutzen ihn nicht als intromittierendes Organ. Vielmehr »besteigt« das Männchen den Rücken des Weibchens, wie es viele andere Säugetiere tun, und nutzt seinen langen Penis wie einen Arm, um die Flughaut zu umgehen, die eine normale Paarung verhindert. Das Männchen drückt dann seinen Penis fest gegen die Vulva des Weibchens, eine Position, in der das Paar dann mehrere Stunden lang ausharren kann. Der erste Beweis für eine Paarung ohne Intromission bei einem Säugetier, ist nur eines der vielen Geheimnisse über die Biologie der Fledermäuse und deren Fortpflanzungsweise, die bei den 1.400 bisher bekannten Arten sehr unterschiedlich ist.
Alles Gute kommt von oben – DNA‐basierte Nahrungsanalysen
Beim »Dämmerungsschwärmen«, nach der nächtlichen Jagd auf Insekten, kehren die Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) zurück zur Wohnhöhle und umkreisen dabei zunächst den Baum. Immer wieder setzen sie sich dabei kurz neben den Höhleneingang und kleben einen kleinen Guano‐Pellet an den Stamm. Aus 350 Insekten haben Zoologen im Natura 2000‐Gebiet »Waldreservat Kottenforst«, wo etwa 13 verschiedene Fledermausarten leben, eine reichhaltige Speisekarte rekonstruieren können: mindestens 126 verschiedene Arten von Nachtfaltern und Motten, 86 unterschiedliche Arten von Fliegen und Mücken, 48 Käferarten und ein paar Dutzend weitere, verschiedene Arten von Wanzen, Eintagsfliegen, Köcherfliegen und Netzflüglern. Ab und an wurden auch Webspinnen, Weberknechte, Läuse und andere kleine Tiere verspeist. Von Ende März bis Ende Juni nimmt die Artenzahl im Guano stetig zu, um dann bis Mitte August wieder abzunehmen, was sehr gut mit dem Aktivitätsmuster bestimmter Insektengruppen übereinstimmt.
Der Buchenwickler (Cydia fagiglandana) – eine Motte – war dabei der am häufigsten verzehrte Schmetterling, das Uferaas (Epheron virgo) – auch »Vergängliche Jungfrau« genannt – die am häufigsten verspeiste Eintagsfliege. Neben der »Hitliste« der 18 wichtigsten Beutetierarten konnten Zoologen die wichtigsten ökologischen Parameter auflisten, mit denen sich die von den Futterinsekten benötigten Lebensräume gezielter sichern lassen, auch ein Beitrag zum Erhalt der Lebensqualität des Kleinsäugers.
Viel Aufwand, wenig Beute – In der City wenig erfolgreich
In der Stadt haben es Fledermäuse relativ schwer. Viel Aufwand – wenig Beute lautet die Bilanz. Im Unterschied zu manchen Wildtieren, die relativ gut in städtischen Lebensräumen zurechtkommen, stellt die Futtersuche größere, insektenfressende Fledermausarten vor Herausforderungen: Um satt zu werden, muss der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) in der Stadt länger als seine Artgenossen auf dem Land fliegen und fängt dennoch weniger Insekten. Städtische Fledermäuse gehen allein auf die Jagd, während die Artgenossen auf dem Land regelmäßig gemeinsam unterwegs sind.
Die etwa 30 Gramm schwere Fledermausart, wurde im Stadtgebiet der Bundeshauptstadt und in einem ländlichen Gebiet in Mecklenburg‐Vorpommern mit kleinen Sensorloggern ausgestattet. Ziel war es, den Aufwand für die Nahrungssuche, die Anwesenheit von Artgenossen und den Jagderfolg während der Nahrungssuche in städtischer und ländlicher Umgebung vergleichend zu erfassen. Obwohl die Tiere in beiden Umgebungen ähnlich große Beutetiere jagten, machten sie in der Stadt deutlich weniger Beute pro Flugzeit und erhaschten im Fluge insgesamt eine geringere Gesamtmenge an Insekten als ihre Artgenossen auf dem Land. Die Tiere mussten zudem höher und weitere Strecken fliegen. Fazit: Sie fangen in der Stadt weniger Beute mit höherem Energieaufwand bei der Suche als auf dem Land.
Zwar leben viele Fledermausarten in städtischen Gebieten, aber es geht nicht allen gleich gut. Vor allem für größere Arten ist das Nahrungsangebot aufgrund der starken Versiegelung durch Straßen, Parkplätze und Bebauung eher schlecht. Alle europäischen Fledermausarten sind Insektenfresser, die abends oder nachts auf Nahrungssuche gehen. In den Städten finden sie ihre Beute in räumlich eng umgrenzten Arealen wie in Parks und Friedhöfen. In der Stadt sind Große Abendsegler zudem weniger sozial und jagen seltener mit Artgenossen. Wahrscheinlich ist die Gruppenjagd in der Stadt unnötig, da es für eine Stadtfledermaus überschaubar ist, in welchen Grünanlagen sich Beuteinsekten befinden. Auf dem Land benötigen sie hierfür die Unterstützung ihrer Artgenossen.
Die meisten Fledermausarten haben aufgrund ihres hohen Stoffwechsels und ihrer energieaufwändigen Fortbewegung einen hohen Energiebedarf. Um diesen während des gesamten Tagesverlaufes in Zeiten von Nahrungsknappheit zu reduzieren, versetzen sie sich in einen Schlafzustand – senken ihre Körpertemperatur und somit ihren Energieverbrauch erheblich. Möglicherweise nutzen größere Arten wie der Abendsegler diese Methode in der Stadt gezielt, um eine positive Energiebilanz aufrechtzuerhalten. Doch der energiesparende Ruhezustand hat auch negative Folgen: Bei den Weibchen wird während der Trächtigkeit das Wachstum des Nachwuchses bis hin zur Jungtierentwicklung ausgebremst.
Fazit: Die Verstädterung hat generell erhebliche Auswirkungen auf Wildtiere und ihre Lebensräume. Auch wenn sich einige wenige Tierarten an städtische Umgebungen anpassen können, meidet die Mehrheit der Wildtierarten urbane Landschaften, was zu einem allgemeinen Rückgang der Artenvielfalt führt. Als »Experimentierfelder der Evolution« zeichnen sich städtische Gebiete durch wenige Spitzenprädatoren (typischerweise Säugetiere), große räumliche Heterogenität und fragmentierte Lebensräume aus, was zu einem höheren Wettbewerb innerhalb und zwischen Arten führt.
Dass Große Abendsegler beim Management ihres Energiehaushalts eine hohe Flexibilität auch im Jahresrhythmus an den Tag legen, zeigen Forschungsergebnisse, bei denen Männchen mit 0,8 Gramm schweren Herzfrequenzsendern ausgestattet und beim nächtlichen Flug bis zu einer Stunde mit dem Flugzeug begleitet wurden: Ihr Herzschlag erreichte Spitzenwerte von etwa 900 Schlägen pro Minute, ein Signal das von menschlichen Ohren wie ein einziger hoher Ton wahrgenommen wurde.
Die Nachtjäger müssen mit ihrer Energie in unterschiedlichen Jahreszeiten bedarfsgerecht haushalten und verbrauchen im Sommer bis zu 42 Prozent mehr als im Frühjahr. Unmittelbar nach dem Winter sind sie in der Lage in eine Art Kurzwinterschlaf (»Torpor«) zu gehen, ein Energiesparprogramm, in dem sie ihre Herzschlagfrequenz auf bis zu sechs Schläge pro Minute senken können. Beim Aufwachen sind sie in der Lage, die Herzfrequenz innerhalb weniger Minuten auf Höchstgeschwindigkeit von bis zu 900 Schlägen pro Minute zu beschleunigen. Um die verbrauchte Energie wieder aufzufüllen, jagen die Männchen im Sommer doppelt so lange wie im Frühjahr und fressen bis zu 33 Maikäfer (Melolontha melolontha) bzw. über 2.500 Mücken pro Nacht.
Mückenfledermäuse: Navigation nach Erdmagnetfeld
Was die Orientierungs‐ und Navigationsleistungen angeht, gelten Zugvögel zwar als wahre Meister. Fledermäuse sind aber die »hidden champions« deren echte Qualitäten auf diesem Gebiet erst jetzt ans Tageslicht kommen. Mückenfledermäuse (Pipistrellus pygmaeus) verfügen über einen magnetischen Kompass und kalibrieren diesen bei Sonnenuntergang. Sie wiegen nur wenige Gramm, legen aber auf nächtlichen Wanderungen von Nordost‐ nach Südwesteuropa wohl jedes Jahr Tausende Kilometer zurück. Im Unterschied zu Vögeln ist der Magnetsinn von Säugetieren, die über lange Distanzen wandern, kaum erforscht.
Im August und September wandern Zehntausende Fledermäuse entlang der Ostseeküste, vor allem Richtung Mitteleuropa. Sie justieren dabei ihren inneren Kompass bei Sonnenuntergang neu und nutzen dafür den Punkt, an dem die Sonne untergeht, um ihre Flugroute auch später in der Nacht bestimmen zu können. Von 65 Tieren, die auf der Ornithologischen Station der Universität von Lettland in Pape gefangen wurden, wurde ein Teil zur Zeit des Sonnenuntergangs mittels einer sogenannten Helmholtz‐Spule einem manipulierten Magnetfeld ausgesetzt, dessen horizontale Richtung um 120 Grad im Uhrzeigersinn gegenüber dem Erdmagnetfeld gedreht war (so, dass eine Kompassnadel nicht nach Norden, sondern nach Südosten zeigen würde). Bei einer zweiten Gruppe wurde zusätzlich die Neigungsrichtung des Magnetfeldes, die sogenannte Inklination umgekehrt, sodass sie natürlichen, auf der Südhalbkugel der Erde gemessenen Werten entsprach. Ein weiterer Teil der Gruppe diente als Kontrollgruppe und war nur dem natürlichen Erdmagnetfeld in den Dünen von Pape ausgesetzt.
Nach dem Freilassen einzelner Tiere einige Stunden später in der Nacht wurde deren Abflugrichtung bestimmt. Das Ergebnis: Aus der Kontrollgruppe flog etwa die Hälfte der Tiere nach Süden, die andere Hälfte nach Norden. Die beiden Gruppen mit manipuliertem Magnetfeld verhielten sich unterschiedlich: Diejenigen Tiere, bei denen die horizontale Richtung des Magnetfeldes gedreht war, orientierten sich überwiegend nach Nordwesten. Bei der Gruppe, bei der zusätzlich die Inklination umgekehrt war, war keine bevorzugte Abflugrichtung zu erkennen. Fazit: Die Fledermäuse sind bei Sonnenuntergang sowohl für die horizontale Richtung als auch für die Inklination des Magnetfeldes sensibel, was ihren Abflug noch Stunden später beeinflusst. Welcher Mechanismus dem Magnetsinn der Fledermäuse zugrunde liegt, ist unklar, jedoch können sie offenbar, ähnlich wie Vögel, die Inklination des Erdmagnetfeldes für ihre Navigation nutzen.
Wo sitzt der Kompass?
Bei Säugetieren mit Magnetsinn steckt der »sechste Sinn« – das geheimnisvolle Orientierungssystem – in der Hornhaut der Augen. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen gehören zum Standardrepertoire – doch manche Tiere besitzen noch einen weiteren Wahrnehmungskanal. Einige Vogelarten, Fische, Schildkröten und auch Säugetiere wie Delfine, Wale oder Fledermäuse verfügen bei großräumigen Bewegungen über ein Orientierungsvermögen, das offenbar nicht auf den klassischen fünf Sinnen beruht. Sie sind in der Lage, Magnetfelder wahrzunehmen und als Navigationshilfen zu nutzen: Eisenoxid‐Partikel in bestimmten Körperzellen fungieren als »mikroskopische Kompassnadeln«.
Bislang gab es nur Hinweise bei Graumullen (Fukomys), dass diese durch Sinnesrezeptoren in ihren verkümmerten Augen Magnetfelder wahrnehmen können, um sich in ihren verzweigten Tunnelsystemen zurechtzufinden. Erstmals wurde auch bei den in Europa beheimateten Rauhautfledermäusen (Pipistrellus nathusii), die, ähnlich wie einige Vogelarten, von ihren Sommerquartieren in Nord‐ und Osteuropa für den Winter in Bereiche mit mildem Klima ziehen, nachgewiesen, dass auch sie über eine Art Kompass verfügen: Bei Säugetieren mit Magnetsinn steckt das geheimnisvolle Orientierungssystem in der Hornhaut der Augen.
Einige Säugetiere nutzen, zumindest bei großräumigen Bewegungen, Magnetfelder und Navigationshilfen auf der Basis von Eisenoxid‐Partikeln, die als »mikroskopische Kompassnadeln« in den Augen eingelagert sind. Forscher haben die Nerven in der Hornhaut (Cornea) kurzzeitig mit einem Tropfen Oxybuprocain betäubt, wodurch das Sehvermögen allerdings nicht beeinträchtigt wurde. Damit konnten sie ausschließen, dass die beobachteten Effekte auf einer Beeinträchtigung des Sehsinns beruhen, den Fledermäuse neben ihrem Echoortungssystem ebenfalls noch manchmal zur Orientierung nutzen. Bei einer Gruppe der Fledermäuse behandelten die Wissenschaftler beide Augen, bei einer zweiten hingegen nur die Hornhaut eines Auges. Bei einer Kontrollgruppe wurde nur eine wirkungslose Kochsalzlösung als Augentropfen verabreicht. Anschließend ließen die Forscher die Tiere in elf Kilometern Entfernung vom Fangplatz wieder einzeln frei und erfassten die Flugrichtungen.
Mit Augentropfen vom Kurs abgebracht
Individuen aus der Kontrollgruppe und der Gruppe mit einseitiger Cornea‐Betäubung orientierten sich ihrer Zugroute entsprechend sofort nach Süden. Die Fledermäuse mit beidseitig anästhesierten Hornhäuten flogen in zufälligen Richtungen davon, was darauf hindeutet, dass die Betäubung der Cornea den Orientierungssinn nachhaltig störte – und dass dieser offenbar auch noch mit einem Auge gut funktioniert. (Da die Cornea‐Betäubung schnell nachlässt, wurden die Tiere nur kurzzeitig beeinträchtigt und konnten schon bald wieder ihre Reise in den Süden fortsetzen.)
Die Forscher hatten damit erstmals ein ziehendes Säugetier vom Kurs abgebracht – ein Meilenstein in der Verhaltens‐ und Sinnesbiologie. Unklar ist, wo der Orientierungssinn sich genau in der Hornhaut der Fledermäuse befindet, wie er funktioniert und ob es sich auch tatsächlich um den vermuteten Magnetsinn handelt.
Fledermaus ist nicht gleich Fledermaus – getrennt betrachten
In über 160 Studien der letzten 40 Jahre hat Natalie Weber keine Belege dafür gefunden, dass afrikanische Fledermausarten – abgesehen vom Marburg‐ und dem Sosuga‐Virus – generell als Reservoirs oder Wirte für Viren dienen, die Menschen infizieren und Krankheit verursachen. Sie konzentrierte sich exemplarisch auf Viren, die in afrikanischen Fledermäusen nachgewiesen wurden und analysierte die Ergebnisse von 162 Studien, die zwischen 1978 und 2020 veröffentlicht wurden, mit Daten von über 80.000 Fledermäusen aus über 160 Arten.
Außer dem Nilflughund (Rousettus aegyptiacus) ist für keine andere Art nachgewiesen, dass er eine zentrale Rolle für die Übertragung von Viren auf den Menschen spielt. In Afrika ist in zwei Fällen die Übertragung von Tier auf Mensch eindeutig dokumentiert. Fledermäuse werden oft als eine Einheit betrachtet. Tatsächlich sind Fledermäuse aber eine äußerst heterogene Tiergruppe, die sich über Dutzende von Millionen von Jahren diversifiziert hat: Allein in Afrika leben mindestens 324 verschiedene Fledermausarten.
Waldfledermäuse – turbulente Windenergie »nein danke«
An Windenergieanlagen kommen nicht nur viele Fledermäuse zu Tode, die Anlagen verdrängen auch einige Arten weiträumig aus ihren Lebensräumen. Die Aktivität von Fledermausarten, die in strukturdichten Habitaten wie Wäldern jagen, sinkt im Umkreis von 80 bis 450 Metern um die Anlage um fast 80 Prozent. Als Ursache dieses Vermeidungsverhaltens gilt vor allem der Lärm der Rotoren, der mit zunehmender Windgeschwindigkeit steigt.
Knapp 30.000 Anlagen wurden bislang auf dem Festland installiert, auch Wälder sind im Fokus. Betroffen sind auch heimische Fledermausarten, etwa das Große Mausohr (Myotis myotis), durch Kollision mit den Rotoren aber auch indirekt. Die waldspezialisierten Arten meiden Windenergieanlagen über eine Entfernung von mehreren hundert Metern – wenn die Anlagen in Betrieb und die Windgeschwindigkeiten hoch sind.
In hessischen Wäldern nahm die Aktivität von Fledermäusen, die in der Vegetation von Wäldern nach Nahrung suchen, im Umkreis von 80 bis 450 Metern um die Windenergieanlagen mit zunehmender Windgeschwindigkeit um durchschnittlich 77 Prozent ab, wenn die Anlagen in Betrieb sind. Waren die Anlagen abgeschaltet, blieb die Fledermausaktivität dagegen von der Windgeschwindigkeit unbeeinflusst.
Die Rotorbewegungen der Windenergieanlagen erzeugen neben sogenannten Wirbelschleppen auch Lärm. Beides kann sich über mehrere hundert Meter auf Fledermäuse auswirken. Waldfledermäuse, die unter dem Kronendach jagen und vermutlich nicht mit den Wirbelschleppen in Kontakt kommen, könnten von den Geräuschemissionen der Anlagen betroffen sein, auch wenn der Frequenzbereich der Geräusche weit unterhalb der Frequenz der Echoortungsrufe liegt. Vermeiden Waldfledermäuse Geräuschemissionen an den Windenergieanlagen, verlieren sie weiträumig wertvollen Lebensraum.
Insgesamt stellen Windenergieanlagen in Wäldern Fledermäuse vor mehrere Probleme: Sie verlieren Lebensraum durch Rodung beim Bau der Windenergieanlagen und meiden laufende Anlagen. Fledermäuse, die oberhalb der Baumkronen jagen, können an den sich drehenden Rotorblättern verunglücken.
Wie Fledermäuse verschiedene Laute unterscheiden
Lärmemissionen an Windenergieanlagen können auch die feinsinnige Kommunikation von Waldfledermäusen stören. Die Brillenblattnase filtert wichtige Signale aus einer Geräuschkulisse heraus und unterscheidet dabei zwischen Echoortungs‐ und Kommunikationsrufen.
Fledermäuse leben in einer Hörwelt. Sie nutzen ihre Stimme sowohl zur Kommunikation mit ihren Artgenossen, als auch zur Orientierung in der Umwelt. Dazu stoßen sie Ortungslaute im Ultraschallbereich aus, aus deren Echos sie ein Abbild ihrer Umgebung formen. Der südamerikanischen Brillenblattnase gelingt es jedoch, aus einer Geräuschkulisse die wichtigen Signale herauszufiltern und dabei insbesondere zwischen Echoortungs‐ und Kommunikationsrufen zu unterscheiden.
Die Brillenblattnase (Carollia perspicillata) lebt in den subtropischen und tropischen Wäldern Mittel‐ und Südamerikas und ernährt sich dort hauptsächlich von Pfefferfrüchten. Die Tage verbringen die Tiere in Gruppen von 10 bis 100 Individuen in Baumhöhlen und Felsgrotten, nachts gehen sie gemeinsam auf Futtersuche. Dabei verständigen sie sich mit Kommunikationslauten, die in der Kolonie eine ausgeprägte Geräuschkulisse bilden – wie das Stimmengewirr auf einer lebhaften Party. Gleichzeitig nutzen die Fledermäuse ihre Stimme aber auch für die Orientierung in der Umwelt: Für die Echoortung senden sie Ultraschalllaute aus, die von festen Oberflächen zurückgeworfen werden. Aus diesen Echos gewinnen die Tiere ein Abbild ihrer Umgebung.
Wie aber gelingt es der Brillenblattnase, aus einer permanenten Geräuschkulisse die wichtigen Laute herauszufiltern? Ein gängiges Erklärungsmodell besagt, dass das Gehirn laufend Vorhersagen für das nächste Signal macht und auf ein unerwartetes Signal stärker reagiert als auf ein erwartetes. Die Mechanismen dieser Abweichungserkennung (Deviance Detection) sind weitgehend unklar. Bekannt ist, dass die Verarbeitung der Signale nicht erst in höheren Hirnregionen beginnt, sondern bereits im Hirnstamm, der für die Steuerung wesentlicher Lebensfunktionen wie Atmung und Herzfrequenz zuständig ist. Da diese Studien lediglich künstliche Stimuli verwendeten, die für die Tiere keine Bedeutung haben, wurden sie mit natürlichen Kommunikations‐ und Echoortungslauten wiederholt. Wie verhält sich die Abweichungserkennung, wenn anstelle von bedeutungslosen Stimuli solche präsentiert werden, die in der Hörwelt der Brillenblattnasen auch wirklich vorkommen?
Mit zwei haarfeinen Elektroden unter der Kopfhaut wurden die Hirnströme aufgezeichnet – zwar schmerzlos für die Tiere, aber dennoch unter Narkose, da Bewegungen die Ergebnisse verfälschen könnten. Auf Geräusche reagiert das Fledermaushirn auch im Narkoseschlaf. Den Tieren wurden dann entweder Echoortungs‐ oder Kommunikationsrufe vorgespielt, in die mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent der jeweils andere Laut eingestreut war.
An den gemessenen Hirnströmen ließ sich ablesen: Der Hirnstamm verarbeitet Echoortungs‐ und Kommunikationsrufe unterschiedlich. Während seltene Echoortungslaute tatsächlich stärkere Signale hervorriefen als häufige – also Abweichungserkennung zeigten – hatte bei den Kommunikationslauten die Auftrittswahrscheinlichkeit keinen Einfluss auf die Antwortstärke.
Wahrscheinlich werden während der Echoortung schnellere Reaktionszeiten benötigt als bei der Kommunikation mit Artgenossen. Da der Hirnstamm die akustischen Signale als erste Station im Gehirn empfängt, könnte es nötig sein, schon hier die Auftrittswahrscheinlichkeiten von Echoortungsrufen und vor allem deren Echos zu berechnen, damit das Tier Hindernissen rechtzeitig ausweichen kann. Die stärkere Antwort auf die seltenen Rufe entsteht vermutlich durch eine bessere Synchronisation der Neuronen.
Neben Unterschieden in der Tonhöhe kann der Hirnstamm auch noch andere Merkmale der Fledermausrufe wie schnelle Frequenz‐ oder Lautstärkeänderungen für die Abweichungserkennung nutzen. Dies erstaunt, da es sich um ein recht primitives Hirnareal handelt, dessen Rolle bislang eher darin gesehen wurde, Signale vom Hörnerv zu empfangen und an höhere Hirnregionen weiterzuleiten.
Kapitel 2Von Haien im Atemstillstand bis zu den Salamandern der Götter
****************************************************************
Gruppenjagd im offenen Ozean
Die gemeinsame Jagd ist eine interessante Ausprägung des Gruppenverhaltens bei Wirbeltieren. Die Vor‐ und Nachteile liegen auf der Hand: Viele Augen sehen mehr – können also Beute schneller entdecken, und auch die Jagd selbst ist mit vielen Tieren erfolgreicher als allein. Nachteil: Die Beute muss aufgeteilt werden. Die Vielfalt und Komplexität von Strategien der Gruppenjagd sind groß, und man geht davon aus, dass sie hohe kognitive Fähigkeiten von den Raubtieren erfordert. Die Tracking‐Technologie ermöglicht Untersuchungen, ob die Koordination zwischen Raubtieren nicht vielmehr auf einfachen Faustregeln beruht, die keine hohen kognitiven Fähigkeiten voraussetzen.
Der Gestreifte Marlin (Kajikia audax) wird fast vier Meter lang und bis zu 200 Kilogramm schwer. Charakteristisch ist sein speerförmiger Oberkieferknochen, der im Gegensatz zum Schwert des Schwertfischs (Xiphias gladius) nicht flach und scharfkantig, sondern im Querschnitt nahezu rund ist.
Motivation und Hunger statt Rangordnung und Dominanz
Das kollektive Jagdverhalten von Gestreiften Marlinen, die zur Familie der Speerfische gehören, wurde in freier Wildbahn in Baja California Sur im Pazifischen Ozean Mexikos mit hochauflösenden Videokameras verfolgt. Anhand von Körpermerkmalen konnten einzelne Tiere identifiziert und so ihr Jagdverhalten und ihre Rolle in der Gruppe geklärt werden. Bei der Jagd schwammen die Marline in Gruppen um die Beute herum, wobei die einzelnen Tiere abwechselnd angreifen. Der Wettbewerb um die Beute führt zu einer ungleichen Verteilung unter den Räubern: 50 Prozent der am häufigsten angreifenden Marline erbeuteten 70 bis 80 Prozent der Fische. Eine solch ungleiche Verteilung der Beute ist auch von Landtieren bekannt.
Die Ungleichverteilung lässt sich nicht durch aggressives Verhalten, Körpergröße oder Unterschiede in der Jagdeffizienz erklären. Marline, die sich der Gruppe neu anschlossen, haben im Durchschnitt mehr Zugang zur Beute. Möglicherweise waren diese Tiere besonders hungrig und motiviert zu fressen und konnten sich so gegenüber ihren Artgenossen durchsetzen.
Im Gegensatz zu vielen Gruppenjägern an Land existiert bei Marlinen keine strenge Hierarchie. Dominanz, Verwandtschaft und soziale Bindungen bestimmen nicht, wer wann und wie lange Zugang zur Beute erhält. Es gibt im Meer in der Regel keinen großen Kadaver, an dem mehrere Tiere nach der Tötung fressen können. Da es bei vielen kleinen Beutetieren – wie etwa in einem Fischschwarm – kaum möglich ist, einzelne Beutetiere bis zur Sättigung zu monopolisieren, hat sich die soziale Hierarchie als treibende Kraft für die Beuteaufteilung wohl nicht durchgesetzt.
Räuber‐Beute‐Größenverhältnis
Wahrscheinlich ist das Größenverhältnis zwischen Räuber und Beute ein wichtiger Einflussfaktor für unterschiedliches Jagdverhalten bei Wirbeltieren. Bei großen Beutetieren könnte insbesondere die effiziente Auswahl eines Beutetieres aus einer Gruppe und die Eindämmung eines möglichen Stärkevorteils, den das Beutetier aufgrund seiner relativen Größe hat, eine wichtige Rolle spielen. Sind die Beutetiere jedoch deutlich kleiner als die Räuber, wie es bei Fischschwärmen der Fall ist, werden die einzelnen Tiere bereits vor dem Töten unter den Räubern aufgeteilt. In diesem Fall ist die Gruppenjagd vorteilhaft, um die kollektive Verteidigung der Beute zu überwinden und die Manövrierfähigkeit zu erhöhen.
Seelöwen als Beuteparasiten
Manchmal schließen sich den Marlinen Seelöwen (Zalophus californianus) an. Diese profitieren von der Fähigkeit der Marline, die Beute aufzuspüren und an die Wasseroberfläche zu treiben. Bei dieser gemischten Jagd isolieren die Marline zuerst einen kleinen Schwarm und treiben ihn an die Wasseroberfläche. Dann können auch die Seelöwen angreifen. Dabei sind die Seelöwen erfolgreicher als die Marline. Doch obwohl die Seelöwen den Zugang zum Beuteschwarm dominieren und den Marlinen den Zugang erschweren, reagieren die Marline nicht aggressiv auf die mitjagenden Seelöwen. Beuteparasitismus scheint ein wichtiger Faktor zu sein, genau wie an Land.
Hammerhaie – Atemstillstand beim Tauchen
Hammerhaie halten in kaltem, dunklem und tiefem Wasser den Atem an. Sie können ihre Kiemen schließen, um warm zu bleiben, wenn sie in die Tiefe gehen. Indem sie ihre »Schotten dicht machen«, regulieren sie ihre Körpertemperatur, wenn sie vor der Küste Hawaiis, Hunderte Meter unter die Oberfläche tauchen und sich vor Kälte schützen.
Bogenstirn‐Hammerhaie (Sphyrna lewini), die in der Nähe von Hawaii leben, verbringen ihre Tage damit, sich in warmen Oberflächengewässern zu sonnen. Aber nachts jagen sie in den kalten Meerestiefen Hunderte von Metern unter der Oberfläche nach Tintenfischen und anderen Beutetieren. Die Haie können ihre Körperwärme in den kalten Gewässern speichern, indem sie beim Tauchen den Einsatz ihrer Kiemen unterdrücken und im Wesentlichen etwa eine Stunde lang »den Atem anhalten«. Auch Wale und andere tieftauchende Säugetiere halten den Atem an. Bei Hammerhaien wurde das Verhalten aber erstmalig bei tauchenden Fischen beobachtet.
Haie und andere Fische sind Ektothermen, das heißt, ihre Körpertemperatur wird weitgehend durch die Wärme des Wassers um sie herum gesteuert. Fische verlieren und gewinnen viel Körperwärme, wenn sie durch ihre Kiemen atmen, die dem durch das Organ strömenden Wasser Sauerstoff entziehen. Sie wirken wie riesige um den Kopf geschnallte Heizkörper. Deshalb neigen viele Haiarten in den Tropen dazu, sich etwa in den ersten 100 Metern sonnenerwärmtem Wasser nahe der Meeresoberfläche aufzuhalten, wo die Temperaturen um die 26° Celsius schwanken. Doch Markierungen von Bogenstirn‐Hammerhaien – einer Art, die in Küstengewässern überall in den Tropen vorkommt – zeigen, dass diese Haie nächtliche, stundenlange Tauchgänge bis zu 1.000 Meter unter der Oberfläche unternehmen. In diesen Tiefen können die Wassertemperaturen bis zu 5 °C betragen – viel zu kalt für einen tropischen Hai.
Um herauszufinden, wie die Haie solch eisige Temperaturen aushalten, verfolgten Meeresforscher mit kleinen Sensoren am Rücken von Haien, die sich in einer flachen Bucht vor Oahu zur Paarung versammelt hatten, deren Lebensweise. Sie dokumentierten in den nächsten 23 Tagen deren Bewegungen, wie tief sie schwammen und wie sich ihre Innentemperatur veränderte. Fazit: Sie machten V‑förmige Tauchgänge Hunderte von Metern in die Tiefe, bevor sie »wie eine Rakete« direkt wieder nach oben schossen, doch die Körpertemperatur veränderte sich kaum. Erst als sie in einer Tiefe von rund 290 Metern, wo das Wasser etwas kühler als an der Oberfläche ist, ihren Aufstieg verlangsamten, sank diese um durchschnittlich 2,8 Grad Celsius.
Die Fische mussten wohl die meiste Zeit des Tauchgangs ihre Kiemen schließen, um ihre Wärme zu bewahren. Erst als die Haie in eine temperaturtechnisch sicherere Tiefe zurückgekehrt waren, konnten sie diese reaktivieren und nahmen zum ersten Mal seit etwa einer Stunde wieder Sauerstoff, saugten dabei kaltes Wasser auf. Das Festhalten ihrer Wärme beim Tauchen hilft Haien offensichtlich, sich in der Tiefsee schnell fortzubewegen.
Was war zuerst da – Schwimmblase oder Lunge?
Haben Haie eine Schwimmblase, die ihnen wie den meisten anderen Fischen dabei hilft, im Wasser zu schweben? Diese Frage sorgte vor rund 150 Jahren noch für hitzige Diskussionen. Bereits im Jahre 1868 diskutieren Charles Darwin und Ernst Haeckel ausführlich über ein mögliches Schwimmblasen‐Rudiment bei Haien. Ausschlaggebend für ihre Diskussion ist die Forschung von Haeckels damaligem Assistenten Nikolai Nikolajewitsch Miklucho‐Maclay. Der russisch‐stämmige Wissenschaftler, der später vor allem als Ethnologe Berühmtheit erlangte, begleitete seinen Lehrer im Herbst 1866 auf eine Forschungsreise auf die Kanarischen Inseln. Dort untersuchte er unter anderem die Gehirne von Haien und entdeckte dabei eher zufällig hinter den Kiemenöffnungen, oben im Übergang zum Darmbereich der Tiere, eine Ausstülpung. Dieses Gebilde interpretierte Miklucho‐Maclay als Rudiment einer Schwimmblase, die bei den Vorfahren aller Wirbeltiere vorhanden gewesen sein musste. Haeckel war begeistert von dieser Entdeckung, da er davon ausging, dass Haie ursprüngliche Wirbeltiere seien, aus denen die Knochenfische, die Lungenfische und später die Landwirbeltiere hervorgegangen wären. Somit wäre die Schwimmblase evolutionär vor der Lunge entstanden.
Die Entdeckung teilte er in einem Brief seinem von ihm verehrten Kollegen Charles Darwin mit, der am 6. Februar 1868 allerdings eher skeptisch antwortete: »Ich verstehe nicht ganz, was Sie mir über seine Entdeckung der Schwimmblase erzählen […].« Da der Brite in väterlichem Ton »Mikluska« statt »Miklucho« schrieb, blieb der Wissenschaftsgeschichte die Verbindung zu Haeckels Assistenten lange verborgen. Darwin ging davon aus, dass die Lungenfische ursprünglich seien und sich alle Wirbeltiere – auch die Knorpelfische, zu denen die Haie gehören – daraus entwickelt hätten. »Entsprechend war für Darwin die Lunge das ursprüngliche Gas‐Organ. Doch Haeckel sollte mit seinem Stammbaumentwurf weitestgehend recht behalten, obwohl die Haie seit dem Ursprung aller Wirbeltiere natürlich auch eigenen Veränderungen ausgesetzt waren.
Dies war jedoch nicht der einzige Streitpunkt: Die von Miklucho‐Maclay entdeckte Ausstülpung hielt Darwin nicht für eine rudimentäre Schwimmblase, sondern für eine undifferenzierte Struktur, aus der sich evolutionär einmal eine solche ausbilden könnte. Heute sind sich die Forschenden einig, dass Darwin mit dieser Einschätzung recht hatte.
Dennoch ein Beleg dafür, welch wissenschaftliches Vermächtnis der junge Russe hinterlassen hat und welchen Einfluss er in wenigen Forschungsjahren – er starb im Alter von 41 Jahren – auf die Geschichte der Zoologie ausgeübt hat.
Lunge oder Schwimmblase – das ist hier die Frage
Doch was genau hatte Haeckels Assistent da entdeckt? Querschnittabbildungen von Hai‐Embryonen und die Erkenntnisse aus 100 Jahren Forschung, die nach dem Briefwechsel einsetzte, bestätigen: Haie und andere Fische atmen durch Kiemen, die im Inneren mit Kiemensäcken verbunden sind. Fünf Kiemenöffnungen auf jeder Seite sind heute bei Haien üblich, ihre Vorfahren hatten möglicherweise mehr, weshalb die heutigen Hai‐Embryonen noch einige undifferenzierte Kiemensäcke als Anlagen aufweisen. Sie sind nur als kleine Fortsätze zu sehen, die sich nicht zu Kiemen umbilden, sondern nur nach verschiedenen Seiten hin aussacken. Ein solches Gebilde hat Miklucho‐Maclay auch noch in ausgewachsenen Haien gefunden.
In der Evolution haben sich aus den embryonalen Fortsätzen Lungen oder Schwimmblasen entwickelt. Die Beschäftigung mit dem über 150 Jahre alten Briefwechsel führte auch zu neuen Überlegungen, warum sich nur eines der beiden Organe jeweils ausbildete und es nicht etwa Tiere gibt, die sowohl Schwimmblase als auch Lungen haben. Eventuell hatte das mit dem verfügbaren Platz in der Körperhöhle zu tun, der wiederum mit den Lebensbedingungen der Tiere verbunden ist. Fische beispielsweise, die in offenen Gewässern schwimmen, sind im Querschnitt eher vertikal ausgerichtet, was im oberen Bereich ihres Rumpfes mehr Platz lässt, in dem sich eine unpaare Schwimmblase, die vorrangig eine hydrostatische Funktion übernimmt, ausdehnen kann. Fische dagegen, die häufiger am steinigen oder bewachsenen Grund von flachen Gewässern leben, bilden eher eine zweiflüglige Lunge aus. Die Flossen sind mehr in die Breite angelegt und schaffen so im Inneren Platz für die Ausbildung der seitlichen Atmungsorgane aus zwei der unteren embryonalen Aussackungen.
Genetische Stabilität: zweischneidiges Schwert
Haie existieren seit Millionen von Jahren, erkranken selten an Krebs und reagieren empfindlich auf ökologische Veränderungen. Eine Erklärung liegt in den Genen. Seit etwa 400 bis 500 Millionen Jahren bevölkern sie die Weltmeere. Während sich unser Planet und viele seiner Bewohner in dieser Zeit mehrfach massiv verändert haben, bildet diese ursprüngliche Gruppe der Wirbeltiere eine gewisse Konstante, hat sich ihr grundsätzliches Erscheinungsbild kaum gewandelt. Sie können die niedrigste Mutationsrate zwischen den Generationen aufweisen, die bislang bei Wirbeltieren nachgewiesen wurde.
Untersuchungen an Epaulettenhaien
Epaulettenhaie (Hemiscyllium ocellatum) wurden vor der Nordostküste Australiens gefangen und deren Mutationsrate innerhalb eines Haistammbaums genetisch bewertet. Zuerst wurde ein hochwertiges Referenzgenom erstellt und die gesamten Genome der Eltern und anschließend der neun Nachkommen sequenziert, um neue Mutationen zu entdecken, die in den Nachkommen auftreten. Fazit: Mit einer geschätzten Mutationsrate von 7×10−10 pro Basenpaar pro Generation weisen sie die niedrigste Mutationsrate auf, die bislang bei Wirbeltieren verzeichnet wurde. Sie ist damit zehn‐ bis zwanzigmal niedriger als bei Säugetieren.
Niedrige Mutationsrate: zweischneidiges Schwert
Haien wird schon lange eine außergewöhnlich niedrige Krebsrate nachgesagt. Daran könnte die niedrige Mutationsrate entscheidenden Anteil haben. Was zunächst nach guten Neuigkeiten für die Tiere klingt, bringt aber auch einige Probleme mit sich. Mutationen sind von entscheidender Bedeutung, da sie die genetische Variabilität innerhalb von Populationen erhöhen und so die Anpassung an neue Bedingungen und den evolutionären Wandel ermöglichen. Da sich Haie nur sehr langsam weiterentwickeln, besteht die Gefahr, dass sie ökologischen Belastungen wie Überfischung und Lebensraumverlust nicht standhalten können.
Haipopulationen erleben weltweit teils dramatische Einbrüche. Von rund 530 bekannten Haiarten gelten bereits mehrere als akut vom Aussterben bedroht. Besonders bedroht sind sie durch Veränderungen ihres Lebensraums, beispielsweise durch die Erwärmung der Meere oder den Beifang in der Fischerei. Allerdings wird auf Haie auch aktiv Jagd gemacht, etwa zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln gegen Krebs – natürlich ohne wissenschaftliche Basis.
Evolution: Bereits Haie schmeckten Bitterstoffe
Menschen und Haifische teilen Rezeptoren für bittere Substanzen, obwohl sich die evolutionären Wege vor fast 500 Millionen Jahre trennten. Ein Geschmacksrezeptor für Bitterstoffe wurde in zwölf verschiedenen Knorpelfischen (Haie und Rochen) entdeckt. Der Rezeptor gehört zu den sogenannten Typ 2 Geschmacksrezeptoren (T2R), die auch bei Menschen dafür sorgen, bittere und potentiell giftige Nahrungsstoffe wahrzunehmen. Bisher hatte man angenommen, dass solche Rezeptoren nur in Wirbeltieren mit Knochen vorkommen.
Hai‐Genome sind relativ groß, bislang war die Sequenzierung aufwendig und langwierig. Mittlerweile sind die Techniken so ausgereift, dass zunehmend mehr Knorpelfische gensequenziert sind und die Suche nach Bitterstoffrezeptoren bei den Knorpelfischen erleichtert ist. Fazit einer Analyse: Zwölf von siebzehn untersuchten Knorpelfischgenomen enthielten Gene für die Typ 2 Geschmacksrezeptoren, wobei in jeder Spezies nur ein einziges T2R‐Gen vorhanden war. Dieses einzelne Gen wurde T2R1 benannt. Die Tatsache, dass das Geschmacksrezeptor‐Gen nur einzeln vorlag, spricht dafür, dass es sich dabei um die Urform dieser Bittergeschmacksrezeptoren handelt, die nicht durch Genverdopplung und nachfolgende unterschiedliche Spezialisierung der resultierenden Rezeptoren verändert wurde.
Die Ergebnisse ermöglichen neue Einblicke in die Evolution dieser Rezeptoren: Wir können fast 500 Millionen Jahre auf den molekularen und funktionalen Ursprung einer ganzen Familie von Rezeptoren für Bitterstoffe zurückblicken. Denn so alt ist der letzte gemeinsame Vorfahre von Knorpel‐ und Knochenfischen. Das T2R1‐Gen des Bambushais (Chiloscyllium plagiosum) und des Katzenhais (Scyliorhinus canicula) wurden zudem in Labor‐Zelllinien eingebracht. Die beiden Haifischarten können auch dem Menschen bekannte Bitterstoffe wie Colchicin oder Gallensäure wahrnehmen. Ein Screening von vierundneunzig menschlichen Bitterstoffen identifizierte elf Stoffe, die auch die Haifischrezeptoren aktivieren konnten. Manche dieser elf Stoffe aktivieren auch Bitterrezeptoren des »lebenden Fossils« Quastenflosser (Coelacanthiformes), einer alten Knochenfischart – ein erstaunliches Ausmaß an Konservierung dieser Funktion durch die gesamte Evolution der Wirbeltiere hindurch.
Urzeithai Megalodon – anders als gedacht
Der gigantische, mindestens 15 Meter lange, ausgestorbene Urzeithai Megalodon, der vor etwa 15 Millionen Jahren erstmals auftauchte und vor 3,6 Millionen Jahren ausstarb, ist eine Ikone der Urzeit. Bekannt für seine großen Zähne, war er einer der größten marinen Fleischfresser überhaupt und hatte bedeutenden Einfluss auf die Meeresökosysteme. Um seine Biologie und damit auch sein Verhalten besser zu verstehen, ist die korrekte Rekonstruktion seiner Körperform von entscheidender Bedeutung. Doch von diesem Hai sind zwar Zähne und Wirbel, aber keine vollständigen Skelette erhalten. Dennoch war der ikonische Hai Megalodon (Otodus megalodon), entgegen bisheriger Annahmen, wesentlich schlanker als der Weißen Hai – und auch seine Lebensweise unterschied sich von diesem.
Was bisher geschah
Die Tatsache, dass Megalodon wie der Weiße Hai seine Körpertemperatur teilweise regulieren konnte (»regionale Warmblütigkeit«) und Ähnlichkeiten in der Zahnform aufwies, galt lange Zeit als Argument dafür, dass er auch in seiner Körperform dem modernen Weißen Hai ähnlich gewesen sein könnte. Früher vermutete man, dass Megalodon aufgrund seiner angenommenen Gestalt ein schneller Schwimmer war und den heutigen Makrelenhaien – den sogenannten Lamniden – ähnelte, zu denen auch der Weiße Hai gehört. Deshalb wurde der Weiße Hai (Carcharodon caracharias) als Modellart für die Interpretation der Lebensweise und Gestalt von Megalodon herangezogen. Mithilfe einer teilweise erhaltenen Wirbelsäule von Megalodon und einigen Exemplaren heutiger Lamniden konnten nun die 2D‐ und 3D‐Rekonstruktionen der Körperform von Megalodon neu bewertet werden.
Wie die Geschichte weitergeht
Die Verwendung einer unvollständigen Wirbelsäule ohne weitere Skelettelemente wie den Schädel und der Vergleich mit einem CT‑Scan eines jungen Weißen Hais ohne Berücksichtigung ontogenetischer Veränderungen, um die Körperform von Megalodon und damit biologische Aspekte zu rekonstruieren, sind fehleranfällig. Trotz der Unzulänglichkeiten der bisherigen Studien lieferten diese bereits einen wichtigen Hinweis auf die Körperform von Megalodon, nämlich auf die im Vergleich zum Weißen Hai langgestreckte Gestalt.
Körperform und Lebensweise neu interpretiert
Der anatomische Vergleich der Wirbelsäulen heutiger Makrelenhaie mit denen von Megalodon zeigt, dass der urzeitliche Riesenhai noch länger und schlanker war. Kombiniert ergibt sich das Bild eines vergleichsweise schlanken und langen, regional warmblütigen, eher langsam schwimmenden Top‐Prädators, der zumindest eine ähnliche, vielleicht sogar höhere trophische Position einnahm als der heutige Weiße Hai.
Obwohl Megalodon fast 12 Millionen Jahre lang unangefochten an der Spitze der Nahrungskette stand, starb er vor etwa 3,6 Millionen Jahren aus. Klimatische Veränderungen, aber auch die heutigen Weißen Haie – sie erreichen vermutlich schneller ihre Geschlechtsreife – wurden ihm möglicherweise zum Verhängnis. Das Verständnis des Erfolgs, aber auch des Aussterbens solcher Raubfische ist von großer Bedeutung, da es Rückschlüsse auf die Zukunft der heutigen Top‐Prädatoren zulässt, die für das ökologische Gleichgewicht der Ozeane unverzichtbar sind.
Grasfrosch: mit Totstellen Männchen loswerden
Nach dem Motto »nein heißt nein« können Grasfroschweibchen (Rana temporaria), entgegen vorherigen Annahmen, Männchen durch unterschiedliche Abwehrverhalten ablehnen. Das Spektrum reicht vom Drehen des Körpers, »Lass‐mich‐Los‐Grunz«‐Rufen und wenn alles nichts hilft: tot stellen!
Als »explosiv« ablaichende Art haben Frösche oder Kröten eine sehr kurze Fortpflanzungszeit. Das Brutgeschehen beschränkt sich im zeitigen Frühjahr auf oft wenige Tage bis zwei Wochen, an denen sich Hunderte bis Tausende von Tieren am Teich sammeln. Da Grasfroschweibchen älter werden müssen, um sich fortzupflanzen und dies dann oft nicht jedes Jahr tun können, die Männchen sich aber jährlich am Teich einfinden, sind letztere in der großen Überzahl und konkurrieren um das seltenere Geschlecht. Dabei sind sie nicht wählerisch und umklammern mit großer Kraft alles, was sich bewegt. Wird ein anderes Männchen umklammert, ruft dieses, und »reklamiert« den Fehler. Bislang nahm man an, dass sich die Weibchen in diesen Laichgesellschaften nicht gegen die Nötigung durch die Männchen wehren können. Klammern sich viele Männchen um ein Weibchen, kommt es zur Formierung eines »Paarungsballs«, in dem das Weibchen sogar sterben kann.
Die Weibchen haben aber auch Möglichkeiten sich zu wehren. Dazu nutzen sie ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Häufiges Verhalten, um dem Griff des Männchens zu entkommen: das Drehen des Weibchens um die eigene Körperachse. Zudem können die Weibchen zwei verschiedene Rufe äußern: einen tieferen, niederfrequenten Grunz‐Laut, der den »Loslass«‐Ruf des Männchens imitiert, und einen höherfrequenten Quietsch‐Laut, bei dem nicht sicher ist, was er genau bedeutet. Die Krönung der Abwehrreaktion: eine tonische Unbeweglichkeit, gemeinhin als Totstellen bezeichnet, bei der die Weibchen ihre Arme und Beine steif von ihrem Körper ausstrecken und solange unbeweglich bleiben, bis das Männchen loslässt.
Kommunikation geht unter die Haut
Frösche und Kröten kommunizieren akustisch. Es gibt jedoch immer mehr Hinweise darauf, dass zumindest einige Froscharten auch andere Formen nutzen, wie zum Beispiel visuelle oder chemische Signale, wie sich an Säbelzahnfröschen (Odontobatrachidae)





























