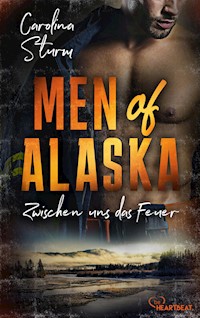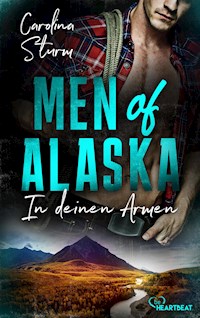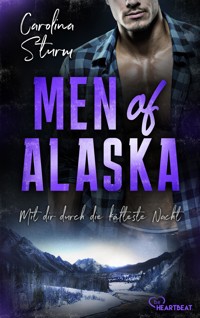
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knisternde Romance in der Wildnis Alaskas
- Sprache: Deutsch
Für Charlie gibt es nichts Schöneres, als mit dem Schlitten und ihren Huskys in den Weiten Alaskas die wohltuende Ruhe der Natur zu genießen. Doch damit ist es vorbei, als ihr Highschool-Schwarm Tyler plötzlich wieder in der Stadt auftaucht. Nach dem tragischen Unfall seiner Frau ist der gefeierte Eishockeystar in seine Heimat zurückgekehrt - mit seiner traumatisierten Tochter Melissa, die kein Wort mehr mit ihrem Vater spricht. In seiner Verzweiflung sucht Tyler mit ihr Charlies Huskyfarm auf, weil er sich erhofft, dass das Zusammensein mit den Hunden bei Melissas Trauerbewältigung helfen könnte. Charlie merkt, wie tief die Gräben zwischen Vater und Tochter sind, und versucht alles, um die beiden einander wieder näherzubringen. Doch womit Charlie nicht gerechnet hat, sind ihre Gefühle für Tyler, die stärker sind als je zuvor. Immer tiefer lässt sie sich in seinen Bann ziehen, bis die Schatten der Vergangenheit sie beide einholen ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Er ist wieder da
Daddy-Esel und Tochter-Esel
Von Croissants und Stehlampen
Der falsche Riggs
Wegen mir
Das kann ja heiter werden
Diese Frau ist anders
Impulsiver Hornochse!
Nasenspitze an Nasenspitze
Nichts als Schwärmerei
Nie. Wieder.
Er ist schuld!
Ich hab dich lieb
Dieses Gefühl …
Die Kälte in mir drin
Es war nur ein Kuss
Nur der Wind
Ein unmoralisches Angebot
Ich bin kein Arschloch. Nicht so eins.
Was ich will … bist du.
Ich sehe dich
Spiel und Realität
Ohne Hoffnung
Familie und andere Katastrophen
Warum bin ich hier?
Verlieb dich bloß nicht!
Vertrau mir
Von Himmel und Hölle
Über den Abgrund
Mein Kind!
Und dann ist alles still
Schwarz
Nicht stark genug
Verloren
Überraschung
Ich kann dich nicht lieben
Aber du tust es
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Für Charlie gibt es nichts Schöneres, als mit dem Schlitten und ihren Huskys in den Weiten Alaskas die wohltuende Ruhe der Natur zu genießen. Doch damit ist es vorbei, als ihr Highschool-Schwarm Tyler plötzlich wieder in der Stadt auftaucht. Nach dem tragischen Unfall seiner Frau ist der gefeierte Eishockeystar in seine Heimat zurückgekehrt – mit seiner traumatisierten Tochter Melissa, die kein Wort mehr mit ihrem Vater spricht. In seiner Verzweiflung sucht Tyler mit ihr Charlies Huskyfarm auf, weil er sich erhofft, dass das Zusammensein mit den Hunden bei Melissas Trauerbewältigung helfen könnte. Charlie merkt, wie tief die Gräben zwischen Vater und Tochter sind, und versucht alles, um die beiden einander wieder näherzubringen. Doch womit Charlie nicht gerechnet hat, sind ihre Gefühle für Tyler, die stärker sind als je zuvor. Immer tiefer lässt sie sich in seinen Bann ziehen, bis die Schatten der Vergangenheit sie beide einholen …
Carolina Sturm
MENofALASKA
Mit dir durch die kälteste Nacht
Roman
Die Liebe richtet nicht.Die Liebe fühlt.Sie nimmt uns so, wie wir sind.Mit all unseren Fehlern und Makeln.
Dieses Buch ist für dich.Für deine Fehler und deine Makel.
Er ist wieder da
Charlie
Einsamkeit. Nichts als der blaue Himmel über mir. Die gleißenden Strahlen der Sonne. Das Hecheln der Hunde, das sich mit meinem Atem und dem Geräusch der Kufen im Schnee vermischt.
»Gee!« Meine Stimme hallt durch die Wildnis, und Banshee drängt nach rechts. Ihr Fell löst sich vor meinen Augen auf, wird eins mit dem Weiß der Natur, dem hellen Licht, und in Momenten wie diesem treibt es mir ein Lächeln aufs Gesicht, wie sehr die Hündin und ihr Name zusammenpassen. Lediglich ihre Augen und die dunkle Nase verhindern, dass sie zum Geist wird, aber beides bekomme ich von meinem Platz aus nicht immer zu sehen.
»Easy!«, rufe ich und bin bereits mit einem Fuß auf der Bremse, damit die Zugleine, die den Schlitten mit meinen Hunden verbindet, auch auf dem abschüssigen Teil der Piste gespannt bleibt.
Geschafft. Wir haben den kleinen Abhang mit Bravour gemeistert, und meine Leithündin jault einmal auf, als wolle sie die anderen für ihre gute Leistung loben. Banshee weiß, dass wir heute eine Meute junger Wilder dabeihaben – Baxter und Steel laufen zum ersten Mal vor dem Schlitten und auch für Amy und Gwendolyn ist dieser Ausflug noch alles andere als Routine. Aber genau wie ich vertrauen sie auf die Erfahrung von Banshee und auch Knox, der als Co-Leithund neben ihr eingespannt ist.
Ich atme tief durch, entspannt und glücklich, und recke mein Gesicht der wärmenden Sonne entgegen. Na gut, wärmend ist relativ, denn die Temperaturen liegen tagsüber noch immer weit unter dem Gefrierpunkt. Aber die Tage werden jetzt spürbar länger und der Schnee hat die perfekte Beschaffenheit für meine Hunde.
Ich liebe diese Zeit des Jahres, wenn der strengste Winter vorbei, der Frühling aber noch weit genug entfernt ist. Wenn die Schneestürme immer seltener werden und die ständige Dunkelheit hinter uns liegt. Natürlich hat es auch etwas für sich, mit einem guten Buch auf der Couch zu lesen oder sich die langen Abende mit unseren Freunden bei Gesellschaftsspielen zu vertreiben, wobei der Gedanke an Letzteres mich tief seufzen lässt. Kirima. Sie fehlt mir.
Meine beste Freundin, einer der wenigen Menschen, die ich nach dem Unfall noch in meiner Nähe ertrug. Doch wie die meisten jungen Leute verließ sie Nenana für ihr Studium und kam nicht mehr zurück. Ich kann ihr beim besten Willen keinen Vorwurf daraus machen – als Anwältin würde sie in unserem kleinen Kaff sicher nur Däumchen drehen –, doch auch das größte Verständnis hilft nicht gegen die Wehmut, die mich beschleicht, sobald ich an Kiri denke.
Seufzend schüttle ich die beklemmende Enge von mir und konzentriere mich wieder ganz auf mein Gespann. Nein. Kein Job der Welt und nicht einmal Kiri würden mich von hier fortkriegen. Mein Platz ist hier – in der Natur und bei meinen Hunden.
Ein kleines Stück führt uns der Trail noch durch den Wald. Vorbei an Tannen, deren Äste unter dem Neuschnee der letzten Woche noch immer tief herabhängen, und dann bricht sie wieder hervor, die Sonne. Schickt ihre Strahlen über die weite Ebene und geleitet uns nach Hause. Die Hunde jaulen, werden noch einmal schneller in freudiger Erwartung auf einen leckeren Snack und Streicheleinheiten im Stroh. Auch ich lächle, als ich Dad winkend im Hof stehen sehe.
»Na? Wie haben sie sich geschlagen?«, fragt er, als ich das Gespann zum Stillstand gebracht habe, und krault Banshee zwischen den Ohren.
Ich steige vom Schlitten, den ich vorsichtshalber an einem Pfosten festmache, ehe ich meinem Vater helfe, die Hunde abzuschirren. Vor allem Baxter hüpft und bellt, als wolle er noch einmal los, aber für heute ist Feierabend. »Gut, Dad. Sehr gut sogar. Hältst du die Hunde fest? Ich sollte Bax zuerst losmachen, ehe er noch die anderen verrückt macht.«
Lachend schnalle ich den jungen Rüden ab und bringe ihn in das große Freigehege, in dem die Hunde sich nach einer Tour auslaufen und zur Ruhe kommen können. Dann hilft Dad mir mit den anderen, während Banshee und Knox die Zugleine gespannt halten und brav warten, bis auch sie an der Reihe sind. Die zwei sind wirklich Gold wert. Ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen, traben sie zu dem Lager aus Stroh, das Dad bereits vorbereitet hat, und neben dem Näpfe mit Wasser bereitstehen. Erst als jeder Hund getrunken und ich Streicheleinheiten und Kaustreifen verteilt habe, klopfe ich mir selbst den Schnee von den Klamotten. Meine Wangen spannen von der Kälte, doch der Blick auf meine zufriedenen Tiere wärmt mich von innen.
»Du wirst nicht erraten, wer wieder in Nenana ist.« Dad hat die Leinen im Schlitten verstaut und wartet an der Tür des Auslaufes auf mich. Ah, stimmt. Mom war heute zum Einkaufen im Dorf und hat sicher wieder den aktuellsten Tratsch mit nach Hause gebracht.
»So? Wer denn?«, frage ich, obwohl es mich nicht wirklich interessiert. Denn zum einen bin ich nicht so der gesellige Typ und darum nur selten im Dorf, und zum anderen sehe ich Wolf von der Veranda des Haupthauses trotten. Der große graue Rüde ist mein ein und alles. Mein bester Freund. Seit die Gelenke ihn plagen und er in Rente gegangen ist, wohnt er bei mir im Haus und nicht wie die anderen Hunde im Zwinger. »Hey, mein Großer«, begrüße ich ihn, schlüpfe aus den Handschuhen und versenke meine Finger in seinem Fell. Er brummelt sein Begrüßungsbrummeln und lässt sich mit einem Seufzen gegen meine Beine fallen.
»Tyler Riggs.«
Wollte ich mich gerade noch zu meinem Hund knien, so halte ich nun abrupt inne und sehe auf. Suche im Gesicht meines Vaters nach einer Emotion. Nach irgendetwas, was mir sagt, wie ich reagieren soll. Denn ich selbst weiß nicht, was der Klang dieses Namens, der bis eben noch tief in meiner Erinnerung vor sich hin schlummerte, mit mir macht. Tyler. Riggs.
»Du weißt doch, wen ich meine, Charlie, oder? Roberts Sohn. Der Eishockey–«
»Ich weiß, wer Tyler ist, Dad.« Mit einem Lächeln sinke ich nun doch zu Boden, wo Wolf nur darauf gewartet hat, mir seine feuchte Nase ins Gesicht zu drücken. Es flattert in meinem Magen. Winzig kleine imaginäre Flügelchen schlagen gegen mein Innerstes, so wie sie es schon damals taten, als mein dreizehnjähriges pubertierendes Ich zum ersten Mal erkannte, dass Jungs nicht ausschließlich nur doof sind.
Tyler Riggs. Er war der Schwarm aller Mädchen. Der Wunschschwiegersohn jeder Mutter von hier bis Fairbanks. Hätte es damals schon diese Poster von ihm gegeben, wie ich sie später in diversen Zeitschriften entdeckt habe, ich hätte wohl mein Zimmer damit tapeziert. Ja, auch ich war seinem Charme hoffnungslos erlegen. Diesen tiefbraunen Augen. Dem jungenhaften Grinsen. Und sicher auch ein wenig seinem Ruhm als das Hockey-Talent schlechthin.
Mit einem Seufzen schiebe ich die Erinnerungen an diese Zeit beiseite. Diese unbedarfte Zeit, bevor mein Leben von einem Moment auf den anderen im Chaos versank. »Was treibt ihn zurück nach Nenana?«, frage ich möglichst beiläufig. »Will er Ryan besuchen?«
Mein Vater schnaubt. »Das soll er sich mal trauen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ausgerechnet der ihm einen warmen Empfang bereiten sollte. Unmöglich, diese ganze Geschichte. Wenn du mich fragst, hätte er einfach in Toronto bleiben sollen.«
»New York.«
»Was?«
»In New York, Dad. Tyler spielt schon seit ein paar Jahren nicht mehr in Kanada.«
»Seit wann interessierst du dich denn für Eishockey?«
»Och …« Ich zucke mit den Schultern. Niemand hat behauptet, dass ich mich für Hockey interessiere. Höchstens vielleicht für einen Hockeyspieler. Aber das ist nicht mehr als schnöde Schwärmerei aus Teenietagen. Auch wenn das Kribbeln bis heute nicht ganz verschwunden ist. Jedes Mal, wenn Tyler mir auf irgendeinem Titelbild oder im Fernsehen begegnet, ist es zurück. Und jedes Mal verdrehe ich innerlich die Augen über mich selbst. Schließlich bin ich mittlerweile eine erwachsene Frau, die das Schwärmen längst hinter sich gelassen haben wollte. »Lass uns reingehen, Dad. Ich mache uns einen heißen Kakao, ja?«
Mit angewinkelten Beinen hocke ich vor dem alten Kachelofen, Wolf an meiner Seite und eine Tasse in der Hand. Die Wärme des Ofens und ein leckerer Kakao, das treibt nach so einem Tag die Kälte aus dem Körper. Dazu noch mein Hund, der zusammengerollt neben mir schläft, und der Duft des Abendessens aus der Küche – was will ich mehr?
Die Hände in zwei Topfhandschuhen und eine große dampfende Schüssel balancierend, schwebt Mom durch den Türrahmen. »Ryan hat übrigens angerufen«, bemerkt sie wie beiläufig und stellt die heiße Fracht auf den Esstisch. »Zweimal.«
Ich kenne den Blick, den sie mir über ihre Schulter zuwirft. »Und was wollte er?« Unbeteiligt schwenke ich meine Tasse und betrachte die Schlieren in verschiedenen Brauntönen, die der Strudel in mein Getränk reißt. Ich weiß, was Ryan will.
»Das hat er mir nicht gesagt. Ich soll dich nur lieb grüßen.«
Soso, lieb grüßen. »Na, das hast du ja jetzt getan, Mom. Danke.«
»Nun sei doch nicht so.« Ich rolle mit den Augen. »Und hör auf, die Augen zu verdrehen, junge Lady, das hab ich genau gesehen.«
»Ach, Mama.« Schmunzelnd kraule ich Wolf zwischen den Ohren, stehe auf und folge meiner Mutter mit der Tasse in der Hand in die Küche. »Ich meine doch gar nicht dich. Es ist nur … Ich will nichts von ihm. Wann kapiert er das endlich?« Die nächste dampfende Schüssel in der Hand, dreht Mom sich zu mir – hm, Nudeln. Mein Magen gibt ein freudiges Grummeln von sich.
Sie seufzt. »Du willst von keinem Mann etwas, mein Kind, und langsam mache ich mir ernsthafte Sorgen.« Mit diesen Worten umschifft sie mich geschickt und ich dackle erneut hinter ihr her. Es könnte mir ja egal sein. Ob oder mit wem ich mich treffe, ist schließlich ganz allein meine Entscheidung. Doch da ist dieser dämliche Anflug von schlechtem Gewissen, der mich hinter ihr hertreibt.
»Du machst dir Sorgen, weil ich keine Dates habe?« Ich schüttle den Kopf. »Jetzt mal ehrlich. Machen sich Mütter nicht normalerweise Sorgen, dass ihre Töchter zu viele Männer treffen? Zu lange fort bleiben, trinken und … dann schwanger nach Hause kommen?«
Getroffen zieht sie die Brauen nach oben.
»Na, siehst du?«, kontere ich. »Das kann dir mit mir schon mal nicht passieren.« Und das mit dem Schwangerwerden schon mal gar nicht. Ich schaue auf die Nudeln, auf die ich mich bis gerade eben noch so gefreut hatte, und ziehe mir lustlos einen Stuhl zurück. Der Appetit ist mir vergangen.
»Wer ist schwanger?« Mit großen Augen und breitem Grinsen reibt Dad sich die Hände. Ich habe ihn gar nicht kommen hören.
Aber wenigstens in diesem Punkt scheinen Mom und ich uns einig zu sein. »Niemand!«, rufen wir im Chor. Ich greife nach Dads Teller und befülle ihn mit Nudeln. Das Essen bringt uns hoffentlich auf andere Gedanken.
Doch Mom ist hartnäckig. War sie schon immer. »Ich verstehe einfach nicht, warum du Ryan nicht mal eine Chance gibst. Der Junge ist das Beste, was du hier im Umkreis finden wirst, das sage ich dir.«
»Junge?« Danke, Dad! Er schenkt mir ein Schmunzeln, ehe er meiner Mutter liebevoll eine Hand auf die Schulter legt. »Vivian, Ryan Riggs ist mittlerweile alles andere als ein Junge.« Und an mich gewandt fügt er hinzu: »Allerdings hat deine Mom in dem Punkt recht, dass er eine sehr gute Partie wäre.«
»Dad!« Na toll, jetzt fällt er mir auch noch in den Rücken. »Sagt mir doch gleich, dass ich ausziehen soll.«
»Ach, Charlie.« Mama lässt sich seufzend auf ihren Stuhl sinken. »Du sollst doch nicht ausziehen, aber …«
Es scheppert, als ich meine Portion Nudeln schwungvoll auf den Teller klatsche und selbst zusammenzucke. Ich will nicht, dass mich dieses Gespräch so in Rage bringt, doch da ist dieser Knoten ganz tief in mir drin. Er umschlingt meine Gedärme, ist schon fest mit ihnen verwachsen. Ihn zu bekämpfen hat über all die Jahre an meiner Geduld genagt. Und doch war es vergebens, denn er ist nach wie vor da. Scheint von Tag zu Tag an Gewicht und Zugkraft zu gewinnen, je älter ich werde.
»Nun lass sie doch in Ruhe, Vivi.« Dad tätschelt meine Hand. »Sonst vergraulst du uns noch unser einziges Kind.« Mom brummelt etwas Unverständliches vor sich hin, und auch ich wende meine ganze Aufmerksamkeit dem Essen zu, obwohl ich am liebsten vom Tisch aufstehen würde. Besteckklappern ist das Einzige, was für die nächsten Minuten durch das Esszimmer hallt, und auch, als ich Mom danach helfe, alles wieder in die Küche zu tragen, reden wir kein Wort. Mehr als einmal bin ich versucht, sie einfach in den Arm zu nehmen, aber Stolz und mein Dickkopf, den ich übrigens von ihr geerbt habe, halten mich davon ab. Ich brauche keinen Mann. Ich will keinen Mann. Und das soll sie endlich einsehen. Denn daran, dass irgendwann eine kleine Fee angeflogen kommen wird, die alles ungeschehen macht, glaube ich schon lange nicht mehr.
Da schwingt meine Mutter plötzlich herum. »Ich mache mir doch nur Gedanken, Charlie, verstehst du das nicht?« Schaum tropft vom Spülschwamm in ihren Händen auf den Boden, doch das scheint sie gar nicht wahrzunehmen. »Du bist so eine wunderhübsche junge Frau. Die Männer stehen Schlange, um mit dir ausgehen zu dürfen, aber du verbringst lieber jeden Tag mit deinen Hunden. Ich weiß, dass sie alles für dich sind, aber …« Plitsch. Das zweite Schaumhäubchen landet in der Lache des ersten, da pfeffert sie den Schwamm mit einem Laut der Verzweiflung in die Spüle. »Mäuschen, liegt es an den Männern? Magst du vielleicht lieber …« Mom räuspert sich und schaut hilfesuchend zur Decke. »Frauen?« Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. »Ich meine, das wäre nichts Schlimmes! Wirklich. Dein Dad und ich, also … wir kämen damit schon klar. Denke ich. Du kannst es mir also ehrlich sagen! Wir werden dich nicht verurteilen.«
Verdattert starre ich ihr entgegen. Frauen? Ich pruste los. »Mom!« Herrje, endlich ist mir klar, warum sie so auf dem Thema herumhackt. Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass ich mit meinem Verhalten diesen Verdacht in sie setzen könnte. Und trotzdem bekomme ich das Grinsen nicht aus meinem Gesicht. Es war zu süß, wie sie sich gerade um Kopf und Kragen geredet hat. »Ich bin nicht lesbisch, Mom. Was das Thema betrifft«, ich ziehe die Augenbrauen hoch, »stehe ich eindeutig auf Männer.«
»Und warum dann? Ist es wegen …«
»Mama, bitte«, falle ich ihr ins Wort. Ich habe einfach nicht die Nerven, um mir zum x-ten Mal von ihr anhören zu müssen, dass meine Makel nicht schlimm sind. Dass es in der Liebe nicht um Äußerlichkeiten geht und auch nicht … um Kinder.
Ich verziehe das Gesicht, weil allein der Gedanke daran den Knoten in meinem Bauch weiter anschwellen lässt. Ich weiß das alles. Meine Eltern haben es mir oft genug gesagt. Nur überzeugen konnten sie mich leider nicht, und darum wiegle ich das Thema rasch ab. »Vielleicht ist der Richtige einfach noch nicht vorbeigekommen. Die Auswahl in Nenana ist jetzt auch nicht gerade die größte. Aber«, ich hebe den Zeigefinger, weil Mom schon wieder Luft holt, »Ryan ist es definitiv nicht. Er ist ein lieber Kerl, ganz sicher. Aber er ist nicht der Richtige für mich, okay?«
Sie nickt. Traurig und unbefriedigt, aber sie nickt. »Na gut, ich werde nichts mehr dazu sagen. Aber sollte der Richtige doch noch auftauchen, dann halt ihn fest, ja? Versprich mir das.« Sie zieht mich an ihre Brust. »Ich will doch nur das Beste für dich. Und dein Dad auch.«
»Ich weiß, Mom. Ich weiß.« Dankbar für ihre Liebe drücke ich sie an mich. Den Knoten zu lösen, schafft sie aber trotzdem nicht.
Ich bin nun mal kaputt und keine normale junge Frau, die ausgeht, um sich einen Freund zu suchen. Denn dafür hat der Unfall viel zu viele Spuren hinterlassen. Auf meinem Körper und auf meiner Seele.
Daddy-Esel und Tochter-Esel
Tyler
Die alten Holzstufen knarzen unter meinen Füßen und das Geräusch katapultiert mich um Jahre zurück. Ich verharre, verlagere mein Gewicht nach vorn, nach hinten. Lausche, wie das Knarzen sich verändert und doch immer dasselbe bleibt – ein Klang meiner Kindheit, meiner Jugend. Tief verankert in meinem Bewusstsein und verbunden mit so vielen Erinnerungen.
Ich bin zurück. Ich bin tatsächlich wieder hier in Nenana. Im Haus meiner Tante. Ich war siebzehn, als ich das letzte Mal auf dieser Treppe stand. Siebzehn. Ich hebe den Blick, lasse ihn über die Fotos an der Wand gleiten, und ein trauriges Lächeln legt sich auf meine Lippen. Tante Dorothy hat es schon immer geliebt, unser Leben in Bildern festzuhalten. Überall schleppte sie ihre Kamera mit sich herum, und so schaue ich nun auf Jahre im Zeitraffer. Sorgsam gerahmt und in penibel eingehaltenen immer gleichen Abständen an die Wand gepinnt. Ryan und ich, in dicken Pampers-Hosen vor einer der Maschinen in Dads Firma, die damals noch eine kleine Werkstatt war. Schulfotos, Geburtstage, Weihnachten. Berge von Schnee und mein Bruder und ich mittendrin. Mit Dad.
Ich steige eine Stufe hinab. Knarz. Er hat selten gelacht. Erst recht nicht auf Fotos. So auch nicht auf diesem hier. Die dunklen Augen geradewegs in die Kamera gerichtet, je eine Hand auf unserer Schulter, blickt er mir entgegen, und sofort sind all seine Vorwürfe, all die Enttäuschung über seinen jüngsten Sohn zurück. Ich kann seine Verachtung förmlich spüren. So allgegenwärtig und schmerzhaft, als seien inzwischen nicht vierzehn Jahre vergangen. Ich hebe eine Hand, lasse sie aber kurz vor dem Holzrahmen wieder sinken. Zu lange. Zu lange ist es her und mit nichts wiedergutzumachen.
»Es tut mir leid«, sage ich leise und die Tatsache, dass ich es ihm nie gesagt habe, als er noch lebte, lastet tonnenschwer auf meinem Brustkorb.
»Stimmt es, dass der Weihnachtsmann in Alaska wohnt?« Mein Kopf ruckt in Richtung Küche, wo ich von hier aus nur ihre Füße sehen kann. In pinkfarbenen Stoppersocken baumeln sie von einem der Hocker, die an Tante Dorothys Kücheninsel stehen, und mein Herz setzt für einen Schlag aus. Die Finger um das Geländer gekrallt, stehe ich ganz still, wage es kaum, zu atmen, um den wertvollen Moment nicht mit irgendeinem Geräusch zu zerstören. Ich höre ihre Stimme. Und auch wenn sie nur zu ihrer Großtante spricht und nicht zu mir, ist es wie ein Geschenk. Kostbar und … viel zu selten.
»Ich glaube, da musst du noch ein gutes Stück weiter in den Norden, mein Schatz. Lebt der Weihnachtsmann nicht am Nordpol? Das war zumindest meine letzte Information.« Tante Dorothy versperrt mir den Blick. Tritt vor Melissa und stellt irgendetwas auf die Theke. Ihre Haltung ist gebeugt. Vor zwei Monaten erst hat sie eine neue Hüfte bekommen, was sie aber nicht davon abhält, Lissy und mich nach Strich und Faden zu verwöhnen. »Hast du schon meine Kekse probiert?« Das ist also in der Schüssel, die sie vor Lissy abstellt – Tante Dorys berühmte Cookies. »Ich versichere dir, die sind mindestens so gut wie die der Elfen.«
Wieder baumeln die pinken Socken, dann sehe ich, wie Melissa die Füße verschränkt und sich einen Keks angelt. Die langen blonden Haare schwingen im Takt ihrer Bewegung mit und ich lasse mich auf die Treppenstufen sinken. Mich schmerzt, wie sehr sie ihrer Mutter ähnelt. Jeden Tag aufs Neue. Haare, Augen, alles. Von mir hat sie nichts. Nicht einmal einen Leberfleck.
»Sie ist genauso stur wie du, Tyler. Ihr seid wie zwei Esel. Daddy-Esel und Tochter-Esel. Ganz genau, das seid ihr!«
Gott, Maggie, du fehlst mir.
Aus der Küche höre ich Geschirr klappern, Lissy, die nuschelnd die Kekse lobt und meine lachende Tante. Während ich allein im Halbdunkel auf einer blöden Treppe hocke, das Gesicht in meinen Händen verborgen, und ohne den Hauch einer Ahnung, wie es weitergehen soll. Denn wenn ich ehrlich bin, kam ich nicht nur wegen Melissa hierher. Ich hielt es in New York selbst nicht mehr aus. Die Decke fiel mir auf den Kopf, jeden Tag mehr, den ich nicht zurück aufs Eis durfte.
Dieses beschissene Knie. Selbst jetzt, im Sitzen, pocht es und ich fahre mir mit der Hand darüber. Über den Trümmerhaufen, der einmal meine Kniescheibe war. Ich wurde operiert. Mehrfach. Die Ärzte haben alle Splitter entfernt und durch ein Implantat ersetzt, doch es wollte einfach nicht heilen. Monatelang haben wir alles versucht. Ich, meine Coaches, die Ärzte. Dabei spürte ich selbst am besten, dass alles aussichtslos blieb. Seitdem versuchte ich es zu verdrängen und biss immer wieder die Zähne zusammen. Bis zu dem Tag, an dem das finale Urteil fiel und sie mir sagten, dass ich nie wieder professionell Eishockey spielen würde. Da bin ich ausgerastet.
»Ist es weit bis zum Nordpol, Auntie?«
»Kind, du stellst Fragen. Aber ja, das ist noch weit. Oder was denkst du, warum der Schlitten fliegen kann?«
Ich lehne meinen Kopf ans Geländer. Weiß, worauf das Gespräch dort unten hinauslaufen wird, und schließe die Augen. Diesen Wunsch hatte sie schon, da konnte sie kaum sprechen.
»Früher wollte ich immer mit dem Weihnachtsmann mitfliegen, Tante Dorothy. Und jetzt … Er wüsste bestimmt, wo meine Mom ist, oder? Er kennt doch alle Engel.«
Stille. Nur mein Herz, das sich schmerzhaft zusammenzieht. Auch in der Küche passiert für einen Moment lang nichts und nur zu gut kann ich mir den Blick meiner Tante vorstellen. Da höre ich ihr leises Keuchen, ihre schnellen, schlurfenden Schritte, und als sie ein gequältes »Oh, mein armes Kind« von sich gibt, weiß ich, dass sie Melissa in ihre Arme schließt. Meine Tochter, für die ich nicht mehr bin als ein Fremder. Der Mann, der zwar verantwortlich dafür ist, dass sie geboren wurde, danach aber kaltherzig ihre Familie zerstört und ihr die Mutter genommen hat. So sieht sie es. Sie hasst mich. Ich weiß das, weil es die einzigen drei Worte waren, die sie seit Maggies Tod an mich gerichtet hat. Ich. Hasse. Dich.
Mein Knie ist vergessen. Der Schmerz in meinem Herzen dagegen viel schlimmer, als ich mich auf die Füße ziehe und Stufe für Stufe ins Erdgeschoss schleiche.
Sie will mich nicht sehen. Vermutlich wird sie wieder abhauen, sobald ich im Türrahmen erscheine. Aber sie ist doch mein Kind. Und so steuere ich auf die Küche zu mit nichts im Sinn als dem Wunsch, ihr nah zu sein. Sie trösten zu dürfen. Doch ich habe den Raum noch nicht einmal wirklich betreten, da reißt sie den Kopf hoch. Starrt mich einen Moment lang an mit dieser Zerrissenheit in ihren blauen Augen, schiebt sich aus Tante Dorothys Armen und rutscht vom Hocker. Schnell greift sie noch nach einem Cookie, ehe sie an mir vorbeieilt, durch den Flur und die Treppe hinauf. Da ist es wieder, das Knarzen der Stufen. Unter ihren Schritten, die poltern wie einst meine eigenen. Auch ich habe mich als Kind oft in das Zimmer dort oben am Ende des Ganges geflüchtet, dessen Tür nun krachend ins Schloss fällt.
»Lass ihr Zeit, Tyler. Das wird schon wieder.« Tante Dorothys Hand auf meinem Arm, ihre Stimme in meinem Ohr. Beides tröstet mich nicht.
»Das bezweifle ich, Dory.« Ich drehe mich zu ihr. »Sie hat doch recht. Was soll sie mit mir anfangen?« Und als meine Tante vorwurfsvoll den Kopf schüttelt, füge ich hinzu: »Sie hat zu der Richterin gesagt, dass sie lieber in ein Heim gehen würde, als bei mir zu wohnen. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Ich schon. Ich war dabei. Ich habe es gehört. Dory, meine eigene Tochter gibt mir die Schuld an Maggies Tod. Und Scheiße, ich …«
»Hör auf, Tyler!« Mit einer entschlossenen Handbewegung durchschneidet sie die Luft. Hält ihre Stimme zwar gesenkt, damit Melissa sie nicht hören kann, aber die Vehemenz darin lässt mich verstummen. Wie früher. Meine Tante ist die Sanftheit in Person, aber wenn sie ihre Autorität nach außen kehrt, dann kuscht jeder.
Mit gesenktem Kopf, die Kiefer so fest aufeinandergepresst, dass meine Zähne knirschen, füge ich mich und folge ihrem Fingerzeig, der mich auf den Hocker dirigiert, auf dem Lissy bis eben noch saß. Mit vor Wut pochendem Herzen sehe ich zu, wie sie die Kaffeekanne aus der Maschine zieht und zusammen mit zwei Tassen vor mich stellt. Ich atme tief durch, versuche mich zu beruhigen. Nein, es ist keine Wut. Dieses Gefühl in mir drin ist schlimmer. Resignation. Kapitulation. Emotionen, die ich nicht kenne und nicht begreife. Trotzdem haben sie mich fest in ihren Klauen.
»Melissa ist noch ein Kind.« Dory schenkt Kaffee in beide Tassen. »Und du ein Hitzkopf.« Ich will widersprechen, doch wieder genügt ihr Blick, dass ich auf meinem Hocker zurücksinke. »Wie alt war sie, als Maggie und du euch getrennt habt? Vier? Fünf?«
»Vier. Doch auch davor hat sie mich kaum zu Gesicht bekommen.« Ich spreche zur Arbeitsplatte. Leise. Weil ich den Vorwurf in Dorys Worten hören kann. Und weil mich derselbe quält. »Wir waren doch noch so jung. Ich …«
»Du wolltest nicht Vater werden, stimmt’s?«
»Nicht damals. Nicht so früh.«
Sie schiebt mir die Tasse zu und setzt sich neben mich. »Du bist ein guter Junge, Tyler. Das warst du schon immer.«
Ich schnaube.
»Hast du Maggie denn geliebt? Ich habe sie ja nie kennengelernt.«
Richtig. Das hat niemand hier. Weil ich nie wieder in meine Heimat zurückgekehrt bin. Weil ich die Vergangenheit hinter mir lassen und verhindern wollte, dass meine Frau herausfinden könnte, wen sie wirklich geheiratet hat. Einen Feigling. Einen … Verbrecher.
»Ja«, antworte ich. »Ja, ich glaube schon, dass ich Maggie geliebt habe.« Ihr Lachen. Ihre ausgelassene Fröhlichkeit. Mit ihr war nichts schwer. Kein Ziel unerreichbar. »Aber es hat nicht gereicht.« Weil ich immer nur an mich selbst gedacht habe. An meinen Sport und den Erfolg. Um zu vergessen, warum ich kein Herz mehr habe und nicht mehr fühlen will.
»Eure Liebe konnte nicht gegen das Eishockey bestehen, hm?«
Ich nicke, auch wenn das nur die halbe Wahrheit ist, und lasse zu, dass Tante Dorothy ihre Hand auf meine schiebt. »Und jetzt habe ich auch das verloren.« Gedankenversunken starre ich auf die blaue Tasse vor mir. Dampf steigt daraus empor, doch wirklich wahrnehmen tue ich ihn nicht. Alles ist verschwommen und taub, und ich habe eine Scheißangst, dass dieser Zustand für immer andauern wird.
»Ty?«
»Hm?« Ich sehe auf.
»Du darfst jetzt nicht stehenbleiben. Du musst nach vorne schauen. Da liegt noch so viel vor dir, aber für jeden Weg bedarf es den ersten Schritt. Und den musst du jetzt tun. Für dich und für deine Tochter.« Lächelnd schüttelt Dory den Kopf, wobei die grauen Löckchen, die sich aus ihrer Hochsteckfrisur gelöst haben, um ihr Gesicht schwingen. Früher war ihr Haar fast schwarz gewesen. Wie das ihrer Schwester und auch meins. Ob Mom mittlerweile auch graue Haare hätte? Sie war nur zwei Jahre jünger gewesen als Dorothy.
»Das sagst du so leicht«, entgegne ich und versuche mich an einem Lächeln. Es fühlt sich eher an wie eine Grimasse.
»Natürlich. Weil es die Wahrheit ist. Und die Wahrheit kommt einem immer leicht über die Lippen.«
Gott, nein, das tut sie gewiss nicht. »Es kommt immer darauf an, welche Art von Wahrheit du meinst, Tante Dory.« Denn wenn ich eine Lektion in meinem Leben gelernt habe, dann ist es die Tatsache, dass sie auch zerstören kann. Uns selbst oder jemand anderen. Karrieren oder ganze Leben.
»Ich rede von der Wahrheit, die aus deinem Herzen kommt, Tyler. Hast du Melissa jemals gesagt, wie viel sie dir bedeutet?«
Natürlich!, möchte ich antworten. Mein Mund klappt auch prompt auf, doch ich bringe nichts heraus als Luft. Habe ich es gesagt? Habe ich es wenigstens versucht? »Sie würde mir doch sowieso nicht zuhören.« Resigniert ziehe ich meine Hand aus ihrer und stehe auf. Ich kann nicht stillsitzen, während die Gedanken mich überrollen. Was tue ich hier? Warum bin ich ausgerechnet nach Nenana gekommen? Im Winter! Warum habe ich Melissa in diese Einöde geschleift?
»Sie ist traumatisiert, Ty, nicht taub.« Tante Dorothy hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen, und ich habe ihr das immer hoch angerechnet. Dieser Satz aber schlägt in mir ein wie eine Bombe.
»Denkst du etwa, das wäre mir nicht auch klar?!«, schleudere ich ihr entgegen, so laut, dass wir beide erstarren. Und lauschen. Im Obergeschoss bleibt alles still, doch meine Tante erhebt sich und schließt die Tür.
Seufzend dreht sie sich zu mir. »Tyler. Bitte. Du hilfst damit niemandem. Weder dir noch ihr.«
Ich weiß, was sie meint. Meine Ungeduld. Wenn der Druck in meinem Inneren zu stark wird und ich kein Ventil dafür finde, gehe ich viel zu leicht hoch. Mein Sport war immer dieses Ventil gewesen, doch jetzt … Scheiße. Ich raufe mir die Haare. »Tut mir leid. Ich … Verdammt, Dory, ich bin überfordert. Mit allem. Ich komm doch nicht mal mit mir selbst klar, wie soll ich dann für ein Kind da sein? Sag es mir! Wie?«
Dory lächelt. »Ich muss mich berichtigen. Den ersten guten Schritt hast du bereits getan: Du bist wieder hier.«
Ich schnaube.
»Und bei den nächsten Schritten werde ich dir helfen. Ich habe auch schon eine Idee.«
Von Croissants und Stehlampen
Tyler
»Hundeschlitten? Willst du mich umbringen?« Entgeistert starre ich meiner Tante entgegen. »Dory, ich bin froh, endlich wieder ohne Krücken laufen zu können, da stelle ich mich doch nicht auf einen Hundeschlitten.«
»Du sollst dich da auch gar nicht draufstellen, sondern Melissa. Und ich weiß, dass Charlie auch Schlitten hat, in die man sich ganz bequem hineinsetzen kann. Deinem Bein wird also rein gar nichts passieren.«
Ja klar, ich lasse mich von irgendeinem Typen durch die Winterlandschaft kutschieren. So weit kommt’s noch. Als meine Tante mich jedoch an Lissys großen Wunsch erinnert, einmal den Schlitten des Weihnachtsmannes lenken zu dürfen, zerschellt mein Widerstand an diesem unschlagbaren Argument.
»Weihnachten ist vorbei und einen Santa Claus mitsamt seinen Rentieren kann ich ihr auch nicht herbeizaubern. Aber einen Schlitten. Und Hunde. Lass es auf einen Versuch ankommen, Tyler. Mehr kaputtmachen kannst du damit nicht, oder?«
Ich schweige, denn sie hat recht. In New York habe ich es mit allem probiert, was kleinen Mädchen angeblich gefallen soll. Wahllos kaufte ich irgendwelche Dinge, vom Teddybären bis zur Spielekonsole. Sogar einen blöden Schminktisch mit Glitzerspiegel. Nichts davon hat sie auch nur eines Blickes gewürdigt. Und das Ende vom Lied war, dass der ganze Scheiß jetzt unausgepackt im Trainingsraum meines Penthouses steht. Ich kneife mir mit zwei Fingern in die Nasenwurzel. Das Penthouse. Noch so ein unerledigter Posten auf dem Stapel der Hölle. Ich bin arbeitslos. Zugegeben ein noch recht wohlhabender Arbeitsloser, aber trotzdem werde ich die Wohnung verkaufen müssen. Hab sie eh nie gemocht.
»Und?« Dorys Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. »Was sagst du jetzt zu der Idee?«
Geräuschvoll entlasse ich alle Luft aus meinen Wangen. »Schön. Und wo finde ich … Charlie?« Ich konnte diesen Namen noch nie ausstehen und rolle meine Augen. Charlie. Charles. Oder gar Charlton? Noch schlimmer. Wer tut seinem Kind so etwas an?
»Das ist leicht. Du weißt doch noch, wo eure Firma liegt?« Mein Augenrollen wird zum bösen Blick. »Natürlich weiß ich das«, knurre ich. Ich wollte dort aber nicht hin.
»Die Farm der Lamberts liegt ein Stück weiter den Fluss hinauf. Aus Nenana raus und die zweite Straße links. Von da kannst du es nicht mehr verfehlen, der Weg führt direkt darauf zu.«
Ich trete aus der Haustür und stehe sofort in der Kühlkammer. Zwar scheint die Sonne, doch mein Atem gefriert, kaum dass er meinen Mund verlassen hat. Mit einem unwilligen Brummen ziehe ich die Kapuze meines Parkas noch zusätzlich über die Wollmütze und weiß wieder genau, was ich nicht vermisst habe – die verdammte Kälte. Trockene, alles zu Eis erstarrende Kälte. Als wir vorgestern auf dem kleinen Flugplatz landeten, war es verhältnismäßig mild gewesen. Heute jedoch scheint die Schonzeit vorbei und Alaska schlägt temperaturtechnisch mit allem zu, was es zu bieten hat. Das Thermometer auf Tante Dorys Sideboard zeigte eine Außentemperatur von minus 21 Grad Celsius an, weshalb ich kurz überlegte, doch nicht spazieren zu gehen. Aber ich brauche Bewegung. Muss irgendetwas tun. Und gemessen an der Eiseskälte, mit der mir meine bezaubernde Tochter beim Frühstück begegnete, ist das hier draußen beinahe schon wie Frühling. Die Kniebandage unter der Skihose ziept, aber ich traue mich noch nicht, längere Strecken ohne sie zurückzulegen.
Ein Geräusch zieht meine Aufmerksamkeit zur anderen Straßenseite, wo sich das Rolltor einer Garage in Gang gesetzt hat. Die Hendersons wohnen dort drüben, das haben sie zumindest vor vierzehn Jahren getan. Als der blaue Subaru aber rückwärts auf die Straße setzt, erkenne ich Marks Profil. O Mann, auch er ist ganz schön alt geworden. Seufzend ziehe ich mir die Kapuze tiefer ins Gesicht. Mein Polarexpeditionsoutfit hat auch Vorteile, denn ich habe keine Lust darauf, dass Mark mich erkennt. Und noch weniger auf ein Gespräch. Also ignoriere ich ihn und gehe weiter, als sei er ein Fremder. Was er nach einer so langen Zeit ja auch irgendwie ist, nicht wahr? Oder … eher ich. Ich bin der Fremde in dieser Stadt, und stelle schon wieder infrage, warum ich überhaupt hier bin.
Nenana hat sich kaum verändert. Das Industriegebiet ist gewachsen, das habe ich auf der Fahrt vom Flugplatz hierher gesehen. Als ich nun aber die Main Street entlanglaufe, könnte ich nicht sagen, ob etwas anders ist als damals. Aneinandergereihte Holzhäuser in Braun, Blau und Rot, keines höher als zwei Stockwerke und meist mit weiß umrandeten Fenstern. Alles ist noch, wie es war, wie ich es in meiner Erinnerung mit mir herumgetragen habe. Doch nein, warte. War da drüben nicht Mrs Sanders’ Bäckerei? Ja.
Ich bleibe stehen und ertappe mich beim Grinsen. Mrs Sanders hatte Croissants. Die besten, denn sie hat sie tatsächlich einmal pro Woche selbst gebacken. Ryan und ich standen montags gerne früher auf, um uns vor der Schule eine ganze Tüte voll zu kaufen, und das Wasser läuft mir im Mund zusammen, als ich an diesen unverwechselbaren Geruch denke, wenn wir die Tüte wieder öffneten. Warme Butter und frischer, fluffiger Blätterteig. Ein wenig traurig neige ich den Kopf und betrachte das Schild, das jetzt über dem Eingang hängt. Mollys Bread & Cakes. Hm. Ob die auch Croissants haben? Ich knete meine Fingerspitzen in den Handschuhen – Fäustlinge wären heute eindeutig die bessere Wahl gewesen. Es kribbelt bereits unangenehm unter der Haut, und auch wenn ich Gefahr laufe, dort drin jemandem zu begegnen, den ich kenne, so lockt mich die Aussicht auf einen heißen Kaffee und eventuell ja auch ein Croissant auf die andere Straßenseite.
Der Schnee auf dem Asphalt ist rutschig, festgefahren von Autos und stellenweise glatt. Noch vor ein paar Monaten hätte mir das nichts ausgemacht. Wahrscheinlich hätte ich sogar noch Anlauf genommen und wäre mit einem Lachen darüber geschlittert, doch jetzt setze ich vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Ich will den Heilungsprozess meines Knies nicht noch weiter in die Länge ziehen. Die Kälte allerdings scheint ihm gutzutun, trotz des Fußmarsches habe ich keine wirklichen Schmerzen. Immerhin ein kleiner positiver Aspekt, der es tatsächlich schafft, meine Stimmung zu erhellen. Aber scheiße, meine Finger frieren mir wirklich gleich ab, und so bin ich froh, als ich ohne Sturz die Tür der Bäckerei erreiche.
Stimmengewirr empfängt mich. Fröhliches Lachen, Small Talk und Countrymusik. Die Tür fällt hinter mir ins Schloss, streift erneut das Glöckchen darüber. Zusammen mit seinem hellen Klingeln und meinem Lächeln erkenne ich, dass bis auf den Namen und das Schild an der Wand hier drinnen alles noch beim Alten ist. Okay, das Kuchenangebot in der goldumrahmten Auslage hat eindeutig mehr zu bieten als damals, aber sonst …
Mir wird warm ums Herz. Als sei ich für diesen einen kleinen Moment wieder ein Teenager. Fehlt nur noch, dass Ryan gleich hinter mir hereinkommt. Und tatsächlich. Das Glöckchen klingelt erneut und schon drückt sich die Kante der schweren Holztür in meinen Rücken.
»Hoppla! Oh, Verzeihung! Habe ich Ihnen wehgetan?« Der Klang ihrer Stimme dringt zu mir, während ich mich noch umdrehe, aber nichts als den buschigen Fellrand an einer großen Kapuze erkenne. Rotbraune Strähnen fließen auf einer Seite darunter hervor und Hände in himmelblauen Handschuhen heben sich, schieben die Kapuze zurück, und dann sehe ich in zwei haselnussbraune Augen. Die nächste Strähne fällt ihr in die Stirn, gelöst aus dem Zopf in ihrem Nacken, und mit einem schiefen Grinsen pustet sie sie zurück. Vergeblich, denn gefolgt von einigen Wellen mehr rutschen die Haare geradewegs zurück in dieses hübsche Gesicht. »Darf ich mal vorbei?«, fragt sie und erinnert mich daran, dass sie noch immer in der halb geöffneten Tür steht.
Auch die Fröhlichkeit in den Gesprächen hinter mir hat sich gelegt, stattdessen ruft eine Frau laut: »Tür zu, junger Mann!«
Eilig trete ich zur Seite, während mein Gegenüber mit einem freundlichen »Danke, Mary!« an mir vorbeischlüpft und sich auf dem Fußabtreter den Schnee von den Stiefeln klopft. »Sorry noch mal, ich hab Sie da nicht stehen sehen.« Wieder pustet sie gegen die Strähnen an und sieht dabei so bezaubernd aus, dass ich dem Impuls widerstehen muss, ihr die Haare einfach hinters Ohr zu streichen.
»Nichts passiert«, entgegne ich. Heiß. Es ist plötzlich so heiß hier drin, dass auch ich nach meiner Kapuze fasse und sie mir gleich mitsamt der Mütze vom Kopf streife.
»Cool, wir haben denselben Friseur.«
Äh, was? Verdutzt starre ich ihr entgegen, bis sie grinsend zwischen meinen und ihren Haaren hin- und herzeigt und mir bewusst wird, dass auch meine Frisur mir wild um den Kopf stehen muss. »Tja.« Ich fahre mir mit den Fingern, die ich mittlerweile aus den Handschuhen befreit habe, notdürftig hindurch und lächle ihr entgegen. »Dann haben wir ja was gemeinsam.«
Auch Miss Haselnuss lächelt, sodass sich kleine Grübchen in ihren Wangen bilden. Allerdings nur so lange, bis sie ihre Handschuhe in den Jackentaschen verstaut hat und wieder zu mir aufsieht. Ich kenne ihn mittlerweile zu gut, den Moment, wenn den Leuten klar wird, wer ich bin. So wie gerade diese junge Frau vor mir, deren reine Anwesenheit ein imaginäres Lämpchen über mir aufleuchten lässt, das mich in einen Kegel aus Licht und Wärme zu tauchen scheint. Jedoch beginnt das Lämpchen zu flackern, als sich ihre Augen für einen winzigen Moment weiten und ihr Mund mit den rosigen Lippen aufklappt. Sie hat mich erkannt. Mit Sicherheit. Eigentlich macht es mir nichts aus, ich bin das gewohnt. Auch wenn ich hin und wieder den Umstand verfluche, nicht einfach wie jeder andere Mensch ein Croissant kaufen gehen zu können, ohne Autogramme geben zu müssen. Ob sie auch eins will? Nein. Oder? Aber ich könnte es ihr anbieten und dann heimlich meine Handynummer darunterkritzeln.
»Ja, dann, einen schönen Tag noch. Und schöne Grüße an Ihren Friseur.«
»Aber …« Was? Nein! Nicht weggehen! Zu spät. Miss Haselnuss hat sich bereits umgedreht, steuert auf die Theke zu und nimmt ihr Licht mit sich.
»Das läuft hier alles ein wenig anders als in New York, was, mein Junge?« Eine kräftige Hand auf meiner Schulter, der unverkennbare Duft von »Old Spice« in meiner Nase, dann sehe ich ihm geradewegs ins Gesicht.
»Guten Morgen, Mark.« Ihn hatte ich nun wirklich nicht erwartet, und das schlechte Gewissen plagt mich, weil ich ihn vorhin so geflissentlich ignoriert habe.
»Wusste ich doch, dass ich mich nicht verguckt habe. Meine Augen sind noch immer zuverlässig, musst du wissen.«
Ich nicke mit zusammengekniffenen Lippen, denn er macht es mit seinem Kommentar nicht unbedingt besser.
Doch der alte Kauz setzt noch einen drauf. »Der verlorene Sohn ist also zurück, was? Bisschen spät vielleicht, wenn du mich fragst, aber …« Er schiebt sich an mir vorbei. »Willkommen zu Hause.«
Die Glocke klingelt, kalte Luft wirbelt mir ins Gesicht, dann schließt sich die Tür erneut, nur ich stehe noch immer inmitten des Eingangsbereichs. Marks Worte waren ein Schlag in den Magen. Gezielt und schmerzhaft. Ja, willkommen zu Hause.
Brennend spüre ich die Blicke der Leute auf mir und beginne in meinem dicken Parka zu schwitzen. Ich sehe mich um. Jedem Einzelnen ins Gesicht und suche nach etwas, was mich hier hält, oder zumindest davon abhält, wieder zu gehen. Denn komischerweise will ich das nicht.
Sicher, es wäre die einfachste Lösung. Gehen, packen, mein trotziges Kind in den nächsten Flieger verfrachten und wieder von hier verschwinden. Die Gesichter um mich herum spiegeln allesamt wider, was mir eigentlich längst klar war – ich gehöre nicht zu ihnen, bin kein Teil mehr dieser Gemeinschaft. Dafür hat mein Vater gesorgt, öffentlich und vor aller Welt. Niemand hier würde mir glauben, dass er gelogen hat.
Es war ein Fehler, herzukommen. Mich aus dem Haus meiner Tante heraus und in die Öffentlichkeit zu wagen. Ich sollte gehen, doch stattdessen drücke ich den Rücken durch und suche nach dem einzigen Grund, der mich noch in diesem Café hält. Sie. Die kleine Stehlampe mit den Haselnussaugen. Mein Blick findet sie am Ende der langen Theke, auf ihrem Parker sitzend und über eine Tasse gebeugt. Gedankenverloren kreist sie den Löffel darin, und als ich näher komme, höre ich deutlich, wie Metall gegen Porzellan klirrt.
»Wenn du so weitermachst, schlägst du noch Macken hinein.« Ich lege meinen Mantel über den Hocker neben ihrem, sehe sie aber nicht an, während ich der Bedienung winke und mich setze. Das Klirren ist verstummt und ich weiß, dass sie mich aus diesen Augen betrachtet. Ich spüre es. Jeden einzelnen Blick, mit dem sie mir folgt. Sie kribbeln in meinem Nacken. Auf meinen Armen und Händen. Und als sie mir damit beinahe die Wangen versengt, sehe ich sie an. Geradeheraus und ohne Umschweife stürze ich mich mit Wonne in dieses brodelnde Braun. Will wissen, wie sie darauf reagieren wird und ob ich es noch einmal schaffe, den Schalter zu finden, der sie anknipst. Und ja, sieh an. Miss Haselnuss leuchtet. Sie glüht förmlich. Doch die Sanftheit ist verschwunden. Ihre Augen gleichen nunmehr Spotlights. Mit einem Grinsen, von dem ich ganz genau weiß, dass es seine Wirkung nicht verfehlen wird, strecke ich ihr die Hand entgegen. »Hi, ich bin …«
»… ganz schön von dir überzeugt, ich weiß.« Sie wendet sich ab und schon ist das Klirren zurück. Doch auch wenn sie den Löffel nun weniger fest gegen das Innere der Tasse schlagen lässt, so scheint es in mir auf einmal doppelt so laut zu tönen. Das nenne ich mal eine Abfuhr. Ich war nicht darauf gefasst, dermaßen auf meinen Platz verwiesen zu werden, ziehe aber mit einem anerkennenden Nicken meine Hand zurück.
Sie gefällt mir. Sie imponiert mir. Und hat irgendetwas an sich, das mir die Schwere von der Brust nimmt. Ich habe Lust zu spielen. Zu flirten. Herauszufinden, wie weit ich bei dem kleinen Wildfang wohl gehen kann.
»Kummer?«, frage ich und werfe der Bedienung gleichzeitig mein Sports-Illustrated-Lächeln zu, weil die kleine Blondine zu wissen scheint, wer ich bin und mir schöne Augen macht. Und weil ich in der Spiegelfront hinter der Theke genau gesehen habe, dass Miss Haselnuss uns beobachtet. Ich kann ein Arsch sein, ich weiß. Aber manchmal muss man den Leuten eben die Art von Show bieten, die sie von dir erwarten. Wie war das? Ich kann hier mit meinem Promistatus niemanden beeindrucken? Das wollen wir doch erst mal sehen.
»Was darf ich Ihnen bringen, Mr Riggs?« Die Bedienung – auf dem kleinen Namensschild, das sich in dem Sammelsurium aus bunten Halsketten verfangen hat, kann ich den Namen Hannah entziffern – strahlt mir entgegen. Sie scheint ein nettes Mädchen zu sein, vielleicht Anfang zwanzig, und ihr Augenaufschlag hat echt Potenzial, doch ich schiele heimlich an ihr vorbei, während ich höflich und zuvorkommend eine heiße Schokolade mit einer Extraportion Sahne bestelle.
Sie guckt. Nach außen hin voll und ganz auf ihre Tasse fixiert, sehe ich genau, wie ihr Blick regelmäßig nach oben huscht. In den Spiegel, zu Hannah und mir. Und als ich der Bedienung ein Kompliment für ihren außergewöhnlichen Halsschmuck mache, rollt sie die Augen.
Ich krieg dich, Hazel, wart’s nur ab. Aber … o Mann, was mache ich hier eigentlich? Wem will ich was beweisen? Mir, dass ich es trotz allem noch draufhabe? Oder der fremden Frau neben mir, dass ich ein vollkommenes Arschloch bin? Ich vermute Letzteres, denn Hazel zeigt mir demonstrativ die kalte Schulter.
»Hey«, wende ich mich erneut an meine Nachbarin. »Tut mir leid, okay?« Sie ignoriert mich und trotzdem wage ich einen weiteren Vorstoß. Meine Finger stupsen gegen den weichen Mohair ihres Pullis. »Darf ich noch mal von vorn anfangen?«
Ein warnender Blick aus dem Augenwinkel.
»Ich bin Tyler. Und ja, du hast recht, ich bin von mir überzeugt. Meistens zumindest.«
Da passiert es. Sie lacht. Kopfschüttelnd und in ihre Tasse, aber sie lacht. »Entschuldige, wenn ich dir das so direkt sage, Tyler, aber du bist echt ein Idiot.«
Ich nicke, da schiebt Hannah mir eine riesige Tasse über den Tresen. Der Berg aus Sahne schwimmt bedrohlich wankend obenauf und wird im letzten Moment vom Rand zurückgedrängt, ehe er eine Welle aus heißem Kakao darüber hinaus und in den Unterteller befördert, auf dem kleine Marshmallows drapiert liegen. Ich murmle einen Dank, während mir der süße Duft in die Nase steigt und mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Doch dabei belasse ich es auch, greife nach der Untertasse und schiebe sie vorsichtig zu Hazel hinüber.
»Hier«, sage ich und versuche mich an einem aufrichtigen Lächeln. »Sieh es als Friedensangebot.«
Unschlüssig blickt sie mir entgegen, wahrscheinlich noch immer nicht ganz überzeugt davon, ob ich sie verarsche oder nicht.
»Verrätst du mir jetzt deinen Namen? Sonst muss ich dich einfach Hazel nennen.«
»Hazel? Wie um Gottes willen kommst du denn ausgerechnet darauf?« Die Tasse steht unangetastet zwischen uns, der Sahneberg schmilzt langsam vor sich hin. Doch das ist nebensächlich, denn das Licht und die Wärme sind zurück. Ein Schmunzeln legt sich um ihre rosigen Lippen. »Du weißt nicht, wer ich bin, stimmt’s?«
»Ist das eine Fangfrage?« Denn ich gehe jede Wette ein, dass ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Zumindest kann ich mich nicht an sie erinnern.
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, Mr Riggs, das ist keine Fangfrage. Aber es wundert mich auch nicht, ist ja schon eine Ewigkeit her.«
Ich öffne den Mund, will mich entschuldigen und erfahren, wer sie ist, da klingelt mein Handy. »Entschuldige mich kurz, ja?«
Sie nickt und ich rutsche vom Hocker, verdrücke mich in die hintere Ecke des Cafés, wo es zu den Toiletten geht, und nehme das Gespräch an. »Riggs?«
»Wo bist du? Und warum bist du nicht zum Teammeeting erschienen?«
»Ich freue mich auch, deine Stimme zu hören, Gabe. Aber bevor du weitersprichst, ich bin nicht in New York. Ich musste mal … raus.«
»Raus?« Mein Coach klingt abgelenkt, und ich vermute schwer, dass er in der Eishalle steht – im Hintergrund höre ich das Schleifen der Kufen und Schläger, die auf einen Puck treffen. Es dringt mir bis tief in den Magen. »Was meinst du mit raus?«
»Gabriel, bitte.« Ich schneide ihm das Wort ab, ehe er weitersprechen kann. »Was soll ich beim Meeting? Ich bin raus, schon vergessen?« Am anderen Ende der Leitung rumst es – einer meiner Teamkollegen ist vermutlich in die Bande gekracht und ich will dieses Gespräch so schnell wie möglich zu Ende bringen. Ich habe keinen Bock auf Eishockey. Keinen Nerv für auch nur eine einzige Erinnerung. »Ich bin bei meiner Tante in Alaska, okay? Wenn ich wieder in der Stadt bin, melde ich mich bei dir.« Ohne ein weiteres Wort abzuwarten, lege ich auf. Meine Hände zittern. Mein Atem geht flach. Ich sollte Gabriel dankbar dafür sein, dass er an mir festhält. Dass er mich in den Trainerstab bringen möchte. Aber im Moment kann ich mir nicht einmal vorstellen, eine Eishalle auch nur wieder zu betreten.
Ich sehe hinüber zu ihr. Wie sie dahockt und mit dem Löffel die übrig gebliebene Sahne in den Kakao rührt. Sie hat ihn angenommen, immerhin, und ich muss lächeln, habe ich doch noch immer keine Ahnung, wie sie heißt. Hazel ist es ja nun offensichtlich nicht. Aber sie sagte, dass wir uns kennen. Was mich wundert, denn so viele Jugendliche gab es damals nicht in Nenana oder den umliegenden Gemeinden. Sie muss also ein gutes Stück jünger sein als ich. Seufzend stecke ich das Handy ein. Ich sollte zahlen und mich von ihr verabschieden.
Da zieht das Glöckchen meine Aufmerksamkeit zur Eingangstür, und das Schicksal kippt mir den nächsten Eiskübel über den Kopf. Scheiße. Das ist echt nicht mein Tag. Ihm zu begegnen, stand heute definitiv nicht auf meiner Liste der aufzuarbeitenden Dinge. Ich ducke mich in den Schatten einer dunklen Ecke, während mein Bruder das Café durchquert. Ich habe ihn sofort erkannt. Er hat sich kaum verändert, eigentlich gar nicht. Bis auf die Tatsache, dass auch er erwachsen geworden ist. Gut sieht er aus mit den im Nacken kurzrasierten Haaren. Und auch der Bartschatten steht ihm. Verdammt. Ich schlucke gegen die plötzliche Enge in meinem Hals. Da vorne, nur noch ein paar Schritte entfernt, ist Ryan. Mein Bruder. Und die vierzehn Jahre, die ich ihn nicht mehr gesehen habe, kommen mir auf einmal vor wie Jahrhunderte. Ich habe ihn vermisst. Ich habe ihn verflucht noch mal vermisst und ein Teil von mir würde jetzt tatsächlich gerne einfach zu ihm hinübergehen und ihn in eine Umarmung ziehen. Ihm sagen, wie sehr es mir leidtut, dass ich jeglichen Kontakt abgebrochen habe, und ihn um Verzeihung bitten. Aber ich tue es nicht. Ich stehe stocksteif da, nicht Manns genug, um über meinen eigenen Schatten zu springen. Ich bin so ein Feigling. Und er kommt immer näher. Ist bereits auf Hazels Höhe und … »Hey, guten Morgen!« Ryan ist bei ihr stehengeblieben. Er … Die beiden kennen sich?
Natürlich, du Idiot. Das hier ist nicht New York. In Nenana kennt jeder jeden. Aber ausgerechnet …
Jetzt deutet er auch noch auf den Platz neben ihr. Den Platz, über dem meine Jacke hängt. »Das ist ja mal eine schöne Überraschung, dass ich dich hier treffe. Darf ich?«
Nein, darfst du nicht! Das ist mein … Verdammt, was mache ich denn jetzt? Hazel hat sich umgedreht und schaut ein wenig verunsichert in meine Richtung. Entdeckt mich in meinem Versteck und zieht die Brauen zusammen, da bemerkt Ryan den Parka vor sich. »Oh, ist das deiner? Oder …«
»Nein, Ryan, das ist …« Ihr Blick. Sie nimmt ihn nicht von mir. Verankert ihn mit meinem und der Vorwurf darin zieht mich nahezu aus dem Schatten. »Komm raus«, sagt sie stumm. »Komm raus, oder ich verpfeif dich.« Aber das hat sie längst, denn mein Bruder ist ihrem Blick gefolgt. Er sieht mich an. Ich spüre es, wage aber nicht, sie aus den Augen zu lassen. Aus purer Angst, was mich erwarten wird, wenn ich in seine schaue. Ich weiß, dass es ausweglos ist. Dass ich in der Falle sitze. Ich muss irgendetwas tun. Aber wie ein Kind weigere ich mich mit aller Kraft, das Unvermeidliche anzunehmen. Da entscheidet sie für mich, senkt den Kopf und nimmt mir, woran ich mich festklammerte. Nimmt mir meinen Schutz und zwingt mich, zu handeln. Und im selben Moment, in dem Ryan einen Schritt auf mich zu macht, gebe ich meine Deckung auf.
»Meiner«, sage ich. »Das ist mein Mantel.«
Dann stehen wir uns gegenüber. Mein Bruder und ich. Nach so langer Zeit. Kein Wort verlässt seine Lippen, die er zu einer schmalen Linie gepresst hat. Keine Regung in seinen blauen Augen. Und doch liegt so vieles zwischen uns. All die unausgesprochenen Vorwürfe. Die Fragen nach dem Warum und Weshalb. Gefühle, von denen ich nicht weiß, ob und in welchem Ausmaß er sie noch für mich empfindet. Liebe? Zuneigung? Oder doch nur Wut und Enttäuschung?
Ich suche die Antwort selbst in mir drin. In dem Knäuel aus Empfindungen, das mit jedem Herzschlag statt klarer nur noch undurchschaubarer und verstrickter wird. Ich will hier nicht sein. Nicht an diesem Ort, nicht in dieser Situation. Als ich beschloss, zurückzukehren, war ich mir bewusst, dass es geschehen könnte. Dieser Ort ist viel zu klein, als dass ich Ryan nicht begegnen würde. Doch ich war noch nicht bereit dafür. Nicht heute und morgen bestimmt auch nicht, und so hätte ich es immer weiter vor mir hergeschoben. Mit etwas Glück vielleicht sogar bis zu unserer Abreise. Aber jetzt ist es geschehen. Hier stehen wir. Und gerade, als ich es nicht mehr aushalte, die Stille um und zwischen uns mich zu erdrücken droht, schüttelt er den Kopf.
»Da bist du also wieder«, sagt er, so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann. Doch dass er überhaupt zu mir spricht, lässt mich hörbar nach Luft schnappen.
Da bist du also wieder. Keine Ahnung, ob das der Satz ist, den ich mir für unser erstes Wiedersehen von ihm gewünscht hätte, aber … hey, er redet mit mir. Und ich bin gewiss nicht in der Position, Ansprüche zu stellen an das Wie und Was.
»Hallo, Ryan.« Ich mache einen Schritt auf ihn zu, unschlüssig, was ich mit meinen Händen tun soll. Seine schütteln? Ihn gar zu umarmen kommt mir vollkommen fehl am Platz vor, obwohl es tatsächlich das ist, was mein Herz sich insgeheim wünscht. Wäre da nicht dieser Ausdruck in seinen Augen, der mich auf Distanz hält.
»Was willst du hier?« Sein Ton ist kalt.
»Ich …« Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Zumindest keine, die ihn zufriedenstellen wird, da bin ich mir sicher. »Maggie ist tot.« Das ist das Einzige, was mir einfällt. »Meine Frau …«
»Ex-Frau, wenn ich richtig informiert bin.«
»Ja, du hast recht. Ich …« Verdammt, ich stammle wie ein Volltrottel. In meinem Kopf herrscht die vollkommene Ebbe. Da fällt mein Blick auf sie. Reglos hockt sie auf dem Barhocker, die Hände in ihrem Schoß gefaltet und mit geröteten Wangen. Sie will auch nicht hier sein. Zumindest das haben wir beide gemeinsam.
Da greift Ryan nach meiner Jacke, die noch immer über dem Hocker hängt, und hält sie mir entgegen. »Du solltest jetzt gehen«, sagt er und die Entschlossenheit in seiner Stimme duldet keinen Widerspruch. Und ich? Ich bin ihm sogar dankbar dafür. Dankbar, dass er mich aus dieser Hölle entlässt. Dass er entscheidet und ich mich nicht länger quälen muss.
Ich nehme ihm die Jacke ab, knete sie zwischen meinen Händen, während ich meinem Bruder noch einmal ins Gesicht sehe. Gott, er sieht aus wie Dad. Und dann gehe ich. Wortlos.
Am Ende der Theke lege ich Hannah noch einen Schein hin. »Stimmt so«, murmle ich. Dabei stimmt überhaupt nichts. Zumindest nicht in mir drin.
Der falsche Riggs
Charlie
»Das war nicht nett, das weißt du, oder?« Auch wenn es mir nicht gefällt, er tut mir leid. Und ganz ehrlich habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich Tyler zwar ansah, dass er seinem Bruder am liebsten aus dem Weg gegangen wäre, ich ihn aber trotzdem in die Höhle des Löwen getrieben habe.
Andererseits, seine dämliche Jacke hat ihn doch verraten, nicht ich. Außerdem hätte er auch nicht ewig dort hinten in der dunklen Ecke warten können, bis Ryan wieder gegangen wäre. Es ist also nicht meine Schuld. Aber warum fühle ich mich dann so schlecht?
»Das ist mir egal.« Ryan tritt um mich und zieht sich den Hocker auf der anderen Seite zurecht. Weil sein Bruder auf diesem hier saß? Das ist jetzt echt kindisch. »Was hat er bei dir gewollt?«
Mir klappt der Mund auf. »Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Und überhaupt, hör auf, ständig bei meiner Mom anzurufen.« So, jetzt ist es raus. Ich wollte ihm das eigentlich weniger patzig beibringen, aber die Art, wie er Tyler gerade behandelt hat und sich nun mir gegenüber aufspielt, geht mir gehörig gegen den Strich.
»Nimmst du ihn jetzt auch noch in Schutz?«
»Das tue ich überhaupt nicht! Und selbst wenn, du und ich«, ich rutsche vom Hocker und fuchtele mit dem Zeigefinger zwischen uns hin und her, »da ist nichts, was dir das Recht geben würde, dich darüber aufzuregen, verstanden? Bye.«
»Charlie, bitte! Es tut mir leid.«
»Sag das deinem Bruder.« Damit schwinge ich mir die Jacke über die Schultern und marschiere in Richtung Ausgang. Stille herrscht im ganzen Laden. Selbst Hannah hat mitten im Kaffeeausschenken innegehalten. Mir ist als würden mich alle anstarren. Allen voran Mrs Grant und Mrs Davenport, die beiden Vorsitzenden von Nenanas inoffiziellem Komitee für Tratsch und Gerüchte aller Art.
»Und ihr«, den Türgriff bereits in der Hand drehe ich mich noch einmal um und deute schwungvoll über ihre aller Köpfe, »ihr hättet auch netter zu ihm sein können. Ich habe eure Blicke genau gesehen. Schämt euch! Alle miteinander!«
Die Kälte schlägt mir entgegen, kaum dass ich vor dem Mollys stehe, doch ich heiße sie willkommen. Ich bin aufgeheizt, mein Gemüt wie mein Körper. Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann sind es Streit und miese Schwingungen. Ich hangle nach meinem Reißverschluss. Und öffentliche Verurteilungen. Der Zipper rutscht mir immer wieder durch die Finger, ich bekomme ihn einfach nicht in die Führung. Und … ach, Tyler. Seufzend lasse ich die Enden meiner Jacke fallen und stapfe zum Auto.
Ich war auch nicht nett zu ihm, das gebe ich ja zu. Aber es war nicht böse gemeint. Eher ein Abwehrmechanismus. Oder Selbstschutz. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll, aber als ich erkannt hatte, in wen ich da hineingelaufen war, als er mich nach all den Jahren plötzlich live und in Farbe anlächelte – ER! MICH! –, da hielt ich es im ersten Moment für das Sicherste, ihn auf Abstand zu halten. Und dann kam er mir auch noch nach und fragte, ob er sich neben mich setzen darf, ts. Hätte er das vor vierzehn, fünfzehn Jahren getan, wäre ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit in Ohnmacht gefallen und nie wieder aufgewacht. Es sei denn, er hätte mich wachgeküsst wie Schneewittchen. Schneewittchen? Oder war das Dornröschen?