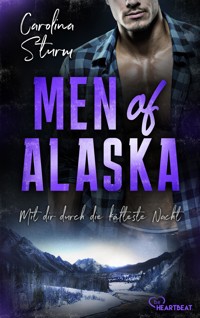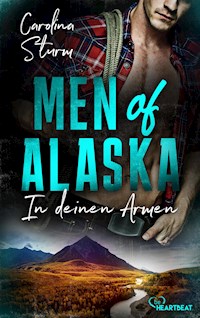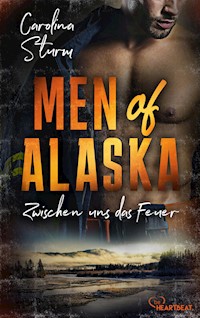
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knisternde Romance in der Wildnis Alaskas
- Sprache: Deutsch
Um ihren kleinen Sohn Davy zu beschützen, lässt Amber in einer Sturmnacht alles hinter sich. Sie flieht vor ihrem gewalttätigen Freund, doch dann kommen sie und ihr Baby von der regennassen Straße ab. Gefangen in ihrem Wagen und ohne Hoffnung, ist es Feuerwehrmann Jesse, der ihnen nicht von der Seite weicht, bis sie in Sicherheit sind - in dem kleinen Örtchen Thunderbird Falls. Dort will Amber eigentlich nur wieder zu Kräften kommen. Allerdings nehmen der Klinikleiter und seine Frau sie so herzlich auf, dass sie sich das erste Mal in ihrem Leben geborgen fühlt. Und außerdem ist da immer noch der unverschämt gutaussehende Jesse. Die Luft knistert zwischen den beiden, aber eine junge Mutter und ein Frauenheld? Das kann nicht gutgehen. Oder doch? Denn Jesse gewährt ihr immer öfter einen Blick hinter die Fassade des toughen Firefighters, und was Amber dort entdeckt, erschüttert ihr Herz. Die beiden kommen sich näher, und Amber schöpft neue Hoffnung. Bis die Vergangenheit plötzlich vor ihrer Tür steht ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
Am Abgrund
Endstation Hoffnung
Nicht in der Stimmung
Willkommen im Wunderland
Dafür sind Freunde da
Dein Schicksalstier
Vertrauen muss man lernen
Von Fettnäpfchen und Monstern
Vollmond
»Was bin ich für dich?«
Gut oder böse?
Kuchen und Erkenntnis
Ist der Ruf erst ruiniert …
Ein Tanz unter Sternen
Ausgetrickst
Halt dich an mir fest
Schatten der Vergangenheit
Schick mich nicht fort
Engel, nicht Hexe
Brücken
»Möchtest du … alles?«
Altes und Neues
Er hat sie gefunden
Wenn du alles verlierst
Feuer
Alles wird gut
Neuanfang
Die Last der Erinnerung
Vergebung
Keine Zukunft ohne dich
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Um ihren kleinen Sohn Davy zu beschützen, lässt Amber in einer Sturmnacht alles hinter sich. Sie flieht vor ihrem gewalttätigen Freund, doch dann kommen sie und ihr Baby von der regennassen Straße ab. Gefangen in ihrem Wagen und ohne Hoffnung, ist es Feuerwehrmann Jesse, der ihnen nicht von der Seite weicht, bis sie in Sicherheit sind – in dem kleinen Örtchen Thunderbird Falls. Dort will Amber eigentlich nur wieder zu Kräften kommen. Allerdings nehmen der Klinikleiter und seine Frau sie so herzlich auf, dass sie sich das erste Mal in ihrem Leben geborgen fühlt. Und außerdem ist da immer noch der unverschämt gutaussehende Jesse. Die Luft knistert zwischen den beiden, aber eine junge Mutter und ein Frauenheld? Das kann nicht gutgehen. Oder doch? Denn Jesse gewährt ihr immer öfter einen Blick hinter die Fassade des toughen Firefighters, und was Amber dort entdeckt, erschüttert ihr Herz. Die beiden kommen sich näher, und Amber schöpft neue Hoffnung. Bis die Vergangenheit plötzlich vor ihrer Tür steht …
Carolina Sturm
MENofALASKA
Zwischen uns das Feuer
Roman
Das Feuer der Liebe.Die Glut der Leidenschaft.Aus einem Funken Hoffnung.
Für Dich.
Prolog
Amber
»Verzeih mir, Baby.« Ich verrenke meinen schmerzenden Körper und taste hinter mich. Das Lenkrad rutscht durch meine Finger, mattes Grau leuchtet im Scheinwerfer auf. Die Leitplanke! Ich reiße am Steuer, während die Tränen mir schon wieder die Sicht nehmen. »Verzeih mir, mein Schatz. Ich mach das wieder gut, hörst du? Mommy macht alles wieder gut.«
Trost. Ich brauche Trost und wage einen zweiten Versuch, bis ich endlich den winzigen Turnschuh erfasse, in dem der noch winzigere Fuß meines kleinen Sohnes steckt.
Davy. Er schläft. Gott sei Dank. Nachdem ich ihn mitten in dieser Gewitternacht aus seinem Bettchen gezogen habe, hat er bitterlich geweint. Ich konnte ihn nicht trösten. Alles musste schnell gehen, denn Scott war nur kurz weggegangen, um Zigaretten zu holen. Und höchstwahrscheinlich eine neue Flasche Bourbon. Ich wage kaum, mir auszumalen, wie er reagieren wird, wenn er merkt, dass ich das Auto genommen habe. Dass sein Sohn oder gar ich weg bin, das wird ihm in seinem Rausch vielleicht sogar noch entgegenkommen. Aber der Wagen, sein Heiligtum!
Er schlägt dich tot, wenn du auch nur einen Kratzer in den schäbigen Lack fährst!
Und trotzdem habe ich es getan. Den Wagen genommen. Ihn quasi gestohlen. Und das, obwohl die Angst in mirnach allem, was er mir angetan hat, so laut schreit, dass selbst die nächsten heftigen Schluchzer sie nicht zu übertönen vermögen. Ich bin so erbärmlich.
Immer wieder fahre ich mit dem Daumen über das abgewetzte Wildleder des Kinderschuhs, während ich versuche, die Straße nicht aus dem Blick zu verlieren. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist – der Schleier aus Tränen vor meinen Augen oder der Regen. Wasser ergießt sich in einem fort während eines sintflutartigen Wolkenbruchs, der uns zu verfolgen scheint, seit wir die Stadtgrenze von Anchorage in Richtung Norden hinter uns gelassen haben. Ohne Ziel, denn es gibt keines.
Keinen Menschen, dem ich vertraue. Keinen Freund. Keine Familie, in deren Obhut ich mich mit Davy flüchten könnte. Seit einer guten Dreiviertelstunde gibt es nur noch uns zwei – mein Kind und mich. Das Unwetter ist so stark, dass ich befürchte, dass selbst der liebe Gott mich verlassen hat. Doch ich gebe nicht auf. Für Davy.
Ich werde alles tun, um ihn vor seinem Vater zu schützen.
Am Abgrund
Jesse
»Hey, das ist mein Donut!«
Ich drehe mich weg, ehe Malvin zupacken kann. »Quatsch nicht!«, schnauze ich ihn an. »Oder steht dein Name auf der Packung? Die hat Hattie für uns alle vorbeigebracht, und jetzt hol dir selbst einen.« Ich zeige auf die Tür zur Küche, doch mein Kollege baut sich vor mir auf.
»Den hatte ich mir bereits geholt, du Penner.« Er streckt mir die Hand entgegen. »Hol du dir gefälligst einen Neuen.«
»Ihr streitet jetzt nicht allen Ernstes wegen eines Donuts, oder?« Der Captain ist hinter mir aufgetaucht und stützt die Hände auf die Lehne meines Stuhls. »Gib Malvin das Ding zurück, Jesse. Seine Frau hat ihn heute Nacht auf der Couch schlafen lassen. Er braucht den Zucker dringender als du.«
Schon wieder? O Mann, armer Mal. Ich bin tatsächlich versucht, ihm den Teigkringel zu überlassen. Erst vor ein paar Tagen hat er sich bei mir ausgeheult, wie scheiße es gerade bei Trish und ihm läuft. Als ich jedoch aufsehe, halte ich inne.
Eine Hand in die Hüfte gestemmt steht er vor mir, während er mit der anderen vor meiner Nase herumwedelt. Sein Gesichtsausdruck ähnelt dem seines vierjährigen Sohnes, den ich in Gedanken quaken höre: Mama hat gesagt, ich darf das! Und da ich Malvin ebenfalls bereits kenne, seit wir vier Jahre alt waren, wird mein Grinsen immer breiter. Ich genieße, wie seine grauen Augen sich weiten und er immer ungläubiger verfolgt, wie der süße Kringel meinen Lippen unaufhaltsam näher kommt. »Untersteh dich«, brummt er, längst wissend, dass seine Drohung wirkungslos an mir abprallen wird.
Ich öffne den Mund, sehe, wie das Gesicht meines Freundes immer mehr einem glühenden Kupferkessel ähnelt, und in meiner Brust zuckt bereits das Lachen. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht! Malvin zu provozieren macht einfach zu viel Spaß, und zu wissen, dass er das weiß und trotzdem jedes Mal wieder darauf einsteigt, hält mein Mitleid auf boshaft niedrigstem Niveau.
In meinem Rücken spüre ich, wie der Captain sich von meinem Stuhl abstößt, mit einem genervten Laut in Richtung Büro entschwindet, und zeitgleich mit seinem vor sich hin gemaulten »Kindergarten« trifft die Schokoglasur des Donuts auf meine Geschmacksknospen. Hmm, zartbitter.
Mals Gesichtszüge entgleisen, als ich mit der Zunge einmal quer über das Gebäck schlecke, doch als ich ihm das Teil mit dem Grinsen des Siegers entgegenstrecke und höflich frage: »Magst du ihn noch?«, bleibt mir gerade noch genug Zeit, die Arme hochzureißen. Der Stuhl kippt, der Donut fliegt in hohem Bogen durch den Mannschaftsraum, und ich lande hart auf dem Fußboden, begraben unter der Masse meines Kollegen.
»Touchdown, du Arschloch«, fährt er mich an, seinen Unterarm um meinen Hals geschlungen. Ich japse, kann aber nicht aufhören zu lachen, was die zunehmende Atemnot nur verstärkt.
»Tut mir leid!«, presse ich hervor und schlage mit der flachen Hand auf den Linoleumboden. »Ich ergebe mich!«
»Holst du mir einen neuen Donut?« Malvins Gewicht auf mir wird immer erdrückender. Und während die Crew um uns herum einstimmig seinen Namen grölt wie bei einem Ringkampf, wird mir mal wieder klar, warum er so erfolgreich in der Defensive-Line gespielt hat.
»Ja, Mann!« Ich lache immer noch, mein Kopf wird immer heißer. »Geh. Runter!«
Endlich. Ich kann wieder atmen. Tränen laufen mir aus den Augenwinkeln und über mein mit Sicherheit hochrotes Gesicht.
Malvin kniet neben mir und wuschelt mir durch die Haare. »Geht doch«, brummt er und entblößt seine riesigen weißen Zähne für ein Grinsen. An dem Kerl ist einfach alles groß.
Er will gerade meine Hand greifen, um mich auf die Füße zu ziehen, da schrillt die Alarmglocke durch die Wache, gefolgt von Lindas Stimme aus den Lautsprechern: »Einsatz, Jungs! Rüstgruppe 51, Rettungswagen 12. Verkehrsunfall auf dem Old Glenn Highway. Ein Auto hängt am Berg. Vermutlich zwei Personen eingeschlossen.Und fahrt vorsichtig.«
Das sagt sie immer, und jedes Mal schenkt sie uns damit ein kleines Lächeln, während wir zu unseren Spinden hasten. Bei einem Verkehrsunfall ist das Risiko gering, dass einem von uns etwas passiert, dennoch wissen wir in unserem Job nie, was auf uns zukommt. Jeder Einsatz ist anders, egal, wie oft du schon ausgerückt bist. Rüstgruppe – zu der gehöre ich.
Malvin ist raus, da er zur Besatzung des Leiterwagens gehört, dennoch zieht er mich mit Schwung auf die Füße und verpasst mir einen Klaps auf die Schulter. »Viel Glück, Jess. Ich heb dir einen Donut auf.«
***
Der Regen lässt allmählich nach, aber die tief hängenden dichten Wolken haben das Tageslicht schon längst verschlungen. Es ist Ende August, und die starken Regenfälle der letzten Tage bescheren uns zwar vermehrte Einsätze wegen Überflutungen, versprechen aber auch eine gute Lachswanderung.
Ich werde Malvin fragen, ob er nächste Woche mit mir zum Eklutna River fährt. Selbst wenn die Lachse noch etwas auf sich warten lassen, etwas Ruhe und ein kaltes Bier tun ihm sicher gut. Vielleicht sollte ich auch mal mit Trish reden. So einen wie Mal wird sie so schnell nicht wieder finden, und der arme Kerl leidet wie ein Hund.
»Mann, bei dem Sauwetter muss man ja im Graben landen.« Hardin beugt sich an mir vorbei, um einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Außer den schemenhaften Umrissen der Bäume, deren regennasse Rinde unser Blaulicht reflektiert, gibt es nicht viel zu erkennen. Wir müssten bald am Unfallort ankommen. »Stimmt es, dass Trish Malvin verlassen hat?«
Der Geruch seines Schnupftabaks steigt mir in die Nase, und angewidert schiebe ich Hardin von mir. »Gott, Kumpel, dein Kraut ist so widerlich. Außerdem hängt die Hälfte in deinem Gesicht.«
»Sorry«, murmelt er und reibt mit dem Ärmel über seinen buschigen Oberlippenbart. Auch nicht besser … »Aber nun sag schon, ihr seid doch befreundet. Ist Trish wieder auf dem Markt?«
Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Nur weil wir in einer spärlich besiedelten Gegend leben, in der heiratsfähige Frauen nicht gerade an jeder Ecke stehen, ist das noch lange kein Grund, sabbernd auf die Trennung eines Kollegen zu hoffen. »Nein!«, fahre ich ihn an. »Die beiden hatten nur einen gewöhnlichen Streit. Das kommt in den besten Beziehungen vor. Und selbst wenn Trish sich trennen wollen würde, du kämst sicher nicht infrage.«
Hardin brummelt und zieht sich sichtlich beleidigt auf seinen Platz zurück. Die anderen lachen. Natürlich haben die Jungs mitbekommen, dass Mal und Trish Probleme haben – wir verbringen auf der Feuerwache mehr Zeit miteinander als jeder von uns mit seiner Familie –, dennoch beunruhigt mich, dass Hardin es so offen angesprochen hat. Normalerweise verhalten sich die Jungs loyal untereinander, weswegen dieses Gespräch gerade überdeutlich zeigt, dass mein Kumpel in einer ernsthaften Beziehungskrise zu stecken scheint.
Da schaltet sich John dazwischen: »Meiner Mary hat Trish erzählt, dass sie will, dass Malvin auszieht. Wenn du mich fragst, dann klingt das nach weitaus mehr als nur einem gewöhnlichen Streit.« Er setzt die beiden letzten Worte mit seinen Fingern in Anführungszeichen.
Scheiße. Und warum weiß ich davon nichts? John scheint meinen Gesichtsausdruck richtig zu deuten, denn er beugt sich zu mir herüber. »Tjahaa, Jessie, solltest mal besser wieder mehr Zeit mit deinem Buddy verbringen, als dir die freien Nächte in der Bar um die Ohren zu schlagen. Glaub mir, das wird dir auf Dauer nicht guttun.«
Jetzt reicht’s. Meine Stimmung kippt, Adrenalin flutet meine Adern. Unterstellt John mir gerade ernsthaft, ich sei ein schlechter Freund?! Ich habe leider keine Gelegenheit mehr, ihn zur Rede zu stellen. Wir sind da. Der Truck kommt mit einem Ruck zum Stehen, die Sirene erlischt, und von einer Sekunde zur nächsten sind die Männer im Arbeitsmodus.
»Komm, Jess.« Richard, der Gruppenführer, klopft mir auf die Schulter. »Wir werden hier gebraucht.«
Johns Worte noch immer im Ohr, springe ich als Letzter aus der Kabine. Fuck, ich bin kein schlechter Freund! Malvin mag es nun mal nicht, wenn man ihm zu dicht auf die Pelle rückt, und was kann ich bitte schön dafür, dass er abends keine Lust hat, auszugehen? Soll ich deswegen aufhören, mich zu amüsieren?
Amüsieren, pfft. Die Stimme in meinem Kopf lacht sich schlapp, und ich setze mir mit einem wütenden Knurren den Helm auf. Vielleicht wird sie dadurch leiser. Aber weit gefehlt.
Während ich am Rüstwagen vorbei meinen Kollegen folge, das Auto des Sheriffs am Straßenrand entdecke und das unentwegte Blinken des Blaulichts sich vor mir auf dem regennassen Asphalt spiegelt, bedient sich mein Gewissen eines ganz besonders fiesen Tricks: Es spricht mit Rebas Stimme zu mir, der Frau, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, mir meine Mutter zu ersetzen. Und das macht sie verdammt gut. So gut sogar, dass ich selbst den Kopf einziehe, wenn ich ihre Worte nur in meiner Vorstellung höre. Leichte Mädchen und Bier, Jessie. Ist es wirklich das, was du willst? Deine Eltern waren in deinem Alter bereits verheiratet, mein Junge.
Bullshit! Ich trete um den Truck. In meinem Alter waren meine Eltern bereits tot.
»Wir brauchen die Seilwinde!« Richards Befehl dröhnt über die Rufe der Männer, dann spüre ich seine Hand auf meiner Schulter. »Jess, du gehst runter. Eine Frau und ein Kind sind in dem Wagen. Bleib bei ihnen, und beruhige sie.«
»Ich? Wa…« Doch er eilt bereits weiter. Na prima. Ich fahre mir über das Gesicht. Warum soll ausgerechnet ich den Seelsorger spielen? Soll John das doch machen, wenn er augenscheinlich für alles und jeden so viel Verständnis hat.
Schnaubend steige ich in den Sicherungsgurt, den Hardin mir hinhält, und lasse mir beim Festzurren helfen. Erst als er zur Seite tritt, sehe ich den Unglückswagen. Es ist ein hellblauer alter Chevy Nova, allerdings keiner von denen, für die du noch eine gute Stange Geld bekommen würdest.
Im grellen Licht des Suchscheinwerfers, der vom Dach des Feuerwehrtrucks aus die Böschung beleuchtet, sehe ich Unmengen von Roststellen an dem betagten Fahrzeug. Die Heckklappe ist bereits so stark angefressen, dass ich vermute, sie wird nur noch von den Aufklebern zusammengehalten, die daran haften. Auf der rechten Seite muss der Wagen zudem bereits vor diesem Unfall eine schmerzhafte Begegnung mit irgendeinem Pfosten oder Baum gehabt haben – eine ordentliche Beule verunstaltet das Chrom der Stoßstange.
Dass ich den Wagen jedoch noch nie zuvor gesehen habe, füllt mein angespanntes Gemüt zumindest teilweise mit Erleichterung, denn meine Arbeit geht mir leichter von der Hand, wenn ich die beteiligten Personen nicht kenne.
Ein Ruck am Gurt lässt mich aufschauen. Hardin signalisiert mit dem Daumen nach oben, dass ich loslegen kann, doch zuerst drücke ich meine Absätze in den aufgeweichten Boden, um die beste Stelle für den Abstieg zu finden. »Okay, ich gehe runter!«, rufe ich. Dicke Tropfen aus den Bäumen fallen mir auf Helm und Schultern, das feuchte Laub unter meinen Stiefeln ist rutschig. Zum Glück hat eine der ersten Tannen den Wagen aufgehalten, und ich muss nicht allzu weit runter. Weißer Dampf steigt aus der zerbeulten Motorhaube empor. Offensichtlich hat es beim Aufprall den Kühler zerlegt.
Schritt für Schritt arbeite ich mich abwärts, und die Konzentration beginnt, meine Wut zu überlagern. Das ist gut so, denn der Frau dort drin ist es scheißegal, ob ich mit mir selbst klarkomme oder nicht, sie braucht meine Hilfe. Trotzdem, irgendetwas ist heute anders. Ich schaffe es einfach nicht, meinen Fokus komplett auf die Arbeit zu richten. Und je näher ich dem Fahrzeug komme, umso stärker wird meine Unruhe.
Ich stoppe, blicke den Abhang hinauf, wo der Abschleppwagen endlich eingetroffen ist und der Fahrer zusammen mit der Mannschaft alles dafür vorbereitet, den Wagen zurück auf die Straße zu ziehen. Ihre Stimmen hallen über mich hinweg, werden überlagert von dem Zischen, das aus dem Motorraum hinter mir kommt. Ich muss weiter, doch meine Beine stemmen sich wie festbetoniert in den Abhang. Was ist los mit dir? Warum zögerst du?
Ich schüttle den Kopf, justiere meine Finger neu um das Seil. Habe ich mir jemals etwas aus dem Gequatsche der Kollegen gemacht? Nein. Warum also hänge ich dann hier wie ein Anfänger, der nicht weiß, was er als Nächstes tun soll?
»Hallo?«
Die Frau! Hastig blicke ich über meine Schulter und erkenne ihre Umrisse am Fahrerfenster. Lange Locken heben sich vor dem Licht ab, das die Scheinwerfer ihres Wagens in den finsteren Wald werfen. Sie hat ihre Hände gegen die Scheibe gedrückt. So klein, schießt es mir durch den Kopf.
Ich bin auf Höhe des Kofferraums, und mein Blick fliegt über die Sticker, die das Blech am Auseinanderfallen hindern. Die herausgestreckte Zunge der Rolling Stones glitzert mir entgegen, umringt von Logos und Schriftzügen diverser anderer Rockbands. Ich ignoriere die Fratzen, Schädel, Äxte und auch den Stinkefinger, an dem ein fetter Totenkopfring prangt, denn ein Aufkleber passt so überhaupt nicht in den Wirrwarr aus dunklen und einschüchternden Motiven … Das große Rechteck in allerlei Farben des Regenbogens springt mir förmlich entgegen. Zwei gefaltete Hände sind darauf zu erkennen, und nur ein einziges Wort steht in Großbuchstaben daneben: HOPE.
Hoffnung? Verwirrt ziehe ich die Brauen zusammen, da kippt in mir ein Schalter. Hoffnung!Ich bin die verdammte Hoffnung für diese Frau. Die Unruhe schlägt um in Ehrgeiz, und plötzlich bin ich vollkommen klar. »Keine Angst, Ma’am, ich bin gleich bei Ihnen!«
Das Seil rutscht kontrolliert durch meine Handschuhe, ich mache die letzten Schritte, da justiert jemand den Suchscheinwerfer neu, und ein gleißender Lichtstrahl trifft mich. Fluchend reiße ich einen Arm vors Gesicht … und höre ein Glucksen.
Was ist das? Den Kopf geneigt, um meine Augen mit dem Schild des Helms vor der Helligkeit zu schützen, blicke ich in den Wagen und bin im ersten Augenblick nicht darauf vorbereitet, was mich erwartet. Scheiße, ja! Es war die Sprache von zwei Personen gewesen. Die Frau ist nicht allein.
Unter einer Seattle-Seahawks-Mütze, die ihm locker zwei Nummern zu groß ist, strahlen mich zwei freche runde Augen an, und in dem vor Freude aufgerissenen kleinen Mund prangen vier winzige Schneidezähne – zwei oben und zwei unten –, während es mit beiden Fäusten immer wieder auf den Henkel des Kindersitzes trommelt. Ein Baby! Hat Richard das erwähnt? Habe ich nicht richtig zugehört?
Der kleine Kerl scheint sich auf jeden Fall bester Gesundheit zu erfreuen, und bei seinem Anblick heben sich unwillkürlich meine Mundwinkel. Nur ein Eisklotz könnte diesem Lachen widerstehen, und der bin ich nun wirklich nicht, egal, was mein Umfeld von mir denkt. Das breite Lächeln noch immer im Gesicht, nehme ich eine weitere Bewegung im Augenwinkel wahr und sehe mich um. Heiliges Karibu!
Mein Fuß rutscht über das Laub, ich strauchle, kippe, das feuchte Laub kommt mir immer näher, ich kann den Moder bereits riechen, da gelingt es mir gerade noch, mich mit einer Hand abzufangen.
»Alles in Ordnung?«
Was? Ja klar, ich hänge nur gerade wenig ehrenhaft in meinem Gurt und bin haarscharf daran vorbeigeschlittert, zum Gespött meiner Kollegen zu werden. Am Straßenrand lacht sich Hardin bereits schlapp. »Hey, Crawford! Sag Bescheid, wenn wir dich mitretten sollen!«
Ich ignoriere sein dummes Geschwätz und rapple mich auf, nur um mich erneut diesen Augen auszusetzen, die mir durch das Fenster entgegenblicken. Bambi. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Höchstens, dass der Fratz auf der Rückbank mit Sicherheit der Sohn dieser jungen Frau sein muss, denn seine Augen sind zwar blau, wenn ich das richtig gesehen habe, und nicht dunkel wie ihre, aber die Form ist unverwechselbar – groß und rund, mit langen an den Außenseiten nach oben geschwungenen Wimpern. Bambi! Keine Frage. Und sie ist nicht von hier, denn dann wäre sie mir längst aufgefallen. Aber so was von sicher!
»Sorry«, presse ich hervor. »Ist echt rutschig.«
Ein Lächeln erscheint auf ihren rosigen Lippen, scheu wie ihr Blick, und dennoch so bezaubernd, dass ich gegen dieses seltsame Kribbeln machtlos bin, das es in meinen Magen setzt. Für einen kurzen Moment vergesse ich, warum ich hier bin, und bin tatsächlich ein wenig neidisch. Neidisch auf den Vater des Kindes, denn er hat wahrlich eine Schönheit an seiner Seite. Doch dann neigt sie den Kopf, um meinem Blick zu entgehen, und das Bild der glücklichen Familie, das sich gerade vor mein geistiges Auge geschoben hatte, verpufft. Warte, sind diese Verletzungen vom Unfall?
In den Bruchteilen einer Sekunde checke ich noch einmal den Unglücksort. Die Reifenspuren führen in zwei ziemlich geraden Furchen den Abhang hinunter, und der Wagen hat die Tanne fast mittig getroffen. Es war ein Frontalzusammenstoß. Und das lässt mich daran zweifeln, dass der Bluterguss, der sich neben ihrem linken Auge von der Stirn bis zum Wangenknochen erstreckt, hiervon verursacht wurde. Zumal er sich bereits dunkel verfärbt, was darauf schließen lässt, dass die Verletzung mindestens ein paar Stunden alt sein muss. Doch egal. Ich schüttle die Gedanken beiseite. Das zu beurteilen liegt nicht in meinem Ermessen.
Mein Blick fällt auf das einen Spaltbreit geöffnete Fenster. »Ma’am, sind Sie verletzt? Haben Sie irgendwo Schmerzen?« Sie schüttelt den Kopf. »Mein Name ist Jesse. Wie heißen Sie?« Wieder trifft mich der Blick aus ihren Rehaugen. Ihre Pupillen sind geweitet, der Ausdruck beinahe gehetzt. Ihre Lippen bewegen sich zwar, aber … hat sie Angst? »Ma’am.« Ich versuche, einen möglichst beruhigenden Ton anzuschlagen. »Verraten Sie mir Ihren Namen? Ich hole Sie hier raus.« Sie schweigt weiter, hilfesuchend fliegt ihr Blick zur Rückbank, wo das kleine Kind sich nach wie vor prächtig zu amüsieren scheint. Gut, dann muss ich Bambi eben retten, ohne ihren Namen zu kennen.
Ich ziehe einen Handschuh aus und umgreife den schmalen Türgriff. Der Knopf lässt sich drücken, und beinahe freue ich mich schon, dass wenigstens etwas heute ohne Probleme ablaufen könnte, doch das Schloss öffnet sich nicht. Ich drücke und rüttle – nichts. »Ma’am, haben Sie die Tür von innen verriegelt?« Ein erneutes Kopfschütteln. Die hellen Locken wippen um ihr Gesicht. Mist. »Was ist mit der anderen Seite? Können Sie rüberkrabbeln?«
»Jess, wie sieht’s da unten aus? Gibt es Verletzte?« Richards Stimme knarzt aus dem Funkgerät.
»Nein, aber die Türen haben sich verzogen.« Ich sehe nämlich, wie die Frau ergebnislos gegen die Beifahrertür drückt. »Die zweite Person ist noch ein Baby«, gebe ich durch. »Sollen wir die beiden nicht einfach mit dem Wagen hochziehen? Das erscheint mir von hier aus am sinnvollsten.«
Während ich auf die Antwort meines Lieutenants warte, signalisiere ich der Frau, dass sie das Fenster herunterkurbeln soll, doch selbst das scheint nicht zu funktionieren. »Rich, was ist? Die Fenster klemmen auch, und angesichts des Kleinen würde ich sie ungern einschlagen.« Es rauscht in der Leitung, und oben am Straßenrand sehe ich, wie er sich mit dem Mann vom Abschleppdienst austauscht. Dann geht sein Daumen nach oben. »In Ordnung. Bleib du bei Mutter und Kind, wir kommen gleich runter.«
»Kann ich Davy zu mir holen? Oder darf ich auf den Rücksitz?« Na bitte, Bambi hat ihre Stimme wiedergefunden. Ich lehne mich an den Wagen, um besser durch den Spalt im Fenster reden zu können.
»Sie können gerne zu Ihrem Sohn nach hinten krabbeln, wenn Sie möchten. Aber sobald die Jungs Ihren Wagen gesichert haben, wäre es mir lieber, wenn Sie sich anschnallen würden, okay?«
Sie nickt, schickt sich an, zwischen den Sitzen hindurchzuklettern, und als Bambi ihren Fuß auf die Mittelkonsole hebt, schleicht sich ein breites Grinsen auf meine Lippen.
Keine Ahnung warum, aber ich riskiere gerne mal einen Blick auf die Füße von Frauen. Eigentlich sind es vielmehr ihre Schuhe, die mich interessieren, und über die letzten Jahre hat sich daraus fast schon eine Gewohnheit entwickelt. Ich mache mir einen Spaß daraus, von der Wahl ihrer Schuhe auf eventuelle Eigenheiten zu schließen.
Boots tragen meist die Mädels hier vom Land. Sie sind eigensinnig, selbstbewusst, spielen oft gut Billard und verfallen nicht gleich nach dem ersten Shot in albernes Gegacker. Touristinnen dagegen erkennt man an ihren Wanderstiefeln, die noch keinen einzigen Kratzer im Leder aufweisen und im besten Fall farblich zum Rest des Outfits passen. Diese Ladys sind selten etwas für mich. Sie flirten zwar gern, haben aber in neunzig Prozent der Fälle ihren Ehemann dabei.
Viel Zeit an Hatties Theke und meine gute Beobachtungsgabe haben mich gelehrt, dass meine bevorzugte Zielgruppe Sneakers trägt. Okay, es war nicht immer die Beobachtungsgabe allein … Ein paar zusätzlich gesammelte praktische Erfahrungen untermauern mittlerweile meine Theorie, und darum kann ich auch das Schmunzeln nicht verhindern. Denn Bambi trägt Sneakers. Pink-schwarze Nike-Air-Turnschuhe.
Doch das ist bei Weitem nicht alles, womit sie meine Aufmerksamkeit fesselt. Denn mit nur einer einzigen fließenden Bewegung stößt sie sich ab, ihr Oberkörper verschwindet im Fond des Wagens und dabei gewährt sie mir einen unfreiwilligen Blick auf ihren Hintern.
Ich hole tief Luft. Ja, ich weiß, das macht man nicht, aber was soll ich tun? Ich meine, ich hänge hier mehr in meinem Gurt, als dass ich stehe, während meine Kollegen da oben offenbar erst noch das morgige Mittagessen bequatschen müssen, und diese Bluejeans sitzt mal so was von perfekt, dass ich gar nicht anders kann, als hinzuschauen. Hatte ich schon erwähnt, dass ihr Mann ein echter Glückspilz sein muss? Hoffentlich ist er nicht für das Veilchen verantwortlich.
Und da ist er auch schon wieder dahin, der kurze Moment, in dem ich einfach nur harmlosen Unsinn im Kopf hatte. Durch meinen Job weiß ich leider nur zu gut, dass häusliche Gewalt keine Erfindung gelangweilter Journalisten ist, denen die Ideen für neue Storys ausgehen. Und Bambi hier, eine junge Mutter – ich schätze sie auf höchstens Mitte zwanzig –, ganz allein unterwegs bei diesem Unwetter?
»Davy, hm?«, frage ich. »Verraten Sie mir jetzt vielleicht auch Ihren Namen?« Sie betrachtet mich eingehend. Fast so, als wolle sie abschätzen, wie weit sie mir trauen kann. Doch wieder spricht sie kein Wort und untermauert damit umso mehr den Verdacht, der sich immer deutlicher in mir zusammensetzt: Mit Bambi stimmt irgendetwas nicht. Das ist so klar wie das Wasser des Eklutna an einem Sommertag.
»Amber«, kommt es da aus ihrem Mund. »Ich heiße Amber.« Ihre Stimme klingt so sanft wie die Art, mit der sie ihren Daumen über die winzigen Finger ihres Kindes gleiten lässt.
Der Kleine brabbelt, Bläschen aus Spucke bilden sich vor seinem Mund. Irgendwie eklig, aber er himmelt seine Mama dabei so strahlend an, dass ich lachen muss – gleichzeitig mit ihr. Erschrocken blickt sie auf, doch als ihr Blick auf meinen trifft, wird ihr Ausdruck wieder weich. »Er scheint Sie zu mögen«, sagt sie leise. »Normalerweise hat er es gerade gar nicht so mit Fremden.« Ich schenke ihr ein Lächeln.
Dass ich es für gewöhnlich auch nicht so mit Kindern habe, schlucke ich hinunter. Ja, auch ich kann einfühlsam sein. »Wie ist der Unfall passiert?«, frage ich. Der Old Glenn Highway ist an dieser Stelle kerzengerade, und ich vermute auch nicht, dass sie etwas getrunken hat. Drogen? Nein. So, wie sie sich um ihren Sohn kümmert, macht sie auf mich einen mehr als fürsorglichen und verantwortungsbewussten Eindruck. Trotzdem steht mein Hirn nicht still.
Für gewöhnlich agiere ich in Einsätzen professionell. Freundlich und dennoch reserviert. Die persönlichen Schicksale der Leute an sich heranzulassen kann oftmals schlimmer sein, als das Elend an den Unfallorten zu sehen und zu ertragen. Doch heute ist nicht wie gewöhnlich. Amber. Sie ist nicht wie gewöhnlich. Dieses Mädchen hat irgendetwas an sich, das meine selbst gesetzten Grenzen verschwimmen lässt. Und ich habe keine Ahnung, was.
»Ich bin einem Tier ausgewichen. Ein großes, dunkles.«
»Ein Hirsch? Bär?«
»Nein.« Sie schüttelt den Kopf, und ich verspüre plötzlich den Drang, ihr noch mehr Fragen zu stellen, die sie verneinen kann. Ich mag es, wie die blonden Strähnen um ihr feines Gesicht wippen und versuche, mir vorzustellen, wie sie wohl mit ihrer Naturhaarfarbe aussähe. Denn dass das Blond nicht echt ist, verrät ihr herausgewachsener Ansatz. Er ist dunkel, doch den genauen Ton kann ich in dem Licht nicht erkennen. »Es war eher ein großer Hund, glaube ich.«
Ein Hund? Hier?
»Vielleicht ein Wolf?«, frage ich und freue mich fast schon diebisch über ihr Nein. Wipp, wipp.
»Warum lachen Sie?«
Tue ich das? Tatsache. Ein Grinsen spannt um meine Lippen, und mir fällt auf, dass es das schon ziemlich oft getan hat, seit ich hier unten bin. »Nichts«, sage ich schnell. »Ihr Sohn ist nur so niedlich.« Habe ich gerade wirklich niedlich gesagt? Ich räuspere mich. »Also, dann vielleicht ein Puma?« Berglöwen sind in dieser Gegend zwar eher selten und auch nicht schwarz, aber …
Wipp, wipp.
»Nein, keine Katze. Es hatte auch keinen Schwanz.«
Meine Augenbrauen wandern in die Höhe. Ein großes schwarzes Tier ohne Schwanz? Vielleicht war es dann doch ein Bär. Mir fällt kein Hund aus der Gegend ein, der auf die Beschreibung passen würde.
»Es hat so stark geregnet«, fährt sie fort. »Die Scheibenwischer sind kaum hinterhergekommen, wissen Sie?« Und dann sacken plötzlich ihre Schultern nach unten.
»Hey, hey! Amber!« Verflixt, warum geht diese verdammte Tür nicht auf? »Nicht weinen, okay? Das ist nur Blech. Hauptsache —«
»Das ist nicht nur Blech!«, fährt sie schluchzend dazwischen. »Wenn er …«
Wenn wer was?
»Ist das Ihr Wagen?« Wieder schüttelt sie den Kopf, doch diesmal wünsche ich mir, sie hätte es nicht getan. Die Locken fallen tief in ihr Gesicht, das sie mit einer Hand bedeckt, und unterstreichen die Traurigkeit nur noch mehr. Aus irgendeinem Grund will ich nicht, dass sie traurig ist. »Gehört er Ihrem Mann?« Halt dich da raus, Jess!
»Er ist nicht mein Mann.«
Gut! Nein, Quatsch. Hastig zwicke ich mir in die Nasenwurzel. Was wird das hier? Da höre ich Stimmen über uns. Die Jungs sind im Anmarsch. Amber sieht sie durch die Heckscheibe und wischt sich eilig die Tränen von den Wangen. Ach, Bambi.
Auch der kleine Davy scheint den Stimmungsumschwung zu spüren. Seine runden Backen verfärben sich bedrohlich, werden rot wie Kirschtomaten. Er presst die Augen zusammen, und dann dringen auch schon die ersten abgehackten Schluchzer durch das Wageninnere. Sofort ist Amber für ihn da. Sie beugt sich über ihn und streichelt seine Stupsnase, flüstert beruhigend auf ihn ein.
Und wie aus dem Nichts schwirren Töne durch meinen Kopf. Kämpfen sich aus meiner Erinnerung an die Oberfläche und verbinden sich zu der Melodie, die ich zwar seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe, die ich aber unfähig bin, zu vergessen. In Momenten wie diesen holt sie mich ein – wenn ich die Vertrautheit zwischen Eltern und ihren Kindern sehe. Oder wenn es mir richtig dreckig geht.
Mom hat dieses Lied immer für mich gesungen, wenn ich Bauchweh hatte oder imaginäre Monster unter meinem Bett hausten. Und mit dem dumpfen Schmerz in der Brust, den ich so lange erfolgreich verdrängt hatte, klopfe ich gegen das Blech der Fahrertür. »Keine Sorge, Amber. Bald seid ihr hier draußen.«
Endstation Hoffnung
Amber
»Schhh, mein Liebling. Es wird alles gut.« Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich weiß nicht einmal mehr, ob es richtig war, abzuhauen. Doch Scott war so wütend gewesen. So schrecklich wütend. Er kann es nicht ausstehen, wenn Davy weint, und ich hatte einfach nur noch Angst. Angst, dass es irgendwann nicht mehr reichen wird, mich dazwischenzustellen. Angst, dass er unserem Sohn etwas antut.
Doch jetzt? Ich atme gegen die Tränen an, die sich erneut einen Weg nach draußen bahnen wollen, während zwei weitere Männer am Heck des Wagens hantieren. Es ruckelt. Metall trifft auf Metall. Ich höre ihre Stimmen, blende sie aber aus, weil ich befürchte, dass mein Kopf bald explodiert. Wäre doch nur dieses Tier nicht aufgetaucht. Wie aus dem Nichts hat es plötzlich auf der Straße gestanden, und jetzt habe ich nicht einmal mehr ein Auto.
Davys Schluchzen wird leiser. Sein kleines Köpfchen dreht sich in alle Richtungen, weil die Männer damit begonnen haben, den Wagen an dicken Ketten zu befestigen, und er das unbedingt mitbekommen will. Er ist so wissbegierig, mein kleiner Schatz. Nichts möchte er verpassen und am liebsten überall dabei sein.
Ich streichle seine zarten Wangen und grabe meine Nase in den Spalt zwischen seinem Köpfchen und der Babyschale. Sein unverwechselbarer Geruch beruhigt mich, auch in der größten Not. »Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist.«
»Amber?«
Eine Sekunde lang weigere ich mich, aufzusehen. Es ist der Feuerwehrmann. Sicher will er mir sagen, dass ich mich nun anschnallen soll, aber ich brauche mein Baby noch für einen kleinen Moment.
»Amber? Die Jungs sind so weit.«
Seine Stimme dringt durch die geschäftigen Geräusche um mich herum, und beinahe ist es, als würde er mir nur mit seinen Worten eine warme Decke um die Schultern legen. Mir ist kalt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit seit dem Unfall vergangen ist und wann die Heizung mitsamt dem Motor ihren Geist aufgegeben hat. Beinahe wünsche ich mir, seine Hand halten zu können. Dabei weiß ich, dass er nur nett zu mir ist, weil er seinen Job macht. Aber zu wissen, dass ich nicht allein bin, dass er auf uns aufpasst, tut trotzdem gut.
Ich nicke ihm zu und rücke ein wenig zur Seite. Der Wagen hängt so schräg, dass ich mich mit den Füßen am Vordersitz abstützen muss, um den Gurt anlegen zu können, ohne von der Rückbank zu rutschen. Da gibt es plötzlich einen Ruck.
»Alles gut!« Jesse lacht. »Sie haben nur die Ketten gespannt.«
Angesichts seiner Gelassenheit rutscht mir ein heller Ton über die Lippen. Alles gut, sagt er. Dass mein Herz vor Schreck irgendwo auf Halshöhe pocht, scheint ihm entgangen zu sein. »Bleibst du bei mir? Bitte!« Er nickt. Trotzdem bleibt mein Körper gespannt wie eine Feder. Meine Turnschuhe drücken sich in das Leder des Vordersitzes, meine Finger krallen sich rechts um den Türgriff und links um den Rand des Kindersitzes. Wenigstens Davy hat sich wieder beruhigt und findet die Situation zum Quietschen. Ich zwar auch, aber definitiv aus einem anderen Grund.
»Kann’s losgehen?«, ruft irgendjemand, und mein Blick eilt zu dem Feuerwehrmann. Seine Augen haben die Farbe von dunklem Honig, und ich halte mich an dem Funkeln darin fest.
»Okay?«, fragt er, und ich nicke.
Doch ehe er die Information weitergeben kann, muss ich noch etwas loswerden. »Warte!« Er sieht mich an. Blaulichter tanzen über sein Gesicht, und ein Lächeln spielt um seine Mundwinkel. »Wie heißt du noch mal?« Das Lächeln wird breiter. »Jesse Crawford, Ma’am.« Er tippt sich an den Helm. »Stets zu Ihren Diensten.«
***
Der Weg zurück auf die Straße erinnert mich an den Ausflug in einen Vergnügungspark, den irgendein wohltätiger Spender mal für das Kinderheim organisiert hatte. Ich muss damals acht oder so gewesen sein, und als sie eines der Fahrgeschäfte rückwärtslaufen ließen, erging es mir nicht besser als jetzt.
Die anderen Kinder jubelten und lachten, so wie Davy, nur ich saß mucksmäuschenstill in meiner Ecke und versprach dem lieben Gott, eine Woche lang brav mein Porridge zu essen, wenn er mich hier nur lebend wieder herausließ. Die ganzen sieben Tage lang habe ich beim Frühstück gewürgt und gekämpft, aber ich habe mein Versprechen gehalten. Ich kann Porridge nicht ausstehen.
Jesse ist die ganze Zeit bei uns, hangelt sich Stück für Stück neben dem Wagen her den Abhang hinauf und ist Davys großer Held. Der quietscht und lacht vor Vergnügen, und selbst als der Wagen die Spitze der Böschung überwindet und mit einem Rumpeln zurück auf den Asphalt kippt, wippt er euphorisch mit seinen Ärmchen auf und ab.
Geschafft. Wir stehen wieder waagerecht. Doch die Erleichterung währt nicht lange. Wie soll es jetzt nur weitergehen? Dass der Chevy Schrott ist, bestätigt sich spätestens, als die Feuerwehrleute beginnen, die Fahrertür aufzuhebeln. Das Knarzen des Bleches dröhnt überlaut in meinen Ohren, weil es zugleich auch eine Abschiedsmelodie ist. Bye bye, Freiheit.
Wir sitzen fest. Denn ich kann mir weder ein neues Fahrzeug noch eine Unterkunft für Davy und mich leisten. Die paar Dollars, die ich aus dem Versteck in der Müslipackung mitgenommen habe – Scott würde Müsli nicht einmal anrühren, wenn es das letzte Lebensmittel auf der Welt wäre –, werden höchstens für drei Nächte in einem Motel reichen.
Da kippt der Sitz nach vorn, und eine große Hand schiebt sich in mein Sichtfeld. Schwarze tätowierte Linien schlängeln sich über das von kräftigen Adern überzogene Handgelenk, und sofort schießt mir der Gedanke durch den Kopf, wie leicht es bei ihm wohl wäre, Blut zu nehmen. Als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, war ich bekannt dafür, selbst bei Patienten mit den unsichtbarsten Venen auf Anhieb zu treffen. Den Mann hier vor mir zur Ader zu lassen, wäre keine Herausforderung.
»Mylady, darf ich Sie aus Ihrer Kutsche befreien?«
Was?
Mein Blick schnellt nach oben. Gedanken. Viel zu viele Gedanken toben durch mein völlig überreiztes Gehirn. Ich muss Jesse ziemlich verdattert anschauen, denn er lacht leise und streckt mir seinen Arm noch ein Stückchen weiter entgegen.
»Können … können wir das ganze Ma’am und Mylady nicht einfach weglassen?«, frage ich. »Ich bezweifle, dass du so viel älter bist als ich.« Und außerdem bin ich meilenweit davon entfernt, eine Dame zu sein.
»Klar.« Sein Lächeln erhellt die Nacht. »Komm, ich helfe dir raus.«
»Meine Tasche. Und Davys Sachen.« Planlos deute ich zwischen dem Fußraum des Fahrersitzes und Kofferraum hin und her, wo das wenige Gepäck liegt, das ich mitgenommen habe. Ausweisdokumente und Davys Wickeltasche, ein paar Klamotten und Kosmetikartikel, mehr besitze ich nicht. Es hat alles in einen Rucksack gepasst. Den mit Bambi drauf, den mir meine liebe Kollegin mal geschenkt hat, weil sie meinte, dass meine Augen sie an das Disney-Reh erinnern würden. So oft habe ich mir gewünscht, tatsächlich ein wildes Tier zu sein – oder wenigstens eine Comicfigur.
»Keine Sorge, wir holen alles aus dem Wagen. Ihr beide werdet jetzt erst einmal versorgt.«
Versorgt? Mir bleibt keine Gelegenheit mehr, nach dem Wie und Wo zu fragen, denn Jesses Hand schließt sich um meine. Wärme durchdringt meine Haut. Sein Griff ist fest und zeugt von Stärke, einer Stärke, der ich mich nur zu gerne anvertrauen würde, denn seine Berührung ist dennoch so behutsam, dass ich mich seltsam beschützt fühle. Beschützt. Das bin ich schon lange nicht mehr. War ich es jemals?
Ich blicke auf, in diese Augen, die mich an dunklen Bernstein erinnern. In die Augen dieses Fremden, der mir in den letzten Minuten mehr Trost vermittelt hat, als mein Freund es in drei Jahren konnte, und denke darüber nach, wie glücklich die Frau sein muss, die diesen Mann an ihrer Seite wissen darf. Ich hoffe zumindest, dass sie glücklich ist. Denn ich wäre es.
***
Eingehüllt in eine kratzige Wolldecke sitze ich im Krankenwagen und schaukele Davy in meinem Arm. Die Besatzung aus zwei Männern der Feuerwache kümmert sich rührend um uns. Einer der beiden, er hat sich als Nick vorgestellt, hat meinem Sohn die kleine Taschenlampe überlassen, nachdem der es gar nicht lustig fand, damit geblendet zu werden. Nun ist Davy voll und ganz damit beschäftigt, die Kordel einzusabbern, die daran hängt.
Ich war so lange schon nicht mehr wirklich unter Menschen, dass ich beinahe vergessen habe, wie nett sie sein können. Mein Blick sucht unter den Männern dort draußen, die in der Dunkelheit ihre Ausrüstung verstauen, nach Jesse, und findet ihn bei einem älteren Mann stehend, die Hände lässig in die Seiten gestützt. Seinen Helm hat er abgenommen, das dunkle Haar ist zerzaust.
»Sie sollten Davy jetzt wieder in den Sitz packen, wir fahren gleich los.« Eine Hand auf meiner Schulter reißt mich aus dem seligen Nirgendwo, in das ich gerade abgetaucht war. Nick lächelt mich freundlich an, da höre ich seine Stimme plötzlich neben mir.
»Wo bringt ihr die beiden hin? Soll ich irgendwelche Angehörigen verständigen?« Jesse lehnt in der Tür, seinen Blick auf den zweiten Sanitäter geheftet, der sich gerade hinters Steuer setzen wollte.
Noch ehe der ihm antworten kann, schnellt meine Hand nach vorn. »Nein, nein!«, rufe ich. »Es … es gibt keine Angehörigen.«
Drei Augenpaare auf mich gerichtet, suche ich Jesses Blick.
»Aber …« Ich kann die Fragezeichen sehen, die über seinem Kopf schweben – schließlich hatte ich Scott erwähnt, wenn auch nur am Rand –, doch als er meinen flehenden Ausdruck erkennt, spricht er nicht weiter.
»Ich hab den Doc angefunkt«, sagt Nick und befestigt Davys Kindersitz. »Er weiß Bescheid und erwartet uns in der Klinik.«
»Klinik?« Ich kann nichts gegen den leisen Anflug von Panik unternehmen, der sich in meine Stimme schleicht und mir damit erneut die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden verschafft. »Ich bin Krankenschwester!«, bringe ich schnell hervor. »Uns fehlt nichts, wirklich! Es gibt keinen Grund, uns extra bis nach Anchorage zu fahren. Ein Motel würde uns voll und ganz reichen.«
Jesses Argwohn steigt. Ich sehe es an der Linie, zu der sich seine sanft geschwungenen Augenbrauen verbunden haben.
»Wer redet von Anchorage?«, fragt er, da schaltet sich sein Kollege aber bereits dazwischen: »Ma’am«, er breitet seine Arme aus, »unser schönes County mag Ihnen vielleicht vorkommen, als seien Sie in der letzten Einöde gestrandet, aber Sie hatten Glück: Thunderbird Falls ist noch nicht ganz der Arsch der Welt. Der fängt erst hinter dem KnikRiver an.«
»Nick!« Jesse boxt ihm gegen die Schulter. »Zügle deine Ausdrucksweise, es sind Kinder anwesend.«
Nick lacht. »Oh, sorry. Aber was ich sagen wollte, wir bringen euch nicht extra nach Anchorage. Thunderbird Falls bildet den Mittelpunkt des gesamten Countys, weshalb wir über eine eigene kleine Klinik und sogar eine Feuerwache verfügen.« Nicht ohne Stolz deutet er auf seine Kollegen. »Und ich versichere Ihnen, bei Doc Stacey sind Sie und ihr Kind besser aufgehoben als in Abrahams Schoß.« Der Sanitäter zwinkert mir aus seinen fröhlichen blauen Augen zu, und ich habe gar nicht mehr die Gelegenheit, irgendetwas dazu zu sagen, denn er schiebt Jesse bereits aus der Tür. »Wir sehen uns morgen, Pussycat. Meine Schicht ist in einer halben Stunde zu Ende.«
Äh, Moment! Hastig beuge ich mich nach vorn. Ich habe mich noch gar nicht bedankt! Doch alles, was ich noch sehe, ehe die Tür mit einem satten Flopp ins Schloss fällt, ist Jesse, der sich ebenfalls verrenkt, um mir noch ein schnelles »Alles Gute!« zuzuwerfen. Dann ist er verschwunden, und mein Leben nimmt seinen Lauf. In welche Richtung, das weiß nur das Schicksal allein.
***
»Das ist doch keine Klinik«, entfährt es mir, als ich aus dem Krankenwagen klettere und das Haus anstarre, vor dem wir gehalten haben. Nein, mit einem Krankenhaus hat dieses Anwesen mal so gar nichts gemeinsam, doch auf dem großen hellblauen Schild, das im Vorgarten prangt, lese ich es weiß auf blau: »Thunderbird Falls Medical Center«.
Etwas verloren stehe ich auf dem mit Blumenbeeten eingefassten Fußweg und betrachte die Veranda, die das gesamte zweistöckige Haus einmal komplett zu umlaufen scheint. Der Aufgang ist breiter als bei einem gewöhnlichen Wohnhaus, und neben der dreistufigen Treppe führt eine lang gestreckte Rampe zum doppelflügeligen Eingang hinauf, doch ansonsten würde ich meinen Hintern darauf verwetten, dass hier Menschen wohnen. Wohlhabende Menschen. Mit einem Gärtner und ohne Sorgen.
Austin, der Fahrer, tritt neben mich. Er und Nick haben die ganze Fahrt über in einer Tour geredet. Ich hatte Probleme, der Flut an Informationen zu folgen, mit der sie mich überschütteten, doch ein Entkommen war unmöglich. Und so weiß ich jetzt, dass Austin nach der Heimatstadt seiner Mutter benannt wurde, und dass Nick seine Jugendliebe geheiratet hat. Phoebe! Genau, das war ihr Name.
Es grenzt an ein Wunder, dass mein vollkommen überlastetes Hirn überhaupt noch etwas abspeichert. Wortfetzen und Bilder überschlagen sich in meinen Gehirnwindungen, und ich versuche nur noch, alles einigermaßen in der Spur zu halten, ehe es einen großen Knall macht und mein System die Arbeit komplett einstellt. Nicks Tante Hattie backt ihr drittes Kind, und er und Phoebe bekommen im November die besten Donuts.
Nein.
Stopp!
Andersrum!
O mein Gott … Mein armer Schädel brummt, ich kann meine Augen kaum noch offen halten, doch zum Glück ist wenigstens Davy eingeschlafen. Nick trägt den Kindersitz. Mir wurde verboten, auch nur meinen Rucksack anzurühren, bevor der Doc mich nicht ausführlich untersucht hat.
Sie sind alle so lieb zu mir, dabei möchte ich mich einfach nur noch irgendwo verkriechen und schlafen. Doch vorher werde ich Davy noch mal wecken müssen, er braucht sein Fläschchen und eine frische Windel … und ich habe noch immer keine Ahnung, wo wir heute Nacht schlafen werden. Die Verzweiflung, die Nick und Austin während der Fahrt mit ihrem fröhlichen Geplapper niedergerungen haben, droht mich auf einmal zu überrennen. Mein Puls rast, das Herz pocht mir immer wilder gegen meinen Brustkorb, der sich mehr und mehr zusammenzieht. Halte durch! HALTE. DURCH!
Doch die Angst, wie es nun weitergehen soll, ist zu groß. Die Kraft weicht aus meinen Beinen. Ich knicke ein und spüre gerade noch rechtzeitig Austins Arm um meine Schultern. »Hey!«, sagt er und holt mich mit einem Ruck zurück. Ein fester Griff, ein sanftes Schütteln, und mein Blick klart sich auf. »Das wird alles wieder, okay?«
Ich möchte mich an die Zuversicht in seinem Gesicht klammern, bin so dankbar für jeden kleinen Finger, den man mir reicht, und überwältigt von der Welle der Empathie, die mir seit dem Unfall entgegenschwappt. Nach ein paar langsamen, tiefen Atemzügen habe ich mich wieder berappelt. Aufgeben ist keine Option!
Was hat Nick vorhin gesagt? Ich hätte Glück gehabt, ausgerechnet in der Nähe von Thunderbird Falls von der Straße abgekommen zu sein? Nun ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich Glück nennen soll, aber als Austin mich nun an seine Seite drückt, spüre ich zumindest, dass der kleine Funke Hoffnung in meinem Innern noch nicht ganz verloschen ist. Ein winziges Flämmchen kämpft dort weiterhin ums Überleben. Für meinen Sohn.
***
»Ah, da seid ihr ja! Donna! Kommst du?«
Die Enden seines Kittels wehen, so schnell kommt uns der Mann entgegen, kaum dass wir die Schwelle zur Klinik überschritten haben. Er hat fast weißes, schütteres Haar, seine Oberlippe verschwindet gänzlich unter dem buschigen Schnurrbart, und seine blauen Augen scheinen zu leuchten, als er den schlafenden Davy betrachtet. Ein Namensschild suche ich vergeblich, aber das erübrigt sich, denn Nick stellt uns einander vor. »Doc, das ist die junge Lady. Ihr Name ist Amber. Und der kleine Kerl da heißt Davy. Amber, das ist Doktor Stacey.«
»Oh?« Die Überraschung klingt so deutlich in dem kleinen Wort mit, dass ich versuche, den Moment schnell zu überbrücken, indem ich Doktor Stacey meine Hand entgegenstrecke. Er ergreift sie und lacht, was die Falten um seinen gütigen Blick tanzen lässt.
»Sie hatten eine Frau erwartet, nicht wahr?« Das hatte ich tatsächlich. Er zuckt nur mit den Schultern. »Passiert mir öfter. Aber nun kommen Sie erst einmal mit, damit wir auch wirklich sichergehen können, dass Ihnen nichts fehlt. Donna! Wo steckst du denn?«
Während Austin mein spärliches Gepäck auf dem Sofa abstellt, das im Wartebereich steht, schaue ich mich um. Nope, so eine Klinik habe ich wirklich noch nicht gesehen. Die Möbel sind allesamt aus Naturholz, einschließlich des Empfangs, der wie schon das gesamte Haus eher zu einem Hotel passen würde. Himmelblaue Gardinen schmücken die Fenster, passende Kissen liegen auf den Stühlen und Sesseln, und an den Wänden hängen Ölgemälde.
Erst der Blick in den langen Flur, den Doc Stacey nun entlangeilt und auf dem wir ihm wohl folgen sollen, deckt sich zumindest teilweise mit meinen Vorstellungen eines Krankenhauses, wenn die Behandlungsräume auch lange nicht so steril wirken wie in der Stadt.
Ich bin überrascht von der Modernität der Geräte, die ich erblicke. An der einzigen Tür, die verschlossen ist, hängt sogar ein Schild mit der Aufschrift »Röntgen«. Der Doktor ist zwei Räume weiter abgebogen, und als ich mich beeile, um mit Nick Schritt zu halten, der die Babyschale trägt, prallen wir beinahe mit einer Frau in dunkelroter Schwesternkleidung zusammen.
»Oh, Verzeihung!«, ruft sie lachend. »Ich wollte nur schauen, dass ihr richtig abbiegt. Hi, ich bin Donna.«
Ich ergreife ihre Hand, die sie mir schwungvoll hinhält. Sind hier alle Menschen so gut gelaunt? Mein müdes »Hi« quittiert sie mit einem Zwinkern, und dann darf ich mich endlich wieder setzen. Das Adrenalin in meinem Körper hat sich verflüchtigt und pure Erschöpfung zurückgelassen. Mein Nacken spannt, und ich habe das Gefühl, keine fünf Schritte mehr gehen zu können, ohne vom Schlaf übermannt zu werden. Doch ich weiß, dass ich noch ein wenig durchhalten muss.
Derweil verabschieden sich die beiden Sanitäter. Mit einem aufmunternden Schulterklopfen wünscht Nick mir alles Gute und ist aus dem Raum, ehe ich etwas erwidern kann, doch Austin bleibt bei mir stehen. Unsere Blicke treffen sich, und zum ersten Mal fällt mir auf, dass er graue Augen hat. Hell. Wie der Himmel an einem Wintertag, an dem es noch schneien wird. Strähnen seines dunkelblonden Haares fallen ihm in die Stirn, als er sich zu mir herunterbeugt. »Pass auf dich auf, ja?«, sagt er leise, und dann spüre ich seinen Daumen auf meiner Hand.
Die Berührung ist nur flüchtig, wie unbeabsichtigt, doch der sanfte Druck dahinter irritiert mich. »Vielleicht …« Weiter kommt er nicht, denn Nick ruft von der Tür, dass er seinen süßen Hintern bewegen soll, er habe seit fünf Minuten Feierabend, und als ich zurück zu Austin sehe, hat der sich bereits wieder aufgerichtet. Täusche ich mich, oder ist sein Ausdruck ein wenig zerknirscht?
»Bis dann«, sagt er und wendet sich zum Gehen. Beinahe bin ich erleichtert, denn was immer er mir auch sagen wollte, meine Aufnahmefähigkeit ist ausgereizt, und je weniger Menschen ich um mich habe, auf die sich mein müder Verstand konzentrieren muss, umso besser. Doch etwas hätte ich beinahe schon wieder vergessen. »Austin?« Er ist bereits auf dem Flur.
»Ja?«
»Danke!«
Ein halbseitiges Lächeln bewegt den beginnenden Bartschatten, der sich auf seinen Wangen und dem markanten Kinn abzeichnet. »Dafür nicht, Amber.«
»Doch, gerade dafür«, sage ich. Ich weiß, was die Männer tagtäglich auf sich nehmen. Auch ich habe meinen Job mit Leidenschaft ausgeübt, dennoch war jedes Danke, jede nette Anerkennung meiner Patienten Balsam für die Seele. »Und sag das bitte auch deinen Kollegen, ja?«
Er nickt, und dann ist er verschwunden.
***
»So, das wäre geschafft.«
Eine Stunde später kann ich erleichtert aufatmen. Dr. Stacey konnte bei Davy keine Verletzungen feststellen, und auch meine Nacken- und Kopfschmerzen haben sich durch die Medikamente gelegt. Eine Halskrause lehnte ich dankend ab, auch wenn der Doc meinte, dass es sicher nicht schaden könne.
Doch so schlimm der Wagen jetzt auch aussehen mag, der Aufprall war nicht dramatisch gewesen. Als ich dem Tier ausgewichen bin, hatte ich die Geschwindigkeit aufgrund des Regens bereits so drastisch gesenkt, dass die Schäden am Fahrzeug eher durch sein Eigengewicht entstanden sind. Laut der Feuerwehr ist die Tanne dabei sogar unsere Rettung gewesen. Hätten wir sie verfehlt, wäre das Auto vermutlich den kompletten Hügel hinuntergerutscht. Ich versuche immer noch, auszublenden, was alles hätte geschehen können. Der Wagen ist Schrott, ja. Aber Davy geht es gut, und ich … ich werde klarkommen.
»Hat jemand die Angehörigen informiert?« Dr. Stacey blickt zu Donna hinüber, die meine Personalien aufgenommen hat und mich jetzt stutzig anschaut.
»Es gibt keine, Sir«, komme ich ihr zu Hilfe. »Davy und ich sind allein.«
»Niemand?« Sein verwunderter Blick trifft mich, und ich denke, dass es Zeit für eine Erklärung ist.
»Ich bin alleinerziehend, Sir. Und … viel Geld habe ich auch nicht. Ich hoffe, dass es für die Rechnung reichen wird.« Für einen kurzen Moment schließe ich die Augen. Ich bin am Tiefpunkt angelangt. Nicht zum ersten Mal, doch bisher konnte ich alle Katastrophen in letzter Sekunde verhindern. Irgendeinen Ausweg, einen Lichtschein fand ich immer – und war er noch so klein.
Jetzt aber, hier in diesem Behandlungsraum irgendwo im Nirgendwo, habe ich das Gefühl, auf dem Grund eines ausgetrockneten Brunnens zu sitzen. Ohne Leiter und mit nichts um mich herum als kaltem, glitschigem Gestein. Denn selbst wenn die paar Scheine reichen sollten, um die Arztkosten zu bezahlen, bleibt mir nicht genug, um Davy und mir ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen. Wäre ich allein, wäre das kein Drama, ich bin mir für keine Arbeit zu schade! Aber wer kümmert sich dann um mein Baby?
Und plötzlich fegt ein eisiger Wind durch meinen Brunnen. Er reißt an dem winzigen Flämmchen meiner Hoffnung, dem letzten bisschen Wärme, das sich im Schutz der Anteilnahme, die mir die Menschen heute Abend entgegenbrachten, zögerlich in meinem Herzen ausgebreitet hatte, und hüllt mich in Finsternis. Meine Hände beginnen zu zittern. Ich presse sie aneinander und zwischen meine Knie, während der Kloß in meiner Kehle zu einem riesigen Kürbis anschwillt, der mir die Fähigkeit nimmt, zu sprechen oder auch nur zu atmen. Ich kann nicht mehr zurück! Ich will es nicht! Er wird mich totschlagen! Diesmal wirklich.
»Atmen, Amber. Sie müssen atmen!«
Was?
Hände. Ich spüre Hände auf mir. Auf meinen Knien, an meinen Schultern. Die Berührungen dringen in mich, und ich reiße die Augen auf. Mit einem einzigen Aufkeuchen ziehe ich so viel Luft in meine Lungen, dass ich mich beinahe daran verschlucke. Scheiße! Ich habe die Beherrschung verloren!
»Beruhigen Sie sich. So ist es gut.«
Panisch fixiere ich die Augen des Doktors, der meine Hände zwischen seine genommen hat und demonstrativ in einem langsamen Rhythmus vor mir ein- und ausatmet. »Ein.« Ich blinzle. »Aus.« Panikattacke. »Ein.« Du hast eine Panikattacke. »Aus.«
Ich klammere meine Finger um die des Doktors, spüre, wie Donna mir beruhigend den Rücken streichelt und ebenfalls mitatmet. Und es gelingt mir, meinen Fokus wieder aus der Furcht zu lösen, die mich so blockiert. Ich öffne mich und lasse zu, dass die Hilfe mich erreicht, dass der Sauerstoff wieder in gleichmäßigen Zügen meine Lungen füllt. Dass meine Augen sich allerdings genauso gleichmäßig und unaufhörlich mit Tränen füllen, dagegen bin ich machtlos. Ich kann nicht mehr. »Es tut mir leid«, presse ich hervor. »Es tut mir so leid. Es geht gleich wieder.«
»Na, na, na.« Die Stimme des Arztes ist warm und fürsorglich. Seine Knie rahmen meine ein, während die Wärme seiner Hände mir Trost spendet. »Das kriegen wir alles hin, Miss Richmond. Einverstanden?« Miss Richmond? Ach so, ja, Donna und die Personalien. »Machen Sie sich wegen der Rechnung bitte erst einmal keine Sorgen, und heute Nacht bleiben Sie und Davy auf jeden Fall hier.«
Als ich den Mund aufreiße für den kläglichen Widerspruch, der in meiner Brust brennt, hebt er nur die Hand. »Nichts da. Ihr Zimmer ist bereits vorbereitet. Sie nehmen jetzt eine große Mütze voll Schlaf. Und machen Sie sich wegen Davy keine Sorgen, Donna wird ihn Ihnen abnehmen, falls nötig. Und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.«
Mein Hals ist wie zugeschnürt, und ich könnte schon wieder heulen – vor Dankbarkeit. Der Doc tätschelt meine Hand, und als ich aufsehe, schaukelt die Schwester meinen kleinen Sohn. Das Lächeln, das sie mir schenkt, ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Thunderbird Falls … Womit habe ich dich nur verdient?
Nicht in der Stimmung
Jesse
Das wird nichts. Das sehe ich jetzt schon. Austins blaue Zwei liegt mir im Weg, aber wenn ich der weißen Kugel ein wenig Effet verpasse, könnte es klappen. Klack, klack, klack. Daneben.
»Ist irgendwas?« Austin greift zur Kreide, um seinen Queue für meine Niederlage vorzubereiten. Ich habe ihm die Kugeln mit meinem letzten Stoß quasi als Geschenk hinterlassen, die Acht liegt direkt vor dem Mittelloch. Aber heute ist mir egal, ob ich verliere, und das hat er auch bereits gemerkt.
»Was soll sein?« Ich greife mein Bier von der Ablage, und spüre, dass ich beobachtet werde. Am Tisch nebenan spielen drei junge Frauen, wobei man das Geschubse nicht wirklich Billard nennen kann. Es ist die Sneakers-Fraktion – vermutlich College-Freundinnen, die übers Wochenende einen kleinen Ausflug unternehmen –, und sie tuscheln und kichern schon die ganze Zeit, doch ich beachte sie kaum.