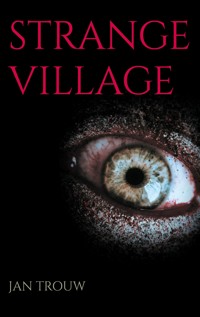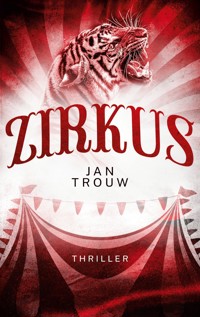Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vor zweihundert Jahren hätte er das Licht der Welt in einem Krankenhaus erblickt. Fürsorgliche Hände hätten ihn in die Arme seiner glücklichen Mutter gelegt. Aber er wurde in der Massenhaltung als Nutzmensch geboren, nur um ein paar Monate später in einem Schlachthaus ermordet zu werden.
Doch er entkommt und wird vom achtjährigen Lux Addax gefunden. Das Alienkind will dem Menschenkind helfen. Aber wie? In einer Welt, in der der Mensch (ohne Sprache und Kultur) als Fleischware gehandelt wird?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Menschenschutzgesetz
Mama
Das Diner
Der Transport
Im Museum
Basebax
Die neue Welt
Gestatten, Lux
Ein Menschenleben
Pex: Das Eintreiben
Die Bettdecke
Frühstück
Wir gehen vor die Tür
Das Dinner
Lexa
Meine rebellierende Tochter
Die Nacht
Sonnenregen
Werbung: Meatlovers
Apoorox: Der Morgen
Auf geht‘s
Bad News
Cazzelstown
Apoorox: Auf dem Markt
Fleischmesse
Die Rettung
Warten
Im Krankenhaus
Das Geständnis
Die Familie
Der nächste Morgen
Besuch des Ministers
Pex: Auf der Veranda
Der erste Kontakt
Willkommen in Haven
Der Vorhang
Fun to Slaughter
Die Bitte
Verluste
Die Beisetzung
Werbung: Preiswert
Apoorox: Wasser oder Medizin?
Der Stick
Werbung: Weibliche Brust
Winora allein nach Haven
Mom?
Das Ei
Apoorox: Heimwärts
Zwickmühle
XC-19
Die Begrüßung
Die Audio-Datei
Die Erkenntnis
Pex: Bei der Bank
Der Copter
Die schwarzen Anzüge
Der Abflug
Mrs. Nook
Lexa
Die Pressekonferenz
Lux
Haven in Aktion
Nix wie raus
Toby
Vor dem Hospital
Werbung: Möner Burger
Haven wer?
Zurück in Haven
Unser Haus
Die Koffer voran
Das Telefonat
Fahr den Kombi vor
Das Veilchen
Die Verfolgung
Konzern, Familie oder Konzern?
Pex: Lebe deinen Traum
In Haven Again
Mr. President
Fleisch, ein Gedicht
Menschenschutzgesetz
(MenSchG)
§ 1
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Menschen als Mitgeschöpf zu betrachten und dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einen Menschen ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen.
§ 2
Wer einen Menschen hält, betreut oder zu betreuen hat, (1) muss den Menschen seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, (2) darf die Möglichkeit des Menschen zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden und (3) muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Menschen erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.
§ 3
Ein Mensch darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden. Einen Menschen töten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.
Mama
Mit Einsetzen der Wehen brachten sie die Frau in den Geburtsbereich, legten sie auf den harten Spaltenboden und ketteten sie an.
Dann ließ man sie allein.
Stundenlang.
Die schwangere Frau schwitzte und verrichtete ihre Geschäfte an Ort und Stelle. Niemand kam, um die Fäkalien um sie herum zu entfernen. Niemand machte die Frau zwischendurch sauber. Ihr Rücken war wund und stellenweise entzündet.
Nach qualvollen Stunden in den Wehen presste sie ihn schließlich heraus. Vorbei an der entzündeten und mit Eiter übersäten Wunde, welche die Körperöffnung am Hintern zierte.
Der Menschenjunge landete in den Exkrementen seiner Mutter.
Wie gern hätte sie ihren schreienden Jungen erblickt und in den Arm genommen, aber die Ketten hielten sie auf dem Rücken. Sie war zu schwach, ihren Kopf anzuheben und zwischen die Schenkel zu schauen.
Vier oder mehr Menschenkinder pro Geburt waren aufgrund der genetischen Veränderung der Spezies keine Seltenheit, und so folgten zwei weitere Jungen und zwei Mädchen.
Ein Junges rang wild zuckend nach Luft, lief blau an. Die Lungen hatten sich nicht vollständig entwickelt. Eine grüne Hand griff nach ihm und schlug seinen Kopf solange auf den Boden, bis er sich nicht mehr rührte.
Er wäre aber auch ohne das Eingreifen von oben gestorben.
Langsam.
An Organversagen.
Er landete in einer der zahlreichen Kadavertonnen, die nach Verfall rochen und bei sensiblen Nasen einen Brechreiz hervorriefen. Der Verwesungsgeruch in der Halle war schon beißend und stechend, aber auf dem Komposthaufen am Rande der Zuchtfarm, wo die Kadavertonnen geleert wurden, war der Gestank unerträglich. Besonders an warmen Tagen unter direkter Sonneneinstrahlung.
Einen Menschenarzt zu beschäftigen, der die Frischgeburten medizinisch betreute oder von den Qualen würdevoll erlöste, war unrentabel. Wegwerfen war billiger. Dabei kam jedes zehnte Menschenkind behindert und nicht überlebensfähig auf die Welt. Eine Folge der Turboschwangerschaften, die eine Menschenfrau in wiederkehrenden Produktionszyklen durchleiden musste. Nach der Schwangerschaft war vor der Schwangerschaft. Keine Zeit zum Durchatmen. Alles betriebswirtschaftlich kalkuliert.
Auch das Leben kannte keine Pausen. Frisch aus dem Mutterleib geschlüpft, bestimmten der Lebenswille und die Durchsetzungskraft die Dauer eines Menschenlebens. Nur die Stärksten und Cleversten überlebten und gaben ihr Erbgut weiter. Der Pfad der Evolution.
Normalerweise.
Wenn die Frischgeburten gewusst hätten, dass ihnen ein befristetes Leben von zwölf Monaten in einer abgedunkelten Halle des Leids bevorstand und der Tod per Terminkalender auf sie wartete, so hätten sie auf der Stelle aufgehört zu atmen und wären tot umgefallen. Ihr Erbgut wurde nicht an die nächste Generation weitergegeben, sondern landete mit ihrem Fleisch auf dem Essteller. Doch die Frischlinge folgten ihrem Instinkt und kämpften um die Brüste ihrer Mutter, die erschöpft auf dem Rücken lag. Die Brüste der Nutzfrauen waren anatomisch größer und praller als zu Zeiten der menschlichen Herrschaft, aber sie besaßen nach wie vor nur zwei Zitzen. Eine Zitze war durch die vorherigen Schwangerschaften und Stillphasen eingerissen, hatte sich leicht gelöst. Bald würde sie mangels Durchblutung verfaulen und abfallen. Aber darauf nahmen die Frischgeburten keine Rücksicht. Sie rangelten um die Muttermilch, saugten und rissen an den Zitzen, als ginge es um Leben und Tod. Nur zwei Kinder konnten zur selben Zeit saugen. Die anderen mussten warten oder die saugenden Geschwister wegdrängen.
Die erste Milch war lebensentscheidend. Sie beinhaltete Immunglobuline, die die Neugeborenen gegen Krankheiten immunisierte. Quasi die erste Impfung. Wer davon nicht genug erhielt, hatte schlechte Karten.
Wenn ein Frischgeborenes die ersten vierundzwanzig Stunden überlebte, brannte sich eine Nummer in dessen Nacken. Ein Junges bekam die Zahl 2134-13 eingraviert.
Dann ging es den männlichen Jungen an die Kronjuwelen. 2134-13 war wehrlos, als die grüne Hand von oben auf ihn zukam, seine Fußgelenke packte und ihn in die Luft hob. Er war machtlos, als die Messerklinge durch die dünne Haut seines Hodensacks glitt und die Eier herausgedrückt zu Boden plumpsten. Alles ohne Betäubung, denn Betäubungsmittel waren weitere unnötige Kosten und in der Produktkalkulation nicht vorgesehen. Das Produkt musste billig sein. Billig, billig, billig.
Die Kastration der männlichen Nutzmenschen diente nicht der kontrollierten Fortpflanzung. Mit Ausnahme weniger Männer, die ihr Dasein als Zuchtmaschinen fristeten, endeten sie noch vor ihrer Geschlechtsreife als Boulette oder billiges Hack. Nein, die im Hoden produzierten Geschlechtshormone verfälschten das spätere Konsumerlebnis, und der Geschmack des Fleisches war ein wichtiges Verkaufskriterium.
Der Verbraucher war King, der Eigentümer der Hoden nicht.
Nach zweiundsiebzig Stunden im engen, versifften Zwinger wurden die Kinder vom Muttermenschen getrennt. Für immer. Nach Geschlechtern sortiert, landete 2134-13 in einer Halle ohne Frischluft und Tageslicht. Ein Ort der Finsternis, der Qualen und der Tränen. Die Menschenkinder weinten um den Verlust ihrer Mütter.
Für 2134-13s Mutter war es der letzte Geburtszyklus. Sie war zu abgemagert und zu verbraucht. Selbst für den Schlachthof besaß ihr Fleisch nicht die erforderliche Qualität. Sie wurde zum Sterben zurückgelassen und endete auf dem Komposthaufen, wo die Sonne den körperlichen Verfall anheizte.
Das Diner
Der Geschäftsmann, der fröhlich von einem Termin zum nächsten hetzt und sich über den sichtversperrenden Aktenberg auf dem Schreibtisch freut, ist kein Mensch, sondern ein humanoides Alien mit grüner Haut, vier Armen und vier Händen; und mit zwei Fühlern auf dem Kopf.
Eine Tennisspielerin der gleichen Gattung holt mit dem letzten Schlag den Sieg und hält den Pokal in ihren vier Händen.
Eine junge Familie picknickt am Meer. Der Vater hält sein Neugeborenes vor Freude in die Luft. Die Haut des Neugeborenen ist noch weiß, und die Fühler nur wenige Millimeter lang. Richtig niedlich.
Dann erklingt eine warme Stimme.
„Sie geben alles für Ihren Job? Für Ihre Karriere? Für Ihren Sport? Für Ihre Familie? Wir möchten Ihnen etwas zurückgeben. Wir von Humeat Limited sorgen seit einhundert Jahren dafür, dass Sie das bekommen, was Sie verdienen.“
Eine idyllische Alpenwiese. Menschen, die auf allen vieren sorgenfrei umherspringen und mit ihrem Nachwuchs kuscheln.
„Unser Fleisch stammt von fröhlichen, gesunden Menschen. Wir sind der Beweis, dass eine artgerechte und nachhaltige Menschenhaltung zu einem fairen Preis keinen Widerspruch darstellt. Bauchspeck, Hintern-Schinken, Baby Nuggets, Mönerfleisch oder weibliche Brust. Gönnen Sie sich das Beste, damit Sie den Alltag spielerisch meistern.“
Ein schlankes, grünes Wesen sticht mit der Gabel in ein ansehnliches Stück Fleisch und steckt es sich genüsslich in den Mund.
„Menschenfleisch von Humeat Limited.“
Solche Werbespots liefen täglich über die Hologrammbildschirme. Wie auch im gut besuchten Diner am Highway. Die bunten Werbefiguren, die den Screen verließen und durch den Raum schwebten, wirkten wie aus Fleisch und Blut. Die Gäste des Diners, vorwiegend Trucker und bizarre Eigenbrötler, blickten nur flüchtig hin, während sie das Fleisch in ihre grünen Schlünde schaufelten und ihre innere Einsamkeit und Traurigkeit mit dunklem Zuckerwasser, Kaffee oder dem bierähnlichen Getränk Urina hinunterspülten – und es war gerade erst Mittag. Die meisten keuchten und atmeten dabei schwer. Sie waren sichtlich weniger schlank als die im Werbefilm gezeigten Wesen.
Wie der füllige Trucker, der am Tresen saß und eine Riesenportion Schnitzel inhalierte. Sein Trucker-Cap hatte oben zwei Öffnungen, durch die seine Fühler herausschauten.
„Das schmeckt köstlich. Wie immer“, schwärmte er. „Ich liebe deine Schnitzel.“
„Du kannst mich jeden Tag loben, Darling, aber der Tresen hier trennt uns. Wie immer“, erwiderte die Kellnerin und zwinkerte. „Außerdem musst du meinen Mann um Erlaubnis bitten, mich freizugeben. Er dürfte darüber nicht erfreut sein.“
„Ich sagte, ich liebe das Schnitzel, nicht dich“, konterte der Trucker. „Aber, wenn dem so wäre, vielleicht gibt mir dein Mann den Segen mit Kusshand?“
Beide lachten.
„Wie lange ist das jetzt her?“, fragte sie, und das Lachen des Truckers erstarb.
„Drei Jahre“, antwortete er. Warum musste sie ihm die Freude über das Essen und dem nicht ernst gemeinten Flirt nehmen? Er legte das Messer und die Gabel beiseite und kaute langsam auf dem Stück Schnitzel herum. Der Drang, es hinunterzuschlucken und durch ein neues zu ersetzen, blieb aus.
Der Kellnerin schien ihre Frage leidzutun und schob den Grund nach. „Es steht mir nicht zu, aber meinst du nicht, dass es Zeit wäre, erneut dein Glück zu versuchen?“
Der Trucker spülte das Fleischstück mit Kaffee den Rachen hinunter. Er wollte nicht antworten, aber die Kellnerin hielt Augenkontakt.
„Mein erhöhter Bluthochdruck macht mir zu schaffen“, sagte er schließlich. „Meine Pumpe spielt ganz schön verrückt. Das Atmen fällt mir teilweise schwer. Ich fühle mich oft schlapp und müde. Außerdem möchte ich nicht noch eine Frau an Darmkrebs verlieren.“
Die Kellnerin ließ die Antwort nicht gelten.
„Schau dich um, Darling. Die meisten von uns sind übergewichtig oder haben Wehwehchen, gegen die wir Pillen nehmen. Das gehört zum Älterwerden dazu. Wir alle haben irgendjemanden an Krebs verloren. Oder an einen Herzinfarkt. Ich habe Diabetes Typ zwei. Und mein Mann hat bereits vier Bypass-Operationen hinter sich. Dank der modernen Medizin bedeutet eine Krankheit nicht gleich den Tod. Mit Operationen und Medikamenten dürfen wir unser gewohntes Leben weiterleben.“
„Da ist was dran.“ Im Gesicht des Truckers kehrte ein Lächeln zurück. „Wie heißt es so schön? Unverhofft kommt oft, oder?“
„So sicher wie der nächste Sonnenregen“, bestätigte sie.
Wieder lachten beide.
„Die treten immer häufiger auf“, stellte der Trucker fest. „Globale Erderwärmung oder so. Irgendwann dürfen wir nur noch mit Schutzanzügen raus. Das haben wir den Menschen zu verdanken. Die haben den Planeten zerstört, und wir müssen es ausbaden.“ Er beförderte das letzte Stück Fleisch in seinen Schlund.
„Noch Kaffee?“, fragte die Kellnerin. Er nickte, und sie füllte mit der oberen rechten Hand auf; die unteren Hände vor der Schürze verschränkt.
„Dank der Klimaanlage hast du es schön kühl hier drin. Du glaubst nicht, wie heiß es im Führerhaus werden kann. Und die warmen Temperaturen sind nicht gut für meine Ladung. Deswegen muss ich gleich weiter. Auch wenn ich mich nur ungern von dir trenne.“
„Du Charmeur. Ich weiß genau, dass du wegen meiner Schnitzel wiederkommst.“
„Du hast mich durchschaut, Liebes.“
Der Fahrer verließ wenig später das Diner und setzte sich in den Sattelzug, der in der prallen Sonne parkte.
Mit Menschen beladen.
Seitlich am Anhänger zierten das Logo und der Slogan der Firma:
Humeat Ltd. est. 2054 100 Jahre gesundes Menschenfleisch
In der Fahrerkabine brutzelte es. Der Fahrer wischte sich den Schweiß von der Stirn und richtete sein Cap, welches dabei in Schieflage geraten war. Dann aktivierte er den Startknopf. Der Truck ohne Reifen erhob sich einige Zentimeter vom Boden und verdrängte die staubige Sandschicht unter sich. Kein vertrautes Fauchen eines Achtzylinders unter der Motorhaube. Keine Rauchschwaden aus den Auspuffrohren an der Rückseite des Führerhauses, denn es gab keine. Der Truck schwebte sanft wie der Wind und leise vom Parkplatz und über den betonierten Highway davon.
Der Transport
Seine Augen waren dem Leben in der abgedunkelten Halle angepasst. Das Sonnenlicht, welches jetzt durch die Gitterfenster des Transporters schien und ihn blendete, war anfangs schmerzhaft gewesen. Seine Augen mussten sich an die Helligkeit erst gewöhnen. Und der Hunger, der Mangel an Schlaf und die stickige Luft führten ihn an die Grenzen des Erträglichen.
Physisch.
Psychisch.
Der zwölf Monate alte Junge von der Größe eines Vierjährigen mit der Nummer 2134-13 im Nacken hätte sich gern hingelegt oder hingesetzt, doch eng zusammengepfercht, hatte er nicht die Möglichkeit dazu.
Der Fahrer stoppte nur, um das Fahrzeug schwer atmend zu verlassen und mit einem schmerzverzerrten Gesicht in eine Gaststätte zu humpeln. Viele der grünen Wesen darin waren übergewichtig. Sie wirkten träge, bekamen schwer Luft und ihre fettige Haut glänzte. Anders das schlanke grüne Wesen auf der Neonreklame, das an der Einfahrt der Gaststätte für Menschenfleisch warb und die Ankömmlinge mit glücklichen Augen begrüßte.
Was auch immer die Wesen im Diner aßen und tranken, es regte 2134-13s Speichelfluss an, und sein leerer Magen knurrte. Er und die anderen Menschenkinder waren seit über sechsunddreißig Stunden in dem Transporter. Der Fahrer kam nicht zu ihnen, um sie zu füttern oder ihnen Wasser zu geben, geschweige denn, sie an der frischen Luft austreten zu lassen.
Die fünfunddreißig Grad im Schatten knallten erbarmungslos aufs Dach. 2134-13s Kreislauf drehte durch, ihm fielen vor Erschöpfung immer wieder die Augen zu. Würden die Kinder nicht eng beieinanderstehen, wäre er längst zu Boden gesackt und erstickt, oder hätten die anderen ihn totgetreten.
Die Luft war dünn und beißend. Nur der Fahrtwind, der über die Gitterfenster ins Innere drang, verschaffte Abkühlung und sorgte für einen geringen Luftaustausch. Der penetrante Geruch von Kot, Urin und Erbrochenem dominierte. Vor allem, wenn der Truck ungeschützt in der Sonne parkte. Die Menschenkinder ließen ihren Geschäften freien Lauf. Sie pinkelten und kotzten sich gegenseitig an. Ihre Scheiße lief die Beine entlang zu Boden oder blieb am Körper kleben und vertrocknete. Viele von ihnen husteten und niesten. Die Sporen und Viren flogen umher und steckten die gesunden Kinder an. Auch 2134-13s Hals kratzte. Das Schlucken tat ihm weh. Glücklicherweise hatte er nur noch wenige Stunden zu leben, sodass ihm eine fette Erkältung erspart blieb.
Die Bedingungen im Transporter waren unerträglich, und die angeschlagenen Kinder kämpften um jeden Zentimeter Platz. Die Toten, und die, die im Sterben lagen, stapelten sich um die Füße der Lebenden. Wie bedauerlich, so kurz vor dem Ziel.
Kein Gesetz grenzte die Dauer eines Menschentransports ein. Und nirgendwo stand, dass man die Menschen währenddessen mit Nahrung und Wasser zu versorgen habe. Allein die Unternehmen, die über die Transportware verfügten, bestimmten darüber. Die Transporte beschränkten sich jedoch meist auf Stunden oder ein, zwei Tage, schließlich sollte die Ware den Schlachthof lebend erreichen. Denn tote Menschen wurden nicht geschlachtet, sie landeten unverbraucht im Müll.
Aus den vorbeifahrenden Fahrzeugen kamen neugierige Blicke - es waren so viele -, doch niemand alarmierte die Polizei, um die Kinder zu befreien. Der Truck fuhr ungehindert zum Ziel. Selbst die grünen Wesen in den Gaststätten schenkten ihnen keine Aufmerksamkeit; wie die Kinder in der stickigen Hitze auf dem Parkplatz dahinsiechen.
Im Museum
Museen konservieren historische Ereignisse, damit die in der Gegenwart Lebenden diese nicht vergessen und vergangene Fehler nicht wiederholen.
Das Museum in Cazzelstown wirkte auf den ersten Blick menschlichen Ursprungs, doch in der Eingangshalle und in den Gängen wanderten grüne Wesen umher. Mit zwei Fühlern auf dem Kopf; und mit vier Armen und vier Händen. Ihre klackenden und surrenden Stimmen schallten über die Flure.
Wie jeden Vormittag unter der Woche fanden auch heute Schulführungen statt. Die meisten Schüler der Klasse langweilten sich. Okay, immer noch besser als im Unterrichtsraum auf die Tafel zu starren, aber sie wollten zu gern die Skelette und Nachbildungen von Riesenechsen und prähistorischen Säugetieren bestaunen. Der T-Rex, der Diplodokus, der Säbelzahntiger oder das drei Meter hohe Faultier in der Nebenhalle waren faszinierender als die Spezies Mensch, die bei ihnen jeden Tag auf dem Teller landete. Selbst Tiere, die durch das zerstörerische Verhalten des Menschen ausgestorben waren - wie der Eisbär oder der Condor -, waren spannender. Doch heute standen für Lexa und ihre Klassenkameraden die Kolonialisierung von Terra Nova auf dem Unterrichtsplan. Die Exponate in der Halle (3D-Modelle, Hologramme und gefundene Relikte der Menschheit wie etwa Kleidung, ein Barbecue-Station-Grill, ein Automobil mit Reifen und fossilem Brennstoffantrieb, ein Space-Shuttle und ein unglaublicher Berg aus bunten Plastiktüten) veranschaulichten die Epoche vor der Besiedlung, zu einer Zeit, als der Mensch den Planeten beherrschte – wie primitiv er doch gewesen war.
„Könnt ihr mir sagen, warum unsere Vorfahren damals auf Terra Nova gelandet sind?“, fragte die Museumsmitarbeiterin. Sie trug eine Brille mit Kette, wie Bibliothekare sie gern trugen, eine, die man nach dem Absetzen vor die Brust hing.
„Weil unser Heimatplanet vor dem Kollaps stand und wir fliehen mussten“, sagte die Quotenstreberin der Klasse.
„Richtig“, sagte die Museumsmitarbeiterin zufrieden.
„Könnt ihr mir auch sagen, wie die Menschen den Planeten nannten?“
„Erde“, sagte jemand. Wieder die Streberin. In der Schule wurde sie für das strebsame Beantworten von Fragen gemobbt, aber jetzt waren die Mitschüler ihr dankbar. Doch Frau Lehrerin nahm ihnen den Joker und drohte damit, einen Test darüber schreiben zu lassen, wenn die Klasse sich nicht einbrächte.
Auch Lexa war nur halbherzig dabei. Sie wollte zu den Dinosauriern. Der Brachiosaurus faszinierte sie am meisten. Etwa fünfundzwanzig Meter lang, dreizehn Meter hoch und vierzig Tonnen schwer. Er war einer der größten Dinosaurier; und Pflanzenfresser.
„Was geschah, als unsere Vorfahren den Menschen eroberten und den Planeten übernahmen?“, fragte die Museumsmitarbeiterin.
Lexa hob gelangweilt ihre obere rechte Hand und bekam das Wort. „Unsere Anführer Ypsi Cran und Decker Cran stritten sich darüber, wie Terra Nova besiedelt und kultiviert werden sollte. Ihr Streit löste den Zwanzigjährigen Krieg aus.“
„So ist es“, sagte die Museumsmitarbeiterin. Lexas Ausdrucksweise wie ‚kultiviert‘ beeindruckte sie. Ungewöhnlich für das Alter. „Schauen wir uns das in einem kurzen Film an.“
Die Gruppe verschwand in einem kleinen Kinoraum. Der Vorhang schob sich beiseite und gab die Leinwand frei. Patriotische Musik ertönte, und eine Erzählstimme setzte ein.
„Einst hat der Mensch den Planeten Terra Nova, den er selbst Erde nannte, dominiert. Der Mensch spielte Gott und unterwarf die anderen Lebewesen. Er nannte sie Tiere und Pflanzen, um sich von ihnen abzugrenzen und abzuheben. Der Mensch zerstörte die Wälder, vergiftete die Gewässer und rottete die Tierwelt aus. Selbst vor seiner eigenen Spezies machte er nicht halt. Er zerfleischte sich selbst und verlor sich in sinnlose Kriege und egozentrische Selbstverwirklichungen.“
Das gezeigte Archivmaterial aus der Zeit des Menschen und die bedrohliche Hintergrundmusik zeichneten das Bild eines schrecklichen Dämons: zwei Weltkriege, der Vietnamkrieg, Straßenschlachten, Vergewaltigungen, die Vergasung der Juden, Todesstrafen in China und den USA, Rodungen der Regenwälder, Tschernobyl, auslaufende Öltanker in den Meeren und leergefischte Ozeane durch kilometerlange Fangnetze. Es nahm kein Ende. Der Mensch war zweifellos böse. Eine egoistische und angriffslustige Kreatur.
Lexa hätte sich lieber einen Film über Dinosaurier angesehen.
„Die Auswirkungen des menschlichen Handelns beeinträchtigen unser heutiges Leben“, sagte die Erzählstimme weiter. „Irreparable Schäden im Ökosystem und bedrohliche Wetterphänomene sind unser Erbe. Sonnenregen etwa treten immer häufiger auf, sie werden immer gefährlicher. Unsere Führer stritten darüber, wie Terra Nova für unsere Bedürfnisse gestaltet werden sollte und löste den Zwanzigjährigen Krieg zwischen den Ypsi- und Decker-Anhängern aus.“
Die eingeblendeten Kriegsbilder waren nicht weniger grausam als die der Menschenkriege, aber die musikalische Untermalung war jetzt heroisch-patriotisch.
„Ressourcen wie Munition und Nahrung schwanden auf beiden Seiten. Die Decker-Anhänger änderten ihre Ernährung, stiegen auf Menschenfleisch um. Der Vorteil: Es war ausreichend vorhanden. Etwa neun Milliarden Menschen besiedelten vor unserer Landung den Planeten. Man musste sie nur einfangen, schlachten, ausnehmen und verzehren. Die Ypsi-Anhänger hingegen lehnten Menschenfleisch ab, verweigerten sich diesem. Sie ernährten sich pflanzlich. Die Pflanzen mussten sie jedoch anbauen und bewässern, und hoffen, dass der vom Wetter abhängige Ertrag sie ausreichend versorgte. Zudem führen Pflanzen dem Körper weniger Energie zu als Menschenfleisch. Menschenfleisch besitzt Proteine, die einen groß und stark machen. Es ist der Energieträger schlechthin.
Und dank des Menschenfleischs gelang den Deckern der Sieg. Die Ypsi wurden in die Wüste geschickt. Sprichwörtlich. Ihre Nachfahren besiedeln heute die armen Regionen in Apoorox.
Decker Cran wurde Präsident, und der Platz vor dem Präsidentenpalast zu seinen Ehren Decker Plaza benannt.“
Der Lehrfilm endete mit dem Slogan eines Sponsors.
„Dieser Film wurde Ihnen präsentiert von: Humeat Limited. Gönnen Sie sich nur das Beste, damit Sie den Alltag spielerisch meistern.“
Die Leinwand wurde schwarz, der Vorhang zog sich zu und das Licht ging an. Die Museumsmitarbeiterin klatschte in die Hände.
„Seht ihr Kinder? Dank des Menschenfleischs leben wir heute in einer friedlichen und fortschrittlichen Zivilisation. Hätten die Ypsi gewonnen, wären wir längst zugrunde gegangen. Seit also dankbar für das, was ihr habt. Genießt euer Leben und vertraut den Politikern. Sie führen das Erbe des großen Decker Cran fort.“
Lexa verdrehte die Augen. Die Geschichte der Cran-Brüder stand jedes Jahr auf dem Lehrplan. Auf dem Hologrammbildschirm daheim liefen regelmäßig Dokus dazu. Und als ob das nicht reichte, riss Vater das Thema immer wieder an. Doch Lexa kannte eine weitere Version. Eine inoffizielle Version, die eine Untergrundorganisation in Umlauf brachte. Die Gruppe wurde von der Regierung nur geduldet und stand unter Beobachtung.
Nach der Tour durchs Museum ging es für die Klasse mit dem gelben Schwebe-Schulbus zurück in die Lehranstalt. Der Mensch hatte das folgende Fach Hauswirtschaftslehre genannt, mit dem Lehrziel, den Kindern das Kochen beizubringen. Bei den Deckern hieß es Lehre zur Körperstärkung. Dort stand Menschenfleisch in seiner Vielfalt auf dem Speiseplan, damit die Decker auch zukünftig den Planeten beherrschten.
Ab morgen zum Glück Ferien, dachte Lexa, die vom heutigen Unterrichtstag genug hatte.
Basebax
Die Decker waren sportbegeisterte Wesen, wenn auch mehr als Zuschauer, denn während die Heranwachsenden in der Schule und in den Vereinen aktiven Sport betrieben, verschlug es die Erwachsenen auf die Couch. Nur wenige besuchten ein Fitnessstudio oder drehten eine Runde durch den Park. Der Lieblingssport der Decker war Basebax und dem Baseball ähnlich. Mit einer Ausnahme: Die verteidigende Mannschaft konnte ebenfalls punkten. Dazu musste sie nach Abschlag des Gegners den Ball direkt aus der Luft fangen und auf einen Gegenspieler werfen, der über die Bases rennt.
Im Stadion herrschte ein monotones Dauergemurmel aus sechzigtausend Stimmen. Nur gelegentlich gab es AAAH- und OOOH-Laute von den Zuschauerrängen. Und vor den Ausschänken bildeten sich lange Schlangen. Die Fans hatten einen unermesslichen Appetit nach Hotmogs und Humeat Burger; und großen Durst nach dunklem Zuckerwasser oder dem bierartigen Getränk Urina. Sie nahmen so viele Getränke und Speisen mit, wie sie mit ihren vier Armen und Händen balancieren konnten.
Basebax-Spieler wie Derek Jetex, David Ortizex, Mike Troux, Babe Rux oder CY Younx wurden für ihre Erfolge geliebt und geehrt. Natürlich hatten diese Stars einmal klein angefangen, als die Fühler gerade so aus ihren Köpfen hervorgeschaut hatten. Kein Wunder also, dass viele junge Decker von einer Karriere als Profispieler träumten.
Wie auch der achtjährige Lux Addax aus Suburbia, einem Vorort der Millionenmetropole Cazzelstown. Obwohl er nicht vor sechzigtausend Fans im Stadion spielte, sondern vor einer Handvoll Zuschauer auf einer kleinen Holztribüne, fühlte er sich wie ein Großer. Sein Trainer meinte, er habe Potenzial.
Lux‘ Verein spielte in der Jugendliga und hatte schon einen Sponsor: Humeat Limited, der dem Team regelmäßig verschiedene Sorten Menschenfleisch spendierte und somit für gesellige Abende im Klubhaus sorgte, zu denen auch die Eltern herzlich eingeladen waren.
Im bisherigen Spielverlauf hatte Lux im Angriff einen Hit gelandet und in der Verteidigung zwei Gegner abgeworfen. Seine Mutter jubelte ihm zu. Bei jedem seiner Erfolge schwangen ihre Fühler auf dem Kopf aufgeregt auf und ab.
Lux‘ Vater fehlte auf der Holztribüne. Als CEO verbrachte dieser viel Zeit in seinem Unternehmen, dessen imposanter Wolkenkratzer sich tadellos in Cazzelstowns Gebäudelandschaft einfügte. Die kilometerweit entfernte Skyline der Metropole war vom Spielfeld aus gut zu erkennen. Am Tage eine glanzlose Architekturwüste in Grau, in der Dunkelheit ein bläulich-rot-violettes Lichtermeer aus Hologrammen und Neonschriftzügen. Lux blickte immer wieder unbewusst dorthin.
Seine sechzehnjährige Schwester Lexa hing nach der Schule lieber mit ihren Freundinnen im Einkaufszentrum ab und schwärmte für das andere Deckergeschlecht. Ihre Abwesenheit störte ihn nicht. Hauptsache, er konnte Basebax spielen. Bei dem Spiel wirkte er wie ein gesunder Junge. Es gab genug Phasen zum Ausruhen. Neunzig Minuten am Stück laufen, oder mehrere hundert Meter schwimmen, schaffte er nicht. Gern wäre er so fit wie seine gleichaltrigen Teamkameraden oder Mitschüler, aber er gehörte zu denjenigen, die krank geboren wurden. Er war der Einzige aus dem Team, der mithilfe eines Chips im Oberarm regelmäßig den Zuckerspiegel maß und sich spritzte.
In zehn Jahren wäre er alt genug, um in der Major Basebax League zu spielen. Sein selbst auferlegter Karriereplan beinhaltete bis dahin ein hartes Training, Disziplin und eine ausgewogene Menschenfleischernährung. Und keine Mädchen. Die waren doof. So doof wie seine Schwester.
Am Ende gewann sein Team das Spiel mit einem Punkt Vorsprung.
Die neue Welt
Die Scheibenwischer vertrieben die Regentropfen von der Windschutzscheibe, und im Nachthimmel zeichneten Blitze wirre Striche. Der Wind tobte um den Truck, das Stabilisierungsprogramm hielt ihn in der Spur. Aquaplaning wie zu Zeiten der menschlichen Reifentechnologie gehörte der Vergangenheit an. Das Fahrzeug schwebte unbeirrt über den nassen Highway.
In der Fahrerkabine dudelte das Radio. Der Gesang glich einem tiefen Klacken, gepaart mit einem metallischen Surren. Als wenn ein Insekt und ein Roboter bei miesem Empfang ein Duett sangen. Für das menschliche Ohr eine Vergewaltigung.
Mit drei Händen am Lenkrad wechselte die vierte Hand des Fahrers den Sender. Und auch der neue Song mit befremdlichem Gesang war für das menschliche Ohr unerträglich. Der Fahrer jedoch wippte mit dem Kopf zum wilden Rhythmus. Seine Fühler baumelten. Die quiekenden und grunzenden Menschen im Anhänger vernahm er nicht. In den Anfangstagen als Fahrer hatte ihn das noch verrückt gemacht, doch jetzt blendete sein Gehirn die lästigen Hintergrundgeräusche aus.
Die Zigarette in seinem Mundwinkel beruhigte ihn, der Aschenbecher quoll bereits über. Selbst beim roten Dreieck, welches jetzt auf der unteren Hälfte der Frontscheibe aufblinkte, bewahrte er Ruhe. Im Fahrzeug kommunizierten diverse Computerprogramme miteinander. Das rote Dreieck konnte alles Mögliche bedeuten. Solange die technische Störung die Fahrt nicht beeinflusste, war alles okay. Selbst als das rote Dreieck konstant aufleuchtete, blieb er gelassen. Er verließ die Autobahn und setzte die Reise auf der Landstraße fort. Er sah nicht ein, rechts heranzuschweben und auf den Pannendienst zu warten. Oder in die Werkstatt zu fahren und blöde Formulare auszufüllen. Er wollte pünktlich Feierabend machen.
Und irgendwer hatte Erbarmen mit ihm. Das rote Dreieck erlosch, und zauberte beim Fahrer ein Lächeln hervor. Wohl ein Fehlalarm.
Doch die Freude hielt nur kurz, die Elektronik setzte aus. Ohne das Stabilisierungsprogramm war der Truck für den Wind leichte Beute. Die nächste Bö drückte ihn gegen einen Baum, und der Aufprall schickte ihn zurück auf den Asphalt. Durch die Wucht riss der Anhänger von der Zugmaschine, ratschte über die Straße und kam schließlich zum Liegen. Der Fahrer flog durch die Frontscheibe und blieb mit dem Rumpf in dieser stecken. Er zierte die Motorhaube wie eine blutverschmierte Kühlerfigur.
Das Radio verstummte, und das Quieken und Grunzen der Menschen durchbrach die Stille der Nacht.
Zwei Polizisten entdeckten den Unfall und stiegen von ihren schwebenden, Jetski-ähnlichen Gefährten. Die Blitze reflektierten in ihren weißen Helmen, aber ihre Gestalten blieben in der Dunkelheit verborgen. Sie betrachteten den toten Fahrer mit dem zerteilten Gesicht und dem abgeschnittenen Fühler in der Windschutzscheibe. Erst dann widmeten sie sich dem auf der Seite liegenden Anhänger. Die zerbeulte Heckklappe stand einen Spalt offen, und im Laderaum lagen nur die toten und schwer verletzten Menschenkinder. Die anderen hatten diesen instinktiv verlassen. Sie hatten sich durch die schmale, scharfkantige Öffnung der deformierten Klappe gewunden.
Gehend.
Krabbelnd.
Kriechend.
Doch sie waren nicht weit gekommen. Ihre verstümmelten und verkrüppelten Gliedmaßen vereitelten die Flucht. Sie schrien, als ob man ihnen bei Bewusstsein die Haut abzog.
Dem Jungen mit der Nummer 2134-13 im Nacken gelang als Einziger die Flucht. Auf allen vieren war er in ein Gebüsch gekrochen, von wo aus er beobachtete, wie die Polizisten ein auf der Straße liegendes, noch atmendes Menschenkind anstarrten. Beim Herauswinden durch die aufgerissene Heckklappe hatte es sich die Bauchdecke aufgeschlitzt. Die Hälfte der Gedärme - teilweise noch mit dem Körper verbunden - lag in einer Pfütze. Die harten Regentropfen prasselten auf die Organe und verursachten einen höllischen Schmerz. Der Regen schaffte es nicht, das Blut des Opfers von der Straße zu spülen.
Die Polizisten dachten nicht daran, dem Menschenkind zu helfen; oder die anderen einzufangen. Deren Krankheitserreger könnten auf die Ordnungshüter überspringen und sie infizieren. Zudem waren die stöhnenden und schreienden Kinder nichts weiter als Verarbeitungsware für den Schlachthof. Ihr Schicksal war es, auf Speisekarten der Restaurants und in den Kühltheken der Supermärkte zu landen.
2134-13 verstand nicht, worüber die Gesetzeshüter sich unterhielten oder was sie über die Walkie-Talkies meldeten. Er vernahm nur ein Klacken und Surren. Ähnlich der Gesangsstimmen im Radio.
Die kühle Regenluft rasselte im Hals. Instinktiv versuchte er, den aufkommenden Hustenreiz zu unterdrücken und die Luft anzuhalten. Doch zu spät. Die Polizisten drehten sich um, erfassten die Geräuschquelle mit der Taschenlampe und gingen darauf zu. Aber im Gebüsch bewegte sich niemand. Oder sprang erschrocken heraus. Es war nichts zu hören. Und so kehrten sie zur Unfallstelle zurück, die einem blutigen Schlachtfeld glich. Wozu sich mit einem möglichen Überlebenden beschäftigen? Die Wildnis, die Kälte und der Hunger würden es schon richten.
2134-13, der seine Hände vor dem Mund gehalten und durch die verschnupfte Nase geatmet hatte, um nicht zu husten, atmete auf.
Kurz darauf erschienen Fahrzeuge der Firma Humeat Limited. Die Mitarbeiter trugen weiße Overalls mit Kapuze, die ihre Fühler verbargen, und Handschuhe über ihre vier Hände. Dazu einen Mundschutz. Sie bewegten sich im weißbläulichen Lichtfeld der mobilen Bergungsleuchten umher. Jeder von ihnen kannte seine Aufgabe. Der Vorarbeiter, der den Vorgang überwachte, griff nur selten ein.
Einige weiße Overalls trieben die Menschenkinder im Umfeld des Unfalltrucks zusammen und scheuchten sie in einen Ersatztransporter. Damit sie dort landeten, wo sie von Anfang an hätten landen sollen: auf dem Schlachthof. Wer nicht laufen konnte oder nicht schnell genug spurtete, wurde getreten, geworfen oder am Hals gepackt und in den Laderaum gezogen.
Für die schwer verwundeten Kinder im Unfalltruck hatte die Firma keine Verwendung. Mit einer Flex entfernten die weißen Overalls die kaputte Heckklappe, packten die Kinder am Hals und warfen sie auf die von Pfützen durchzogene Straße.
Noch vor Ort gab es den Gnadenschuss. Den Taser im Nacken angesetzt, fuhr ein gewaltiger Stromschlag durch die Kinderkörper. Sie zuckten kurz und blieben dann regungslos liegen. Ihre verschmorte, nasse Haut dampfte in der kühlen Regenluft.
2134-13 hockte wie gelähmt im Gebüsch. Obwohl ihn die Geschehnisse am Unfalltruck erschütterten und Angst einjagten, konnte er sich von ihnen nicht abwenden. Und er haderte, zu fliehen, aus Sorge, von den Overalls entdeckt zu werden.
Die toten Sprösslinge wurden zu einem Stapel aufgetürmt. Dann ratschte die Baggerschaufel über den Asphalt und nahm die toten Kinder in sich auf. Das langgezogene Metallkreischen stoppte erst, als die Schaufel sich erhob und die Leichen über einen Muldenkipper ausspuckte. Dann kratzte das Metall erneut über den gehärteten schwarzen Teer. Die toten Menschenkinder waren kein wertiges Fleischprodukt mehr. Sie endeten später als billiges Hack, welches nicht einmal Hunde freiwillig fraßen. Die Zutaten: Gammelfleisch, Knorpel, Eiter und Medikamente.
Der demolierte Unfallwagen wurde abgeschleppt.
2134-13 nahm den Geruch von Verbranntem wahr, der dem umherwandelnden Rauch anhaftete. Selbst dann noch, nachdem die Bergungsleuchten erloschen und die Aufräumkolone davongefahren waren. Als ob die Geister der toten Kinder nicht wussten, was ihnen widerfahren war, und nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Sie hatten ja kein Zuhause. Niemanden, der sie vermisste und sich an sie erinnerte.
Die frische Luft und der Wind waren befremdlich. In der Zuchthalle wollte 2134-13 immer wissen, woher das Licht kam, das über die schmalen Fensterschlitze unter dem Dach einfiel und welches so ganz anders war als das Schwarz, das seine Welt beherrschte. Gern hätte er das Licht besucht, aber es war zu hoch und zu weit weg gewesen. Nun befand er sich in der Welt des Lichts und sah ihre mögliche Quelle: der Mond am Nachthimmel.
Die Erkenntnis stimmte ihn jedoch nicht glücklich. Denn kaum war er der Aufräumkolone entkommen, wartete schon die nächste Herausforderung auf ihn. Er war auf sich allein gestellt und hatte keine Ahnung, wo er sich befand und wohin er gehen sollte. Die gewonnene Freiheit war keine. Die innere Stimme, die sich wünschte, tot zu sein, ganz gleich, ob durch den Unfall oder durch eines der Blitzdinger, wurde vom Überlebenstrieb überstimmt. Und so tastete er sich in der neuen Welt vorsichtig voran.
Der Wind wehte über seinen nackten Körper, auf dem sich feine Regentropfen setzten. Unter seinen Händen und Füßen knackte das Gehölz. Die Pflanzen kitzelten an den Knöcheln. Befremdlich und doch so wunderbar. Viel schöner als der versiffte harte Boden in der Halle, der nur selten von Exkrementen, Erbrochenem und Futterresten befreit worden war.
Je weiter die neue Welt sich ausdehnte, umso mehr überwog die Neugier. Die anfängliche Angst verblasste. Was blieb, war die Schwerkraft, die auf ihn lastete. Wie bei einem Astronauten, der nach mehreren Monaten im All auf die Erde zurückkehrt. Jeder Schritt schmerzte. Er hatte in seinen zwölf Lebensmonaten auf engstem Raum verbracht. Sein Körper war auf die rapide Gewinnung von Fleisch ausgerichtet, nicht für eine Nachtwanderung durch die Wildnis. Das genmanipulierte Mastfutter und die prophylaktisch verabreichten Medikamente - und weiß Gott noch was - hatten den einjährigen Jungen auf die Körpergröße eines vierjährigen Kindes heranwachsen lassen. Seine Knochen waren in die Höhe gewachsen, nicht in die Dicke. Das Übergewicht drückte auf seine Stelzen und ließ die unterentwickelten Gelenke ächzen. Und die kühle Regenluft reizte seine Atemwege. Löste Husten und Niesattacken aus.
2134-13 schaute verängstigt um sich. Die grünen Wesen wie der Farmer und der Trucker waren böse. Und die weißen Overalls am Unfallort waren grausam. Aber wie verhielt es sich mit dem wildgrunzenden Borstenvieh, das plötzlich seinen Weg kreuzte? Sie standen sich auf allen vieren gegenüber. Der warmfeuchte Atem des Tieres strömte über sein Gesicht. Adrenalin schoss durch seinen Körper.
Das Tier war verärgert, hielt die Nase in die Luft. Es roch 2134-13s Geruchscocktail aus Urin, Stuhl und Angstschweiß. Solch eine merkwürdige rosa Erscheinung ohne Fell hatte das Borstenvieh noch nie zuvor gesehen - und gerochen. Es fühlte sich bedroht und schnaubte erbost. Das Menschenkind sollte aus seinem Terrain verschwinden, es hatte hier nichts zu suchen. Aber das Tier griff nicht an. Es konnte die Stärke und Wendigkeit seines Gegenübers nicht einordnen.
2134-13 wich langsam zurück. Eine zu schnelle Bewegung, und die bedrohlichen Hauer durchbohrten sein Fleisch. Eine Unachtsamkeit, und die kräftigen Pranken zertrümmerten seine Rippen. Dann wäre alles vorbei. Ohne die Gefahr aus den Augen zu verlieren, ertastete er auf dem nassen Waldboden jeden glitschigen Stein und jeden Baumstumpf hinter sich, um nicht auszurutschen oder darüber zu stolpern. Auch auf allen vieren kein leichtes Unterfangen. Dass sich hinter ihm ein Abgrund auftun könnte, daran dachte er nicht. Doch genau das geschah, er trat ins Leere. Die vom Regen aufgeweichte Erde beschleunigte die Rutschpartie. Er purzelte unkontrolliert den Abhang hinunter. Die Steine und Äste rammten sich in seine nackte Haut.
Unten angekommen, richtete sich 2134-13 langsam und beschwerlich auf. Seine missgebildeten Gelenke und dünnen Knochen schmerzten.
Auch wenn das Borstenvieh nicht zu sehen war, er musste weg von hier. Es konnte von allen Seiten aus der Dunkelheit hervorspringen und ihn angreifen.
Ihn töten.
Das Weite suchend, erreichte 2134-13 eine Wohnsiedlung am Rand des Waldes und drehte sich - ohne anzuhalten - ein weiteres Mal um. Das Tier schien von ihm abgelassen zu haben, doch dann rammte sich etwas in seinen Rücken. Sein Herz beförderte ihn an den Rand des Wahnsinns. Aus und vorbei. Mit dem Scheppern einher.
Eine Ringmülltonne.
Sie hatte sich in seinen Rücken gedrückt und war sodann lautstark zu Boden gefallen.
Der Krach weckte die Bewohner des Hauses.
In einem Fenster ging das Licht an.
Gestatten, Lux
„Die Mülltonne wurde umgeworfen“, sagte ein weibliches grünes Wesen im Nachthemd. Der Lärm hatte sie aus dem Schlaf gerissen und ans Schlafzimmerfenster im oberen Stock des Hauses geführt.
2134-13 verstand kein Wort, vernahm wieder nur das Klacken und Surren. Er hatte sich gerade so hinter dem Geräteschuppen im Garten verstecken können, und schaute nun vorsichtig um die Ecke.
„Vermutlich ein Testosteron-überladendes Wildschwein auf Streifzug. Ich werde die Tonne morgen früh aufrichten, wenn ich zur Arbeit fahre“, sagte Rox Addax, der mit hochgezogener Bettdecke liegen blieb. Nur seine Fühler schauten hervor.
„Aber der Müll! Der liegt jetzt auf dem Gehweg verstreut.“
„Wenn wir wie die Nachbarn einen Zaun um unser Haus hätten, wäre das nicht passiert.“
„Du weißt genau, dass ich den freien Blick auf die Straße liebe; und in den Wald.“
„Ein Zaun bietet mehr Sicherheit.“
„Wir haben eine aufmerksame Nachbarschaft. Wir passen gegenseitig auf uns auf.“
„Mit Nachbarschaft meinst du wohl die alte Mrs. Nook, die ihre Nase ständig zwischen die Gardinen steckt. Die permanente Neugier hat ihr bereits einen Fühler gekostet.“
Das weibliche grüne Wesen am Fenster drehte sich zu ihrem Ehemann unter der hochgezogenen Bettdecke um. „Lenk das Thema nicht auf Mrs. Nook. Was machen wir jetzt mit der umgeworfenen Tonne und dem Müll auf dem Boden?“
„Ich sammle jetzt nicht inmitten der Nacht den Müll zusammen. Das mache ich morgen früh bei Sonnenaufgang. Ist ja nicht so, dass ein heftiger Sturm den Müll durch die Nachbarschaft wirbelt.“
„Der Vollmond spendet dir genug Licht. Ich kann die Mülltonne von hier oben erkennen.“
„Ein weiterer Grund liegen zu bleiben. Wenn ich sie jetzt aufstelle, wird das blöde Vieh sie nur wieder umwerfen. Wahrscheinlich verträgt es den Vollmond nicht.“
Das weibliche grüne Wesen blickte auf die Mülltonne in Seitenlage. „Dann gehe ich eben.“
„Leg dich wieder hin, Winora.“
Mit dieser Antwort verschwand das Wesen mit Namen Winora am Fenster. Das Licht erlosch.
2134-13 wiegte sich sicher und war daran, sein Versteck zu verlassen. Schnell weg, bevor das Wesen am Fenster zurückkam. Oder das seltsame Borstenvieh. Aber ein Klappern ließ ihn verharren und die Luft anhalten. Er blinzelte nicht einmal. Aus Angst, der wandernde helle Strahl könne ihn lähmen oder gar töten.
Winora war im Garten aufgetaucht und warf einen Lichtstrahl umher, der aus dem Ding in ihrer Hand schien. Das Licht streifte über den Rasen hinweg zum Bürgersteig, wo die Mülltonne lag, und zurück zum Garten. Dann erfasste der weiße Kegel den Geräteschuppen. Winora glaubte zuerst, das Tier habe sich dahinter versteckt, aber dann hielt sie es für wahrscheinlicher, dass es in den Wald zurückgekehrt war. Oder den Pfad der Verwüstung ein paar Straßen weiter fortsetzte. Und so erlosch der Lichtstrahl. Winora verschwand. Sie wollte nicht weiter nachforschen, denn das Tier könnte sie jederzeit aus dem Hinterhalt attackieren. Lieber zurück ins Haus und die Mülltonne am Morgen aufstellen.
An einem dunklen Fenster in der oberen Etage des Hauses hatte jemand die Szene beobachtet und verschwand ebenfalls.
2134-13 indes verharrte diesmal länger in seinem Versteck. Er befürchtete, Winora könnte erneut aus dem Haus kommen und ihn suchen. Und sein Bauchgefühl gab ihm recht. Es klackte abermals. Die Gestalt war kleiner als Winora, und sie wusste auch ohne Taschenlampe, wo sich 2134-13 versteckte. Sie näherte sich vorsichtig, blieb kurz vor ihm stehen und legte etwas auf den Boden. Dann ging sie auf Abstand. In Gegensatz zu Winora nahm die Gestalt den stechenden Gestank des Menschenjungen wahr.
2134-13 wägte ab. In seinem Versteck warten, bis die grüne Gestalt ins Haus zurückkehrte, oder von den lecker riechenden Keksriegeln auf dem Teller probieren; und von der weißen Flüssigkeit im durchsichtigen Gefäß.
Er wartete, aber seine Taktik ging nicht auf. Der Hunger nahm Oberhand. Wenn die Gestalt ihn angreifen wollte, so hätte sie dies längst getan. Und wenn er nicht bald etwas aß, starb er.
„Ich bin Lux“, stellte sich das Wesen vor. „Wie heißt du?“
2134-13 antwortete nicht. Er kam misstrauisch aus dem Versteck hervor und stopfte sich einen Keksriegel hinein, um den inneren Hungerwolf zu besänftigen. Doch er spuckte den Riegel wieder aus.
„Was ist? Schmecken sie dir nicht?“
Lux schaute dem wimmernden Menschenkind in den Mund und erblickte die krummen und schiefen Zähne. Einige steckten hinter dem Zahnfleisch fest, andere wirkten locker.
Wie die Tasten eines Klaviers, das aus dem zehnten Stock gefallen ist. So wie die aussehen, muss er beim Kauen Schmerzen haben.
„Ich breche ihn dir in kleine Stücke, damit du diese leichter herunterschlucken kannst. Aber nicht den Riegel, den du angesabbert hast. Den fasse ich nicht an.“
Lux zerdrückte den ersten Keksriegel und gab sie 2134-13, der ungeduldig seine Hände danach ausstreckte. Die anderen zerkleinerte er in Ruhe.
2134-13 verstand kein Wort von dem, was Lux sagte, aber er freute sich über die Gesellschaft und aß die zermatschten Riegel. Und der Geschmack der weißen Flüssigkeit weckte in ihm ein Gefühl der Geborgenheit.
Dann meldete sich seine Erkältung zurück und er musste ohne Vorwarnung niesen. Lux sprang erschrocken beiseite.
„Iiiieh, du hast mich angeniest. Genau in meine Fühler. Du musst die Hand vor deinem Mund halten. Und den Schnodder nicht am … abwisch …“
2134-13 hatte mit einer Hand den Rotz von der Nase gewischt und über den Bauch abgerieben. Dann aß er weiter.
Lux verschwand kurz im Haus, um seine Fühler sauber zu machen, und kam mit neuer Milch und weiteren Keksriegeln zurück. Und er hatte einen Stick von der Größe eines Daumens dabei, der an einer Kette baumelte. Er hielt es dem Menschenkind vor die Nase. 2134-13 roch skeptisch daran, und als Lux ihm den Stick um den Hals anlegte, wehrte er sich zunächst. Doch dann sah er vor Lux‘ Brust das gleiche Gerät hängen und gewährte.
Lux aktivierte beide Sticks und justierte den Kanal. Nach einem kurzen Klacken und Surren erklang eine menschliche Stimme.
„Ich bin Lux.“ Lux zeigte auf sich.
2134-13 verstand ihn nicht, aber er freute sich über die angenehme Stimme und brabbelte. Obwohl er ihn erst wenige Minuten kannte, vertraute er ihm. Er war ganz anders als die anderen. Die waren böse zu ihm gewesen. Der Farmer, der ihm die Hoden herausgedrückt hatte. Der Trucker, der ihn und die anderen im Anhänger dahinvegetieren ließ. Die Polizisten, die den Kindern beim Sterben zugesehen hatten. Oder die Aufräumkolonne, die die Kinder mit Tasern hingerichtet hatte.
„Woher kommst du? Ich habe noch nie einen von euch frei herumlaufen sehen.“
2134-13 hörte ihm zu und schluckte die portionierten Keksriegel hinunter.
„Du hast ja richtig Hunger. Und mächtig Durst. Ich werde dich Sam nennen. Wie die Keksriegel, die du isst. Sie heißen Sambiscuit. Eine Symbiose aus Uncle Sam und Biscuits, verstehst du? Die Menschen nannten dieses Land hier Amerika. Und Uncle Sam war eines ihrer Nationalsymbole gewesen. Soll auf einen Hersteller von Fleischkonserven zurückzuführen sein. Das hat mir meine Schwester mal erzählt. Ob das stimmt, weiß ich nicht.“
2134-13 antwortete nicht, aß weiter die Riegel, wenn auch nicht mehr so hastig. Das Sättigungsgefühl trat ein.
„Du bist verletzt. Deine Wunden sind entzündet. Und deine kaputten Zähne … Du wirst im Wald keinen Tag überleben. In Cazzelstown nicht mal eine Stunde. Ich kann dich hier draußen nicht allein lassen.“
Lux wollte dem Menschenkind helfen. Aber wie? Er musste Zeit gewinnen. Hier im Garten würde er so schnell keine Lösung finden.
Der Keller!