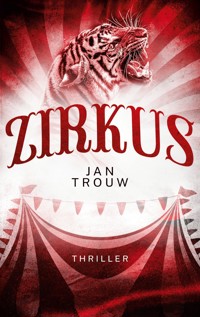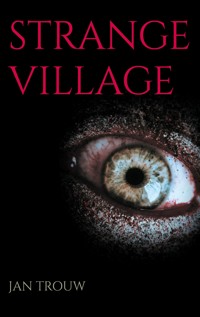
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Unfall, eine Kleinstadt voller Geheimnisse und ein Fremder, der um sein Leben kämpfen muss. Als der Buchautor Luke Vremdalleen auf einer einsamen Straße in Maine einem Kind ausweicht, überschlägt sich sein Wagen. Doch als er zu sich kommt, ist nichts mehr wie zuvor: Eine abweisende Kleinstadt, deren Bewohner und Sheriff voller Misstrauen sind. Luke darf weder bleiben noch gehen – und die düstere Wahrheit lauert in jeder Ecke. Wem kann er vertrauen? Und wird er jemals wieder nach Hause finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vader Jacob! Vader Jacob!
Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?
Alle klokken luiden! Alle klokken luiden!
Bim, bam, bom! Bim, bam, bom!
Kinderlied
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 11
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
1
Vier Scheinwerfer tasteten sich durch den dunklen Wald und erfassten ein stillgelegtes Gleis. Es tauchte – wie aus dem Nichts – von einer Seite auf, schlug zwei Furchen durch die schmale Straße und löste sich auf der gegenüberliegenden Seite wieder auf. Das Gleis hatte einst den Ort mit der Außenwelt verbunden, doch die Natur war auf dem Vormarsch; und bereit, ihr Enteignetes zurückzuholen. Beim holprigen Überqueren hüpften die Scheinwerfer kurz auf und ab. Erst am Rande des Waldes, nahe dem Ortseingang, gab sich das fauchende Fahrzeug zu erkennen: ein 1978er Cherokee Chief. Die Einsatzleuchte ruhte auf dem Dach, die Funkantenne wackelte bei jeder Unebenheit; und auf der Motorhaube zierte ein Sheriffstern. Das Gefährt war den Nachtgestirnen schutzlos ausgeliefert. Im Lack reflektierte der blutrote Vollmond.
Am Ortseingang erfassten die Scheinwerfer ein heruntergekommenes Schild:
HER L H W LLKO MEN
ie We t hat u s ve gessen!
Die beiden Zusatzscheinwerfer am Kühlergrill erloschen. Sie wurden nicht mehr gebraucht. Andere Lichtquellen zeigten jetzt den Weg. Der helle Strahl des Leuchtturms wanderte gleichmäßig im Kreis umher und holte – wie die Laternen entlang der Straße – die Stadt teilweise aus der Dunkelheit hervor. Abgesehen von ein paar Motten, die um die Laternen schwirrten, wirkte das Städtchen abgeschieden und – tot. Allein das Rauschen des Ozeans, das über die Klippen hinweg zu hören war, trübte die Stille.
Der Sheriff strich mit dem Zeigefinger durch seinen ungepflegten Oberlippenbart. Er müsste diesen mal wieder stutzen, aber die Sorgen, die rund um die Uhr auf ihn einhämmerten, ließen ihn kleine Dinge wie eine Rasur vergessen.
Am Straßenrand poppte die Kirche auf. Das am Kirchenturm hängende Kreuz Christi hatte seine Spitze eingebüßt; es hatte nichts Göttliches mehr an sich. Es glich mehr dem T-Logo einer fiktiven Supermarktkette. Das Mauerwerk des Gotteshauses, das seit Langem keinen Handwerker mehr gesehen hatte, hielt wie ein Wunder zusammen; die einst bunten Fenster waren vergilbt und löchrig. Und die Nachrichtentafel am Eingang hatte schon lange nichts mehr zu vermelden. Keine Buchstaben, Zeichen oder Zahlen schmückten diese. Weder der nächste Gottesdienst noch eine andere gemeinschaftliche Zusammenkunft wurde angekündigt.
Als der dürre Priester aus der Kirche heraustrat, bremste der Ordnungshüter das Fahrzeug auf Schrittgeschwindigkeit herunter. Der Geistliche führte das kleine Kreuz Christi, das an einer feinen Kette vor seiner Brust hing, zu den Lippen und ließ sie miteinander berühren, dann nickte er dem Gesetzeshüter zu. Dieser zeigte jedoch keine Regung und fuhr weiter.
Das Fahrzeug schwebte wie ein Fremdkörper durch den geisterhaften Ort, es folgte dem Verlauf der aufgeplatzten Straße, vorbei an verwilderten Vorgärten und grauen Häusern mit Rissen in den Fassaden.
Als der Cherokee auf den einzigen Laden des Städtchens zufuhr, erfassten die Scheinwerfer eine Frau, die vor dem Geschäft auf einer Hollywoodschaukel saß. Unter ihrem linken Auge zierte eine vertikal verlaufene Narbe. Obwohl das Licht sie blendete, wand sie sich von diesem nicht ab. Erst als der Wagen stoppte, der fauchende Motor verstummte und die Scheinwerfer sich verdunkelten, lockerten sich ihre Gesichtsmuskeln. Sie wirkte apathisch und hilfsbedürftig. Ihre makellose Haut sagte dem Beobachter, dass sie jung war, ihre weißen Haare wiederum eher alt. Und aus ihren Augen sprach das gebrochene Herz.
Der Sheriff wusste um ihr wahres Alter; um ihren Verlust. Es stimmte ihn traurig. Er fühlte ihr nach, denn er wusste, dass der Verlust des eigenen Fleisches und Blutes einem die Lebenskraft rauben konnte; sogar einen Teil der Seele.
Die Öffnungszeit des Ladens war längst überschritten, doch im Inneren brannte Licht. Es fand eine Ratsversammlung statt. Vor langer, langer Zeit hatten diese im Rathaus stattgefunden, aber an dem Tag, an dem der Bürgermeister des einst idyllischen Ortes vom Erdboden verschluckt wurde, verschwand auch das Gebäude. Die wenigen Bewohner, die dem Spektakel beigewohnt und dieses überlebt hatten, verstanden bis heute nicht, was an diesem mysteriösen Tag geschehen war.
In seinen Gedanken versunken, glitt der Sheriff mit den Fingern durch den Oberlippenbart. Sie würden nicht eher zur Ruhe kommen, bis er ihnen die Nachricht übermittelte. Er schnappte sich den Sheriffhut vom Beifahrersitz, stieg aus und befreite den Kühlergrill von Schmutz und Gras. Nicht, weil es ihn störte, sondern um Zeit zu gewinnen. Die Ratsmitglieder würden schon früh genug erfahren, was geschehen war.
Er ging auf die Frau auf der Hollywoodschaukel zu und legte seine Hand auf ihre Schulter. Beim Blick in seine traurigen Augen senkte sie enttäuscht den Kopf. Dann widmete er sich der lebhaften Diskussion im Laden. Anstatt hineinzugehen, stellte er sich neben die leicht geöffnete Tür und lauschte. Jede einzelne Stimme war gut zu verstehen; und ihm vertraut. Die Ratsmitglieder waren so sehr in ihrem Schlagabtausch vertieft, dass sie seine Ankunft nicht bemerkt hatten.
„Das schaffen die nie! Das hat noch niemand bisher!“, sagte eine dünne Stimme. Sie gehörte Mr. Smith. Seine Frau und er führten den Laden. „Das nimmt einfach kein Ende.“
„Wo bleibt eigentlich unser so großartiger Sheriff?“, fragte Mr. Wooter, der Chef der Holzfällertruppe. Sein tief aggressiver Ton war furchteinflößend.
„Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben“, hielt eine weibliche Stimme dagegen. Ihr Klang erwärmte das lauschende Sheriffherz.
„Samantha hat Recht. Eines Tages wird er dermaßen beschäftigt sein, dass er abgelenkt ist, und wir …“
Der Sheriff hatte genug gehört. Er schlich sich um das Gebäude, zum dahinter gelegenen See, in dem sich der Vollmond spiegelte. Die Bilder gingen ihm nicht aus dem Kopf. All die Jahre, seit Bürgermeister Mounte-Pennys Verschwinden, hatte er einiges mit ansehen müssen, aber die letzten Zwischenfälle nahmen perversere Dimensionen an.
Diesmal war es ein 1986er Ford Taurus Wagon. Der Kombi hatte den Raimonds gehört, ein junges Pärchen aus Chicago. Sie waren letzte Nacht panikartig davongefahren, nachdem sie ihren Wagen frisch repariert zurückbekommen hatten. Mr. Baker hatte noch versucht, sie von ihrem Vorhaben, nach Hause zu fahren, abzubringen, doch Mr. Raimond hatte erwidert: „Tut mir leid, Mr. Baker. Der Ort bringt uns um. Wir fahren. Haben Sie vielen Dank für alles.“
Der Sheriff spielte mit dem Hut in seinen Händen, machte sich Vorwürfe. Aber was er hätte er tun sollen? Wäre er ihnen gefolgt, würde er jetzt – wie das Pärchen – verstreut im Wald herumliegen und nicht hier am See grübeln. Auch ihn hätte es erwischt. Vielleicht aus Versehen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall tot. Er musste endlich eine Lösung finden, damit all das aufhörte.
Wie buntes Konfekt hatten die auseinandergerissenen Gliedmaßen und Innereien der Raimonds auf dem Waldboden gelegen; wie auch Teile des Kombis. Ein Pfad der Verwüstung. Sheriff Baker hatte den Unfallhergang anhand der Spuren rekonstruiert. Der Wagen hatte mehrere Bäume gestreift und dabei Karosserieteile verloren. Ein großer Baum war am Ende ihre Erlösung. Der Stahl hatte ihre Knochen durchbohrt, und der warme Motor sich mit ihren Körpern verschmolzen. Die Armatur hatte ihre Beine zerquetscht, und die Frontscheibe ihre Gesichter zu einem mosaikartigen Gebilde zerschnitten.
Der Sheriff war sich sicher: Die Dampflok hatte die Raimonds ohne Vorwarnung erfasst und in die Dunkelheit des Waldes mitgeschliffen.
„WAS?!“
Der Sheriff erschrak. Sein Hut landete im Gras. Es durchfuhr ihn kalt über den Rücken. Irgendjemand hatte ohne Vorwarnung seine linke Schulter berührt.
„Entschuldigen Sie, Sheriff, ich wollte Sie nicht erschrecken“, sagte eine männliche Stimme hinter ihm.
„Ist Ihnen aber gelungen, Vater!“ Schwer atmend, verstärkt durch den festanliegenden Gürtel, der sich in seinen Bauchansatz drückte, bückte sich Mr. Baker nach unten, griff nach seinem Hut und setzte ihn sich auf.
Der dürre Priester, dessen Gesicht durch einen schwarzen Hut verborgen blieb, stellte sich neben ihn. Beide blickten auf den See.
„Sie waren so sehr in Ihren Gedanken versunken, dass Sie meine Vorwarnung nicht gehört haben.“
„Woher wussten Sie, dass ich …?“
„Dass Sie hier sind? Bei meiner Ankunft habe ich Ihren Wagen vor dem Laden parken sehen, Sie aber nicht in der Ratsrunde erblickt. Somit wusste ich, wo ich Sie zu finden habe. Das machen Sie immer, wenn Sie ein wenig Zeit für sich brauchen, ehe Sie … zu uns stoßen. Sie stehen dann gern hier, atmen einmal durch und verkünden uns sodann die schlechten Nachrichten.“
„Sie hätten das Ausmaß im Wald sehen sollen, Mr. Medley. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Das ist kein Kinderspiel mehr.“ In Mr. Bakers Kopf spukten immer wieder die Bilder vom Tatort umher.
Priester Medley legte seine Hand auf Mr. Bakers Schulter. „Kommen Sie, die Anderen warten schon auf uns. Gott ist mit …“
„Stopp! Bitte!“, unterbrach der Sheriff ihn mit gehobener Handfläche, um den Worten mehr Ausdruck zu verleihen. „Bitte lassen wir das! Nicht falsch verstehen, aber bei IHM bin ich momentan nicht sicher, auf wessen Seite ER ist!“
„ER ist auf unserer Seite.“ Der Geistliche hob seinen Kopf in den Himmel, und der Vollmond legte das knochige Gesicht unter dem Priesterhut frei.
Sie gingen in den Laden, wo Mr. Medley sich zu den anderen setzte. Mr. Baker blieb im Türrahmen stehen und wurde von einer jungen Frau mit dunkelblonden Haaren empfangen. Sie kam auf ihn zu und umarmte ihn herzlich.
„Zum Glück ist dir nichts passiert, Dad!“
„Samantha!“
Die Ladenbesitzer Mr. und Mrs. Smith begrüßte er mit einem dezenten Nicken. Mit ihren übergroßen kreisrunden Brillengläsern sahen die beiden Alten aus wie eineiige Monchichis.
„Haben die Raimonds es geschafft, Sheriff?“, fragte Mr. Wooter. Die zwei Meter große, breitschultrige Erscheinung des Holzfällers war genauso furchteinflößend wie dessen Stimme.
Sheriff Baker schwieg. Seine müden Augen scannten die überschaubare Ratsrunde und blieben bei Samantha stehen. An dem Tag, an dem Bürgermeister Mounte-Penny verschwand und die Stadt ihren Glanz verlor, hatten sich die meisten Einwohner in Luft aufgelöst. Die Übriggebliebenen verstanden bis heute nicht, warum sie noch da waren; und nicht verschwunden. War es Gottes Wille oder war es das Werk des Teufels?
„Haben die Raimonds es geschafft?“, fragte Mr. Wooter erneut. „Sind sie durch den Wald gekommen? Sind sie auf dem Weg zurück nach Chicago?“
Mr. Baker lehnte sich gegen den Türrahmen und hielt sein Schweigen aufrecht.
„So eine verfluchte Sch…!“ Mr. Wooter sprang vom Stuhl auf. „Wann hört das endlich auf? Was hat uns Mr. MountePenny mit seinem Heiligen Experiment eingebrockt? Wo ist dieser Bastard hin? Irgendwann muss es doch jemanden geben, der es schafft, von hier zu wegzukommen.“
„Wir wissen nicht, wo Mr. Mounte-Penny ist. Das weiß nur der HERR“, versuchte Priester Medley den Holzfäller mit sanfter Stimme zu besänftigen, doch seine Worte brachten Mr. Wooter weiter in Rage.
„Der HERR? Wo ist denn dein HERR? Mr. MountePenny, dieser Bastard, ist der EINZIGE, der Antworten auf unsere Fragen hat. Er hat uns diese verfluchte Scheiße erst eingebrockt.“
Dann, ganz plötzlich, hielt er inne. Sein aggressiver Gesichtsausdruck verschwand. Ein Ureinwohner mit versteinerter Miene hatte sich an den im Türrahmen stehenden Sheriff vorbeigedrängt und in die Mitte der Ratsrunde gestellt. Die raue Haut verriet sein fortgeschrittenes Alter. Das rote Stirnband verhinderte, dass seine langen grauen Haare ins Gesicht fielen und die Augen verdeckten. Um seinen Hals baumelte eine Halskette mit einem Seeadler-Medaillon. An den Füßen, auf dem nackten Oberkörper und auf der Hose aus Hirschleder klebte Blut. Der Ureinwohner schaute schweigend in die Runde und ließ seine Mitbringsel auf den Holzboden fallen: ein Lenkrad und ein Schuh, aus dem ein Fuß mit etwas Schienbein herausschaute. Anschließend drehte er sich um und verließ den Laden.
Die Bewohner des kleinen Städtchens nannten ihn Silent Dog. Den Namen hatte er aufgrund seiner kommunikativen Eigenschaft des Schweigens und wegen der zahlreichen Hunde erhalten, mit denen er zusammenlebte. Je mehr er schwieg, desto lauter bellten diese. Er besaß ein Grundstück außerhalb des Städtchens, das tief in den Wald hineinragte und am tosenden Ozean grenzte. Die einen sagten, er sei von einem Tag auf den anderen erschienen und habe sich hier niedergelassen. Andere meinten, er hätte schon vor der ersten Besiedlung durch die Europäer hier gelebt. Aber niemand konnte das so genau sagen. Gerüchte waren manchmal stärker als die Wahrheit.
„Die Raimonds haben das Spiel mit der Dampflok verloren“, sagte Mr. Baker, während er Silent Dog hinterherschaute.
2
Er stand nur ungern im Rampenlicht, aber berufsbedingt ließ sich das nicht vermeiden. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Besonders dann, wenn ein neues Buch von ihm erschien. Aber an diesem Abend, keine zweiundsiebzig Stunden bevor sein Leben auf den Kopf gestellt werden sollte, stand jemand anderes im Rampenlicht.
Für die Lesung in der kleinen Buchhandlung in Manhattan waren hundertfünfzig Stühle aufgestellt worden, und ganze zwanzig Leser und Leserinnen waren erschienen. Darunter auch der Unruhestifter, der in der letzten, fast unbesetzten Reihe aufgesprungen war und mit einem Buch des Autors in der Hand seinen Unmut herausbrüllte. Seine Stimme war penetranter als ein hupender Autofahrer in New York.
„Für so etwas bekommen Sie auch noch Geld? Wissen Sie, wie viele Stunden ich in der Woche schuften muss, um meine Familie zu ernähren? Und Sie? Sie schreiben ein Buch von dreihundert Seiten und verdienen Millionen. Schämen Sie sich, Mr. Vremdalleen.“
„Ich wünschte, es wäre so, Sir. Millionär bin ich bei Weitem nicht“, erwiderte Luke Vremdalleen.
„Sie lügen! Ihre Bücher stehen überall in den Buchläden herum, und man hat Ihnen diese Auszeichnung verliehen. Diesen … ähm …“
„Sie meinen den International Thriller Award?“
„Genau. Und ich? Ich bin nicht einmal Vater des Jahres!“
„Wie heißen Sie, Sir?“, wollte Luke Vremdalleen wissen, doch da setzte der Mann sich schon in Bewegung, marschierte um die Stuhlreihen herum nach vorn und knallte das Buch auf den Tisch, an dem der Autor saß. Dann schrie er diesem förmlich ins Gesicht: „Warum wollen Sie wissen, wie ich heiße? Ist das wichtig? Ich bin ein Nichts. Ein Niemand. Niemand, der mich kennt. Einfach nur ein Versager, der versucht, seine Familie zu ernähren.“
Dann folgte der Mittelfinger.
Man sah es dem Autor, der den Mann ruhig und mitfühlend anschaute, äußerlich nicht an, aber sein Körper aktivierte den Verteidigungsmodus; der Stresspegel stieg.
Der protestierende Mann blickte um sich, blickte in die Gesichter der anderen Besucher und hoffte, in diesen irgendeine seelische Unterstützung zu finden. Ein leichtes Nicken etwa, oder Betroffenheit in deren Augen. Aber mitnichten. Niemand sagte etwas, niemand ergriff Partei. Peinliche Stille. Die gegenwärtige Situation glich einer Pattsituation, die nur aufgelöst werden konnte, indem jemand einlenkte. In diesem Fall war es der Verursacher selbst. Der Familienvater wich einen Schritt vom Tisch zurück, blickte erneut in die Runde und nickte leicht; mehr zu sich selbst. Sein Auftritt war vorbei. Er stellte den Protest ein und verließ den Laden.
Luke blickte dem Mann beim Hinausgehen hinterher. Er kannte den Mann nicht, aber er verstand dessen Wut und Verzweiflung und fühlte mit ihm. Aber bei allem Respekt, auch er hatte, wie so ziemlich jeder, persönliche Probleme. Diese waren jedoch irrelevant. Es sei denn, sie waren einem Skandal dienlich. Die Medien würden jeden Fehler von ihm vor Millionen von Menschen kundtun. In den Tageszeitungen, in den Abendnachrichten; und im Internet sowieso.
Autor zu sein, war dennoch sein Traumberuf. Den vorhin erwähnten International Thriller Award hatte man ihm für sein Buch Das Volk der Finsternis verliehen. Der Nachfolger Die geheimnisvolle Mauer verkaufte sich ebenfalls sehr gut. Auch wenn er von den Buchverkäufen sorgenfrei leben konnte, Millionär war er bei Weitem nicht. Er verstand sich eher als Handwerker. Er musste genauso arbeiten und liefern wie Mechaniker, Banker, Bäcker oder Lehrer. Die Fans erwarteten ständig neues Futter.
Seine Gefühle waren zweitrangig. Bei Lesungen musste er raus auf die Bühne und gute Stimmung verbreiten, ganz gleich, ob vor tausend Menschen – wie zu Zeiten der ersten beiden Bücher – oder – wie an diesem Abend – vor zwanzig Leuten in einer kleinen Buchhandlung, weil er sich von der Buchhändlerin dazu überreden lassen hatte. Er hatte seit gut zwei Jahren keine Lesung mehr gehalten und sich mit der heutigen Veranstaltung einen kleinen Motivationsschub erhofft. Seit diesen genannten zwei Jahren fand er einfach keine zündende Idee für sein nächstes Buch. Sein Agent und der Verlag machten bereits Druck. In spätestens sechs Monaten habe er ein Manuskript vorzulegen, ansonsten könne er einpacken.
Glücklicherweise war er nur für sich selbst verantwortlich. Er hatte keine Kinder wie der aufgebrachte Familienvater eben, und eine Frau hatte er auch nicht. Eigentlich schon, Victoria, andererseits aber auch wieder nicht.
Irgendwie.
Beziehungsstatus: Es ist kompliziert.
Nein, nicht an Victoria denken. Nicht jetzt. Bleib professionell!
„Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Mr. Vremdalleen, und auch Ihnen, liebe Gäste“, sagte die Buchhändlerin peinlich berührt, „aber ich denke, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Einverstanden?“
Luke nickte, wie auch die Anwesenden, die sodann seinen Worten lauschten. In der anschließenden Fragerunde kamen die zu erwartenden Fragen wie „Wie kamen Sie zum Schreiben?“ oder „Wie finden Sie den richtigen Stoff für Ihre Thriller?“. Aber die Masterfrage war stets die, ob er ab und wann eine Schreibblockade habe, die er stets mit „Depressionen, Alkohol, Drogen und Nutten.“ beantwortete. Das Publikum fasste dies natürlich als einen Scherz auf, und im Grunde war die Aussage auch ein Witz. Eine Übertreibung. Er nahm keine Drogen, und mit Nutten verkehrte er auch nicht, aber depressive Phasen waren ihm vertraut, die er mit Whiskey besänftigte. Er glaubte nicht an Schreibblockaden. Der Bäcker blieb ja auch nicht mit einer Backblockade im Bett. Und eine Mutter konnte ihrem Kind nicht sagen, sie habe eine Erziehungsblockade.
Dass sein Schreibfluss derzeit deutlich gehemmt war, gestand er sich selbst ein, aber nicht gegenüber den Lesern. Bis vor zwei Jahren war das Schreiben ein Leichtes gewesen. Als ob eine fremde Kraft ihn geführt und die Werke für ihn geschrieben hätte. Ganz anders heute. Jeder Tag bedeutete eine Qual.
Diese Qual setzte sich am Tag nach der Lesung in der Buchhandlung in Manhattan fort. Mit der Gewissheit, dass auch an diesem Tag kein Wunder geschehen würde, setzte er sich an den Schreibtisch und fuhr den Laptop hoch. Schon kurz darauf wartete der blinkende Cursor auf die Eingaben des Autors. Doch das virtuelle Papier blieb leer.
Warum fand er keine Geschichte für sein nächstes Buch? Er saß doch am selben Schreibtisch, an dem er seine ersten beiden Bücher geschrieben hatte, hier in diesem Arbeitszimmer des Stadthauses in Greenwich Village. Jene Nachbarschaft, in der Victoria und er sich wohlgefühlt hatten. Der europäische Charme des Viertels ähnelte ihren Geburtsstädten London und Amsterdam: lückenlos aneinandergereihte Stadthäuser, schmale Straßenzüge und kleine Bäume. Sie hatten oft in den Cafés und im Washington Park gesessen oder waren regelmäßig über die Flohmärkte geschlendert.
Luke löste sich vom Laptop und blickte in eines der Bücherregale, in dem die Bobbleheads von Derek Jeter und Mariano Rivera, zwei Baseballspieler der New York Yankees, standen. Dann scannte er sein kleines Arbeitszimmer mit den vollen Bücherregalen und Auszeichnungen an der Wand und stoppte bei einem Foto, auf dem eine junge schlanke Frau abgebildet war. Ihre langen braunen Haare waren nach hinten zusammengebunden. Eine Momentaufnahme kurz vor ihrem ersten Karriereauftritt, wo sie ihrer glorreichen Zukunft noch entgegensah. Victoria.
Alles war so perfekt, bis Victoria mit Mitte dreißig am Boden zerstört war. Das Showbusiness war gnadenlos, hart und schnelllebig. Das war beiden bewusst. Besonders am Broadway, wo Victoria als Schauspielerin und Tänzerin angestellt war. Dumm nur, dass sie alterte und immer seltener für Shows verpflichtet worden war. Man bevorzugte junge Dinger, die nach einer Karriere am Broadway strebten. Am Ende hatte Victoria sich aussortiert gefühlt und eine Auszeit genommen; floh nach England, um von allem ganz weit weg zu sein.
Luke, der in den ersten sechs Lebensjahren in Amsterdam aufwuchs und dann nach New York zog, weil sein Vater beruflich dorthin versetzt worden war, hatte mit dem Altern kein Problem. Als Autor musste er weder jung sein, noch gut aussehen, um Bücher zu schreiben. Jetzt mit ebenfalls Mitte dreißig interessierte ihn die Vergänglichkeit eher literarisch, nicht biologisch. Er sah in jedem Altersabschnitt des Lebens das Positive. Victoria hingegen hatte ihre biologischen Veränderungen als demütigend empfunden. Sie hatte ihrer Vergangenheit hinterhergetrauert, in jeden Spiegel hineingeschaut und Luke gefragt, ob er sie noch attraktiv fände. Komplimente von Fremden, Freunden und ihm hatten ihre Unsicherheit nicht geschmälert.
Vor sechs Monaten war sie aus England wieder in die USA zurückgekehrt, aber nicht zu ihm nach New York, sondern nach Las Vegas, wo sie jetzt in einem Casino allabendlich Zocker und Touristen mit einer Bühnenshow unterhielt.
Er hatte Victoria einmal in der bunten und elektrisierenden Wüstenstadt besucht und vorgeschlagen, bei ihr zu bleiben. Schließlich könne er überall Bücher schreiben. Dass er sich dabei selbst belog, wusste er. Sein Herz hing an New York, aber für die Liebe wollte er es versuchen. Doch Victoria hatte abgewunken. Seitdem nahm der Kontakt zwischen den beiden stetig ab. Sie beantwortete seine E-Mails immer seltener, und die gelegentlichen Telefonate, sofern Victoria am anderen Ende abnahm, waren kurz und wortkarg. Luke fragte sich, ob sie jemals wieder zu ihm nach New York zurückkehren würde.
Er schaute aus dem Fenster und beobachtete das bunte Treiben auf der Straße; wobei bunt mit grauen Farbtönen gleichzusetzen war. Es war ein typischer Herbstanfang, wo graue und schwarze Regenschirme, Regenjacken und Mäntel die Mode bestimmten. Der heutige Tag hatte verregnet begonnen; und die zugezogene Wolkendecke versprach weitere Regenschauer.
Wo war seine Energie nur hin? Seine Inspiration? Nicht nur das digitale Blatt Papier im Laptop und sein Kopf waren leer, sondern auch sein Herz. Immer wieder kreisten seine Gedanken um Victoria. Sie ging ihm einfach nicht aus dem Kopf.
Ich muss raus!
Er sprang vom Schreibtischstuhl auf, verließ das Haus und öffnete das Fahrradschloss an seinem Mountain Bike, welches er am Zaun neben der Eingangstreppe seines Stadthauses angeschlossen hatte. Den nassen Sattel mit einem sauberen Taschentuch abgetrocknet – er hatte dafür eigens ein paar eingepackt –, schwang er sich aufs Rad, quetschte sich durch zwei parkende Autos hindurch und raste die enge Straße hinunter. Nach wenigen Blöcken erreichte er die Wolkenkratzer und ließ die Idylle von Greenwich Village hinter sich. Der Regen, der auf ihn einprasselte, ließ ihn kalt.
3
Let’s go Yankees! (Clap-Clap-ClapClapClap), schallte es im Yankee Stadium. Bereits vor Spielbeginn heizten sich die Baseballfans ein. Nur wenige Buhrufe und Pfiffe seitens der Gäste durchdrangen den dominierenden Sprechchor. Der Wind pfiff durch die Arena, der Regen blieb aus.
„Wie ich mich auf die Postseason freue!“, sagte Luke. Er inhalierte die Stadionatmosphäre und blühte förmlich auf. Kaum zu glauben, dass er vorhin im Arbeitszimmer noch einen Depri geschoben hatte. Die frische Luft wirkte genauso befreiend, wie unter Menschen zu sein.
„Die Red Sox sind gut in Form. Das wird schwer für die Yankees“, sagte Max, der jede Gelegenheit nutzte, um seinen Freund zu sticheln.
„Keine Chance, wir schicken Boston zu null nach Hause.“ „Dass du immer noch so ein verrückter Yankee-Fan bist!“ „Das bin ich, seitdem mein Vater mich zum ersten Mal zu einem Yankee-Spiel mitgenommen hat.“
„Ich weiß“, sagte Max. „Dein Vater hat von seiner Firma immer Karten bekommen und dich mitgenommen.“
Nach der Vorstellung der Gästemannschaft ertönte das imperialistische Throne Room des Leinwandklassikers Star Wars, begleitet von jubelnden Yankee-Fans.
„Und hier sind sie, die New York Yankees.“ Die stolze Stimme des Stadionsprechers schallte durch das Stadion, und auf der Anzeigentafel erschien die Startaufstellung der Mannschaft.
„Auf der Shortstop, mit der Nummer zwei, Derek Jeter. Nummer zwei.“
„Du bist unser Mann!“ Luke freute sich wie ein kleiner Junge; rutschte auf dem Sitz wild hin und her. Obwohl die New York Yankees innerhalb der USA oft als die Baseballmannschaft der Touristen und Nicht-Amis im Ausland verschrien waren, so war Luke ein Yankee-Fan durch und durch.
„An der First Base, mit der Nummer fünfundzwanzig, Mark Teixeira. Nummer fünfundzwanzig.“
Der triebgesteuerte Max bekam einen hormonellen Schub und tauchte in seine sexuelle Gedankenwelt ab. „Die Anzeigentafel mit Monitor ist so gewaltig. Auf der möchte ich gern mal ein Filmchen mit hübschen Mädels gucken, wenn du verstehst, was ich meine. Stell dir vor, wie groß erst der Hintern und die …“
Max zwinkerte Luke zu, doch sein Kumpel hatte nur Augen und Ohren für das Geschehen auf dem Spielfeld, und so stellte er die Mitteilung seines sexistischen Gedankenguts ein.
Während des Spiels vergaß Luke alles um sich herum. Seinen Schmerz, seinen Verlust, seine Victoria.
4
Nach dem Spiel setzten sich Luke und Max an die Theke einer spärlich beleuchteten Bar in Midtown, Manhattan.
„Was darf es denn für Sie sein, meine Herren?“ Das Geschirrtuch über die Schulter geschlagen und die Hände auf den Tresen gestützt, blickte der Barkeeper sie beide an. Im Glasregal hinter ihm standen diverse Flaschen bekannter Originalmarken.
„Einen Dalmore, 15 Jahre, bitte“, antwortete Luke. „Für mich einfach einen Jack Daniel’s on the Rocks.“
Der Barkeeper schenkte ein und reichte den beiden Männern ihre Getränke. Luke erhob das Glas. „Lass uns auf das Spiel anstoßen! Denen haben wir es so richtig gezeigt.“
Zwei Gläser klirrten vorsichtig gegeneinander.
„Ich habe dich lange nicht mehr so lebendig gesehen wie vorhin im Stadion“, sagte Max. Dann weckten zwei Ladies am Ecktisch seine Aufmerksamkeit. „Bei den beiden würde ich gern einen Hit landen.“
Luke schwieg, er schaute nicht einmal hinter sich, sondern blickte starr auf den Tresen. Selbst dann noch, als Max ihm auf den Oberarm klopfte. „Hey, schau dir mal die beiden Granaten an.“
Luke nahm einen großen Schluck vom Whiskey. „Bitte nicht heute.“
„Wenn du siehst, was ich sehe, kannst du nicht anders. Die beiden sind bestimmt Studentinnen. Was meinst du?“
Luke drehte sich zum besagten Ecktisch herum, an dem zwei Frauen sich kichernd unterhielten. Eine von ihnen trug ein schlichtes schwarzes T-Shirt und Designer-Jeans. Ihrem Akzent nach womöglich Französin. Die Andere, eine Latina, trug ein enges rotes Kleid.
„Wen von den beiden möchtest du, Kumpel?“
„Wir sind nicht mehr auf dem College, Max. Du änderst dich wohl nie, oder?“
„Warum sollte ich auch? Solange es mir dabei gut geht.“