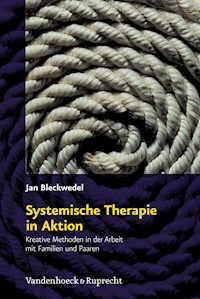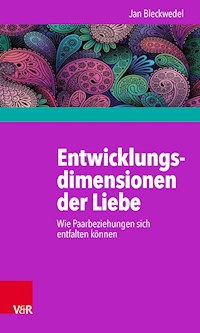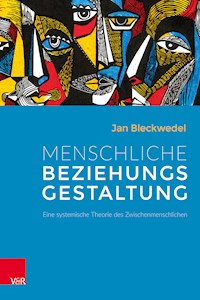
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im Verlauf der Evolution erfanden Menschen immer komplexere Formen und Muster des sozialen und kulturellen Miteinanders, der Kooperation und kommunikativen Abstimmung. Gleichzeitig entwickelten sich ebenso komplexe Formen und Muster des Selbstempfindens, des Bewusstseins und der Sprachfähigkeit. Im Rahmen einer systemisch-entwicklungsorientierten Theorie des Zwischenmenschlichen können die genannten Phänomene zusammengedacht werden. Was uns als Spezies auszeichnet, geht aus dem sozialen Zusammenleben hervor und entwickelt sich im Rahmen gemeinsamer Beziehungsgestaltung. Wir sind beziehungsgestaltende Akteure, die sich gegenseitig beim Beobachten und Gestalten von Beziehungen beobachten, und wir haben gelernt, Beziehungen kreativ zu gestalten. Eine allgemeine Theorie menschlicher Beziehungsgestaltung fehlte bisher. Sie wird hier evolutionär und entwicklungspsychologisch begründet. Eine übergreifende theoretische Perspektive, die das Blickfeld erweitert, hin zu einer konsequent beziehungsorientierten Sichtweise. Ein wissenschaftlich fundiertes, gleichwohl gut lesbares und spannend geschriebenes Grundlagenwerk für Beratung, Therapie und Supervision.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Bleckwedel
MenschlicheBeziehungsgestaltung
Eine systemische Theorie des Zwischenmenschlichen
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit einer Abbildung und 3 Tabellen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.deabrufbar.
© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Sunnyisland/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99397-3
»Wir sind zwei, wir sind drei […].«
(Mikis Theodorakis, Imaste dio)
»Allerdings glaube ich, dass sie (die Delfine), wie wir selbst und andere Säugetiere, vornehmlich mit den Mustern ihrer Beziehung beschäftigt sind.«
(Gregory Bateson, 1983, S. 478)
Inhalt
Vorbemerkung
1Einführung: Der Raum des Zwischenmenschlichen
1.1Gemeinsame Beziehungsgestaltung als Basis
1.2Kreative Beziehungsgestaltung
1.3Gemeinsame Beziehungsgestaltung als Rahmen
1.4Kreative Kooperation
1.5Praxis und Theoriebildung
1.6Basale menschliche Beziehungssysteme
1.7Beziehungsgestaltende Akteure
1.8Theorie des Zwischenmenschlichen
1.9Geschichtlichkeit
1.10 Entwicklungsräume – Grenzen und Möglichkeiten
1.11 Unterschiedliche Ordnungen – Bewusstsein, Kommunikation und Sinn
Teil I: Beziehungswelten
2Ursprünge der Menschwerdung
2.1Kreative Beziehungsgestaltung – Spuren und Quellen
2.2Unterwegs zum schöpferischen Sein
2.2.1Beziehungswesen auf Wanderschaft
2.2.2Aufrecht gehende Wanderer mit Verstand, Überblick und Ausdauer
2.2.3Zeit der Artenvielfalt – kleine Gruppen herumziehender Homines
2.2.4Eine kulturelle Erfindung mit weitreichenden Folgen
2.3Metakommunikation und Erfindungsgeist
2.3.1Möglichkeiten eines offenen und fiktionalen Sprachsystems
2.3.1.1Austausch, Koordination, Kooperation und Organisation
2.3.1.2Fiktion
2.3.1.3Zukunftsorientierung und -planung
2.3.1.4Erfinden von Wirklichkeiten
2.3.1.5Gestalten von Wirklichkeiten
2.3.2Eintritt in eine Zeit kulturell beschleunigten Wandels
2.4Kooperation und Kommunikation
2.4.1Kulturelles Lernen
2.4.2Besonderheiten menschlicher Kommunikation
2.4.2.1Gemeinsam geteilte interaktive Aufmerksamkeit
2.4.2.2Gemeinsam geteilte Intentionalität (»shared intentionality«)
2.4.2.3Gemeinsam geteilte Hintergründe
2.4.3Sprachliche Infrastruktur als operative Basis
2.4.4Zusammenfassung
2.5Schöpferischer Geist und fantastisches Denken
2.5.1Fantasie – die Verselbstständigung des Geistes
2.5.2Bedeutungsgebung und Sinnproduktion
2.5.3Mehrdeutigkeit, Fehlerfreundlichkeit und doppelte Kontingenz
2.5.4Framing, Verschachtelung und Narration
2.5.4.1Fluide Kombinatorik und permanente Neu-Ordnung
2.5.4.2Bilder und Geschichten – die fantastische Verschachtelung von Szenarien
2.5.5Bewusstsein – der sich selbst beobachtende und gestaltende Geist
2.5.6Freies Spiel und mentale Simulation
2.5.6.1Selbstregulation im Wechsel von Zusammensein und Mit-sich-für-sich-Sein
2.5.6.2Mentale Simulation von Szenarien
2.6Austauschlust und Verständigungsfreude
2.6.1Intersubjektive Resonanz und Austauschlust
2.6.2Sprechen, leibliche Resonanz und Bewusstseinsbildung
2.7Übergänge – Menschwerdung als Wandel erster und zweiter Ordnung
2.7.1Neuordnung durch Fluktuation – wenn Veränderungen erster Ordnung zu einem Wandel zweiter Ordnung führen
2.7.2Sechs Entwicklungsbereiche des Humanen
2.7.3Signaturfähigkeiten des modernen Menschen
2.7.4Portfolio menschlicher Signaturfähigkeiten
2.8Soziales Zusammenleben als Ursprung
2.8.1Aufmerksamkeit für Beziehungsdynamik
2.8.2Kulturelle Kreativität als treibende Kraft
2.8.2.1Veränderungsstress
2.8.2.2Exkurs: Vom Primat kultureller Kreativität
2.8.3Auf der Insel – Robinson und Freitag
2.8.4Sozialer Erfindungsgeist
2.8.4.1Der »Love Code« (Porges) – Sicherheit als Basis
2.8.4.2Zugehörigkeit als zentrales Thema
2.8.4.3Verteilung und Sicherheit – soziale und psychische Konflikte als Quelle von Mitmenschlichkeit, Individualität und Zusammenarbeit
2.8.4.4Diversität als Lösung
2.8.4.5Mentale und emotionale Flexibilität als Lösung und Problem
2.8.5Liebe und Spiel
2.8.5.1Abweichung, Variation und Vielfalt
2.8.5.2Spiel aktiviert soziales Engagement
2.8.5.3Produktive Emotionen und Systemstimmungen
2.8.5.4Zärtlichkeit, Sex, Erotik, Fürsorge, altruistische Pflege, Fairness, Teilen, Mitfühlen, Trösten
2.8.6Fürsorge, Bindung und Beziehungslernen
2.8.7Ambivalenz und Flexibilität
2.8.7.1Zwei Formen der Beziehungsgestaltung
2.8.7.2Zwei Beziehungsmodi
2.8.8Emotionale Flexibilität und kulturelle Regulation
2.8.9Beziehungsverstehen und Beziehungsgestaltung
2.8.9.1Mentale Kalkulation und soziale Regulation
2.8.9.2Emotionale und mentale Flexibilität, Resilienz und Verletzlichkeit
2.8.9.3Beziehungsintelligenz und Weltklugheit
2.8.10 Kleine Gruppen als soziale Akademien
Teil II: Theorie des Zwischenmenschlichen
3Theoretische Grundlagen und Zugänge
3.1Theoriebildung als offener Prozess
3.2Systemtheoretische Prämissen
3.3Eine ökosystemische Perspektive
3.4Verschiedene theoretische Zugänge
3.4.1Subjektbeziehungsorientiertes Denken
3.4.2Kritik der Bindungstheorie
3.4.3Interaktionsorientiertes Denken
3.4.4Diskursiv orientiertes Denken
3.4.5Systemtheoretisch orientiertes Denken
3.5Kritik der »Theorie sozialer Systeme« – über Luhmann hinaus
3.6Prämissen einer Theorie des Zwischenmenschlichen
4Eine systemische Theorie menschlicher Beziehungsgestaltung
4.1Beziehungsgestaltung als Ursprung und Triebkraft menschlicher Evolution
4.2Soziales Zusammenleben, gegenseitige Beobachtung und gemeinsame Beziehungsgestaltung
4.3Organisationsebenen des Lebendigen
4.4Basale menschliche Beziehungssysteme
4.5Basale Beziehungssysteme als dynamische soziale Systeme
4.6Umgebungen und Umwelten in sozialen Systemen
4.6.1Umgebung und Umwelt – eine fundamentale Unterscheidung
4.6.2Doppelt resonante Wechselwirkungen in basalen Beziehungssystemen
4.6.3In mir und in der Umgebung aktiv – zur Unterscheidung von ICH, NICHT-ICH und WIR
4.7Interdependenz und Interferenz in basalen Beziehungssystemen
4.7.1Zur Interdependenz von Ereignissen
4.7.2Interdependenz in basalen Beziehungssystemen
4.7.3Interferenz zwischen Personen
4.8Geschichtlichkeit in basalen Beziehungssystemen
4.8.1Schnell verblassende und länger andauernde Musterprozesse
4.8.2Situationserleben und generalisierte Episoden
4.8.3Vergangenheitsbezug und Zukunftsbezug
4.8.4Empfinden von Identität und Kohärenz
4.8.5Geschichtliche Bedeutungsrahmung und konkrete Lebensweise
4.8.6Aufbewahrung, Wiederverknüpfung und Wandlung
4.8.7Die Geschichtlichkeit gemeinsamer Beziehungsgestaltungen
4.9Dimensionen gemeinsamer Beziehungsgestaltung
4.10 Die leibliche Dimension gemeinsamer Beziehungsgestaltung
4.10.1Primäre Co-Existenz
4.10.2Supramodales Beziehungserleben
4.10.3Einander berühren: Kontakt, Begrenzung und Austausch
4.10.4Tönen, Summen, Singen – stimmliche Abstimmung und stimmlich erzeugte Resonanzbeziehungen
4.10.5Raumempfinden, Bewegungskonturen und habituelle Beziehungsgestaltung
4.10.6Erleben und Beobachten von Aktivierungskonturen
4.10.7Soziale Räume als Beziehungsräume
4.10.8Habituelle analoge Beziehungsgestaltung
4.10.9Gegenseitiges soziales Engagement und vegetative Regulation (Polyvagal-Theorie)
4.10.10 Synchronisation von Aufmerksamkeit: das Zusammenspiel von Blicken, Gesichtsausdrücken und Augenbewegungen
4.10.10.1 Individuelle Aufmerksamkeit – die Verbindung von Innenwelt und Umgebung
4.10.10.2 Synchronisation sinnlicher Aufmerksamkeit in Beziehungen
4.10.10.3 Blickkontakt und gegenseitige Aufmerksamkeit
4.10.11 Lachen und Weinen – soziale Synchronisation
4.11 Die emotionale Dimension gemeinsamer Beziehungsgestaltung
4.11.1Gemeinsame Regulation und Abstimmung von Affekten
4.11.2Gemeinsame Koordination und Abstimmung von Emotionen
4.11.3Denken und Fühlen, Bauch und Hirn
4.11.4Emotionale Gestimmtheiten und emotionale Resonanzen
4.11.5Habituelle emotionale Grundmuster
4.11.6Gemeinsam hergestellte Systemstimmungen
4.11.7Vitales Empfinden in und intuitives Erleben von Beziehungen
4.12 Die kooperative Dimension gemeinsamer Beziehungsgestaltung
4.12.1Tatsachen
4.12.2Gemeinsame Urheberschaft
4.12.3Interaktive Präsenz und kooperative Kopplung
4.13 Die kommunikative Dimension gemeinsamer Beziehungsgestaltung
4.13.1Grundlagen menschlicher Kommunikation
4.13.2Miteinander Sprechen als mehrdeutiges Ereignis
4.13.3Mentale Kalkulation – miteinander sprechen im Modus des gegenseitigen Mentalisierens
4.13.4Mentalisierungsmodus
4.13.5Sprache als zweischneidiges Schwert
4.13.6Gemeinsame Sinnerfindung und Wir-Bedeutungen
4.13.7Das Empfinden einer Gesprächssituation
4.13.8Metakommunikation
4.13.8.1Gemeinsames Mentalisieren
4.13.8.2Sprechen über Sprechen
4.13.8.3Über eine Beziehung ins Gespräch kommen
4.13.9Gemeinsame geteilte Geschichtlichkeit
4.13.9.1Wandel erster Ordnung: Kontinuität, Konstanz und moderater geschichtlicher Wandel
4.13.9.2Wandel zweiter Ordnung: Irritation, radikale Abweichung und experimenteller Wandel
4.13.9.3Neuordnung und alternative Rahmung
4.13.9.4Die Macht sprachlicher Rahmungen
4.14 Trialogisches Geschehen – Beziehungsgestaltung in Triaden
4.14.1Die Entwicklung von Familienallianzen – Beziehungsgestaltung in primären Dreiecken
4.14.2Kritische Situationen und Übergänge
4.14.3Intersubjektive Verbundenheit
4.14.4Gemeinsame Rahmung
4.15 Die Entfaltung transaktionaler Muster und die Epigenese von Beziehungssystemen
4.15.1Transaktionale Muster
4.15.2Die Entwicklung basaler Beziehungssysteme
4.15.3Die Epigenese biologischer, psychischer und sozialer Systeme
4.15.4Zwei-Ebenen-Modell der Transformation – Wandel erster und zweiter Ordnung
4.15.5Transformationsprozesse – Neuordnung durch Fluktuation
4.15.6Epigenese der Persönlichkeitsentwicklung (Erikson)
4.15.7Epigenese von Beziehungssystemen (L. C. Wynne)
4.15.7.1Verschachtelung und Anordnung hierarchischer Organisationsebenen
4.15.7.2Jede Organisationsebene hat ihre eigene Qualität
4.15.7.3Feldabhängige soziale Interdependenz und personale Eigenständigkeit
4.15.8Entwicklungsbereiche basaler Beziehungssysteme
4.15.9Funktionale und parafunktionale Muster
5Entwicklungsräume gemeinsam gestalten
5.1Gemeinsam geteilte Entwicklungsräume (Beziehungsethik)
5.2Licht und Schatten – zur Ambivalenz der Kulturentwicklung
5.3Therapie: Beziehung als geschützter Entwicklungsraum
5.4Evolution der Beziehungsgestaltung – Psychotherapie als Beziehungsraum
Postskriptum
Literatur
Dank
Vorbemerkung
Lesbarkeit und Verständlichkeit sind mir ebenso wichtig wie eine möglichst genaue Sprache, die allen gerecht wird. Ich nutze daher weibliche und männliche Schreibweisen »freihändig«, je nachdem was mir – zwischen Plural, Singular, Sternchen, Sprachästhetik und Genderbewusstheit – besser zu passen scheint. Ich nehme mir meine Freiheiten, übe mich in Toleranz und schlage vor, dass Sie es ebenso tun.
1 Einführung:Der Raum des Zwischenmenschlichen
»Alles wirkliche Leben ist Begegnung.«
(Martin Buber, 1979, S. 18)
Im Verlauf der Evolution erfanden Menschen immer komplexere Formen und Muster des sozialen und kulturellen Miteinanders, der Kooperation und kommunikativen Abstimmung. Gleichzeitig entwickelten sich ebenso komplexe Formen und Muster des Selbstempfindens, des Bewusstseins und der Sprachfähigkeit. Was uns als Spezies ausmacht, geht aus dem sozialen Zusammenleben hervor und entwickelt sich im Rahmen gemeinsamer Beziehungsgestaltung.
Wir haben tatsächlich gelernt, Beziehungen schöpferisch zu gestalten, zu uns selbst, untereinander und zur Umgebung. Das bedeutet auch, die Möglichkeitsräume, in denen wir uns entwickeln können, sind nur in einem gewissen Maß vorgegeben. Tatsächlich erfinden und gestalten wir die Entwicklungsräume, in denen wir uns bewegen, selbst – in unserer Fantasie und im kooperativen und kommunikativen Miteinander.
Diese Erkenntnis erschreckt und tröstet zugleich. Die Welt ist so, wie wir sie gemeinsam mit anderen hervorbringen, und ja, wir können sie gemeinsam neu erfinden und anders gestalten. Im Rahmen der natürlichen Umgebungen und der Naturgesetze sind unsere gemeinsamen Gestaltungsmöglichkeiten fast unbegrenzt.
Subjektiv erfahren und erleben wir unser In-der-Welt-Sein als Resonanz (Rosa, 2016), aber da ist mehr als subjektive Resonanz. »Als Jugendliche dachte ich, es gebe in jeder Beziehung zwischen Menschen noch etwas Drittes, ein von den Akteuren zwischen ihnen hergestelltes imaginäres Wesen, und dieses unsichtbare Ding sei so wichtig, dass es einen eigenen Namen verdiente …«, schreibt Siri Hustvedt (2015, S. 260, Hervorhebung J. B.).
Wenn aber das, was Menschen in einer Beziehung zwischen1 sich herstellen, weder ein Ding noch ein Wesen ist, was ist es dann? »Das Tun des Einen ist das Tun des Anderen«, formuliert treffend Helm Stierlin (1971) in seinem »Versuch über die Dynamik menschlicher Beziehungen«. Doch wie erfassen wir, was, neben dem subjektiven Erleben und Tun, zwischen Menschen geschieht? Wir können es Intersubjektivität, Interaktion, Interdependenz, Interferenz oder Resonanzgewebe (Rosa, 2016, S. 416) nennen. Aber solche Begriffe verlieren sich leicht im Allgemeinen, sie beantworten kaum die Frage, wie genau Menschen gemeinsam Beziehungen herstellen, noch, was sie zwischen sich »herstellen«, wenn sie gemeinsam eine länger andauernde Beziehung gestalten.
Wie und auf welcher Basis sind personale und interpersonale Phänomene miteinander verknüpft, und wie entsteht diese Basis? Und wenn es da etwas gibt, wie genau entfaltet sich zwischen Menschen jenes »Dritte«, von dem Siri Hustvedt spricht? Was also meinen wir genau, wenn wir von menschlichen Beziehungen sprechen?
1.1 Gemeinsame Beziehungsgestaltung als Basis
Die Welt zwischenmenschlicher Beziehungen ist uns nur allzu vertraut. Sehr früh entwickeln Menschen im intersubjektiven Bezogensein und durch gemeinsame Beziehungsgestaltungen nicht nur ein differenziertes Selbstempfinden, sondern auch ein implizites Beziehungswissen (Stern, 1993, 2010). Wir leben eingetaucht in Beziehungen, und doch gibt es auf diesem Gebiet, das komplexer und faszinierender kaum sein könnte, noch viel zu entdecken.
Eine erweiterte Sichtweise ergibt sich, wenn wir unsere Vorstellungswelt und unsere Aufmerksamkeit mehrdimensional, mehrfach fokussiert und zirkulär organisieren. Stellen wir uns ein Fußballspiel vor oder ein Konzert: Wollen wir, wie gute Dirigenten oder Fußballtrainer, das Spiel oder die Musik als Ganzes, als Ereignis erfassen, sollten wir sowohl (a) die Performance einzelner Spieler/-innen als auch (b) ihr Zusammenspiel sowie das, (c) was die Spieler durch ihre besondere Art des Zusammenspiels hervorbringen, in den Blick nehmen (oder hören). Im Fall eines Fußballteams bestünde die Hervorbringung in wechselnden, sich je nach Spielverlauf verschiebenden Mustern von Konstellationen und Konfigurationen, die das Spiel eines Teams auszeichnen und die, indem sie intensiv trainiert werden, die Performance des Teams und jedes einzelnen Spielers formen. Im Fall eines Orchesters oder einer Band entsteht, wenn es gut geht, aus den besonderen Mustern des Zusammenspiels ein besonderer (unverwechselbarer) Gesamtklang, ein Sound der (einmal eingegroovt) wiederum das Spiel jedes einzelnen Band- oder Orchestermitglieds prägt. Natürlich kann man allein mit dem Ball trainieren oder Geige üben, aber niemand kann allein Fußball spielen oder musizieren. Gemeinsames Musizieren verbindet Individuen. Musik ruft Kollektive ins Leben und eröffnet gleichzeitig Möglichkeiten der individuellen Entwicklung. Ähnlich ist es mit Fußball (wobei Musik vielleicht doch das Größere ist, aber das hängt vom Beobachter ab).
Ganz ähnlich ist es im Beziehungsleben von Paaren, Familien oder kleinen, dauerhaft bestehenden Gruppen. Während die Beteiligten ihre Beziehungen zueinander gestalten und dabei Muster von Transaktionen hervorbringen, organisieren sie sowohl (a) sich selbst als auch (b) die anderen. Um diesen zentralen Zusammenhang in den Blick zu bringen, schlage ich vor, die Art und Weise der Beobachtung und Aufmerksamkeit auf den Bereich des Zwischenmenschlichen auszuweiten: Im intersubjektiven Beziehungsraum (Stern, 1993) ereignet sich (a) das Erleben und Handeln von (mindestens zwei) Personen und (b) das, was zwischen den Personen geschieht, auf der Basis und im Rahmen gemeinsamer Beziehungsgestaltung.
In basalen Beziehungssystemen (Teil II) wiederholen, verändern und entwickeln sich über eine gewisse Dauer Formen und Muster gemeinsamer Beziehungsgestaltungen, und diese Transaktionsmuster (Wynne, 1985) wirken auf die Beteiligten zurück, sie werden erlebt und empfunden.2 Nicht umsonst verfügen Menschen über ein feines Gespür für Beziehungen (so wie die Inuit über ein feines Gespür für Schnee verfügen). Intuitiv nehmen wir in unserem Vitalitätsempfinden (Stern, 1993) das »Klima« in Beziehungen durchaus wahr: als besondere Atmosphären (Ohler, 2016) oder Systemstimmungen (Bleckwedel, 2008). Kurz: Wir existieren in intersubjektiven Beziehungen,3 und wir beschränken oder erweitern unsere Entwicklungsmöglichkeiten durch die Art, wie wir Beziehungsräume miteinander »einrichten« und Beziehungen gestalten.
1.2 Kreative Beziehungsgestaltung
Die Fähigkeit, gemeinsam mit anderen Beziehungen kreativ zu gestalten4, die uns vor allen anderen Lebewesen besonders auszeichnet, geht aus dem sozialen Zusammenleben hervor, sie beflügelt den menschlichen Geist und begründet soziale und kulturelle Erfindungen und damit die Vielfalt und Mannigfaltigkeit menschlicher Kommunikation und menschlichen Daseins. Doch wie kam es im Verlauf der Evolution, und wie kommt es im Verlauf des persönlichen Lebens zur Entwicklung dieser Fähigkeit? Um das genauer zu verstehen, müssen wir zurückgehen zu den Ursprüngen der Menschwerdung, zu den systemischen Anfangsbedingungen, die unsere Entwicklung als Spezies bestimmen. Wie und unter welchen Bedingungen hat sich diese Fähigkeit im Verlauf der menschlichen Evolution immer differenzierter herausgebildet? Welche Möglichkeiten, Ambivalenzen und Widersprüche, welche produktiven und destruktiven Kräfte schlummern in diesem kreativen Potenzial?
Beziehungskreativität hinterlässt keine materiellen Artefakte wie Knochen oder Faustkeile, und doch liefert die evolutionäre Anthropologie (Tomasello, 2006, 2011, 2020; Suddendorf, 2014a) diverse Anhaltspunkte, um die Menschwerdung als Geschichte zu verstehen, in der sich Beziehungskreativität entfaltet. Diese Geschichte, in der die Evolution gemeinsamer Beziehungsgestaltungen die Evolution der Menschheit vorantreibt, soll hier in Ansätzen erzählt werden (Teil I): Sie bildet als anthropologische Rekonstruktion das Fundament und den Ordnungsrahmen für alle weiteren Überlegungen zu einer entwicklungsorientierten systemischen Theorie gemeinsamer Beziehungsgestaltung, die ich in Teil II vorstelle.
1.3 Gemeinsame Beziehungsgestaltung als Rahmen
Lebendige Beziehungen bilden die Basis des alltäglichen Lebens und Überlebens. Diese Erkenntnis ist weder neu noch originell. Sie spiegelt die Lebenserfahrung des Homo sapiens, gleich auf welchem Kontinent, in welcher Zeit oder Kultur. Gelingende oder misslingende menschliche Beziehungen sind von entscheidender Bedeutung, sowohl für den sozialen Zusammenhalt als auch für das Dasein jedes Einzelnen. Gelingende Beziehungen begünstigen Entwicklung, Zufriedenheit, Wohlbefinden und Gesundheit. Menschen sind – so selbstbezüglich sie auch immer erscheinen mögen – vor allem Beziehungswesen, sie sind auf gelingende Beziehungen angewiesen. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen diese Erkenntnis.5 Allein die berühmte Harvard-Studie6 zeigt eindrücklich: Lang andauernde gute Beziehungen mit hoher Qualität halten gesund und machen zufrieden. Leben heißt In-Beziehung-Sein zu sich selbst, zu anderen, zur Umgebung und zu einer Aufgabe, die uns mit Sinn erfüllt.
Die Ergebnisse der Psychotherapieforschung zeigen ebenfalls mit schöner Regelmäßigkeit: Die Qualität einer therapeutischen Beziehung entscheidet darüber, was sich im Prozess einer Therapie zwischen und in den Beteiligten ereignen kann. »Kein Befund der Psychotherapieforschung ist […] so häufig bestätigt worden wie der Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Wirkfaktor Therapiebeziehung und dem Ergebnis von Psychotherapie« (Pfammatter, Junghan u. Tschacher, 2012, S. 24)7. Das gleiche Ergebnis zeigt sich in den Bereichen Beratung (Nestmann, 2004; Hackney u. Cormier, 1998), Coaching (Pauw, 2016), Soziale Arbeit (Gahleitner, 2017) oder Pädagogik.8
Wenn aber die Qualität des Beziehungsgeschehens der entscheidende Faktor ist, dann rückt die gemeinsame Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die spezifische Gestaltung einer Beziehung gibt den gemeinsamen Rahmen vor, eröffnet oder verschließt Möglichkeitsräume. Der intersubjektive Raum (Stern, 1993, 2010; Wegscheider, 2020), in dem sich zwischenmenschliches Geschehen ereignet, ist weder statisch vorgegeben noch kann er einseitig kontrolliert werden: Er wird vielmehr von den beteiligten Akteuren in einem Prozess kooperativen und kommunikativen Zusammenwirkens gemeinsam hervorgebracht und gestaltet.
Es sind daher nicht, wie irrtümlich in klassischen Forschungsansätzen zur Wirkung von Psychotherapie angenommen, Methoden und Techniken, die in therapeutischen Prozessen wirken, sondern Therapeuten und Klienten, die gemeinsam – in unterschiedlichen Rollen, mit unterschiedlichen Verantwortungen und Aufgaben (vgl. Staats, 2017) – therapeutische Prozesse oder therapeutische Situationen so gestalten, dass Methoden und Techniken wirksam werden können. »Leider ist diese wechselseitige Einbettung von Behandlungstechnik und Beziehungsgestaltung, dieses psychotherapeutische Pendant zu epistemischem Wissen und professionellem Können, mikroanalytisch kaum studiert worden«, schreibt Michael Buchholz und fährt fort, »hier liegt der Ursprung von Kategorienfehlern einer empirischen Forschung, die nur personenunabhängige Technik evaluieren will« (Buchholz, 2020, S. 94). Und Michael Macht bemerkt in diesem Zusammenhang: »Nachdenklich macht allerdings, dass sich trotz der mehr als 12.000 klinischen Studien und über 700 Metaanalysen der letzten 50 Jahre nicht genau sagen lässt, wodurch [diese] Behandlungserfolge zustande kommen« (Macht, 2018, S. 369). Auf Grund vieler Studien und klinischer Evidenz dürfen wir allerdings mit einiger Sicherheit annehmen, dass Behandlungserfolge- oder misserfolge stark durch die Art und Weise gemeinsamer Beziehungsgestaltung beeinflusst werden.
1.4 Kreative Kooperation
Offensichtlich gehören mindestens immer zwei Personen zu einer therapeutischen Beziehung, und diese wird gemeinsam gestaltet.
(A) Auf der therapeutischen Seite spielen Beziehungsverstehen und beziehungsgestalterisches Können, sogenannte »common factors«,9 offenbar eine überragende Rolle. Begegnen Therapeuten und Therapeutinnen ihren Klienten und Klientinnen mit Respekt, Zuversicht und Mitgefühl? Werden Settings angemessen variiert, Methoden und Techniken intuitiv, souverän und flexibel eingesetzt, passend zur Situation, zur Klientel und zu den Aufgaben? Mit welcher inneren Einstellung und Haltung wird die Kooperation mit Klient:innen organisiert?
(B) Auf der Klientenseite kommt es vor allem auf Respekt für die Regeln, den Rahmen und Vertrauen an: Motivation zur Zusammenarbeit, Sympathie, Zuversicht und Zufriedenheit mit dem methodischen Vorgehen beeinflussen, wie wir aus der Forschung wissen, die Wirkung und den Erfolg therapeutischer Prozesse ganz erheblich.
Allerdings ergibt sich erst aus (C) der Beziehungspassung und (D) gemeinsam geteilten Zielen ein tragendes und erfolgversprechendes Arbeitsbündnis. Entscheidend ist offensichtlich, wie Therapeuten und Klienten ihre Beziehung zueinander organisieren und gestalten, um im konkreten Arbeitsprozess (immer wieder) eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten. Damit rückt die kreative Kooperation (Bleckwedel, 2008) aller Beteiligten in den Fokus der Aufmerksamkeit. Konzepte der therapeutischen Allianz, die beide Seiten im Interaktionsprozess berücksichtigen, scheinen deshalb auch weit »besser geeignet [zu sein], Therapievorhersagen zu machen, als ein Konzept, das die Aufmerksamkeit nur auf einen der beiden Interaktionspartner richtet« (Staats, 2017, S. 9).
Die Evolution der Psychotherapie brachte eine begrüßenswerte Vielfalt verschiedener kooperativer Formen kreativer Beziehungsgestaltung hervor: unterschiedliche Settings, unterschiedliche Verfahrensweisen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen, Medien, Methoden und Techniken.10 Die Liste der Pioniere und Möglichkeiten würde hier jeden Rahmen sprengen, und doch geht es immer auf irgendeine Art und Weise um kreative Kooperation. Heute können wir aus einem breiten Repertoire schöpfen, um therapeutische Beziehungen und Prozesse kreativ zu gestalten.
Dabei ist die Auswahl keineswegs beliebig! Im besonderen Fall verfolgt therapeutische Beziehungsgestaltung immer das übergeordnete Ziel, kreative Kooperation in Bezug auf gemeinsam geteilte Ziele zu ermöglichen. Gelingende Beziehungsgestaltung kann daher als gemeinsam geteilter Nenner psychotherapeutischer Verfahren angesehen werden (vgl. unter anderem Bronisch u. Sulz, 2015). Wie kann eine therapeutische Beziehung produktiv, kooperativ und kreativ gestaltet werden? Diese Frage durchzieht wie ein roter Faden die Praxis und die Theoriebildung moderner Psychotherapie.11 Die Zukunft der Psychotherapie liegt daher nicht nur in der differenzierten Erforschung des Zusammenspiels wirksamer Faktoren (Bleckwedel, 2006, S. 378) und in methodischer Vielfalt, sondern ebenso in der Entwicklung einer allgemeinen Theorie menschlicher Beziehungsgestaltung (vgl. Osnabrücker Thesen zur Psychotherapie, 2019).
Allgemein gilt: In der Praxis unterstützen, begleiten und gestalten Therapeut/-innen und Berater/-innen aller Richtungen und Schulen durch ihr praktisches Tun die Entwicklung von Beziehungen. Dabei geht es nicht nur um (a) Beziehungen zu sich selbst und (b) Beziehungen zu bedeutungsvollen Gegenübern, sondern auch um (c) Beziehungen zwischen Menschen und (d) Beziehungen zur weiteren natürlichen Umgebung, Formen des Bezogenseins, die im menschlichen Dasein, im Raum des Zwischenmenschlichen12 eine untrennbare Einheit bilden.
1.5 Praxis und Theoriebildung
Praktiker interessieren sich oft weniger für die Tiefen und Feinheiten von Theorien, sondern verständlicherweise mehr für die unmittelbare Praxis, also für die Frage »Was können wir tun und wie wird es gemacht?«. Doch die Praxis stellt uns immer wieder vor übergeordnete Fragen, und die Antworten auf diese Fragen organisieren, als Vorstellungswelt, nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern ebenso unser Handeln weit mehr, als uns gemeinhin bewusst wird. »Theorie bestimmt, was wir beobachten können« (Einstein, zit. nach von Schlippe u. Schweitzer, 2016, S. 121). Aber unsere Vorstellungen bestimmen nicht nur die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, sondern auch, wie wir uns in ihr bewegen und wie wir, gemeinsam mit anderen, handelnd die Welt hervorbringen.13
Die kritische Auseinandersetzung mit Vorstellungen, die uns in der Praxis leiten und an die wir uns gewöhnt haben, ist also, je länger wir darüber nachdenken, keine rein akademische, sondern eine für die Praxis höchst bedeutungsvolle Angelegenheit. Die Geschichte der Psychiatrie und Psychotherapie zeigt eindrücklich, wie sich Vorstellungswelten und damit Praktiken wandeln können (Stierlin, 1971, 2001). Es gibt keinen vernünftigen Grund anzunehmen, diese Entwicklung sei abgeschlossen.
Psychotherapeutische Theoriebildung beginnt mitten im Leben und beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel mehr oder weniger bekannter Phänomene, immer verbunden mit der Intention, therapeutische Beziehungen, Settings und Situationen bewusster, flexibler, passgenauer und vielfältiger zu gestalten.
1.6 Basale menschliche Beziehungssysteme
Das Leben der Menschen vollzieht sich seit Urzeiten in basalen Beziehungssystemen, die sich von flüchtig vorübergehenden Interaktionen, Organisationen oder Gesellschaften14 unterscheiden: Familien, Paare, Eltern-Kind-Beziehungen, Freundschaften und kleine überdauernde Gruppen reproduzieren und entwickeln sich im »gemeinsamen Lebensvollzug« als »intime Beziehungen« (von Schlippe u. Schweitzer, 2016, S. 131), und zwar dauerhaft, mit allen Windungen und Wendungen, über eine gewisse Zeit.
Solche basalen Beziehungssysteme tauchen als elementare soziale Systemeinheiten in allen Gemeinschaften und Gesellschaften auf – und zwar unabhängig vom Stand der Evolution, von der jeweiligen historischen Situation, vom Grad der Zivilisation, von der jeweiligen kulturellen Verfasstheit oder der speziellen Organisation einer bestimmten Gesellschaft.
Eine systemische Theorie menschlicher Beziehungsgestaltung sollte sich aus zwei Gründen auf soziale Systeme dieser Art beziehen. Ein Grund liegt auf der Hand: In der Praxis beschäftigen sich Therapeuten/Therapeutinnen mit eben solchen Systemeinheiten, und gegebenenfalls bilden sie mit Klient:innen vorübergehend ähnliche Systeme.15
Der zweite Grund ergibt sich aus einer übergeordneten evolutionären und gesellschaftlichen Perspektive. Basale Beziehungssysteme sind nicht einfach nur Orte, an denen sich das »allzu Menschliche« in wechselnden Inszenierungen ewiglich wiederholt. Wir müssen uns basale Beziehungssysteme vielmehr als Entwicklungsräume vorstellen, in denen sich der Prozess der Zivilisation zeigt und im Detail vollzieht.
Basale menschliche Beziehungssysteme sind Orte der affektlogischen (Ciompi, 1982) Transformation: Dort entwickelt und transformiert sich zuallererst das psychische Erleben, das Sprechen, Handeln und Wünschen, und dort werden soziale und kulturelle Erfindungen, wenn nicht gemacht, so doch weitergegeben und verstetigt. Die Erkenntnisse der Soziologie und Sozialpsychologie zeigen eindrücklich den engen Zusammenhang von gesellschaftlichen Beziehungslogiken und Beziehungslogiken in basalen Beziehungssystemen.16
In jedem Fall beginnt die Praxis und Theorie der modernen Psychotherapie seit Freud mit der Dynamik in basalen Beziehungssystemen. In diesem Bereich, dem Raum des Zwischenmenschlichen, geht es um extrem komplexe und feine emotionale, mentale, interaktive und kommunikative Abstimmungs- und Regulationsprozesse, die sich über eine gewisse Dauer ereignen, sich in transaktionalen Mustern verselbstständigen und weiterentwickeln: Muster von Beziehungsgestaltungen, die, wie sich noch zeigen wird, als Transaktionsmuster (Wynne, 1985) eine eigene Dynamik entfalten.
1.7 Beziehungsgestaltende Akteure
Im Raum des Zwischenmenschlichen sind wir gestaltende Beobachter, die sich gegenseitig beim Beobachten und Gestalten von Beziehungen beobachten. Schon Menschenaffen beobachten genau, wie sich Beziehungen in ihrem Umfeld entwickeln (siehe Teil I).
Als Akteure in basalen Beziehungssystemen sind wir also nicht nur »teilnehmende Beobachter«, mehr oder weniger zufällig und passager als »Umwelten« (Luhmann, 1984) eingekoppelt ins Beziehungsgeschehen. Vielmehr bringen wir die intimen Partnerschaften, Eltern-Kind-Beziehungen, Freundschaften oder therapeutischen Beziehungen, von denen hier die Rede ist, gemeinsam mit anderen Akteuren hervor. Darin liegt die tiefere Bedeutung der Kybernetik zweiter Ordnung, also die systemtheoretische Erkenntnis, dass wir immer schon Teil des Systems sind, das wir beobachten. Wir beeinflussen und gestalten, als beziehungsgestaltende Akteure, die Systeme, von denen wir ein Teil sind, ob wir es nun wollen oder nicht. Eine neutrale Position existiert im Raum des Zwischenmenschlichen nicht (Bleckwedel, 2008, S. 39 ff.).
Das gilt selbst im größeren Maßstab: Unser persönlicher Einfluss auf die uns umgebende und nährende Biosphäre mag marginal sein, und doch hinterlassen wir persönlich »Fußabdrücke« oder »Handabdrücke«.
Weit größer ist unser Einfluss in den basalen Beziehungssystemen, die wir gemeinsam mit anderen hervorbringen und in denen wir uns bewegen. Als beziehungsgestaltende Beobachter bringen wir gemeinsam mit anderen Akteuren hervor, was wir Beziehung nennen. Kurz: Menschen beobachten und gestalten sich gegenseitig beim Beobachten und Gestalten von Beziehungen und bringen dabei komplexe Muster von Beziehungen hervor, die auf die Beteiligten zurückwirken.
1.8 Theorie des Zwischenmenschlichen
Legen wir den Fokus der Beobachtung auf die persönliche Entwicklung, können wir sagen, dass sich die an einem basalen Beziehungssystem beteiligten Personen durch bezogene Individuation (Stierlin, 1978, 1989) entwickeln. Gleichzeitig entwickeln sich jedoch auch die Transaktionsmuster zwischen den Personen. In der persönlichen Entwicklung, der Individuation (Simon, 1984) gehen Muster von Emotionen und Verhaltensweisen aus vorangegangenen Mustern hervor, ähnlich entfalten sich in basalen Beziehungssystemen über die Zeit komplexere Formen der Koordination, Interaktion, Kooperation und Kommunikation zwischen den beteiligten Personen.17
Im Bereich des Zwischenmenschlichen ereignen sich also immer mindestens drei Entwicklungsprozesse gleichzeitig: (a) die personale Entwicklung einer Person A, (b) die personale Entwicklung einer Person B und (c) die Entwicklung von Mustern der Koordination, Interaktion, Kooperation und Kommunikation zwischen den Personen A und B. Diese Entwicklungen sind wiederum kontextuell eingebettet in (d) Entwicklungen der engeren und weiteren Umgebung.
Will man das komplexe Zusammenspiel aller Entwicklungsprozesse – die bezogenen Individuationen (Stierlin, 1978) der Personen und die Epigenese von Beziehungssystemen (Wynne, 1985) – im Zusammenhang erfassen und verstehen, stößt man mit Theoriearchitekturen (theoretischen Sichtweisen), die vorwiegend subjektbeziehungstheoretisch oder kommunikationstheoretisch argumentieren, deutlich an Grenzen. Auf die theoriegeschichtlichen Hintergründe, die damit verbundenen theoretischen Probleme und deren Lösung gehe ich in Teil II detailliert ein. Hier nur so viel: In der kommunikativ orientierten Theorie sozialer Systeme (Luhmann, 1984) werden handelnde Subjekte als beziehungsgestaltende Akteure explizit ausgeblendet, während subjektbeziehungsorientierte Entwicklungstheorien sich weitgehend auf die Betrachtung einzelner Subjekte in ihrer Beziehung zur Umgebung beschränken. Das gilt auch für die weithin bekannte Bindungstheorie (Bowlby, 1975, 1988; Grossmann u. Grossmann, 2009, 2012, 2020), die in der Entwicklungspsychologie und inzwischen auch in der Psychotherapie (Trost, 2018) eine überragende Rolle spielt. Der Forschungsschwerpunkt liegt überwiegend auf der Entwicklung einzelner Kinder in Bezug zur mütterlichen Umgebung. Als eigenständige Subjekte, die sich in der Beziehung zu ihren Kindern ebenfalls persönlich weiterentwickeln (Fortsetzung der bezogenen Individuation in der Beziehung zu Kindern), tauchen Eltern, Väter und Mütter in der Literatur kaum auf. Ausnahmen bestätigen die Regel: »Geburt einer Mutter: Die Erfahrung, die das Leben einer Frau für immer verändert« (Stern u. Bruschweiler-Stern, 2014) lautet einer der wenigen Titel, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Erst in einer erweiterten Sichtweise – wenn man also annimmt, dass sich alle an einem basalen Beziehungssystem beteiligten Person persönlich permanent weiterentwickeln –, richtet sich die Aufmerksamkeit auch darauf, wie sich Eltern und Großeltern in der Beziehung zu ihren Kindern und Enkeln lebenslang weiterentwickeln.
Ein Blick auf die Epigenese von Beziehungssystemen (Wynne, 1985) fehlt in der Forschung hingegen fast vollständig. Basale Beziehungssysteme tauchen als eigenständige, sich selbst entwickelnde dynamische Einheiten in den gängigen Theorien schlicht nicht auf und werden daher auch kaum erforscht. Dabei wäre es doch interessant, genauer zu beobachten, wie die Muster und Formen der Koordination, Interaktion, Kooperation und Kommunikation in basalen Beziehungssystemen sich entwickeln und immer komplexer werden. Mit dieser Dimension von Entwicklung haben sich bisher nur wenige Forscherinnen beschäftigt, eine rühmliche Ausnahme bilden die Untersuchungen von Elisabeth Fivaz-Depeursinge und Antoinette Corboz-Warnery (2001), auf die ich in Teil II ausführlich eingehe.
Aus der Praxis ist jedenfalls hinlänglich bekannt, dass sich in länger andauernden intensiven Beziehungen bestimmte wiederkehrende Transaktions- und Kommunikationsmuster – und damit spezifische Systemstimmungen (Bleckwedel, 2008) – verfestigen, herausbilden und entwickeln, die auf die Personen, die diese Muster als Akteure selbst hervorbringen, zurückwirken. Die Bedeutung dieser Muster für die individuelle und kollektive Entwicklung kann kaum überschätzt werden.18
1.9 Geschichtlichkeit
Was verbindet die unterschiedlichen, ineinander verschachtelten Organisationsebenen (Wynne, 1985) des Lebendigen?19 Psychische, soziale und kulturelle Systeme bilden unterschiedliche Systemtypen (Luhmann, 1984), da sie aus unterschiedlichen Elementen bestehen; sie generieren jeweils spezifische Organisations- und Prozessstrukturen und folgen eigenen Regeln. Was also könnten solche Systeme gemeinsam haben? Was verbindet Menschen mit Menschen und diese mit den sozialen Systemen und den Kulturen, die sie hervorbringen, und der Biosphäre, von der sie ein Teil sind?
Gregory Bateson (1983, 1984) hat darauf hingewiesen, dass alle lebenden Systeme, wenn auch auf jeweils sehr besondere Art und Weise, neben einer
(A) Struktur gleichzeitig eine Art von (B) Strukturbewusstsein (Bateson, 1978,
S. 60) ausbilden. Es gibt demnach, so die These, in allen lebendigen Systemen eine Art von geschichtlichem Strukturbewusstsein – ein Bewusstsein über die besondere Gewordenheit und das Werden, mit anderen Worten über die Entwicklung der eigenen Selbstorganisation. (A) Struktur und (B) Strukturbewusstsein lebender Systeme sind nicht identisch, müssen jedoch zusammengedacht werden. Das ist gemeint, wenn Bateson (1984) von Geist und Natur als unauflöslicher Einheit spricht.
Was vielleicht etwas kompliziert klingt, kann gut beobachtet werden, wird subjektiv erlebt20 und ergibt, bei genauerer Betrachtung, einigen Sinn. Es gilt für so unterschiedliche Lebewesen und lebende Systeme wie Menschen, Bäume, Seesterne, Delfine, Elefanten, Bienenvölker, Gruppen von Affen, Wälder und Wiesen oder ganze Ökosysteme. »Das Muster, das verbindet, ist ein Metamuster«, notiert Bateson (1984, S. 19), und es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass sich sowohl menschliche Bewusstseinssysteme (Kandel, 2006) als auch soziale und kulturelle Systeme (Elias, 1976) wie alle lebenden Systeme (Maturana u. Varela, 1987), geschichtlich prozessieren und entwickeln. Eine ökosystemische Theorie des Zwischenmenschlichen sollte daher von Geschichtlichkeit ausgehen:
1.Geschichtlichkeit verbindet, als Grundeigenschaft, sowohl (a) sehr kleine, mittlere und sehr große lebende Systeme (Einzeller, Menschen, Gesellschaften, die Biosphäre) als auch (b) unterschiedliche Systemtypen (leibliche, psychische, soziale, kulturelle oder politische Systeme). Alle diese Systeme prozessieren (sich) geschichtlich.
2.Geschichtliche Systeme beziehen sich im Prozess ihres Werdens und Vergehens epigenetisch21auf vorangegangene Entwicklungen. Das bedeutet:
a)Gegenwärtige Muster und Formen variieren, kombinieren und transformieren ältere Muster und Formen, sie tragen deshalb, bei aller Neuorganisation, Spuren des Gewordenseins (Informationen über die Entwicklung ihrer Selbstorganisation) in sich. Das Vergangene wird, um es mit Hegel zu sagen, in der Transformation aufgehoben.22
b)Zum anderen bilden gegenwärtige Muster und Formen die Basis und die Voraussetzungen zukünftiger Entwicklungen. Mit anderen Worten: Die Vergangenheit geschichtlicher Systeme zeigt sich in der Gegenwart und die Gegenwart wirkt in die Zukunft hinein.
3.Die Geschichtlichkeit eines Systems begrenzt und ermöglicht, im Zusammenspiel mit sich wandelnden Umgebungsbedingungen und im Rahmen systemischer Anfangsbedingungen, alle zukünftigen Entwicklungen.
4.Entwicklungstheoretisch bedeutungsvoll an der Unterscheidung von (A) Struktur und (B) geschichtlichem Strukturbewusstsein ist nun Folgendes: Strukturen der Vergangenheit können in der Gegenwart nicht (rückwirkend) verändert werden, das geschichtliche Strukturbewusstsein von Menschen, sozialen und gesellschaftlichen Systemen über vorangegangene Entwicklungen kann sich hingegen sehr wohl in Gegenwart und Zukunft wandeln und entwickeln. Das geschichtliche (Struktur-)Bewusstsein bleibt mental und kommunikativ zugänglich und ist veränderbar.
5.Mit der Zeit können sich, auf der Basis eines sich entfaltenden Strukturbewusstseins, neue und komplexere Strukturen und Formen von Bewusstsein, von sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Organisation herausbilden.
Obwohl Teil der biologischen Evolution treten die Menschen als kulturelle Wesen aus dieser hervor, und es entwickelt sich, auf der Grundlage einer besonderen Sprachentwicklung (Teil I), eine bemerkenswerte Besonderheit der menschlichen Spezies: Die Möglichkeiten der Formbarkeit und die Veränderungsgeschwindigkeit(en) geschichtlichen Bewusstseins steigen, im Vergleich zu pflanzlichen oder tierischen Bewusstseinsformen, unter Menschen steil an (genauer in Teil II). Damit erweitern sich auch die Möglichkeiten, Beziehungen zu gestalten, enorm. Geschichtlichkeit bedeutet von nun an, Menschen können die Geschichten, die sie über sich selbst und die Welt erzählen, frei gestalten und damit Gegenwart und Zukunft verändern. Kurz: Ab einem bestimmten Punkt der Evolution bestimmt und dominiert die kulturelle Entwicklung die biologische Entwicklung (vgl. auch Krause u. Trappe, 2021, S. 126ff.), wobei Biologie weiterhin die Grundlage jeder Entwicklung bildet und deren Grenzen bestimmt.
1.10 Entwicklungsräume – Grenzen und Möglichkeiten
Vor etwa einhundertfünfzigtausend Jahren entwickelten Gruppen von Homo sapiens ein offenes und fiktionales Sprachsystem (Teil I). Wahrscheinlich nutzten die modernen Menschen diese revolutionäre kulturelle Erfindung bereits, als sie vor etwa 70.000 Jahren von Afrika aus begannen, die ganze Welt zu besiedeln und alle anderen Arten von Hominiden, unter anderem die Neandertaler, zu verdrängen. Tatsache ist jedenfalls, dass die innovative sprachliche Infrastruktur, auf der sowohl unsere Bewusstseinssysteme als auch unsere Kommunikationssysteme operieren, die Basis bilden, auf der sich die außerordentliche Entwicklung der Menschheit seither vollzieht.23 Mit dem innovativen Sprachsystem verschieben sich die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten erstaunlich. Die modernen Menschen können innere Welten in der Fantasie und äußere Welten im kommunikativen Austausch verändern, neu erfinden und anders gestalten, womit sich psychisch, sozial, kulturell, politisch, ökonomisch und technisch ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Andererseits zeigen sich gerade jetzt, im Anthropozän, schmerzhaft die Grenzen einer ungehemmten, besinnungslosen und mit Vernichtung verbundenen Entwicklung.24
Betrachten wir die Evolution der menschlichen Spezies unvoreingenommen, dann ging es niemals nur um die Frage »Wer wird überleben?«, sondern von Beginn an immer auch um die Frage »Wie können wir gemeinsam überleben?«. In diesem Kontext gewinnt die Formel vom »Survival of the Fittest« (Darwin) eine ganz andere Bedeutung als die, die ihr am Anfang des 20. Jahrhunderts durch einen politisch motivierten Sozialdarwinismus25 – fälschlicherweise und in Verkürzung der Evolutionstheorie – zugewiesen wurde. Als Spezies fit zu sein bedeutet heute, zu erkennen, wie wir uns umgebungssensibel innerhalb bestimmter Grenzen26 entwickeln können, um gemeinsam unter den gegebenen natürlichen Bedingungen auf einem gesunden Planeten27 zu überleben. Das bedeutet nichts weniger, als dass wir die Art und Weise, wie wir als Spezies Beziehungen gestalten, zu uns selbst, untereinander und zur weiteren Umgebung, grundlegend transformieren müssen.28
In der Geschichte der menschlichen Zivilisation finden sich von Beginn an zwei widerstreitende Motive oder Logiken, die beide die Entwicklung der Spezies charakterisieren. Ich stelle sie hier einander in Tabelle 1 gegenüber, ohne die Widersprüchlichkeiten und Mehrdeutigkeiten (Bauman, 1995a) im Detail weiter zu diskutieren:
Tabelle 1: Gegenüberstellung zweier Logiken
Elemente und Spuren beider Logiken finden sich schon immer in der Geschichte der modernen Menschen (vgl. Krause u. Trappe, 2021), doch spätestens mit dem weltumspannenden Siegeszug der Industrialisierung und des europäischen Kolonialismus wird die Logik (B) in einer globalisierten Welt zur dominanten Logik, und zwar an allen Orten, auf allen Ebenen und allen Gebieten (Rosa, 2016). Durch technische Innovationen rasant beschleunigt, führt diese Entwicklung die menschliche Spezies an einen kritischen Wendepunkt, und alle Daten weisen darauf hin, dass die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen nur durch einen evolutionären Entwicklungssprung aufgehalten werden kann.
Wenn wir als Spezies überleben wollen, müssen wir lernen, uns mithilfe der Logik (A) innerhalb bestimmter, natürlich gegebener Grenzen zu bewegen und unsere Beziehungen innerhalb begrenzter Entwicklungsräume gemeinsam menschenwürdig und umgebungsfreundlich zu gestalten. Die Herausforderungen, die eine solche zivilisatorische Transformation mit sich bringt, sind riesig (vgl. Göpel, 2020a, 2020b). Gerade deshalb erscheint es mir sinnvoll, sich auf Geschichtlichkeit zu besinnen. Woher kommen wir, und wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Welche Denktraditionen, welche Affektlogiken, welche Formen und Muster von Kommunikationen hindern uns daran, jetzt situationsangemessen zu handeln und tatsächlich nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit umzusetzen? In einer systemisch-entwicklungsorientierten Perspektive sind nachhaltige Lösungen solche Lösungen, die möglichst wenig neue Probleme erzeugen und möglichst viele neue Lösungen ermöglichen. Welche Möglichkeiten ergeben sich, wenn wir unsere Lebensweise und unser Denken verändern? Welche Geschichten tragen uns in die Zukunft, und wie können wir sie erzählen? Am Ende kommt es wohl darauf an, gemeinsam Beziehungen sinnvoll zu gestalten, im Einklang mit uns selbst, menschenfreundlich und im pflegenden Umgang mit der natürlichen Umgebung.29
Die Lebens- und Überlebensfähigkeit psychischer, sozialer und kultureller Systeme hängt vom Grad ihrer Geschichtlichkeit und vom verfügbaren Potenzial zur Veränderung ab.30 Den Grad von Geschichtlichkeit in Systemen kann man »beschreiben als das Verhältnis von Verdrängtem zu Durchgearbeitetem«, schreibt Klaus Theweleit. »Das Durchgearbeitete drängt zu Verwandlungen, zu Spiralen – etwas das trägt und federt –, die Verdrängung führt zu Wiederholungen, zu konzentrischen Kreisen – etwas, das einengt und abstumpft« (Theweleit, 1990, S. 14). In einer systemisch-entwicklungsorientierten Perspektive erhält ein hoher Grad von Geschichtlichkeit zukunftsfähig, weil Potenziale der Veränderung frei zur Verfügung stehen (die sonst gebunden wären). Wenn man diesen Gedanken akzeptiert, dann wird das gemeinsame Verstehen und Bearbeiten von Entwicklungsprozessen mit dem Ziel, Potenziale der Veränderung freizusetzen, in vielerlei Hinsicht zu einem zentralen Moment, nicht nur in therapeutischen Prozessen. Jede Veränderung muss sowohl gewachsene Strukturen berücksichtigen als auch neue Möglichkeitsräume in der Zukunft eröffnen.
1.11 Unterschiedliche Ordnungen – Bewusstsein, Kommunikation und Sinn
Wir leben in einer Zeit, in der Forscher mithilfe großer Rechner alles Mögliche immer genauer beobachten und messen. Die Bewegungen von Sternen und Galaxien, die Dynamik kleinster Teilchen, die Zusammensetzung des Genoms. Die moderne Gehirnforschung führte, beflügelt durch bildgebende Verfahren, zu eindrucksvollen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Biologie des Geistes. Wie arbeitet unser Gehirn? Immerhin können wir über die neurobiologischen Grundlagen von Phänomenen wie Gedächtnis (Kandel, 2012, 2018), Lernen, Empathie, Rollenwechsel (Moreno, 1988) oder Mentalisieren (Fonagy, Gergely, Jurist u. Target, 2004) schon heute einiges sagen (Hüther, 1999, 2004, 2015; Bauer, 2005; Gelernter; 2016, Prinz, 2013).31 Aber ist damit die Welt erklärt?32
Die überragende Bedeutung sozialer Beziehungen für die Gehirnentwicklung steht außer Frage. Doch was ist eigentlich Bewusstsein, und was meinen wir genau, wenn wir von Kommunikation sprechen?
Bei allen Fragen, die in diesem Kontext auftauchen, halte ich es für dringend notwendig, zwischen (A) Ordnungen, die wir beobachten und empirisch überprüfen können, und (B) sprachlichen Ordnungen, in denen wir die Phänomene, die wir beobachten, sinnhaft ordnen, sehr genau zu unterscheiden. Ordnungen der Kategorie (A) sind gegeben oder nicht gegeben, während Ordnungen der Kategorie (B) frei und in beliebiger Vielfalt erfunden werden können.
Neurobiologische Strukturen und Muster, die bewegten Bilder eines sich ausdehnenden Netzwerkes aus Dendriten auf einem Bildschirm, sind faszinierend, ergeben aber für sich genommen, ohne Bedeutungsgebung, keinerlei Sinn! Sinn (Frankl, 2015; Luhmann, 1984, 1988, 1994) entsteht erst unter Menschen, die denken und miteinander über Beobachtungen, Erfahrungen und Gedanken sprechen. Sinn entsteht also erst auf der Ebene menschlichen Geistes und menschlicher Kommunikation; durchaus auf der Basis biologischer Strukturen und Muster, aber eben nicht ohne mentale und sprachliche Deutungen und Einordnungen. Wissenschaftliche Ordnungen entstehen, im Sinne John Deweys (2002, 2007), wenn die vorfindbaren Ordnungen der Kategorie (A) die erfundenen Ordnungen der Kategorie (B) bestätigen oder widerlegen.33
Einen entscheidenden Irrtum begeht man meiner Ansicht nach, wenn man, wie der Nobelpreisträger für Physik Steven Hawking (2018), maschinelle Systeme mit menschlichen Lebensformen und auf dieser Grundlage maschinelle Intelligenzen (KI) mit menschlichem Bewusstsein gleichsetzt. Maschinelle Intelligenzen können lernen zu lernen, das schon. Vielleicht können maschinelle Intelligenzen sich eines Tages sogar selbstständig reproduzieren, und doch bleiben sie emotional blinde, »resonanzlose« Wunderwerke der Technik, denn sie verarbeiten keine Sinneseindrücke, sondern Daten. Es wird zwar gern behauptet, Bewusstsein ließe sich auf Datenströme reduzieren, aber kein Vertreter dieser Idee konnte bisher nachvollziehbar und überzeugend darlegen, »wie und warum Datenströme Bewusstsein und subjektive Erfahrungen erzeugen könnten« (Harari, 2018, S. 533).
Maschinen können lernen, Musik zu komponieren oder menschliche Gesichtsausdrücke und Emotionen durch vergleichende Berechnungen zu identifizieren. Aber sie fühlen nicht, wie und was sie berechnen. Woher auch? »Könnte ein computergesteuerter Roboter Bewußtsein haben?«, fragt der britische Psychologe Nicholas Humphrey (1997, S. 164) in seinem naturwissenschaftlich orientierten Werk über das menschliche Bewusstsein. Seine Antwort: »Nur wenn er Farben, Schmerzen, Juckreiz usw. erleben könnte und ihn das alles so berühren würde wie uns. Nur die Tatsache, daß der Roboter auf hohem Niveau wahrnehmen oder denken könnte, wäre bedeutungslos, solange er kein Gefühlsleben hätte« (Humphrey, 1997, S. 164).
Die maschinellen Intelligenzen, die wir erfinden und herstellen, empfinden weder Schmerz noch Freude, sie fühlen weder Scham noch Schuld, sie haben kein Gefühl für Verantwortung und entwickeln weder Empathie noch Mitgefühl. Sie kennen keinen Humor, haben kein Gewissen und verfügen über keine eigene Moral (Spiekermann, 2019). Sie bilden keinen Begriff von sich selbst und können nur vergessen, wenn man ihnen den Strom abstellt.
Wir selbst aber sind widersprüchliche Wesen und keine zwei gleichen sich, so wie keine Situation einer anderen gleicht. Keine Beziehung, keine Geschichte ist eine simple Kopie von etwas, weil wir der Welt des Lebendigen angehören, und es wäre tragisch, verlören wir die Unterschiede und Grenzlinie zwischen uns und den Maschinensystemen, die wir erschaffen, aus dem Blick.34 Was wir unser Selbst, unsere Seele oder unser Bewusstsein nennen, geht aus dem Auftauchen des Selbstempfindens (Stern, 1993) hervor, das immer schon die emotionale Erfahrung lebendiger Beziehungsgestaltung widerspiegelt.
Die Welt menschlicher Beziehungen, wie überhaupt die ganze Biosphäre, zeigt sich voller zirkulärer Wechselwirkungen, seltsamer Schleifen und rekursiver Resonanzen. Wir nehmen intuitiv mit unserem ganzen Körper wahr, wir agieren und reagieren sowohl eingebettet in unseren Leib (vgl. Storch, Cantieni, Hüther u. Tschacher, 2006; Pesso u. Perquin, 2007; Schmidbauer, 1984; Plassmann, 1994) als auch eingebettet in soziale Beziehungen, und dasselbe gilt für die Gegenüber, mit denen wir uns kommunikativ austauschen.
Fühlen wir uns in einer Beziehung sicher und aufgehoben, können wir flexibel und spontan handeln, und wir können gemeinsam unser kreatives Potenzial entfalten. Mit anderen Worten: Es sind Systeme gegenseitigen sozialen Engagements (Porges u. van der Kolk, 2010; Porges, 2012), die uns als Spezies auszeichnen, die uns guttun und die uns voranbringen.
Bereits im Mutterleib und als kleine Babys sind wir gestaltende Beobachter (vgl. Stern, 1991, 1993; Dornes, 1993) und bleiben es ein Leben lang. In unserem bewussten und unbewussten Sein und Bewusstsein sind wir zutiefst bezogene, geschichtliche und narrative Wesen. Wir beziehen uns auf uns selbst, auf andere Menschen, auf Objekte und Umgebungen, auf die Vergangenheit und die Zukunft, wir denken über verschiedenartige Beziehungen und Beziehungserfahrungen nach, und wir teilen die tiefe Leidenschaft, uns über all das mit anderen auszutauschen. Diese Austauschlust ist vielleicht das Menschlichste an uns. Sie verleiht der Welt ihren Zauber.
______________________
1 Dieses »zwischen« hat schon Martin Buber (2006) interessiert (vgl. auch Wegscheider, 2020, S. 155ff.).
2 »Zwei Psychen erzeugen Intersubjektivität. Doch ebenso werden die beiden Psychen von der Intersubjektivität geformt« (Stern, 2010, S. 90).
3 »Der Mensch ist nicht in seiner Isolierung, sondern in der Vollständigkeit der Beziehung zwischen dem einen und dem anderen anthropologisch existent« (Buber, 2006, S. 290 f.).
4 Diese Fähigkeit können wir in Anlehnung an Ross Ashby, der zwischen Veränderungen erster und zweiter Ordnung unterscheidet (Hoffman, 1984, S. 47), und Watzlawick und Weakland (2000), die zwischen Lösungen erster und zweiter Ordnung unterscheiden, als Kreativität zweiter Ordnung bezeichnen.
5 2008 startete die Langzeitstudie »Panel analysis of intimate relationships and family dynamics« (»pairfam«), Ergebnisse abrufbar unter: https://www.pairfam.de.
6 Diese bisher einzigartige Langzeitstudie über Gesundheit und Zufriedenheit begann 1938 in Boston (vgl. Waldinger, 2015).
7 Eine vielfach bestätigte Aussage (vgl. u. a. Orlinsky, 2008; Orlinsky u. Howard, 1986, Orlinsky u. Roennestad, 2005; Wampold, Imel u. Flückiger, 2018; Sack u. Sachsse, 2013; Grawe, 1992, 1988; Staats, 2017; Wegscheider, 2020; Porges u. van der Kolk, 2010).
8 Die Metastudie des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie zeigt, im Unterricht kommt es, wie Hartmut Rosa formuliert, »vor allem auf die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung an« auf das »Resonanzgewebe« (Rosa, 2016, S. 416; vgl. unter anderem auch Normile, 2017).
9 Interaktive Präsenz, Interesse, Entdeckungsfreude (Neugier), Offenheit, Resonanzfähigkeit, Empathie, aktives Zuhören, Beziehungsverstehen, Reflexion des Übertragungsgeschehens, Kontakt- und Begegnungsfähigkeit, Experimentierfreude, Authentizität, Loyalität, emotionale Schwingungsfähigkeit, Mentalisieren, Mitgefühl, Respekt oder die Fähigkeit, Akzeptanz mit Veränderungsmotivation und systemischer Zuversicht zu verbinden (vgl. u. a. Bleckwedel, 2006).
10 Einen guten historischen Überblick aus systemischer Sicht gibt Alexander Trost (2018, S. 25 ff.).
11 Vgl. dazu das von Klaus Grawe und Franz Caspar entwickelte Konzept komplementärer Beziehungsgestaltung (vgl. auch Sack u. Sachsse, 2013; Grawe, 1992, S. 68 ff.; Asen u. Fonagy, 2021).
12 Ein »Zwischenreich […], in dem Individuen sich miteinander arrangieren, aufeinander einlassen und aneinander wachsen« (Dieter Thomä, zit. nach Zeit.de: https://www.zeit.de/2017/35/anstand-gesellschaft-zusammenleben-ruecksicht/seite-3). Siehe auch Thomä (2003).
13 Foucault spricht in »Die Ordnung der Dinge« von »epistemologischen Feldern« (Foucault, 1974a, S. 24) oder »Epistemen«, die unser Handeln bestimmen und sich historisch wandeln.
14 Niklas Luhmann (1984) unterscheidet in seiner einflussreichen Theorie sozialer Systeme eben diese drei Arten sozialer Systeme. Basale Beziehungssysteme von der Art, um die es hier geht, werden nicht erfasst.
15 Der Unterschied besteht in der Regel darin, dass therapeutische Beziehungen eingegangen werden, um sie zu beenden. Darin besteht das grundlegende Paradox therapeutischer Beziehungen. Ausnahmen, z. B. bei Behinderungen oder langfristigen psychiatrischen Leiden, bestätigen die Regel.
16 Studien zum Autoritarismus (vgl. Reich, 1933/1970; Fromm, 1945/1983; Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson u. Sanford, 1950; Theweleit, 1977, 1978; Heitmeyer, 2002; Ritscher, 2017) illustrieren diesen Zusammenhang eindrücklich.
17 Wie sich Paarbeziehungen, wenn es gut geht, entfalten können, habe ich an anderer Stelle beschrieben (Bleckwedel, 2014).
18 Untersuchungen zeigen: Die Qualität der Beziehung der Eltern zueinander hat einen größeren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern als die Qualität der Beziehung von Kindern zu einzelnen Elternteilen.
19 Diese Organisationsebenen werden in Teil II ausführlich dargestellt.
20 Zum Beispiel im »auftauchenden Selbstempfinden« (Stern, 1993) von Säuglingen oder in Achtsamkeitsübungen (Kabat-Zinn, 2004).
21 Siehe dazu das Kapitel über die Epigenese von Beziehungssystemen in Teil II.
22 Das gilt, solange Menschen und menschliche Systeme existieren. Viktor Frankl sagt dazu: »Vor allem aber kann die Vergänglichkeit des Daseins dessen Sinn aus dem einfachen Grunde nicht Abbruch tun, weil in der Vergangenheit nichts unwiederbringlich verloren, vielmehr alles unverlierbar geborgen ist. Im Vergangensein ist es also vor der Vergänglichkeit sogar bewahrt und gerettet« (1995, S. 9, zit. nach Pfeifer, 2021, S. 117).
23 Selbstverständlich spielen genetische Entwicklungen, klimatische Rahmenbedingungen und historisch bedingte Umgebungsbesonderheiten (wechselnde Eis- und Warmzeiten, katastrophale Vulkanausbrüche, Veränderungen von Fauna und Flora) für die menschliche Evolution eine wichtige Rolle, und doch gilt ab diesem Zeitpunkt »Kultur schlägt Biologie« (Krause u. Trappe, 2021, S. 126).
24 »Wenn die derzeitige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen unvermittelt anhält, werden die absoluten Grenzen des Wachstums auf der Erde in den nächsten hundert Jahren erreicht«, heißt es bereits 1972 im ersten Bericht des Club of Rome (»The limits to growth. A report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind«;. vgl. auch Verbeek, 1998; Film: Der Erdzerstörer, 2019).
25 Im Sozialdarwinismus steht der »Kampf ums Dasein«, nicht Kooperation, im Vordergrund (vgl. Hofstadter, 1944, S. 449).
26 Kate Raworth (2018): Die Donut-Ökonomie (ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten Erde als Lebensraum erhält) geht von einer Reihe planetarer und sozialer Grenzen aus. Grenzen der Erderwärmung dürfen nicht überschritten, Grenzen der Biodiversität nicht unterschritten werden. Die Entwicklung von Bereichen wie Gesundheit und Bildung, deren Begrenzungen sozialpolitisch festgelegt werden, definieren den Entwicklungsraum von Gesellschaften (als alternative Zielvorgabe zum Wachstum des BIP in der traditionellen Ökonomie).
27 Vgl. Planetary Health: https://planetary-health-academy.de
28 Vgl. Dohm, Peter und van Bronswijk (2021). Siehe auch: IPU-Projekt: Psychologie des sozial- ökologischen Wandels: https://www.psychosozial-verlag.de/download/Psychologie_des_sozialoekologischen_Wandels.pdf.
29 Schon heute ist vieles möglich, das zeigt das Konzept der Gemeinwohlökonomie (https://web.ecogood.org/de/) am Beispiel dreier Gemeinden in Nordfriesland, siehe: »Hinterm Deich wird alles gut« (2020), eine filmische Dokumentation.
30