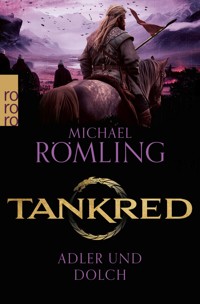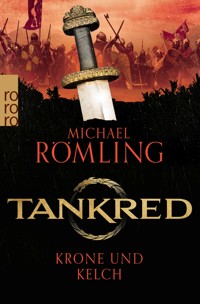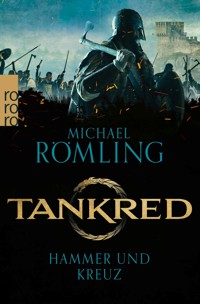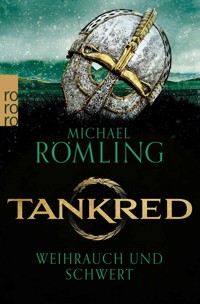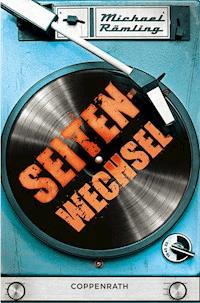9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rom 1566: Der junge Michelangelo ist ein Novellant, ein Nachrichtenhändler. Als er sich auf der Suche nach saftigen Geschichten in Frauenkleidern bei einem Gottesdienst zur Bekehrung von Huren einschleicht, lernt er Mercuria kennen, eine ehemalige Kurtisane mit besten Beziehungen. Bald zieht er ein in ihr prächtiges Haus, wo auch andere Schützlinge Mercurias eine Bleibe gefunden haben, ein Maler und ein Raubgräber. Der findet eines Nachts eine skelettierte Leiche – mit sechs Fingern an einer Hand. Die drei Freunde wollen der Geschichte auf den Grund gehen und stolpern dabei auch über dunkle Geheimnisse aus Mercurias Vergangenheit: eine Tochter, ermordet, und Mercuria hat eine Ahnung, warum. Erst nach und nach wird Michelangelo bewusst, in welche Gefahr er sich begeben hat. Denn es geht um den Ruf höchstgestellter Persönlichkeiten – und um sehr, sehr viel Geld.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 636
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Michael Römling
Mercuria
Historischer Roman
Über dieses Buch
Die Hauptstadt der Christenheit. Die Hauptstadt der Sünde.
Rom, die unheilige Heilige.
Die frömmste Stadt auf dem Erdenrund. Und die sündigste.
Die mächtigen Männer: Kardinäle. Die mächtigen Frauen: Kurtisanen
Rom 1566: Der junge Michelangelo ist ein Novellant, ein Nachrichtenhändler. Als er sich auf der Suche nach saftigen Geschichten in Frauenkleidern bei einem Gottesdienst zur Bekehrung von Huren einschleicht, lernt er Mercuria kennen, eine ehemalige Kurtisane mit Beziehungen in höchste und in frömmste Kreise. Bald zieht er ein in ihr prächtiges Anwesen, wo bereits andere Schützlinge Mercurias eine Bleibe gefunden haben. Einer von ihnen, ein Fälscher und Raubgräber, findet eines Nachts bei der Suche nach antiken Statuen eine skelettierte Leiche – an einer Hand hat der Tote sechs Finger. Die Freunde wollen der Geschichte auf den Grund gehen, sie stolpern dabei über lang begrabene Geschichten voller Blut und Gewalt. Und die düsterste handelt von Mercuria …
Vita
Michael Römling, geboren 1973, gründete nach Geschichtsstudium und Promotion einen Buchverlag und schrieb zahlreiche stadtgeschichtliche Werke sowie historische Romane. Der Renaissance fühlt er sich seit einem achtjährigen Aufenthalt in Rom verbunden. 2019 erschien sein historischer Roman «Pandolfo», über den der WDR urteilte: «Ein pures Vergnügen, wie Michael Römling die wüsten, spannenden historischen Ereignisse ablaufen lässt: farbig, respektlos, detailtrunken.» Mit «Mercuria» wendet er sich nun erneut der italienischen Renaissance zu.
Karte der Stadt Rom
Personen
Die Namen von Personen, die wirklich gelebt haben, sind kursiv wiedergegeben.
Die kleine Gesellschaft von Mercurias Mietern in der Via dei Cappellari und deren Freunde:
Michelangelo Gazettenschreiber und Erzähler der Geschichte
Gennaro Steinmetz, Bildhauer und Raubgräber
Bartolomeo Priester und alter Vertrauter von Mercuria
Antonella Schauspielerin, spezialisiert auf Teufelsaustreibungen
Gianluca Schauspieler, spezialisiert auf Geißlerprozessionen und Wallfahrten
Antonio vom Judentum zum Christentum konvertierter Arzt
Domenikos aus Kreta stammender Maler
Giordana Dichterin und Tochter aus dem Haus Orsini
Personen, die durch Mercurias Erinnerungen geistern:
Stefano junger und verwöhnter Bischof
Isabella Gonzaga Markgräfin von Mantua und zwischenzeitlich Hausherrin im Colonna-Palast
Alessandro di Novellara italienischer Hauptmann
Alonso de Córdoba spanischer Hauptmann
Domenico Venier Botschafter der Republik Venedig beim Papst
Giovanni Maria Botschafter des Herzogs von della Porta Urbino beim Papst
Francesco Mazzola, genannt Parmigianino Maler
Graziano Santacroce altgedienter Verehrer Mercurias
Severina Mercurias Tochter
Wichtig, obwohl im Roman ohne Sprechrollen, sind die folgenden drei Päpste, deren Papstnamen sich ärgerlicherweise so sehr ähneln, dass sie in der Geschichte fast immer mit ihren Familiennamen genannt werden:
Gian Pietro Carafa (Paul IV., 1555–1559)
Gianangelo Medici (Pius IV., 1559–1565)
Michele Ghislieri (Pius V., 1566–1572)
Von der weitverzweigten Familie Carafa sind hier nur die drei Neffen von Gian Pietro Carafa (Paul IV.) von Bedeutung:
Carlo Carafa Kardinal, 1561 hingerichtet
Giovanni Carafa Militär, 1561 hingerichtet
Antonio Carafa Militär, †1588
Die große Gruppe der Nebenfiguren, die für den Fortgang der Handlung sorgen:
Antonietto Sparviero Novellant und Michelangelos Onkel, †1566
Luparella legendäre Kurtisane
Bona la Bonazza Kurtisane
Pasquale venezianischer Botschaftssekretär
Diomede Padovano Hausverwalter des venezianischen Botschafters Domenico Venier
Niccolò Franco Dichter und Publizist, 1570 hingerichtet
Bonifacio Caetani Gennaros Auftraggeber
Giovanni Morone Kardinal
Kaplan von Giovanni Morone, taub
Alessandro Pallantieri päpstlicher Spitzenbeamter, 1571 hingerichtet
Piero Carafa Neffe des Kardinals Carlo Carafa
Laura Köchin von Piero Carafa
Beatrice Lauras Mutter, ebenfalls Köchin
Alessandro Farnese Kardinal, Enkel von Papst Paul III.
Arzt von Alessandro Farnese
Giorgio Leibwächter von Alessandro Farnese
Sebastiano Bentrovato Vollzugsbeamter des Gouverneurs
Girolamo Maler
Fulvio Orsini Alessandro Farneses Antikenverwalter
Alberto Gärtner von Kardinal Este
Als die Kälte ihr langsam in die Knochen kroch, wachte Mercuria auf. Die Seidendecke war vom Bett geglitten. Die Vorhänge wehten im leichten Wind, und über den Dächern bimmelte eine kleine Glocke. Inzwischen kam es seltener vor, dass sie mitten in der Nacht hochschreckte, aber ganz hatten die Albträume nicht aufgehört.
Früher hatte sie wie ein Stein geschlafen, ganz gleich ob nach getaner Arbeit einer ihrer Freunde, Favoriten oder Kunden neben ihr gelegen hatte oder nicht.
Über die Schlafgewohnheiten dieser Herren hätte sie ein Buch schreiben können: Die einen wälzten sich hin und her, die anderen lagen regungslos da wie die Mumien; es gab die Nimmersatten, die noch im Schlaf ihre Hände nicht bei sich behalten konnten, und die Reumütigen, die sich irgendwann in ihre Ehebetten zurückstahlen, nur um am nächsten Tag schon wieder vor ihrer Tür zu stehen; es gab die Ungenierten, die meinten, sie hätten gleich das ganze Bett bezahlt, und sich unter den Laken breitmachten wie die Kuckucksküken im Nest des Wirtsvogels; es gab die Anschmiegsamen mit ihrem Klammergriff und die Verschämten, die so weit vor ihr zurückwichen, dass sie bald auf den Boden kullerten. Einige von denen hatten am Abend zuvor noch schnell das Kruzifix über dem Bett mit einem Tuch verhängt, um ihre Gelüste nicht unter den Augen des Erlösers zu stillen, während sie ihren Beichtkindern bei jeder Gelegenheit damit drohten, dass dem Herrn nichts verborgen bliebe. Manche schnarchten, dass die Scheiben klirrten, oder sie murmelten im Traum vor sich hin, andere waren so still, dass Mercuria schon nach dem Pulsschlag getastet hatte. Einer war tatsächlich mal neben ihr dahingeschieden, ein hochbetagter Mönch aus einem nahe gelegenen Kloster. Du liebe Güte, das war ein Zirkus gewesen, im Morgengrauen waren zwei seiner Mitbrüder erschienen, die genau gewusst hatten, wo der Schlawiner zu finden war; der Abt machte seine Kontrollrunde, und dem konnten sie ja schlecht erzählen, wo der alte Lustmolch mal wieder die Nacht verbracht hatte. Dass er tot war, das hatte denen natürlich nicht ins Konzept gepasst, und von seiner Angewohnheit, sich in Frauenkleidern aus dem Klausurbereich zu stehlen, hatten sie nichts gewusst. Also hatte Mercuria ein Hemd hervorgekramt, das ein anderer Kunde eine Woche zuvor auf der Flucht vor seiner an die Haustür hämmernden Frau bei ihr liegengelassen hatte, ein ziemlich großes Hemd, das sie dem Mönch trotz der Leichenstarre ganz bequem über die morschen Knochen hatten ziehen können. Wie gesagt, ein Buch hätte sie über diese Zeiten schreiben können.
Mercuria zog die Decke wieder hoch, aber der Schlaf wollte nicht zurückkehren. Der Wind spielte mit dem fahlen Mondlicht Verstecken in den Vorhängen, und die Glocke bimmelte unbeirrt weiter. Was gab es um diese Zeit eigentlich zu läuten?
Sie stand auf und trat ans Fenster. Der Mond beleuchtete das schöne neue Pflaster im Innenhof. Die Zweige der Blumen in ihren Kübeln rekelten sich in alle Richtungen. Die Rosen mussten dringend zurückgeschnitten werden.
Sie zog das Nachthemd über den Kopf und kleidete sich an. Es hatte keinen Sinn, sich wieder ins Bett zu legen und das wimmelnde Schlangenbündel von Erinnerungen zu bändigen. Wann immer diese Erinnerungen an jenen Tag vor über drei Jahren sie heimsuchten, hatte Mercuria sich mit irgendwelchen Verrichtungen abgelenkt, aber weil sie ja schlecht mitten in der Nacht an den Pflanzen herumschneiden konnte, beschloss sie, einen Spaziergang am Fluss zu machen und sich vom Rauschen und Gluckern des Wassers an den Brückenpfeilern einhüllen zu lassen.
Den Palazzo Farnese umrundete sie an der Westseite, um nicht an der Ecke vorbeizumüssen, wo es passiert war. Seit drei Jahren mied sie diese Stelle wie ein mit angespitzten Pfählen gespicktes Loch.
Auf das Wasser war Verlass. Kühl und gleichgültig zog der Fluss dahin. Eine schwimmende Mühle dümpelte als konturloser Koloss im Strom und zerrte an der leise klirrenden Kette. Die Glocke bimmelte immer noch vor sich hin. Je näher Mercuria der Engelsbrücke kam, desto vernehmlicher wurde sie. Vielleicht lag irgendein Würdenträger im Sterben.
Mercuria passierte den Palazzo Altoviti. Bindo Altoviti, auch ein ehemaliger Favorit, verschwenderisch wie ein Pharao war der gewesen, hatte sie mit Gold und Perlen zugeschüttet und auf Knien angefleht, das mit dem Ruhestand noch einmal zu überdenken; es hätte wohl nicht viel gefehlt, und er hätte in seinem toskanischen Gehauche noch einen Heiratsantrag hinterhergeschoben, aber dem alten Farnese war in den letzten Jahren seines Pontifikats offenbar der Heilige Geist erschienen und hatte ihn einen Blick ins Fegefeuer werfen lassen. Pünktlich zum Konzilsbeginn hatte der Papst auf einmal die Daumenschrauben der Moral angezogen; Bindo Altoviti musste fürchten, dass ihm mit einer solchen Mesalliance die Kredite bei der Kurie platzten, und so platzte stattdessen der Heiratsantrag, falls Bindo sich wirklich mit entsprechenden Gedanken getragen hatte. Ja gesagt hätte Mercuria ohnehin nicht.
Als sie vor der Engelsbrücke angekommen war, begriff sie, woher das Geläut kam: vom Gefängnis bei Tor di Nona. Da stand eine Hinrichtung bevor. Natürlich! Die ganze Stadt hatte ja von nichts anderem gesprochen die letzten Tage. Hatte Gianangelo Medici also tatsächlich ernst gemacht.
Am Eingang des Gefängnisses rumste es zweimal, als schwere Riegel an die Seite geschoben wurden. Auf dem Pflaster glomm Fackelschein auf, wurde stärker, erreichte die gegenüberliegende Hauswand und tanzte über das Mauerwerk.
Da kamen sie. Du liebe Güte, wie viele Knüppelmänner hatte der Gouverneur denn da zur Nachtschicht verdonnert? Rechnete der ernsthaft damit, dass noch irgendjemand einen Finger rühren würde, um Carlo Carafa und seine Verwandtschaft vor dem Galgen zu bewahren?
Nachdem an die zwanzig Bewaffnete aus dem Tor gequollen waren und sich zu einem Zug formiert hatten, erschien ein Priester mit einem verhängten Vortragekreuz.
Und dann kam er: Carlo Carafa. Zwischen zwei Bütteln schleppte er sich aus dem Tor, die Ketten an seinen Füßen klirrten, und die vor dem Bauch gefesselten Hände hatte er gefaltet, als ob das Beten ihm jetzt noch helfen könnte. Sein Kopf war unbedeckt, selbst das Kardinalsbirett hatten sie ihm also weggenommen, um ihm zu zeigen, dass er, der jahrelang den ganzen Kirchenstaat das Fürchten gelehrt hatte, inzwischen nichts weiter war als ein Verbrecher, dem gleich die Schlinge um den Hals gelegt werden würde.
Langsam kam die Prozession auf sie zu. Im Fackelschein sah Mercuria sein Gesicht: Den Bart hatte er sich zur Feier des Tages noch einmal gestutzt, und auch sonst sah er nicht aus, als hätte er sich im Kerker mit den Ratten um schimmeliges Brot gezankt. Vielleicht war er ein bisschen blass, aber das konnte man im Fackelschein ja nicht so genau beurteilen. Seine Gesichtszüge drückten vor allem Fassungslosigkeit aus, tiefste Erschütterung darüber, dass dieser Papst, der ihm seine Wahl verdankte, es tatsächlich gewagt hatte, ihn, Carlo Carafa, den Neffen und Staatssekretär seines verstorbenen Vorgängers, fallenzulassen.
Das Läuten erstarb mit ein paar letzten verirrten Schlägen des Schwengels gegen den Glockenkörper. Jetzt waren nur noch die Schritte der Büttel, das Klirren der Ketten und das Gemurmel des Priesters zu hören, untermalt vom immergleichen Rauschen des Wassers.
Die Spitze des Zuges bog auf die Brücke ein. Die Knüppelmänner warfen Mercuria einen misstrauischen Blick zu, als rechneten sie damit, dass sie sich gleich wie ein Greif auf den Verurteilten stürzen und ihn mit sich in die Lüfte reißen würde. Es war grotesk: Üblicherweise geleiteten zwei oder vier von ihnen am helllichten Tag die Todeskandidaten durch aufgebrachte Menschenmengen zum Galgen; hier dagegen war eine halbe Armee unterwegs, um eine einzige Zuschauerin auf Abstand zu halten, die wie verloren im Mondlicht auf dem Platz vor der Brücke stand. Vielleicht hielten sie sie auch für eine Unheilsbotin, abergläubisch wie sie waren, oder für einen Racheengel, der sich auf den Gefangenen werfen würde, um ihn zu erdolchen; es gab sicherlich genug Leute in der Stadt, die das liebend gern getan hätten.
Für einen kurzen Augenblick trafen sich ihre Blicke. Mercuria war dem Kardinal das eine oder andere Mal auf einem Fest begegnet, aber sie hatte sich von ihm ferngehalten. Carlo Carafa war ein jähzorniges, gewalttätiges Schwein; jeder wusste, was der auf dem Kerbholz hatte. Mercuria kannte die Gerüchte und die Geschichten von anderen Frauen, und abgesehen davon hatte sie es ihm angesehen, denn diese Sorte von Kerlen war ihr seit frühester Jugend vertraut. Außerdem war sie schon gar nicht mehr im Geschäft gewesen, als sein Onkel ihn aus dem Krieg geholt und vom Söldner zum Kardinal gemacht hatte.
Carlo Carafa war so sehr mit seinem Selbstmitleid und dem Entsetzen über seinen tiefen Sturz beschäftigt, dass es seinem Gesichtsausdruck unmöglich zu entnehmen war, ob er sie ebenfalls erkannte. Einen Augenblick später war er auch schon vorbei.
Ein Dutzend Büttel sicherte das Ende des Zuges. Ohne ein Wort überquerten sie die Brücke und hielten vor der Torbastion. Ein Kommando schallte über den Fluss, eine Antwort wurde zurückgebrüllt, dann öffnete sich das Tor, verschluckte die ganze Prozession, und der Spuk war vorbei.
Mercuria stand allein auf dem weiten Platz. Der Fluss rauschte vor sich hin, und plötzlich kam es ihr vor, als gäbe es in der ganzen Stadt nur noch sie. Hinter den Dächern des Borgo ragte der Apostolische Palast auf. In den oberen Fenstern brannte Licht. Stand dort jemand? Gianangelo Medici?
Sie spähte so angestrengt hinüber, dass sie gar nicht merkte, wie jemand sich von hinten näherte. Als sie sich umdrehte, stand er direkt hinter ihr: ein älterer Mann mit Bart und grauen Locken unter seiner Leinenkappe.
«So früh am Morgen schon unterwegs?»
Teufel auch, Antonietto Sparviero, der Novellant. Der schwirrte ja immer da herum, wo es was zu sehen oder zu erfahren gab, damit verdiente er schließlich sein Geld. Der hatte von seinen Zuträgern wahrscheinlich gehört, wann die Hinrichtung von Carlo Carafa und seinen drei Mitverurteilten stattfinden würde, und jetzt wollte er sich vergewissern, dass sie es auch zu Ende brachten, dass nicht plötzlich ein päpstlicher Bote mit der Begnadigung angaloppiert kam und Carlo Carafa im nächsten Konsistorium wieder grinsend zwischen den anderen Kardinälen Platz nehmen würde.
«Und du? Schläfst du eigentlich irgendwann mal?»
Antonietto Sparviero lächelte sein hintergründiges Lächeln. «Gelegentlich.»
«Wirst du nicht langsam zu alt dafür?»
Er wiegte den Kopf. «Vielleicht. Aber mein Neffe ist noch nicht so weit.»
«Wie alt ist er denn?»
«Sechzehn.»
Mercuria lächelte. «In dem Alter war ich schon längst im Geschäft.»
«Sei froh, dass du’s jetzt nicht mehr bist. Die Zeiten werden nicht besser.»
Sie wies mit einem Kopfnicken zum Papstpalast. «Kommt drauf an, wer als Nächster dort einzieht.»
«Ghislieri, wenn du mich fragst.»
«Bitte nicht der.»
«Wie gesagt. Die Zeiten werden nicht besser.»
Sie standen eine Weile nebeneinander und redeten. Es tat gut, in dieser merkwürdigen Nacht eine so angenehme Gesellschaft gefunden zu haben, auch wenn sie ihn bloß flüchtig kannte. Ihre Welten berührten sich eigentlich nur dann, wenn die Informationen, die er brauchte, in irgendeinem Bett ausgeplaudert worden waren.
Auf der obersten Plattform der Engelsburg regte sich etwas. Eine Fackel flackerte auf, zwei Schemen machten sich dort zu schaffen, dann wurde ein kleines Licht hinter einem Schirm entzündet.
«Das war’s», sagte Antonietto Sparviero. «Carlo Carafa ist tot.»
«Was ist mit den drei anderen?»
«Schon vor zwei Stunden erledigt. Wahrscheinlich bringen sie gleich die Leichen raus, damit das Volk auf ihnen herumtrampeln kann.»
«Ich kann es ihnen nicht verdenken.»
«Ich bitte dich. Das ist doch würdelos.»
«Was sie getrieben haben, das war würdelos.»
«Stimmt.» Er gähnte. «Ich gehe jetzt nach Hause. Übermorgen geht der Bericht raus.»
«Schickst du mir den mal?»
Er zog eine Augenbraue hoch. «Warum interessiert dich das?»
Sie zuckte mit den Schultern. «Nur so. Ich will mal wissen, wie du arbeitest.»
Der Prozess gegen die Carafa und ihre Helfer ist mit der in der Nacht zum vergangenen Donnerstag vollzogenen Hinrichtung der Hauptbeschuldigten zu seinem Abschluss gekommen. Über den Verlauf des Verfahrens, das Schlussplädoyer des Fiskalprokurators Pallantieri und die vergeblichen Gnadengesuche der Anwälte der Beschuldigten wurde bereits berichtet.
Carlo Carafa beteuerte bis zuletzt seine Unschuld und gab an, in Ausübung seines Amtes stets im Auftrag und mit Wissen seines Onkels gehandelt zu haben. Wie es heißt, riss bei der Hinrichtung des Kardinals in der Engelsburg zweimal die Kordel, mit der er erdrosselt werden sollte. Als es endlich gelungen war, ließ der Henker auf der obersten Plattform der Festung ein Licht entzünden, um den Papst über die erfolgte Vollstreckung des Urteils in Kenntnis zu setzen. Die drei anderen Verurteilten wurden im Gefängnis von Tor di Nona enthauptet und ihre Leichen am nächsten Tag auf dem Platz vor der Engelsbrücke der Menge gezeigt, die sie beinahe zertrampelte. Die Bestattung fand in aller Verschwiegenheit statt, um weitere Tumulte zu verhüten.
1
Mein Name ist Michelangelo, und damit eins hier gleich ganz klar ist: Ich kann weder mit dem Meißel noch mit dem Pinsel umgehen. Als ich geboren wurde, war mein unsterblicher Namenspatron schon um die siebzig Jahre alt und hatte gerade das Jüngste Gericht an der Altarwand der Sixtina fertiggestellt, um das später so viel gestritten wurde. Mein Vater verehrte ihn wie einen Gott und hatte mir nicht zufällig diesen gewaltigen Namen mitgegeben, aber wenn er Hoffnungen auf eine entsprechende Laufbahn an diese Wahl geknüpft hatte, so wurden sie schon bald enttäuscht. Mein Talent liegt eher auf dem Gebiet des Erzählens, doch auch diese Gabe verschleuderte ich zunächst, so wie ich in meinen jungen Jahren als gedankenloser Tunichtgut alles verschleuderte, was ich in die Hände bekam, und ich kann noch nicht einmal anderen die Schuld dafür geben, denn es lässt sich beim besten Willen nicht behaupten, dass ich mich in schlechter Gesellschaft bewegt oder die falschen Freunde gehabt hätte. Kurz und gut: Ohne Mercuria wäre ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang der windige, durch sein Leben taumelnde Gazettenschreiber geblieben, der ich war, als diese Geschichte beginnt. Und darum ist sie ihr gewidmet, diese Geschichte.
Mercuria war der aufrichtigste Mensch, dem ich jemals begegnet bin; sie hasste die Lüge, und die Lüge war damals mein Beruf, wobei man, wollte man es etwas freundlicher formulieren, auch sagen könnte, dass ich den Leuten eben die Geschichten auftischte, die sie lesen wollten. Man könnte überdies einwenden, dass auch Mercurias Arbeit in ihren besten Zeiten zu einem guten Teil darin bestanden hatte, ihren Kunden zu sagen, was sie hören wollten, aber letztlich wurde sie im Gegensatz zu mir ja nicht für Worte bezahlt, sondern für Taten.
Als wir uns über den Weg liefen, hatte sie sich längst zur Ruhe gesetzt, schließlich war sie damals schon an die sechzig Jahre alt, aber im Gegensatz zu den meisten Frauen ihres Gewerbes hatte sie es zu Wohlstand gebracht, anstatt als menschliches Wrack im Armenhaus zu landen oder sich an einen Ehemann zu verkaufen, der sie behandelte wie den letzten Dreck. Nein, sie war mehr als wohlhabend, sie war reich: reich nicht nur an Geld, sondern auch an Freunden, die ihr die Treue hielten, während die Pharisäer begannen, über ihresgleichen die Nase zu rümpfen. Über Mercuria aber rümpfte man nicht die Nase. Kardinäle und Botschafter, die früher ihrer Schönheit verfallen waren, verfielen nun ihrer Klugheit, ihrem Witz und ihrer Liebenswürdigkeit. Klingt übertrieben? Ihr habt Mercuria nicht gekannt.
Ich dagegen habe sie gekannt, und wie. Sie mochte das Bett und später den Tisch mit Kardinälen und Botschaftern geteilt haben, aber das dunkle Geheimnis ihres Lebens teilte sie mit mir, der ich ihr Sohn hätte sein können. Mercuria hatte vom ersten Augenblick an Eigenschaften an mir erkannt, von denen mir selbst gar nicht bewusst gewesen war, dass ich sie besaß: die Fähigkeit, mich ernsthaft auf andere Menschen einzulassen, und das Verlangen, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen, das mich am Ende dazu bewogen hat, ihre Geschichte aufzuschreiben. Und um diese ganze Geschichte verständlich zu machen, muss ich mit jenem Tag im November sechsundsechzig beginnen, an dem ich Mercuria zum ersten Mal sah.
Nun also. Es war auf dem Platz vor Santissimi Apostoli. Wir waren beide auf dem Weg zur Messe, kamen aus unterschiedlichen Richtungen und waren aus unterschiedlichen Gründen dort. Mercuria entstieg unter bewundernden und hier und da auch neidischen Blicken einem Einspänner und durchfloss wie Quecksilber das Spalier, das sich ganz von selbst vor ihr auftat und hinter ihr wieder schloss; ich dagegen kämpfte mich unbeachtet durch die Menge. Sie trug eine maßgeschneiderte Robe aus besticktem Brokat mit Spitzenkragen nach der neuesten Mode; ich steckte in einem zu engen geliehenen Kleid und schwitzte trotz der Novemberkälte wie ein Ackergaul unter meiner Perücke, während die Schminke mir die Augen verklebte. Sie war aus beruflicher Verbundenheit gegenüber den anderen Frauen gekommen, ich aus beruflicher Neugier.
Dass diese Messe überhaupt stattfand, das hatten wir Papst Pius zu verdanken, diesem verkniffenen Eiferer, der sein Leben der Inquisition und der Kirchenreform gewidmet hatte, hart wie Granit in Fragen von Moral und Glauben und dabei selbst so integer, dass einem übel werden konnte vor lauter Heiligkeit. Niemand hätte sich daran gestört, wenn er sich nur darauf beschränkt hätte, die Ketzerei ordentlich niederzuknüppeln, denn die Lutheraner krakeelten immer lauter von Deutschland aus herunter und scheuchten mit ihrem Gestänker die halbe Welt auf. Aber Pius, immerhin schon der Fünfte dieses Namens, wenngleich wohl der Erste, der ihn auch verdiente, wollte mehr: Er meinte die Maßstäbe, nach denen die Schafe zu leben hatten, auch an die Hirten anlegen zu müssen. Auf dem Stuhl Petri hatte er zehn Monate zuvor Platz genommen, und in der Zwischenzeit dürfte sich manch ein Kardinal gefragt haben, was den Heiligen Geist wohl geritten haben mochte, als er dem Kollegium einflüsterte, Michele Ghislieri zum Papst zu wählen. Schon zu seiner Krönungsfeier spendete dieser das Geld, das zu solchen Gelegenheiten säckeweise unter das Volk geworfen wurde, für fromme Werke. Kaum im Amt, warf er Dottor Buccia, den wegen seiner deftigen Zoten berüchtigten Hofnarren seines Vorgängers, aus dem Palast und schickte den Schatzmeister auf die Galeere, weil die Rechnungsbücher nicht korrekt geführt waren. Von da an rollten fast täglich Köpfe. Bischöfe, die sich kurz zuvor noch in ihren Palästen atemberaubenden Festen hingegeben hatten, wurden von einem Tag auf den anderen in ihre Diözesen geschickt, um sich dort um die Seelsorge zu kümmern. Ein Hagel von Edikten gegen Simonie, Blasphemie, Sodomie, Entheiligung der Feiertage und Missachtung der Fastengebote prasselte auf die Geistlichkeit herab, Priester sollten plötzlich die Liturgie beherrschen und ihr Keuschheitsgelübde einhalten. Kirchliche Würdenträger wurden mitsamt ihren Mätressen von den Leuten des Gouverneurs aus den Kutschen gezerrt und mit Razzien in ihren eigenen Häusern schikaniert. Sodann knöpfte sich Pius die Kurtisanen vor. Sie wurden ausgepeitscht, ausgewiesen oder eingesperrt und gezwungen, zu bestimmten Zeiten in bestimmten Kirchen zu erscheinen und Predigten über sich ergehen zu lassen, in denen Priester ihnen hektisch erregt ins Gewissen redeten. Und auf einer solchen Veranstaltung, es war, wie gesagt, im November sechsundsechzig, begegnete ich Mercuria.
Was ich dort verloren hatte? Nun, ich bin Novellant, obwohl sich mein Onkel Antonietto sicherlich im Grab herumgedreht hätte, wenn ich diese Bezeichnung damals für mich in Anspruch genommen hätte. Denn er, Antonietto Sparviero, war einer der Größten dieser Zunft, die sich im Wesentlichen auf den Handel mit Nachrichten gründete; seine Kunden saßen in Bologna, Mailand und Venedig, in Avignon, Genf, Nürnberg und Wien. Über ein jahrzehntelang geknüpftes Netz von Zuträgern aus den höchsten Kreisen sammelte er täglich Meldungen und Gerüchte, prüfte und bewertete sie, stellte sie zusammen, formulierte sie um, schnürte sie zu Bündeln und schickte sie mit der Post auf die Reise. Alles schrieb er mit eigener Hand ab, den Kopisten vertraute er nicht und dem gedruckten Wort noch weniger, denn was die Zensur passiert hatte und von Tizio, Caio und Sempronio gelesen wurde, war für seine anspruchsvollen Auftraggeber wertlos und überdies oft noch nicht einmal wahr. Nichts entging ihm, und insofern teilte er mit dem Heiligen Vater zumindest zwei Eigenheiten: Beide hatten einen Namen, der zu ihnen passte, und beide fühlten sich ihren Wahrheiten verpflichtet und handelten danach mit einer Konsequenz, die ihresgleichen suchte.
Nach dem Tod meines Vaters hatte Onkel Antonietto mich bei sich aufgenommen und mit Ernst und Geduld versucht, mich in sein Gewerbe einzuführen, war jedoch an meiner Oberflächlichkeit verzweifelt: Als es ihn schließlich dahinraffte, war ich einundzwanzig Jahre alt, interessierte mich für süßen Wein, halbseidene Unternehmungen, leichtfertige Mädchen und das, was man mit ihnen machen konnte, wenn ihre Eltern zu Bett gegangen waren. Was Kurialen und Diplomaten hinter verschlossenen Türen miteinander vereinbarten, das kümmerte mich ebenso wenig wie Zolltarife, Verordnungen, Ämtervergaben, Truppenanwerbungen, Heiratsprojekte gekrönter Häupter und Gerüchte über die Kandidaten für bevorstehende Kardinalserhebungen; wenn ich mich überhaupt für Nachrichten interessierte, dann waren sie anstößig, schlüpfrig und skandalös. Ich übertrieb und verdrehte, was ich aufschnappte, dichtete Unwahres hinzu und ließ Entscheidendes weg. So belieferte ich die Drucker, die Onkel Antonietto mir vorgestellt hatte, mit Gazetten voller Räuberpistolen, die Schadenfreude und Sensationsgier bedienten, und ich hoffe bis heute, dass es nicht die Enttäuschung über seinen missratenen Neffen war, die ihn ins Grab gebracht hat, aber ganz sicher bin ich mir da leider nicht.
Nicht dass ich nicht erfolgreich gewesen wäre: Meine Gazetten erfreuten sich großer Beliebtheit, sie lagen in den Geschäften der Drucker aus, wurden von Ausrufern auf der Straße verkauft und bisweilen sogar in andere Sprachen übersetzt. Je unsinniger sie waren, desto besser verkauften sie sich. Und weil das Geschäft mit dieser Art von Nachrichten so gut lief, glaubte ich es mir leisten zu können, mich zwischendurch wochenlang Müßiggang und Lotterleben hinzugeben.
Nun, wie auch immer. Trotz der genannten Gemeinsamkeiten schien die Stadt nicht groß genug zu sein für Antonietto Sparviero und Michele Ghislieri, nachdem Letzterer Papst geworden war. Oder sollte es Zufall gewesen sein, dass meinen Onkel der Schlag traf, während er in der Menge auf dem Petersplatz stand und das Ergebnis der Wahl vernahm? Ich stand neben ihm, als er zusammenbrach, und ich erinnere mich noch genau, wie zögerlich der Jubel der Gläubigen ausfiel, als der Kardinalprotodiakon den Namen von der Benediktionsloggia aus über den Platz rief, denn alle wussten, dass mit einem Papst von diesem Kaliber nun andere Zeiten anbrechen würden. Auch Ghislieri selbst scheint das übrigens nicht entgangen zu sein: Angeblich äußerte er bald darauf, er hoffe, das Volk werde seinen Tod dereinst mehr betrauern als seine Wahl.
Man trug meinen Onkel in sein Haus und rief einen Priester für die Letzte Ölung, er aber grunzte nur ungehalten und lebte einfach weiter. Seine rechte Seite war fortan gelähmt, er sprach wie ein Betrunkener und konnte ohne Hilfe keinen Schritt mehr machen, doch mit unerhörter Willensanstrengung empfing er immer noch seine Zuträger und schrieb mit der linken Hand weiter, bis ihn im Spätsommer der zweite Schlag traf. Diesmal kam der Priester zu spät.
Drei Monate darauf, am besagten Tag im November sechsundsechzig, waren dagegen alle pünktlich: der Priester, ein gemütlicher Fettsack mit rotem Gesicht und Weinflecken auf der Albe, der sich unter dem Portal der Kirche aufgebaut hatte und mit einer Mischung aus Milde und Beschränktheit die Ankommenden musterte, dann die Neugierigen in den Fenstern des benachbarten Palastes der Colonna und auf den Dächern der umstehenden Häuser, ferner die Männer des Gouverneurs, die eine Absperrkette gebildet hatten, um die Gaffer wenigstens vom Platz fernzuhalten, sowie die besagten Gaffer selbst, fast ausschließlich Männer, die schwatzend, johlend, pfeifend und applaudierend herandrängten.
Pünktlich waren schließlich auch die Damen, die fürwahr einen atemberaubenden Anblick boten: glänzend herausgeputzt, auf hohen Absätzen, in leuchtenden Kleidern und mit ins Haar geflochtenen Perlen stolz einherschreitend, nach tausend Wässerchen gegen den aus der Kirche herausquellenden Weihrauch anduftend, so formierten sie sich für den Einzug in das Haus des Herrn, offensichtlich nicht gewillt, es als dessen Bräute wieder zu verlassen. Obwohl die Schikanen und Ausweisungen der letzten Monate ihre Reihen ausgedünnt hatten, waren sie immer noch zahlreich genug, um die Kirche zu füllen, und man sah eine ganze Reihe von stadtbekannten Gesichtern. Die Männer hinter der Absperrkette zeigten bald hierhin, bald dorthin, riefen laut jubelnd die Namen ihrer Angebeteten herüber und bekamen Handküsse als Antwort zurück: Biancarossanera stolzierend wie ein Klapperstorch, Gianna la Gazza Ladra ganz in Samtschwarz, Bona la Bonazza betont vulgär mit einem Ausschnitt, der allein schon zwanzig Peitschenhiebe gerechtfertigt hätte, Pasqualina Faccia d’Angelo die Unschuld selbst mit keusch gesenktem Blick und in Wahrheit angeblich doch das größte Luder von allen, Venusia Vanesia schließlich in einem bodenlangen grünen Kleid, das vortrefflich mit der Stola des Priesters korrespondierte. Während wir in einer langen Reihe die Kirche betraten, ebbte das angeregte Schwätzen und Schnattern ab. Der Weihrauch stand als dichter Nebel im Mittelschiff und geriet in Wallung, als die vielköpfige Schar sich auf die Bänke verteilte, niederkniete und schließlich die Plätze einnahm. Das große Apsisfresko mit dem Bild des inmitten von Engelschören zum Himmel auffahrenden Erlösers schimmerte dunkel im Licht der Kerzen.
Der Zufall wollte es, dass ich neben Mercuria Platz fand, die mich zunächst nicht beachtete, sondern leise mit ihrer Nachbarin zu plaudern begann. Zu meiner anderen Seite hockte ein junges Ding in einem billigen Kleid. Ihre traurige Laufbahn stand ihr schon ins Gesicht geschrieben: nicht hübsch genug als Bettgenossin und nicht geistreich genug als Tischgenossin zahlungskräftiger Kunden; man konnte nur hoffen, dass wenigstens sie und einige andere von ihrer Sorte, die mein umherschweifender Blick nach und nach erfasste, der Empfehlung folgen würden, die uns hier gleich erteilt werden sollte.
Doch die erste Empfehlung des Tages kam nicht vom Altar, vor dem der Priester inzwischen Aufstellung genommen hatte, nachdem er zu den Klängen der Orgel unter dem Vortragekreuz mit schwerem Schritt den Mittelgang durchmessen hatte. Sie kam von hinten und war an mich gerichtet. Stoff raschelte, als sich hinter mir jemand vorbeugte.
«Wenn du gelernt hast, dich vernünftig zu schminken, geh zu Kardinal Cornaro», zirpte es mir ins Ohr. «Bist ein leckerer Happen für den alten Lumpensack.»
Ich verzichtete darauf, mich umzudrehen, und fand dementsprechend auch nicht heraus, ob das ein ernst gemeinter Ratschlag oder reine Gehässigkeit sein sollte. Dafür mischte sich nun Mercuria ein, die die Bemerkung offenbar gehört hatte. Sie wandte mir das Gesicht zu. Kluge blaue Augen, die Wimpern tadellos getuscht, musterten mich von oben bis unten. Ein Lächeln huschte über ihre Mundwinkel, spöttisch und dennoch wohlwollend.
«Tu das bloß nicht», sagte sie. «Lass den Blödsinn und such dir ein Mädchen.»
«Aber Cornaro zahlt gut», insistierte die Stimme.
Mercuria wandte sich nach hinten. «Eben nicht. Er schickt seine Diener los und lässt sie halbe Kinder von der Straße holen. Cornaro ist ein altes Schwein, und außerdem hat er die Franzosen, also spar dir solche Ratschläge. Oder halt zur Sicherheit am besten ganz den Schnabel.»
Von hinten beleidigtes Schweigen.
«Dominus vobiscum», sang der Priester.
«Et cum spiritu tuo», schallte es zurück.
Mercuria wandte sich nun wieder ihrer Nachbarin zu, einer eleganten Dame im mittleren Alter, die offenbar ebenfalls vor Zeiten in den Ruhestand getreten war. Die anderen Frauen in der Kirche – ich schätzte ihre Zahl auf etwa hundertfünfzig – waren mindestens fünfzehn Jahre jünger.
Während der Priester ein Gebet sprach und ein Ministrant das Lesepult zurechtrückte, betrachtete ich Mercuria aus dem Augenwinkel. Sie war durch und durch eine vornehme Dame. Die schwarzen Haare hatte sie mit Lack zum Glänzen gebracht und zu einem Knoten gebunden, aus dem ihr eine Strähne ins Gesicht fiel. An ihrem Hals schimmerten Perlen, an den Fingern goldene Ringe, die sie über die schwarzen Seidenhandschuhe gezogen hatte. In den Wangen hatte sie kleine Grübchen, als ob sie sich pausenlos über etwas amüsierte. Wenn sie lachte, blitzten ihre Zähne auf.
«Starr mich nicht so an», sagte sie, wobei sie den Kopf ganz leicht in meine Richtung neigte, ohne sich von ihrer Nachbarin abzuwenden. Ich zuckte ertappt zusammen und ließ meinen Blick weiter durch die Kirche wandern, während der Zelebrant verkündete, die Homilie der heutigen Messfeier über die Sünde halten zu wollen.
«Na, was für eine Überraschung», kam es halblaut von einer der hinteren Bänke, gefolgt von unterdrücktem Gekicher.
Falls der Priester den Zwischenruf gehört hatte, ließ er sich nichts anmerken und verkündete, für die Lesung sei das Buch des Propheten Hesekiel ausgewählt worden.
«Dann hol mal deinen Hesekiel raus», meldete sich wieder die Stimme von hinten. Erneut wurde gekichert, ein paar Köpfe wandten sich um.
Mercuria knurrte leise: «Was soll denn das hier werden?»
Der Ministrant hatte derweil den schweren Buchdeckel der Bibel auf dem Lesepult aufgeschlagen und blätterte darin herum. Ein magerer und blasser Lektor trat dazu und räusperte sich. Dann begann er mit dünner Stimme vorzutragen.
«Das Wort des Herrn erging an mich: Menschensohn, mach Jerusalem seine Gräueltaten bewusst!»
«Lauter!», rief eine schrille Stimme. «Hier hinten versteht man überhaupt nichts!»
«Dann setz dich doch nach vorn», nörgelte eine andere Stimme. «Oder hast du Angst, dass denen beim Anblick deiner faulen Zähne der Appetit vergeht?»
Verunsichert sah der Lektor auf und warf dem Zelebranten einen hilfesuchenden Blick zu, der schüttelte missbilligend den Kopf in Richtung der Gemeinde und wies den Lektor mit einer Handbewegung an, noch einmal von vorn zu beginnen.
Und das tat er, doch das Bemühen um mehr Lautstärke ging auf Kosten der Intonation, er hustete, verhaspelte sich, setzte abermals an und gab ein klägliches Bild ab, wie er da stand, seine renitente Zuhörerinnenschaft einzuschüchtern versuchte und doch nur das Gegenteil erreichte. Hesekiels donnernde Strafpredigt geriet zu einem derart heiseren Gestammel, dass der Prophet sich die Haare gerauft hätte. Selbst der Priester war peinlich berührt und schien zu überlegen, wie er die Sache abkürzen konnte.
«Du hast dich den Ägyptern, deinen Nachbarn mit dem großen Glied, hingegeben und mit ihnen unaufhörlich Unzucht getrieben.»
«Hört, hört, die Ägypter! Kann das jemand bestätigen?», fragte Gianna la Gazza Ladra laut.
«Nie im Leben! Den größten Hirtenstab hat immer noch der Ordensgeneral der Franziskaner!», rief Bona la Bonazza.
«Kann sein, aber er kriegt ihn nicht hoch!»
«Bei dir vielleicht nicht, du alte Schleiereule!»
«Wie bitte? Ich bin achtzehn!»
«Dass ich nicht lache! Du bist inzwischen öfter achtzehn geworden als ich meine Jungfräulichkeit verkauft habe!»
«Ruhe!», wetterte der Priester. Doch niemandem entging, dass seine Mundwinkel zuckten.
Dem Lektor blieb nichts anderes übrig, als mit der demütigenden Prozedur fortzufahren. Die Gesichter der Ministranten waren inzwischen knallrot.
«Darum, du Dirne, höre das Wort des Herrn!»
Während der Lektor stotternd weiterlas, breiteten Unruhe und Erheiterung sich von den letzten Bankreihen immer weiter aus. Einzig Mercuria schien nicht gewillt, sich davon anstecken zu lassen. Mehrmals beugte sie sich zu ihrer Nachbarin hinüber und flüsterte mit unverhohlener Gereiztheit auf sie ein.
Hesekiels schwächlicher Wiedergänger strebte derweil dem Höhepunkt der Tirade zu, verkündete, der Unzucht ein Ende zu bereiten, und drohte die fürchterlichsten Strafen an, während die Zwischenrufe in immer schnellerem Takt auf ihn niederhagelten. Einige Frauen waren aufgestanden und schüttelten die Fäuste, und je weiter der Aufruhr um sich griff, desto wagemutiger wurden sie.
«Schämt euch doch selber! Was glaubt ihr, wer diese Perlenkette hier bezahlt hat?», schrie eine.
«Der neue Kardinal?», fragte eine andere. «Der Kleine? Dieser Bonelli?»
«Nein, Kardinal del Monte!»
«Heilige Nafissa, du auch? Der jagt sein Frettchen aber auch wirklich in jeden Bau!»
«Allerdings! Und zwar am liebsten durch den Hintereingang!»
«Na, der steht bei dir ja mittlerweile weiter offen als das Hauptportal, wie man so hört!»
Diese letzte Bemerkung von Bona la Bonazza löste einen Sturm von Gelächter aus.
«Halleluja!», prustete der Zelebrant und wandte sich zum Altar um. Seine Schultern bebten.
In diesem Augenblick platzte Mercuria endgültig der Kragen. Sie hieb mit der Faust auf die Bank und erhob sich. «Mir reicht’s!», schnaubte sie ihre Nachbarin an, die zunächst unschlüssig schien und schließlich nickend aufstand.
Was dann folgte, war der wahrscheinlich peinlichste und zugleich folgenreichste Moment meines Lebens.
Hätte Mercuria nicht diese natürliche Autorität und Erhabenheit ausgestrahlt, wäre es wohl gar nicht passiert. Aber so war sie: Allein durch ihr Erscheinen teilte sie jede Menschenmenge wie Moses das Rote Meer; ihr Auftreten genügte, um alle beiseitetreten zu lassen, die irgendwie im Weg standen. So auch hier. Es reichte, dass sie aufstand, und schon sprang das junge Ding neben mir demütig aus der Bank, um sie passieren zu lassen. Und weil ich einen Augenblick zu spät merkte, dass auch ich aufstehen musste, tat ich es umso eilfertiger, und da geschah es. Der Saum meines Kleides hatte sich in irgendeiner verdammten Ritze der Bank verfangen, und der Stoff riss entlang einer Naht, die vom Knöchel bis unter die Achsel verlief. Nicht genug damit, dass ich von einem Moment auf den anderen halbnackt in der Kirche stand: Die breite Bandage, die ich zur Vortäuschung weiblicher Konturen mit zwei prachtvollen Äpfeln ausgestopft und mir um die Brust gewickelt hatte, löste sich ebenfalls, und die Früchte, natürlich gleich alle beide, fielen heraus und kullerten über den Kirchenboden. Es gelang mir gerade noch, den lose über meiner linken Schulter hängenden Stoff zusammenzuraffen, um meinen entblößten Oberkörper zu bedecken, was allerdings auch nicht mehr viel half: Ich stand gut sichtbar im Mittelgang, und alle, die in Blickweite saßen, starrten mich an. Gelächter erhob sich, Köpfe wandten sich mir zu, Hälse wurden gereckt, eine stieß die andere an, einige standen auf, und bald waren die Blicke und Finger der ganzen Gemeinde auf mich gerichtet, alles gackerte und prustete.
Mercuria schob sich mit einer Mischung aus Spott und Mitleid im Blick an mir vorbei, ihre Begleiterin folgte ihr peinlich berührt.
«Du kommst mal besser gleich mit», raunte sie mir zu.
Was blieb mir übrig? Im Tumult des immer weiter anschwellenden Gelächters schritten wir zum Portal. Ich traute mich nicht mehr, den Blick zu heben, sondern achtete ängstlich darauf, nicht auch noch über die Reste meines Kleides zu fallen.
Die Türen der Kirche waren geschlossen. Einer der Männer des Gouverneurs, ein tumber Geselle mit unrasiertem Gesicht und struppigem Haar, stand davor und blockierte den Weg.
«Mach auf», sagte Mercuria nur.
«Darf ich nicht.»
«Junge, mach dich nicht unglücklich. Tür auf, aber ein bisschen plötzlich.»
«Der Gouverneur …»
«… ist nachher zum Essen bei mir. Willst du morgen im Steinbruch anfangen?»
Die Tür schwang auf. Das Licht der tief im Westen stehenden Sonne flutete herein. Als ich hinter Mercuria durch das Portal trat, blickte ich zurück: Das wunderbare Apsisfresko glomm auf, als glühte es von innen.
Der Platz war immer noch abgesperrt, aber die Menge der Gaffer war auf ein paar schwatzende Tagediebe zusammengeschmolzen. Mercurias Kutsche wartete mitten auf dem Platz. Das Pferd schlug ein paarmal mit einem Vorderhuf auf das Pflaster. Der Kutscher fummelte und zerrte am Geschirr herum.
Mercuria holte tief Luft und stieß sie wieder aus. «Gott, was für ein würdeloses Spektakel!», ereiferte sie sich. «Die haben wirklich kein bisschen verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Auf so was wartet die Inquisition doch nur.»
Ich war dermaßen damit beschäftigt, das ruinierte Kleid um meinen Körper zu wickeln, dass ich kaum zuhörte. Willenlos ließ ich es geschehen, dass sie mir kopfschüttelnd einen Stoffzipfel aus der Hand nahm, mich unsanft herumdrehte und hinter meinem Nacken irgendetwas zusammenknotete.
«Was hattest du eigentlich da verloren? Schicken die ihre Spitzel jetzt schon in Frauenkleidern durch die Gegend? Wie heißt du überhaupt?»
«Michelangelo.»
«Ach was.» Sie kniff die Augen zusammen. «Der Neffe von Antonietto Sparviero?»
Ich war völlig überrumpelt. «Ja.»
«Mein Beileid.»
«Wie …»
«Mein Gott, den kannte hier doch wirklich jeder. Ich bin Mercuria.»
«Lucrezia», sagte die Nachbarin.
«Luparella», korrigierte Mercuria.
«Das ist lange her», wiegelte Lucrezia ab.
«Sei nicht so feige.»
«Die Zeiten sind vorbei.»
«Warum bist du dann hier?»
Ich war sprachlos und versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. Luparella. Die berühmte Luparella, die ihre Liebhaber bis aufs Blut ausgesaugt und mit dem Geld eine Bank gegründet hatte.
«Krieg dich wieder ein», sagte Mercuria.
Die beiden plauderten noch eine Weile, ohne das Wort an mich zu richten. Ich fühlte mich überflüssig wie ein kleiner Junge, der mit den großen Kindern spielen will, eine Weile herumsteht und langsam erkennt, dass sie sich nicht um ihn scheren. Ich hatte gerade zu überlegen begonnen, wie ich beiläufig und ohne weiteren Gesichtsverlust den Ort des Geschehens verlassen könnte, da kam Lucrezia mir zuvor, verabschiedete sich und ging über den Platz davon. Sie sprengte die Absperrkette mit einer lässigen Handbewegung und verschwand zwischen den Häusern.
«Wo wohnst du?», fragte Mercuria.
«Parione», sagte ich unsicher.
«Soll ich dich mitnehmen?»
«Das wäre sehr freundlich.»
«Freundlich», wiederholte sie spöttisch. «Freundlichkeit ist weiß Gott nicht die Währung, mit der diese Kutsche bezahlt wurde.» Ihre blauen Augen musterten mich wieder, wie in der Kirche, zwischen Wohlwollen und Spott changierend. Dann stiegen wir ein.
Im verglühenden Tageslicht ratterten wir durch die Stadt. Ich bin normalerweise nicht auf den Mund gefallen, aber bis heute ist mir nichts Vernünftiges eingefallen, was ich in dieser Situation hätte sagen können.
«Dein Onkel war ein anständiger Mann», stellte sie fest, während wir das Pantheon passierten. Eine Antwort schien sie nicht zu erwarten, also lächelte ich nur schief.
«Mal im Ernst, was wolltest du da?»
«Ich schreibe», sagte ich zögerlich und hoffte, meine Tätigkeit nicht näher erklären zu müssen, erst recht nicht, nachdem der Name meines Onkels gefallen war. Mein Auftritt war schon lächerlich genug gewesen, und ich legte keinen Wert darauf, jetzt auch noch für meine Arbeit mit den Maßstäben von Antonietto Sparviero gemessen zu werden.
Mercuria runzelte die Stirn. «Im Ernst? Berichte für das Heilige Offizium, oder was?»
«Nein», erwiderte ich entrüstet. «Gazetten.»
Ich muss dazu vielleicht sagen, dass mir meine Arbeit keineswegs peinlich war, obwohl ich dafür in den Kreisen, in denen mein Onkel verkehrt hatte, immer wieder irritiert angesehen worden war. Das überhebliche Nicken, das ich nun von Mercuria für meine knappe Erklärung erntete, kam mir sehr vertraut vor. Normalerweise hätte mich das nicht gestört, denn die Leute, mit denen ich mich sonst so herumtrieb, fanden meine Tätigkeit äußerst amüsant und stachelten mich eher noch an. Ein guter Teil der Geschichten, die ich später den Druckern übergab, entstand an langen Abenden in Wirtshäusern. Doch nach meinem Auftritt in der Kirche empfand ich kein Bedürfnis, mir vor Mercuria weitere Blößen zu geben. Sie saß mir in der Kutsche gegenüber und strahlte eine Überlegenheit aus, die in mir ein unerklärliches Verlangen auslöste, das ich in ihrer Gegenwart noch öfter empfinden sollte: Ich wollte mir ihre Achtung verdienen. Doch weil es in diesem Augenblick nichts gab, was ich zu diesem Zweck hätte sagen können, schwieg ich lieber. Und da sie das zu spüren schien und mich nicht weiter in Verlegenheit bringen wollte, schwieg auch sie.
Als wir vor dem Haus meines Onkels hielten, war es fast dunkel. Ich bedankte mich und stieg aus. Es sollte mehr als drei Jahre dauern, bis ich sie wiedersah.
Eine halbe Stunde später saß ich beim Schein einer flackernden Kerze am Tisch und nippte an einem schlechten Wein. Nach dem ersten Glas schämte ich mich schon ein bisschen weniger. Nach dem zweiten konnte ich über das Missgeschick mit dem Kleid, das wie eine abgeworfene Reptilienhaut hinter mir auf dem Boden lag, schon herzlich lachen. Und nach dem dritten kam mir die Idee, wie die Erlebnisse des Tages sich zu einer hübschen Gazette verarbeiten ließen.
2
Also kehrt um & tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden! Dieses Wort des Evangelisten Lukas aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte fand am Tag der Heiligen Katharina von Alexandria des Jahres MDLXVI in der Kirche Santissimi Apostoli zu Rom seine wundersame & herrliche Bestätigung. Der Heilige Vater nämlich, betrübt & erschüttert ob des Ausmaßes von Sünde & Unzucht, die seit Jahren wie eine Pestilenz in der Stadt um sich griffen, hatte in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Strafmaßnahmen zur Bekämpfung dieses vielgestaltigen Übels & zur Rettung der verführten & geblendeten Seelen ergriffen. Im Vertrauen auf die Kraft der Worte unseres Erlösers aus dem achten Kapitel des Evangeliums nach Johannes – Geh & sündige von jetzt an nicht mehr! – beschloss er, die besagten Übel nicht nur durch die Furcht vor den angedrohten Strafen, sondern auch durch Einsicht & Umkehr zu überwinden & beauftragte zu diesem Zweck einige seiner treuesten & redegewandtesten Diener, den Kurtisanen der Stadt das Evangelium zu predigen & ihnen die Erlösung & das ewige Leben in Aussicht zu stellen, sofern sie von ihrem sündigen Treiben abzulassen gelobten. So fanden sich am besagten Tag in besagter Kirche zahlreiche Frauen von zweifelhaftem Lebenswandel ein, um, teils dem päpstlichen Gebot folgend, teils der Einsicht nachgebend, das Wort des Herrn zu hören. Während der Lesung über die Ermahnungen des Propheten Hesekiel erfrechten sich nun einige besonders verstockte & uneinsichtige Subjekte, von den Bänken aufzuspringen & den Vortrag durch anstößige & schamlose Zwischenrufe zu unterbrechen, wobei sie noch nicht einmal davor zurückschreckten, einige der höchsten Amtsträger der Kirche & damit den Herrn selbst auf eine Weise zu schmähen, die wiederzugeben sich verbietet. Im Augenblick des größten Tumults aber sandte der Allmächtige ein Zeichen & wandelte ihre Unverfrorenheit in Demut. Während nämlich einige besonders dreiste Frauen, stadtbekannte Sünderinnen allesamt, sich bereits anschickten, den Zelebranten vor dem geweihten Altar zu bedrängen, durchstrahlte unversehens ein Licht das köstliche Freskengemälde des zum Himmel auffahrenden Erlösers, das der große Meister Melozzo vor vielen Jahren dort angebracht hatte. Die musizierenden Engel zu seinen Füßen gerieten in Bewegung, zupften & strichen die Saiten ihrer Instrumente, erhoben ihre Stimmen, & eine göttliche Melodie durchströmte die gesamte Kirche, sodass die Versammelten unverzüglich von ihrem Treiben abließen & sich zu Boden warfen. Gleichzeitig ertönte eine Stimme: Schwört ab! Kehrt um! Tut Buße! Das weiße Gewand des Erlösers geriet in Bewegung wie wogendes Wasser & begann immer stärker zu leuchten, sodass das Licht bald den ganzen Raum erfüllte. Schon wurden Tränen vergossen, Ausrufe der Verzückung erklangen, & wie auf ein Zeichen hoben die versammelten Frauen an, das von den Engeln angestimmte Tedeum zu singen, wie es nie zuvor inbrünstiger zu hören gewesen ist. Niemand kann sagen, wie lange sie so verharrten, & als das göttliche Licht endlich erloschen & die letzten Töne des Gesangs verklungen waren, bedrängten die Frauen den Priester erneut, jedoch nicht wie noch kurz zuvor mit Lästerungen & Schmähungen, sondern mit flehentlichen & demütigen Bitten, ihnen das Keuschheitsgelübde abzunehmen, während andere den Rosenkranz betend verharrten & wieder andere ihre Perlenketten, Ringe & Broschen in den Opferstock warfen, um sich auf diese Weise ihrer durch die Sünde erworbenen Reichtümer zu entledigen. So wirkte an diesem Tag durch die Fürsprache des Heiligen Vaters die Gnade Gottes ein Wunder, von dem die Anwesenden bald überall Zeugnis ablegten, sodass der brennende Wunsch, Laster & Ausschweifung zu entsagen & den Versuchungen des Teufels fortan entschlossen zu widerstehen, die ganze Stadt ergriff. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen.
3
«Ist der von dir, dieser Scheiß hier?», schnauzte Mercuria mich zur Begrüßung an, als wir uns drei Jahre später erneut gegenüberstanden.
Eins, zwei, drei Jahre, tatsächlich. Drei Jahre waren ins Land gegangen, in denen sich bei mir nichts verändert hatte: Ich hatte mich herumgetrieben, war den Mädchen hinterhergestiegen und hatte Gazetten voller wilder Geschichten verfasst. Die Kontakte zu den Zuträgern meines Onkels waren eingeschlafen, stattdessen hatte ich sein bescheidenes Vermögen verprasst und schließlich sogar das Haus belastet. Von Antonietto Sparviero war mir nur ein Dutzend Kisten voller Notizen, Nachrichten, Flugblätter und Gazetten aus vier Jahrzehnten geblieben, die seit seinem Tod in einer Ecke standen. Sollte den Gläubigern der Geduldsfaden reißen, würde ich bald auf der Straße stehen. Das Haus musste verkauft werden, um den letzten Rest des Erbes zu Geld zu machen. Ich war vierundzwanzig, abgebrannt und nichtsnutzig. Ich wusste, dass sich in meinem Leben etwas ändern musste. Und ich brauchte eine neue Bleibe.
Ein entfernter Bekannter hatte mir erzählt, dass eine entfernte Bekannte von ihm, eine gewisse Mercuria, eine Wohnung zu vermieten hatte. Oder war es ein Haus? So genau wusste er das nicht.
«Mercuria?», hatte ich gefragt. «Die Kurtisane?»
«Genau die. Sag bloß, du kennst die?»
Die Messe in Santissimi Apostoli fiel mir wieder ein, das gerissene Kleid, der Tumult in der Kirche, meine Heimfahrt in ihrer Kutsche, die Gazette, die ich noch in derselben Nacht betrunken am Schreibtisch verfasst hatte. Sie hatte sich damals ganz gut verkauft.
Und ausgerechnet diese Gazette war es nun, die Mercuria mir gleich zum Auftakt unter die Nase halten musste, nachdem der Bekannte einen Termin zur Besichtigung des Hauses vermittelt hatte. Ich war mir nicht sicher gewesen, ob sie sich überhaupt noch an mich erinnern würde. Nun stellte sich heraus, dass sie sich offenbar besser erinnerte, als mir lieb sein konnte. Das fing ja gut an.
Mercuria erwartete mich am vereinbarten Treffpunkt in der Tordurchfahrt zu einem Innenhof in der Via dei Cappellari, zwischen den Hutmacherwerkstätten, nur einen Steinwurf vom Campo dei Fiori entfernt. Es war ein Samstag, und der Pferdemarkt auf dem Platz ging seinem Ende zu. Menschen drängelten sich an uns vorbei, Händler holten ihre in den Seitenstraßen abgestellten Karren ab und schoben sie rücksichtslos durch das Gewimmel in der ohnehin schon schmalen Straße, über der sich kreuz und quer die Wäscheleinen spannten. Ein Pferd stieg und riss dabei den Ständer eines Mützenmachers um, überall wurde geschrien, gelacht und gepfiffen, während vom Platz her das Wiehern und das Hufgeklapper der Gäule herüberschallte und über den verwinkelten Dächern ein vielstimmiges Glockengeläut wehte. Ich kannte die Gegend ganz gut, weil einer meiner Drucker seine Werkstatt am Campo dei Fiori hatte und weil ein paar Straßen weiter das Bankenviertel begann, wo mein Onkel einen guten Teil seiner Zeit verbracht hatte, um Gazetten und Berichte auswärtiger Novellanten zu kaufen, seine Zuträger zu treffen oder sich einfach nur umzuhören. Ich hatte ihn manchmal begleitet, jedenfalls in der ersten Zeit, als er noch gehofft hatte, mich zu seinem Nachfolger machen zu können.
Da stand sie also, ungezwungen an den Torpfeiler gelehnt, in den die Radnaben der durchfahrenden Wagen im Lauf der Jahre tiefe Scharten gewetzt hatten. Sie trug ein schlichtes Wollkleid und hatte die Haare lose zusammengebunden, und selbst in dieser lässigen Aufmachung war sie eine Erscheinung, ja, gerade in dieser Aufmachung, die einen so deutlichen Kontrast zu ihrem feinen Gesicht mit den strahlenden Augen darstellte. Ihr ganzer Körper war eine fließende Drehung, als posierte sie für ein Gemälde von Parmigianino, aber sie posierte eben nicht: Was andere in eitlem Bemühen einstudierten, war seit Jahrzehnten ihre natürliche Haltung, als wäre dieser abgewetzte Travertinpfeiler eine hochkant gestellte Polsterliege, auf der eine Königin die Bittsteller empfängt. Und genau das war sie: eine Königin. Und genau das war ich: ein Bittsteller.
Ihre Augen blitzten mich an, und ich vermochte nicht zu sagen, ob sie ernsthaft wütend war oder nur spotten wollte; erst später lernte ich, das zu unterscheiden. In der rechten Hand hielt sie also meine drei Jahre alte Gazette. Oben auf dem Blatt prangte ein grobschlächtiger Holzschnitt mit ein paar knienden Gestalten, die sich vor einem in einer Engelswolke schwebenden Heiland niederwarfen – eine Darstellung, die der Drucker damals in seinem riesigen Fundus von Bildern aufgestöbert, für halbwegs passend befunden und über dem Bericht eingefügt hatte, weil illustrierte Blätter sich auf der Straße nun einmal besser verkaufen. Zugegeben, alles in allem war das weder eine geistige noch eine handwerkliche Meisterleistung gewesen, aber der Text hatte die Zensur ohne Beanstandungen passiert. Wie hatte Mercuria sie ausgerechnet jetzt in die Finger bekommen, in diese Finger, die ich nun erstmals ohne Handschuhe sah, auch sie schmal und weiß, wie von Parmigianino gemalt?
Sie stieß voller Verachtung die Luft aus, holte mit dem Blatt aus, als wollte sie es mir um die Ohren hauen, um mich dafür zu bestrafen, dass ich unser damaliges Kennenlernen durch die lügenhafte Darstellung der Umstände entwertet hatte.
«Ja, dieser Scheiß ist von mir», sagte ich und versuchte meinem unbeholfenen Grinsen einen resignierten Ausdruck zu geben; als hätten höhere Mächte mich gezwungen, einen solchen Unsinn zu Papier zu bringen.
«Antonietto Sparviero würde sich im Grab umdrehen», setzte sie nach.
Ich erinnere mich sehr deutlich, dass sich bei diesen Worten ein leichter Trotz in mir regte. Was gab ihr eigentlich das Recht, meinen verstorbenen Onkel als Zeugen gegen mich aufzurufen? Ausgerechnet ihr, einer Person, die ihr Geld ja wohl mit weitaus anstößigeren Tätigkeiten verdient hatte? Später, als ich besser wusste, was ich mir bei ihr erlauben konnte, fielen mir natürlich alle möglichen Antworten ein. Allerdings begriff ich später auch, dass das Kurtisanengeschäft für sie eine durch und durch ehrenwerte Arbeit war, im Gegensatz zur gewerbsmäßigen Verbreitung von Lügen, wie ich sie betrieb.
Mercuria hatte offenbar beschlossen, mich nicht weiter zu triezen, und sie schlug einen versöhnlicheren Ton an. «Bist ein hübscher Kerl ohne dieses Kleid.»
Wie sie es sagte, klang es kein bisschen zweideutig, eher wie ein Befund als wie eine Schmeichelei. Ich darf hinzufügen, dass ich oft Komplimente dieser Art bekam, und das sage ich nicht aus Eitelkeit, sondern nur zur Erklärung.
Mit einem Nicken stieß sie sich vom Pfeiler ab und winkte mir, ihr in den Innenhof zu folgen. Wir durchquerten den Tordurchgang, Mercuria mit federleichtem Gang vorneweg. In ihrem hellen Wollkleid wirkte sie wie ein Engel, der mir durch das Dämmerlicht voranschwebte. Eine Katze, die in einer Ecke gekauert hatte, schoss als Schatten davon wie ein bei finsteren Umtrieben aufgescheuchter Dämon.
Ich war aufgeregt. Vielleicht bilde ich mir das im Nachhinein auch nur ein, aber ich glaube, ich spürte schon in diesem Moment, dass hier nun endlich ein neuer Abschnitt meines Lebens beginnen und dass Mercuria eine wichtige Rolle darin spielen würde. Die Via dei Cappellari bildete die Grenze zwischen Parione und Regola, und das gefiel mir: Parione, die gediegene Welt meines Onkels, der Stadtteil der Literaten, Notare und Verleger, der Kardinalspaläste und Botschafterresidenzen; und Regola, das im Süden bis zum Flussufer reichende Viertel der Handwerker und Tavernenwirte, wo Pilger aus allen Ländern der Christenheit auf einheimische Raufbolde, Beutelschneider und Prostituierte trafen. Streng genommen war die Via dei Cappellari nicht so sehr eine Grenze, sondern eher eine Naht, die nicht trennte, sondern verband, was ohnehin ineinanderwucherte: An Markttagen strömte das Volk auf der Piazza Navona zusammen und erinnerte die feinen Herren in Parione daran, dass die Stadt ihnen nicht allein gehörte, während der allerfeinste dieser Herren, Kardinal Farnese, die Bevölkerung von Regola im Glanz seines fast fertiggestellten Palastes baden ließ, dessen prachtvolles Gesims die verschachtelten Dächer der Umgebung überragte. Ich kannte den Palazzo Farnese und seine Umgebung aus meiner Kindheit, denn mein Vater hatte eine Zeitlang für den Kardinal gearbeitet, worauf ich gleich noch zurückkommen werde.
Mercuria geleitete mich in den schönsten Innenhof, den ich je gesehen hatte: Um die freie Fläche, die tatsächlich gepflastert und überdies sauber gefegt war, drängte sich ein halbes Dutzend Häuser. Winzige Balkone, schiefe Treppen und Anbauten auf hölzernen Stelzen. Überall Blumenkübel. Die Ziegelmauern waren an vielen Stellen mit Bruchstücken antiker Bauten ausgebessert und ergänzt worden; je länger man hinschaute, desto mehr Skulpturfragmente entdeckte man, eine Hand, ein Eierstabrelief, ein halbes in makelloser Capitalis eingemeißeltes Wort. Gegenüber der Durchfahrt lag ein flaches Gebäude, in dem sich offenbar eine Steinmetzwerkstatt befand: zwei breite verschlossene Holztore und davor ein Granitblock, auf dem ein Hammer und mehrere Meißel herumlagen, umgeben von einem bunten Gesprenkel aus Steinsplittern. Rechter Hand wurde der Hof durch ein größeres dreistöckiges Haus abgeschlossen, vor das ein auf zwei ungleiche Säulen mit nachträglich aufgesetzten Kapitellen gestützter Altan gestellt war. Ein Spalier von Blumenkübeln verriet, dass sich darüber eine Terrasse befand.
Mercuria blieb stehen und wies in die Runde. «Bitte sehr», sagte sie mit einem strahlenden Lächeln.
«Alles deins?», fragte ich.
«Alles meins, bis auf das Vorderhaus. Marcello, der alte Raffzahn, will nicht verkaufen. Ich habe schon überlegt, ob ich ihm nicht einfach ein paar Schläger vorbeischicken soll.»
Ich nahm nicht an, dass die letzte Bemerkung ernst gemeint war, obwohl Mercuria keine Miene dabei verzog.
«Du kannst dir nicht vorstellen, wie das hier vorher ausgesehen hat. Alles verfallen und heruntergekommen. Das waren zwei Jahre Arbeit. Nachdem die Ratten ausgeräuchert waren, habe ich zehn Karren Dreck aus den Kellern geholt. Dann habe ich die Wände abgestützt und ausgebessert, die Kamine aufgemauert, die Balken ausgetauscht, die Zwischengeschosse eingezogen, die Dächer gedeckt und den Hof gepflastert.»
Sie sprach, als hätte sie alle diese Arbeiten selbst erledigt. Natürlich hatte sie das nicht, aber die Art, wie sie darüber redete, sagte viel über sie aus: Sie war stolz darauf, auf niemanden angewiesen zu sein und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Erst viel später, als ich ihr Geheimnis kannte, begriff ich, dass sie sich in dieses Vorhaben auch deshalb gestürzt hatte, weil sie nur so ihre Untätigkeit in einer anderen Sache ertragen konnte.
Sie wies auf den Altan. «Die Säulen hat Pirro von der Bauhütte abgezweigt. Du glaubst gar nicht, was sie da alles in die Fundamentgruben kippen.»
Es war nicht zu überhören, dass sie den Namen fallengelassen hatte, um mir zu zeigen, mit wem sie so verkehrte: Sie meinte nicht irgendeine Bauhütte, sondern die des Petersdoms, und Pirro war nicht irgendein Maurermeister, sondern Pirro Ligorio, der große Architekt. Trotz ihrer Selbstsicherheit hatte Mercuria gelegentlich das Bedürfnis zu demonstrieren, dass ihr in dieser Gesellschaft, die in den letzten Jahren mehr und mehr auf Distanz zu ihresgleichen ging, immer noch der verdiente Respekt entgegengebracht wurde.
«Gefällt es dir?»
«Und wie.»
Mercuria wies auf ein schmales Häuschen zur Linken: «Das da steht leer. Wenn du willst, kannst du gleich einziehen.»
Ich war sprachlos. Ein warmes Gefühl durchströmte mich beim Anblick dieses wunderschönen Innenhofes, über dessen Dächern der Palazzo Farnese in der Abendsonne glühte. Ich spürte, wie dringend ich Heilung brauchte, und ich ahnte, dass ich sie hier finden würde. Mein Onkel war trotz seiner herben Art das Fundament und der Kompass meines Lebens gewesen, auch wenn ich erst nach seinem Tod zu ahnen begonnen hatte, was ich ihm bedeutet und mit welcher Redlichkeit er mich auf den richtigen Weg zu bringen versucht hatte. In den vergangenen drei Jahren hatte ich mich schlingernd durch mein Dasein bewegt wie ein Rad mit einer Unwucht. Und jetzt hatte ich plötzlich das Gefühl, behutsam auszurollen. Es war wie ein Wunder, und Mercuria verstand das. Sie wusste, was es hieß, Heilung zu suchen, auch wenn ich das damals noch nicht ahnen konnte.
Und darum machte sie auch nicht mehr viele Worte, sondern ging voraus, die Gazette immer noch in der Hand. Sie schloss das kleine Haus auf, ließ mich eintreten und zog sich zurück, damit ich mich in aller Ruhe mit den Räumen vertraut machen konnte, die in diesem Augenblick mein Zuhause wurden, ohne dass dafür weitere Erklärungen erforderlich waren.
Das Haus war winzig. Es bestand aus zwei übereinanderliegenden Zimmern, die im hinteren Bereich über eine Treppe verbunden waren. Unter der Treppe verbarg sich eine kleine Tür, die zu einem Hinterhof mit Holzlager führte. An der Längsseite des unteren Raumes befand sich ein Kamin, dessen Schacht nach oben durchgemauert war, um die Wärme des Feuers auch in den oberen Raum abzugeben. Die Wände waren ockerfarben verputzt, der Boden bestand unten aus festgestampfter Erde, oben aus frisch abgehobelten Holzdielen. Unten standen ein Tisch, ein paar Schemel und eine Truhe, oben ein Bett und ein kleines Schränkchen.
«Die Möbel kannst du übernehmen, wenn du willst!», rief Mercuria von draußen, als hätte sie durch die Wand gesehen, was ich gerade betrachtete.
Ich blickte aus dem Fenster. Da stand sie, weiß und strahlend, zwischen den Säulen ihres Altans.
«Vielleicht verlegt Gennaro dir unten ein paar schöne Steinplatten», fügte sie hinzu. Und wie um dieses Vorhaben gleich in die Tat umsetzen zu lassen, trat sie an eins der breiten Holztore und schlug ein paarmal mit der Faust dagegen.
«Gennaro! Meinst du nicht, du könntest deinen Hintern mal langsam aus dem Bett wuchten?»
Als Antwort kam mit kurzer Verzögerung ein dumpfer Schlag, als hätte jemand etwas Schweres von innen gegen die Tür geworfen. Dann rührte sich nichts mehr.
«Ja?», fragte Mercuria, als ich wieder vor ihr stand.
«Ja», sagte ich feierlich.
Ich kann kaum beschreiben, wie glücklich ich war, als wir uns kurz darauf bei ihr gegenübersaßen, jeder mit einem kleinen Glas vor sich. Im Kamin brannte ein Feuer, die Fenster zum Innenhof und die Tür zum Altan waren geöffnet, um das letzte Tageslicht hereinzulassen. Alles in diesem Zimmer war kostbar: Der Tisch mit den Intarsien, der dazu passende Sekretär, die Stofftapeten, die Kristallkaraffe mit dem funkelnden Wein, die hüfthohe Marmorstatue eines nackten Fackelträgers in einer Ecke. An den Wänden hingen Gemälde, ein paar Votivbilder, dazu ein halbes Dutzend Porträts von Männern, allesamt hervorragend ausgeführt nach der Manier Raffaels und Sebastiano del Piombos. Während ich die Bilder betrachtete, betrachtete Mercuria mich.