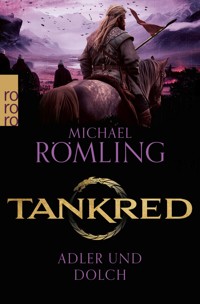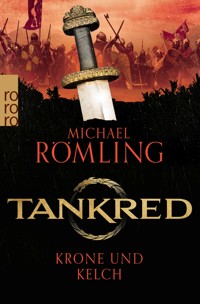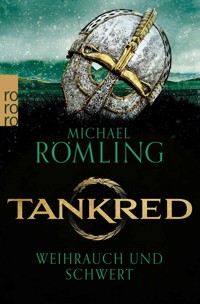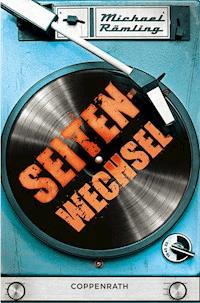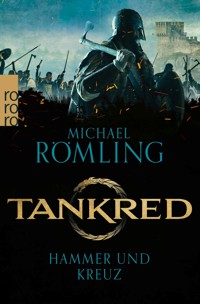
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Im Kampf gegen die Wikinger
- Sprache: Deutsch
Kämpfe und Abenteuer, Machtspiele und Intrigen, Liebe und Rache: die Wikinger an Rhein und Maas. Juli 882: Tankred hat noch eine Rechnung offen. Seine Stiefmutter Uta hat ihn vor Jahren um sein Erbe betrogen. Um endlich zu seinem Recht zu kommen und Uta zu Fall zu bringen, braucht er mächtige Unterstützung. Doch die bekommt er nicht ohne Gegenleistung: Im Auftrag des Kaisers soll der gebildete Kämpfer in einen erbarmungslosen Krieg gegen die Normannen ziehen, die sich unweit seiner Heimatstadt Maastricht verschanzt haben. Zusammen mit seinen Mitstreitern wagt er sich in die Höhle des Löwen und steht dabei plötzlich einem alten Widersacher gegenüber. Band 2 der spannenden Reihe um den Bibliothekar Tankred, der mit dem Schwert in der Hand gegen Wikinger, Intrigen und die Geister seiner Vergangenheit kämpft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Michael Römling
Tankred: Hammer und Kreuz
Historischer Roman
Über dieses Buch
Eine unbezwingbare Festung und ein Mann mit einem kühnen Plan.
Juli 882: Tankred hat noch eine Rechnung offen. Seine Stiefmutter Uta hat ihn vor Jahren um sein Erbe betrogen. Um endlich zu seinem Recht zu kommen und Uta zu Fall zu bringen, braucht er mächtige Unterstützung. Doch die bekommt er nicht ohne Gegenleistung: Im Auftrag des Kaisers soll der gebildete Kämpfer in einen erbarmungslosen Krieg gegen die Normannen ziehen, die sich unweit seiner Heimatstadt Maastricht verschanzt haben. Zusammen mit seinen Mitstreitern wagt er sich in die Höhle des Löwen und steht dabei plötzlich einem alten Widersacher gegenüber.
Band 2 der spannenden Reihe um den Bibliothekar Tankred, der mit dem Schwert in der Hand gegen Wikinger, Intrigen und die Geister seiner Vergangenheit kämpft.
Vita
Michael Römling, geboren 1973 in Soest, studierte Geschichte in Göttingen, Besançon und Rom, wo er acht Jahre lang lebte. Nach der Promotion gründete er einen Buchverlag, schrieb zahlreiche stadtgeschichtliche Werke und historische Romane. Nach «Weihrauch und Schwert» ist «Hammer und Kreuz» der zweite Band der historischen Abenteuerserie um den Kämpfer und Bibliothekar Tankred aus dem 9. Jahrhundert. Darüber hinaus sind im Rowohlt Taschenbuch Verlag die Romane «Pandolfo» und «Mercuria» erschienen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg Copyright © 2023 by Michael Römling
Redaktion Susann Rehlein
Copyright Karte Peter Palm, Berlin
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Collaboration JS/Arcangel; iStock; Hauptmann & Kompanie
ISBN 978-3-644-01199-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Es dämmerte schon, als das Dorf in Sicht kam. Eigentlich war es eher eine Ansammlung armseliger Katen, in denen wahrscheinlich Fischer, Handwerker und Tagelöhner ihr Dasein fristeten. Es gab keine Kirche und keinen Haupthof, und nicht eines der Gebäude hatte ein Steinfundament; noch nicht einmal Schornsteine waren zu sehen. Die Hütten standen kreuz und quer durcheinander. Sie waren aus schiefen Pfosten, Balken und Brettern zusammengezimmert, und die flachen Dächer waren mit Schindeln aus Baumrinde gedeckt. Rauch von feuchtem Brennholz quoll aus Löchern und Ritzen. Überall waren halb vermoderte Boote aufgebockt.
Weiter würden wir an diesem Tag nicht kommen. Eine unbequeme Nacht stand bevor.
«Ist dir nicht gut genug, was?», fragte Bodo, der meinen Blick bemerkt hatte. Er stemmte sich gegen das Ruder, um den Frachtprahm näher ans Ufer zu bringen. Die beiden Ochsen vor uns auf dem Treidelpfad trotteten unbeeindruckt weiter hinter Severin her. Das Seil, das von den Jochen der Tiere zum Bug des Prahms führte, spannte und lockerte sich abwechselnd, hob sich triefend aus dem Wasser und tauchte wieder ein.
«Wird wohl gehen», sagte ich mürrisch. «Ist ja nur für eine Nacht.»
Ich hockte auf einer Ladung Bauholz, die Bodo rheinaufwärts verschiffte. Hinter mir stand mein Pferd, zitternd, die Ohren angelegt, den linken Vorderhuf auf die Spitze gestützt. Kleine Wellen prallten plätschernd gegen den Rumpf.
Bodo hatte ich am Vormittag zufällig kennengelernt. Sleipnir hatte auf der Uferstraße plötzlich zu lahmen begonnen, und ich war abgesessen, um den Huf zu untersuchen. Während ich schwitzend und in verrenkter Haltung versucht hatte, die Stelle zu ertasten, die man aufschneiden musste, ohne dass das Pferd mir vor Schmerzen durchging, hatten plötzlich die beiden Ochsen mit dem Treiber neben mir gestanden, alle drei mit gleich stumpfem Gesichtsausdruck. Dahinter Bodo in seinem Prahm, der mit einem schrammenden Geräusch auf dem Uferkies zum Stehen kam.
Freundlicherweise hatten Bodo und Severin dann das Pferd festgehalten, während ich das Geschwür aufgeschnitten und die Wunde mit Wolle verstopft hatte. Mir war klar gewesen, dass mindestens zwei Tage lang nicht an eine Fortsetzung der Reise zu denken sein würde, jedenfalls nicht im Sattel. Also hatte ich Bodo gefragt, ob an Bord noch Platz sei.
«Wohin soll’s denn gehen?», hatte er gefragt.
«Nach Worms», hatte ich geantwortet.
Er hatte mich überrascht angeblickt, ein altes, faltiges, von struppigen Haaren eingerahmtes Gesicht, wässerige Augen, Tränensäcke wie schlaffe Lederbeutel. «Oho, Worms. Zum Kaiser. Gehörst du zum Aufgebot?»
«Ja», hatte ich knapp erwidert. Streng genommen gehörte ich zu keinem Aufgebot, aber ich musste den Kaiser treffen, und ich hatte keine Lust gehabt, Bodo die ganze Geschichte zu erzählen, also hatte ich es dabei belassen. Es hatte eine Weile gedauert, bis wir das lahme Pferd auf den Prahm bugsiert hatten, aber schließlich war es gelungen. Bodo hatte sofort begonnen, mich auszufragen, und auf dem beengten Raum hatte es kein Entkommen gegeben. Nachdem er herausgefunden hatte, dass ich mich in Fragen des Bußsakraments auskannte, hatte er mir zu entlocken versucht, wie man die Fastengebote umgehen konnte. Ob Schweineschmalz unter das Verbot des Fleischverzehrs falle? Ob er in dieser Zeit wenigstens die Magd besteigen dürfe, wenn schon nicht seine Frau? Mit solchen Fragen war er mir den ganzen Tag über auf die Nerven gegangen. Das war der Preis dafür gewesen, dass er mich mitgenommen hatte.
Und jetzt also das Dorf. Bodo kannte dort jemanden, bei dem wir gegen geringe Bezahlung ein Nachtlager finden würden, und weil es weit und breit keine Herberge gab und wir die Reise im Dunkeln nicht fortsetzen konnten, hatten wir keine Wahl. Als der Prahm aufsetzte, rannten ein paar zerlumpte Kinder ans Ufer und begrüßten uns mit aufgeregtem Geschnatter. Während Bodo sein Gefährt vertäute, führte ich das Pferd von Bord und ließ es saufen.
Unser Gastgeber war ein wortkarger junger Fischer namens Sebastian, der im Gegensatz zu Bodo keine Fragen stellte. Er war hager und unrasiert und trat unbehaglich von einem Bein auf das andere. Bodo erklärte ihm, dass heute ein Strohsack mehr gebraucht würde als sonst, und ich zählte dem Fischer unaufgefordert ein paar Münzen in die Hand. Er schien keine Familie zu haben, jedenfalls lebte er allein in seiner Hütte, an deren Wänden sich Netze, Seile und eingeklappte Gestelle zum Trocknen von Fischen stapelten.
Die Feuerstelle hatte keinen Abzug. Immerhin servierte Sebastian uns frische Forellen, die wegen des dichten Qualms mehr geräuchert als gebraten waren. Während wir aßen, schwadronierte Bodo weiter über Fastengebote und gab Sebastian ungefragt Ratschläge, die er sich aus meinen Angaben zusammengesponnen hatte. Da der junge Fischer weder die Wahl zwischen Fleisch und Schmalz noch zwischen Ehefrau und Magd zu haben schien, ließ er den Wortschwall mit abwesendem Gesicht über sich ergehen. Nur Severin warf ab und zu ein paar Fragen ein, die verrieten, dass er genauso wenig von der Materie begriffen hatte wie der Kahnführer.
Nach dem Essen legten wir uns hin. Bodo begann unverzüglich, zufrieden zu schnarchen, Severin warf sich raschelnd hin und her, und Sebastian gab keinen Laut von sich. Ich starrte vor mich hin und versuchte auszurechnen, wie lange ich bei diesem Tempo bis nach Worms brauchen würde. Wir befanden uns irgendwo zwischen Koblenz und Mainz, wo Bodo seine Fracht löschen würde, um anschließend die Rückfahrt flussabwärts anzutreten. Ich würde mir also eine neue Mitfahrgelegenheit suchen oder tatenlos darauf warten müssen, dass das Pferd nicht mehr lahmte. Über diesen Gedanken schlief ich ein.
Als ich aufwachte, wusste ich nicht, ob Minuten oder Stunden vergangen waren.
Etwas hatte mich geweckt.
Ich hob den Kopf und spähte in die Dunkelheit. Die Ritzen in den Fensterläden und im Dach der Hütte hoben sich als dunkelgraue Streifen vor der Schwärze der Wände ab. Vom Feuer war bis auf ein winziges Glutnest unter der Asche nichts geblieben. Ich lauschte. Und obwohl nichts zu hören war, war ich sicher, dass dort draußen etwas im Gange war. Es gibt zwei verschiedene Arten von Stille: eine natürliche Abwesenheit von Geräuschen und eine unnatürliche. Den Unterschied kann man nicht hören, aber man ahnt ihn: Tiere hören auf zu rascheln, weil sie wittern, dass sich etwas nähert. Ein Fensterladen, der die ganze Zeit im Wind geknarrt hat, steht plötzlich still. Menschen halten im Halbschlaf den Atem an und horchen.
Und dann war da doch etwas: ein leises Knirschen in der Ferne. Ich erkannte es sofort: das Geräusch eines Schiffsrumpfes, der über Kies schrammt.
Von einem Augenblick zum anderen war ich hellwach. Dieses Knirschen kannte ich nur zu gut, seit ich zu Anfang des Jahres Bekanntschaft mit den Dänen gemacht hatte. Aber war es möglich, dass sie sich so weit nach Süden vorwagten? Bisher waren sie nicht über Koblenz hinausgekommen, und seit der Schlacht von Remich waren sie geschwächt. Alle Kundschafter hatten berichtet, dass sie sich in die Festung Asselt an der Maas zurückgezogen hatten und nur noch weit im Norden raubten und brandschatzten. Hatte ich mich verhört? Oder war das vielleicht bloß einer der Männer aus dem Dorf, der von einem nächtlichen Fischzug zurückkehrte?
Ich setzte mich auf und lauschte. Es war still. Zu still. Kein Vogel, kein Atmen, kein Fensterladen.
Ich schlug die Decke zurück, erhob mich, griff mir mein Schwert und tastete mich zur Tür. Ohne ein Geräusch ließ sie sich öffnen. Ein kühler Hauch wehte herein. Auf einem der anderen Strohlager grunzte jemand und wälzte sich herum.
Ich trat ins Freie. Der Rhein glänzte glatt und dunkelgrau im schwachen Mondlicht, das von irgendwoher durch die Wolken drang. Davor zeichnete sich die Silhouette meines Pferdes ab, das ich vor der Hütte angepflockt hatte. Sleipnir schlief nicht. Er stand da wie ein Standbild, den linken Vorderhuf angehoben, die Ohren gespitzt. Irgendwo in der Dunkelheit knarrte das Seil, mit dem Severin die Ochsen an einen Baum gebunden hatte.
Sebastians Hütte stand am Rand der winzigen Siedlung, zwanzig Schritte weiter nördlich reichte ein kleines Gehölz fast bis ans Ufer und verdeckte die Sicht. Ich schlich zwischen die Sträucher, kniete mich hin und spähte über den Strand.
Und dann sah ich sie.
Hundert Schritte flussabwärts, halb verdeckt von Bodos Frachtprahm, lag tatsächlich ein Boot auf dem Strand, größer als die Kähne der Fischer und mit hohen Steven. Ein dänisches Boot. Durch das Geäst sah ich ein Dutzend Gestalten, die sich schleichend in einer lang gezogenen Kette voranbewegten. Während die ersten schon zwischen den Bäumen verschwanden, stiegen die letzten gerade über die Bordwand. Sie traten so leise auf, dass der Kies unter ihren Füßen kaum hörbar klickerte. Alle waren bewaffnet, einige trugen Schwerter, die meisten hatten Äxte in den Händen.
Dänen. Ganz offensichtlich wollten sie das Dorf umrunden und von der Landseite her angreifen, um niemanden in den Wald entkommen zu lassen.
Ohne noch einen Augenblick zu zögern, sprang ich auf, riss das Schwert aus der Scheide und rannte zurück zum Dorf, immerfort brüllend: «Die Dänen kommen! Bringt euch in Sicherheit! Die Dänen!»
Sofort erhob sich in den Hütten ein großes Geschrei. Fensterläden und Türen wurden polternd aufgerissen, Gestalten rannten ins Freie. Einer hatte in aller Eile eine Fackel entzündet, deren Licht die Schatten an den Holzwänden tanzen ließ und die entsetzten Gesichter von Männern, Frauen und Kindern beleuchtete, die sich gehetzt umsahen und dabei gellend durcheinanderschrien. Einige riefen die Muttergottes an, andere stießen wütende und ängstliche Flüche aus. Eine zweite Fackel erschien.
«Von wo?»
«Wie viele?»
«Bleibt zusammen!»
Auch die Tür des Hauses von Sebastian wurde aufgerissen. Drei Gestalten stolperten ins Freie: Sebastian, der ein Zimmermannsbeil umklammert hielt, rannte zu den anderen Dorfbewohnern; Bodo und Severin liefen in Richtung Flussufer, wahrscheinlich um sich zwischen den Bauhölzern auf dem Prahm zu verstecken. Wenn die Dänen den Prahm durchsuchten, nachdem sie mit dem Dorf fertig waren, würden die beiden dort in der Falle sitzen.
«Sie sind im Wald!», schrie ich. «Lauft ihnen nicht in die Arme! Rennt am Ufer flussaufwärts!»
Einige liefen tatsächlich los, darunter einer der Fackelträger, doch sie kamen nicht weit, denn im tanzenden Feuerschein erschienen nun die Schemen von zwei mit Äxten bewaffneten Angreifern, die das Dorf schon umrundet hatten und den Fliehenden den Weg abschnitten, also machten sie kehrt und schlossen sich mit den anderen zu einem wogenden Pulk zusammen. Ein paar Augenblicke später standen um die dreißig Menschen in der Mitte des Dorfes zusammengedrängt, die Frauen und Kinder in der Mitte, außen die Männer, bewaffnet mit Knüppeln, Sensen, Beilen, Messern und Holzstangen; drei oder vier von ihnen hielten Schilde mit rostigen Buckeln in den Händen, die sie vielleicht nach irgendeinem Kriegszug aufbewahrt hatten. Schulter an Schulter standen sie schwankend da wie eine lebende Festungsmauer, zusammengehalten nur von ihrer Todesangst und von der Entschlossenheit, ihr Leben möglichst teuer zu verkaufen. Immer noch wurde geschrien und gebetet.
Ich sprang auf ein Holzgestell, das vor Sebastians Hütte stand, war mit einem Satz auf dem Dach und versuchte, einen Überblick zu gewinnen. Die beiden Dänen näherten sich vom Ufer aus dem Dorf, zögerten aber noch, schienen zu warten, dass die anderen auftauchten. Trotz der erbärmlichen Bewaffnung ihrer Gegner trauten sie sich nicht an die rund fünfzehn Männer heran, die mit dem Mut der Verzweiflung ihre Waffen schwangen.
Und dann kamen die anderen. Zwischen den Häusern erschienen ihre Silhouetten, Klingen blitzten im Fackellicht auf, doch abgesehen von den Waffen waren sie schlecht auf einen Kampf vorbereitet: Keiner trug Kettenhemd oder Helm, noch nicht einmal ein Lederpanzer war zu sehen. Sie schienen überhaupt nicht mit Gegenwehr gerechnet zu haben.
Ich kauerte mich hin, um nicht gesehen zu werden. Meine Hand ertastete ein Netz, das Sebastian wahrscheinlich zum Trocknen auf dem Dach ausgelegt hatte. Die Dänen rückten langsam weiter vor, bis sie einen Kreis um die Gruppe der schreienden Dorfbewohner gebildet hatten, doch sie stürmten immer noch nicht vor. Blicke flogen hin und her, vielleicht fürchteten sie, dass in den Hütten weitere Männer verborgen waren, die sich von hinten auf sie stürzen würden. Ohne die Dorfbewohner aus den Augen zu lassen, rissen sie Türen auf und warfen kurze Blicke in die Dunkelheit.
Und dann hörte ich plötzlich Schritte direkt unter mir. Ich lugte über den Rand des Daches und sah zwei Dänen mit erhobenen Äxten. Einer spähte um die Hausecke, der andere schob die Tür auf und blickte ins Haus, dann schloss er zu dem an der Ecke auf. In diesem Augenblick kam mir eine Idee. Ich legte das Schwert aus der Hand, packte das Fischernetz und warf es von oben über die beiden. Noch ehe sie wussten, wie ihnen geschah, waren sie gefangen. Mit einem halb überraschten und halb wütenden Aufschrei grapschten sie nach den Maschen und begannen, wild daran herumzureißen, um sich zu befreien, doch sie bewirkten damit nur das Gegenteil: Sie verstrickten sich noch weiter, einer stolperte, fiel hin und riss den anderen mit, ich schnappte mir das Schwert, sprang vom Dach und landete direkt neben ihnen. Es war nur ein Netz aus dünnen Flachskordeln, das sie leicht hätten zerreißen können, wenn sie nicht so kopflos herumgefuchtelt hätten, doch mein plötzliches Erscheinen versetzte sie gänzlich in Panik; sie konnten weder ausholen noch zupacken noch zurückweichen. Ich stieß zweimal zu. Meine Klinge fand kaum Widerstand, sie brüllten auf und brachen röchelnd zusammen.
Natürlich hatte das Gebrüll sofort die anderen auf mich aufmerksam gemacht. Köpfe flogen herum, fassungslose Blicke trafen mich; zwei der Angreifer, die mir am nächsten standen, lösten sich aus dem Kreis, der die Dorfbewohner umringt hatte, und stürzten auf mich zu. Einer von ihnen schleuderte seine Axt, ein gut gezielter Wurf, aber ich sah ihn kommen und duckte mich, sodass die Klinge knapp über meinen Kopf hinwegsauste und in der Bretterwand der Fischerhütte stecken blieb. Der andere stürmte weiter voran, holte dabei aber mit seinem Schwert zu weit aus, sodass ich rechtzeitig beiseitespringen konnte. Der Schwung riss ihn mit, er strauchelte; ehe er sein Gleichgewicht wiederfand, stieß ich ihm meine Klinge in den Oberschenkel, und er ging mit einem Aufschrei zu Boden. Der andere wich ein paar Schritte zurück und blickte sich nach einer neuen Waffe um, fand keine, wollte aber auch nicht aufgeben. Ein paar Augenblicke lang stand er mir breitbeinig lauernd und keuchend gegenüber. Zwei weitere Dänen lösten sich aus dem Kreis, sodass nur noch ein gutes halbes Dutzend übrig war, um die Dorfbewohner in Schach zu halten. Wieder gingen sie zu zweit auf mich los, einer von rechts und einer von links, und es wäre wohl eng geworden, wenn nicht Bodo in diesem Moment wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht und mir zur Seite gesprungen wäre. Ich konnte kaum glauben, was ich sah: Der alte Kahnführer, der an Bord seines Prahms so unbeweglich und bequem gewirkt hatte, schwang einen riesigen Hammer, und man sah sofort, dass er damit umgehen konnte. Er schlug dem rechten der beiden Dänen die Axt aus der Hand wie ein Spielzeug, der Hammer zog einen Kreis über Bodos Kopf, gewann dabei noch mehr Wucht und schlug einen Wimpernschlag später im Schädel des Angreifers ein, der mit einem Geräusch zerbarst, das an das Brechen von feuchtem Holz erinnerte. Sein Körper flog gegen seinen Nebenmann, der zur Seite taumelte, woraufhin ich ihm einen Tritt in den Bauch verpasste, sodass er auf den Rücken fiel, dann war ich über ihm und stieß ihm mein Schwert mit solcher Wucht durch die Brust, dass es im Boden stecken blieb.
Alles war so schnell gegangen, dass die anderen Dänen keine Zeit gehabt hatten, sich zu verständigen. Und es kam noch schlimmer für sie: Zwei Männer aus dem Dorf, die sich irgendwo versteckt gehalten hatten, waren unbemerkt auf das Dach einer Hütte gestiegen und deckten die Dänen mit einem Hagel aus Steinen ein, die zur Beschwerung der Bedeckung aus Baumrinde dort oben gelegen hatten. Einer wurde am Kopf getroffen und ging zu Boden; die anderen, die im ersten Augenblick überhaupt nicht begriffen, aus welcher Richtung die Steine angeflogen kamen, wichen mit eingezogenen Köpfen zurück. Die plötzliche Wendung des Kampfes machte den anderen Männern aus dem Dorf Mut, sie lösten ihre Formation auf und gingen zu zweit und zu dritt auf die Dänen los. Bodo und ich stürmten ebenfalls los, doch noch ehe wir das Kampfgetümmel erreicht hatten, gaben die Dänen auf. Mit wütendem Geschrei rannte das verbliebene halbe Dutzend in den Wald zurück. Ich überlegte kurz, ob ich ein paar Männer zusammenrufen sollte, um sie zu verfolgen, verzichtete aber darauf. Es lohnte sich nicht, sich in Gefahr zu bringen. Die Dänen würden ihr Boot ins Wasser schieben und mit der Strömung davonfahren.
Bodo stand neben mir, entspannt auf seinen Hammer gestützt, und beobachtete die Dorfbewohner, die sich aufgeregt in kleinen Gruppen zusammengefunden hatten. Einige der Männer waren auf die Dächer der Hütten gestiegen und spähten angestrengt in die Dunkelheit, andere sammelten die Schwerter und Äxte der Dänen auf und prüften die Klingen. Frauen trösteten weinende Kinder. Weitere Fackeln wurden entzündet, und der gelbliche Lichtkreis schob sich weiter zwischen die Hütten.
«Immer gut, wenn man einen Hammer dabeihat», sagte Bodo und streichelte den Stiel seines Werkzeugs.
«Immer gut, wenn man ihn auch zu benutzen weiß», antwortete ich mit einem Blick auf den eingeschlagenen Schädel des Dänen, den er damit erwischt hatte.
«Was denkst du denn?», sagte Bodo mit zufriedenem Lächeln. «Ich war schon bei Fontenoy dabei.»
«Das ist vierzig Jahre her.»
«Die Arbeit hält einen bei Kräften.»
«Bei Fontenoy wurde mein Vater verwundet», sagte ich, und im nächsten Augenblick bereute ich es auch schon. Wahrscheinlich würde er mich jetzt für den Rest der Nacht über meine Familiengeschichte ausfragen.
«Wie hieß denn dein Vater?»
«Thegan.»
Er zog eine Augenbraue hoch. «Graf Thegan? Aus dem Maasgau?»
Ich nickte.
«Dann bist du der Tankred?»
Wieder nickte ich.
«Hatten sie dich nicht ins Kloster gesteckt?»
Ich nickte ein drittes Mal.
«Donnerwetter», sagte Bodo mit einem Blick auf mein Schwert. «Hast offenbar nichts verlernt über den Büchern. Du kämpfst genau wie dein Vater.»
Tja, dachte ich. Und das ist auch schon alles, was wir gemeinsam haben.
2
Worms platzte aus allen Nähten. So viele Menschen auf einmal hatte ich zuletzt einen Monat zuvor auf dem Schlachtfeld von Remich gesehen, doch damals hatten sie brüllend aufeinander eingeschlagen, und der Boden war von Toten und Verwundeten übersät gewesen. An diesem Tag aber standen gut zweitausend Leute friedlich beisammen und warteten auf den Kaiser.
Ich stand an einem der Fenster des Bischofspalastes und blickte auf den rechteckigen Platz hinab, der sich zwischen dem Palast, dem Dom und der königlichen Pfalz erstreckte, auf das bunte Meer von Mützen, Kappen, Hauben, Schleiern und unbedeckten Köpfen. Männer und Frauen standen zusammengedrängt wie eine Schafherde vor dem Spalier der Bewaffneten an der Treppe zum Eingang der Pfalz. Einige besonders vorwitzige Zuschauer waren auf die Baugerüste und sogar auf das offene Dachgebälk des Doms geklettert, der nach einem Blitzeinschlag vor zehn Jahren abgebrannt und inzwischen zumindest als Rohbau wiederhergestellt worden war.
Alle wollten sie den Mann sehen, der in diesem Augenblick im großen Saal der Pfalz die Huldigungseide der Herren des Ostfrankenreiches entgegennahm. Karl, Urenkel des großen gleichnamigen Kaisers, dem nach einer Reihe von Todesfällen ein riesiges Erbe zugefallen war: zuerst das bescheidene alemannische Teilreich, dann Italien und die Kaiserkrone und nun auch noch ganz Ostfranken, das zudem Bayern, Thüringen, Sachsen und Lotharingien einschloss. Damit reichte seine Herrschaft vom Apennin bis an die Nordseeküste, von der Elbe bis an die Maas und von der Donau bis an die Schelde. Entsprechend groß waren die Hoffnungen, die auf ihm ruhten.
Es war ein warmer Maitag. Die Luft war klar, und kleine vereinzelte Wolken hingen am Himmel. Die ganze Stadt hatte sich für den großen Tag herausgeputzt: Die Straßen waren von Mist und Abfällen gereinigt und sauber gefegt worden, die Fenster waren mit Mistelzweigen und Blumengirlanden geschmückt, und in den Wänden steckten Fackeln für das abendliche Fest.
Die Kämpfe und Verwüstungen der letzten Zeit hatten hier keine Spuren hinterlassen. Die dänischen Flotten, die seit einigen Jahren an den Küsten und zwischen den Oberläufen der großen Flüsse ganze Landstriche terrorisierten, waren nicht über Koblenz hinausgekommen, sodass die Gegend um Worms keinen Schaden genommen hatte. Nur die vielen in der Stadt und auf den Dörfern einquartierten Flüchtlinge zeugten davon, dass sie weiter im Norden immer noch wüteten. Unzählige Menschen waren heimatlos geworden und zogen durch das Land – auf der Suche nach einer Unterkunft und in der Hoffnung, eines Tages nach Hause zurückkehren und ihre abgebrannten Häuser wieder aufbauen zu können.
Obwohl Worms vorerst verschont worden war, wappnete man sich auch hier. Als ich am Tag zuvor angekommen war, um meinem Leben hier eine neue Wendung zu geben, hatte ich gesehen, wie die römische Stadtmauer instand gesetzt und die verschütteten und zugewucherten Gräben neu ausgehoben und freigeschaufelt wurden. Die Türme waren mit Bewaffneten besetzt, die Tore streng bewacht, als fürchtete man einen Überraschungsangriff. Nach der Schlacht von Remich hatten die Dänen sich zwar nach Asselt zurückgezogen, aber sie würden zurückkehren – es sei denn, es gelänge, sie auch von dort zu vertreiben. Genau das erwartete man jetzt vom neuen Herrscher. Der Krieg würde weitergehen.
Ich konnte ein Lied von diesem Krieg singen: Monatelang hatte ich mich mit den Dänen herumgeschlagen. Im Januar war ich ihnen beim Überfall auf das Kloster Prüm in letzter Minute entkommen, dann hatte Ivar Forstyrret, einer ihrer Anführer, meine Schwester Judith aus Aachen verschleppt. Ich hatte ihn und seine Leute bis zum Rhein verfolgt und die Mauern von Koblenz gegen sie verteidigt. Danach war ich ihrer Spur an der Mosel gefolgt und hatte mitansehen müssen, wie sie Trier in Brand gesteckt hatten. Ich war ihnen im Gefolge des Trierer Erzbischofs Bertolf nachgejagt, hatte Ivar kurz darauf in der Schlacht von Remich getötet und Judith befreit. Kurz und gut: Mein Bedarf an Zerstörung und Gewalt war gedeckt.
Doch ich wusste, dass es weitergehen würde. Die Dänen würden wiederkommen, und ich würde nicht abseitsstehen können. Ich war hier, weil ich vom Kaiser einen Gefallen zu erbitten hatte, und den würde er mir wohl nicht ohne Gegenleistung gewähren.
«Was machen die Dänen, wenn sie ein Loch im Schiffsrumpf haben?», fragte Lupus, der neben mir am Fenster stand. Diese Art von Witzen hatten die Verteidiger von Koblenz erfunden, nachdem sie den Angriff der Dänen zurückgeschlagen hatten. Lupus und ich hatten dort Freundschaft geschlossen. Später hatten wir Seite an Seite bei Remich gekämpft. Er war flink und gewandt und durch nichts aus der Fassung zu bringen.
«Sie bohren noch ein Loch, damit das Wasser ablaufen kann», sagte ich.
Lupus wandte mir sein schmales Katzengesicht zu. «Den kanntest du schon.» Er dachte kurz nach, dann fiel ihm der nächste ein: «Wie viele Dänen braucht man, um einen Schafbock zu kastrieren?»
Ich versuchte, mir eine Horde dänischer Krieger beim Bändigen eines Bocks vorzustellen, aber bevor das Bild Gestalt annehmen konnte, geriet die Menge unten auf dem Platz in Bewegung. Das Gemurmel schwoll zu einem lauten Stimmengewirr an; alle reckten die Hälse, Rufe erklangen, Finger zeigten in Richtung der Pfalz.
Eine Gruppe von Männern war aus dem Portal auf den Treppenabsatz getreten: ein halbes Dutzend Soldaten mit Helmen und Kettenhemden, wahrscheinlich Leibwächter, dazu zwei Männer im Bischofsornat, einer davon mit Pallium, und einige prachtvoll gekleidete Herren in rot und blau leuchtenden Gewändern. Alle bis auf die Bischöfe trugen Schwerter, deren Beschläge in der Sonne aufblitzten.
Einen von ihnen kannte ich: Graf Ratwin, der die Verteidigung von Koblenz geleitet hatte. Ich hatte schon vermutet, dass er nach Worms gekommen war, aber ich hatte ihn noch nicht getroffen. Seine Anwesenheit auf der Treppe zeigte, dass er zum engeren Kreis um den Kaiser gehörte. Für mein Anliegen war das von Vorteil, denn zwischen Ratwin und mir war in den Wochen, in denen wir in Koblenz auf den Angriff der Dänen gewartet hatten, ein freundschaftliches Verhältnis entstanden. Einen Fürsprecher wie ihn konnte ich gut gebrauchen. Ich wusste nicht, wie lange der Kaiser in Worms bleiben würde, aber ich musste es schaffen, zu ihm vorgelassen zu werden, bevor er mit seinem Gefolge weiterzog. Mein ganzes weiteres Leben hing davon ab, wie er mein Anliegen aufnahm.
Zunächst aber war es der Palliumträger, der sich Gehör verschaffte. Er war groß und massig und überragte die anderen Männer auch ohne die glitzernde Mitra, die wie die Spitze eines Kirchturms auf seinem Kopf thronte. Es konnte sich nur um Erzbischof Liutbert von Mainz handeln, Erzkanzler und Erzkaplan von König Ludwig, dem verstorbenen Bruder des Kaisers, der diesem die ostfränkische Krone hinterlassen hatte.
Liutbert hob beide Hände und rief der Menge etwas zu. Das Stimmengewirr verebbte; Mützen, Kappen und Hauben wurden abgenommen, Kinder auf den Boden gestellt, dann fielen die ersten Zuschauer auf die Knie. Das allgemeine Niederknien, Nackenbeugen und Händefalten pflanzte sich durch die Reihen fort, und nach wenigen Augenblicken verharrte der ganze Platz schweigend und demütig in Erwartung des kaiserlichen Auftritts.
Liutbert stimmte das Tedeum an, und die Menge fiel ein.
Das Rundbogenfenster, an dem wir standen, befand sich an einem Gang, der die ganze Breite der Fassade im oberen Stockwerk des Bischofspalastes einnahm. Rechts und links von uns lagen weitere Fenster, hinter denen sich Zuschauer drängelten, zumeist gut genährte Geistliche in blütenweißen Feiertagsgewändern, aber auch ein paar festlich gekleidete Gäste und sogar Bedienstete des Bischofs in Schürzen und Kitteln. Kaum schallte der Gesang vom Platz herauf, sanken auch rechts und links von uns alle auf die Knie. Lupus und ich folgten ihrem Beispiel, um nicht hochmütig oder verstockt zu wirken. Dummerweise waren die Fenster so weit oben in die Wand eingelassen, dass man kniend nicht mehr sehen konnte, was unten passierte.
Als der Jubel aufbrandete, erhoben wir uns wieder. Es war wie in der Messe.
Und da stand er, der Kaiser.
Sein Gesicht war aus der Entfernung nicht zu erkennen, aber seine Gestalt überstrahlte die Bischöfe und Grafen, die um ihn herum standen, auf kaiserliche Weise. Er trug einen Purpurmantel mit Pelzborte, Stiefel mit goldenen Sporen und ein Schwert, dessen Scheide vor Edelsteinen glitzerte. Auf dem Kopf hatte er nicht die übliche Bügelkrone, sondern einen goldenen Lorbeerkranz nach der Art römischer Imperatoren. Wahrscheinlich hatte er diesen Brauch in Italien kennengelernt und übernommen, um seinen Vorrang vor den westfränkischen Königen zu unterstreichen. Ich sollte bald erfahren, wer dem Kaiser derlei Ideen einflüsterte.
Karl badete eine Weile im Jubel der Menge, die immer wieder seinen Namen rief und ihm ein langes Leben und glorreiche Siege wünschte. Womit das Thema genannt war, das allen auf den Nägeln brannte.
Nachdem der Kaiser mit einer Handbewegung Ruhe geboten hatte, hob er zu einer Ansprache an. Er hatte eine schwache Stimme, sodass seine ersten Sätze nur bruchstückhaft bei mir ankamen. Immerhin verstand ich, dass Karl seine kaiserlichen Vorfahren beschwor, an ihre Taten und Verdienste erinnerte und auf den göttlichen Auftrag verwies, die Gläubigen aufzurichten, die Ungläubigen zu bekehren und die Feinde der Christenheit zu bekämpfen, die derzeit an den Küsten und auf den Flüssen ihr Unwesen trieben.
Im Verlauf seiner Rede gewann er an Sicherheit und auch an Stimmkraft. Er habe, so fuhr er fort, aus allen Ländern seines Reiches die tapfersten Männer zusammengerufen. Just in diesen Tagen sammle sich ein Heer, wie die Welt es noch nicht gesehen habe.
Bei diesen Worten zog er sein Schwert und reckte es in die Luft. «Franken, Alemannen, Lotharingier, Bayern, Sachsen, Thüringer und Langobarden!», rief er über den Platz. «Wir werden die Nordmänner jagen, wo immer sie sich blicken lassen! Wir werden sie aufstöbern und ausräuchern, wo immer sie sich verstecken! Wir werden diese Teufel mit Gottes Hilfe in die Hölle zurückjagen, aus der sie gekommen sind!»
Die Formulierung kam mir bekannt vor. Genauso hatte der Anführer eines Bauernhaufens in Prüm sich ausgedrückt, bevor er mit seinen Leuten von den Dänen abgeschlachtet worden war.
Doch natürlich wollte die Menge genau solche Worte hören, und der Jubel auf dem Platz war unbeschreiblich. Als der Lärm sich endlich gelegt hatte, stimmte Liutbert das Kyrie Eleison an, und wieder sanken alle auf die Knie und fielen ein.
Nachdem der Kaiser und seine Getreuen sich zurückgezogen hatten, begann die Menge, sich zu verlaufen. Ein großes Schwatzen und Flanieren setzte ein. Aus einem Nebeneingang der Pfalz wurden Fässer auf den Platz gerollt. Bedienstete stellten Tische und Bänke auf. Feuerschalen wurden herangeschleppt, Holz aufgestapelt, Fackeln in Halterungen gesteckt. Gaukler errichteten ein Podest. Musikanten bliesen probeweise in ihre Flöten. Es sollte ein Fest werden, an das man sich noch lange erinnern würde. Und sicherlich würden die Leute für eine Nacht vergessen, welche Sorgen sie plagten. Doch am Ende würde der Kaiser sich daran messen lassen müssen, ob es ihm gelang, die Dänen aus dem Land zu vertreiben oder nicht.
Ein paar Stunden später saß ich mit Lupus an einem der langen Tische und trank Bier, das überall aus großen Fässern ausgegeben wurde. Die Sonne war untergegangen, und der Platz wurde von einem halben Dutzend Feuern und Fackeln erhellt. Hunderte von Menschen hatten sich eingefunden, um die Huldigung und damit die Hoffnung auf bessere Zeiten zu feiern. Wenn es gelang, die Dänen zu vertreiben, würden vielleicht endlich wieder Frieden und Sicherheit einkehren.
Die Stimmung war so ausgelassen, dass ich die Befürchtungen über meine Zukunft zwischenzeitlich vergaß. Lupus unterhielt unsere Tischnachbarn mit Dänenwitzen und schielte immer wieder nach einem der Mädchen, die die Humpen nachfüllten. Aus den Rufen der Männer war zu erfahren, dass sie Agatha hieß. Sie war keine besonders auffällige Schönheit; mit ihren aschblonden Haaren und dem eher kräftigen Körperbau sah sie aus wie eine robuste Bauerntochter, aber sie strahlte eine reizende Unverfrorenheit aus, hatte ein loses Mundwerk und schäkerte viel herum. Lupus war wohl nicht der Einzige, der sich Hoffnungen machte.
Bier und Wein flossen in Strömen.
Wir saßen direkt neben dem Podest, das in der Mitte des Platzes aufgebaut worden war. Ein Akrobat jonglierte mit Fackeln und ließ Teller an Stangen kreisen, die er auf allen möglichen Körperteilen balancierte. Ein Zauberkünstler zog lebende Hasen aus den Falten seines Umhangs und ließ sie wieder darin verschwinden, dann breitete er den Umhang aus, zeigte ihn von allen Seiten, knüllte ihn zusammen und warf ihn in die Luft, woraufhin eine weiße Taube daraus hervorflatterte. Es folgte eine Sängerin, die ein Lied über die Sehnsucht nach dem in der Ferne weilenden Geliebten vortrug.
Lupus, der inzwischen ziemlich betrunken war, blickte mich mitleidig an. «Sie fehlt dir, mein Freund.»
«Ja», sagte ich, obwohl ich wenig Lust hatte, mich mit dem betrunkenen Lupus über meine Sehnsüchte zu unterhalten, Freund hin, Freund her. Und überhaupt: Welche Sehnsüchte denn? Ich hatte im Lauf der letzten Monate so viele Menschen verloren, wiedergefunden und erneut zurückgelassen, dass man fast den Überblick verlieren konnte. Natürlich meinte er Fidis, meine Vertraute und Geliebte, die früher die dunkelsten Stunden meines Lebens mit mir geteilt hatte, dann verschwunden war und schließlich vor einem Monat in Trier plötzlich wieder vor mir gestanden hatte. Nach Judiths Befreiung hatte ich die beiden nach Aachen gebracht, damit meine Schwester sich von den Strapazen der monatelangen Gefangenschaft erholen konnte. Dort warteten sie nun auf mich, und natürlich fehlten mir beide, jede auf ihre Weise. Mir fehlte auch Wolfhelm, mein Vertrauter aus Prüm, von dem ich noch nicht einmal wusste, ob er noch lebte. Mir fehlte Folchar, mein Lehrer aus Aachen, ohne den ich ein anderer Mensch geworden wäre. Und mir fehlte Gauzbert, mein Reisebegleiter aus Inda, der beim Angriff der Dänen auf Koblenz schwer verwundet worden war und den ich hatte zurücklassen müssen, weil Judiths Rettung keinen Aufschub geduldet hatte. Ja, Fidis war von all diesen Menschen derjenige, der mir am meisten fehlte. Aber wenn mein Anliegen beim Kaiser kein Gehör fand, dann war es fraglich, ob ich sie überhaupt jemals wiedersehen würde. Denn wenn man es genau nahm, war ich ein entflohener Häftling. Und es gab durchaus Leute, die es genau nahmen.
Wenn in diesem Augenblick nicht der Bärenführer auf den Plan getreten wäre, wäre ich, angetrunken, wie ich war, wahrscheinlich für den Rest der Nacht in Schwermut versunken.
Während Lupus also nach tröstenden Worten suchte und ich trübe vor mich hin starrte, ging ein Raunen durch die Menge. Die Leute gerieten in Bewegung, ich sah eine Mischung aus Furcht und Bewunderung in den Gesichtern, und eine Gasse öffnete sich, an deren Ende ein merkwürdiges Paar im Licht des Feuerscheins auftauchte: ein etwas irre dreinblickender, vollständig in Leder gekleideter Kerl mit fettig glänzender Halbglatze, der einen Bären am Nasenring mit sich führte. Das Tier watschelte täppisch neben ihm her und blickte dabei scheu nach rechts und links. Obwohl der Bär nicht angriffslustig wirkte, war seine schiere Größe beeindruckend. Ein paar Zuschauer sprangen von den Bänken auf, und als die beiden das Podest erreicht hatten, bildete sich ein großer Kreis um sie herum. Die Gespräche verstummten.
Der Bärenführer breitete die Arme aus und drehte sich einmal im Kreis. Der Bär brummte ein paarmal verwirrt und ließ sich auf alle viere fallen.
«Männer und Frauen von Worms!», rief der Bärenführer.
«Und von Speyer!», schrie einer dazwischen.
«Und von Mainz!», kam es aus einer anderen Ecke.
«Ist ja gut jetzt», murmelte jemand.
«Männer und Frauen von Worms, Speyer und Mainz», wiederholte der Bärenführer bereitwillig und hob den Zeigefinger. «Vor euch steht Bruno, das beißwütige Biest aus dem bayerischen Bergland, gefangen und gezähmt von mir, Balduin, dem beharrlichen Bestienbezwinger aus Bamberg!»
«In Bayern gibt’s überhaupt keine Bären!», rief jemand von weiter hinten.
«Natürlich gibt’s da welche», widersprach jemand anders.
Balduin ließ sich nicht beirren. «Bruno kann singen, rechnen und tanzen!», versicherte er und schüttelte die Kette, dass sie klirrte.
So ging es eine Weile hin und her. Balduin pries die Fähigkeiten seines Bären an, die Zuschauer riefen ihm launige Bemerkungen zu, der Bär tapste brummend auf dem Podest herum. Schließlich schritt der Bestienbezwinger zum Beweis der außergewöhnlichen Fähigkeiten seines Bären. Er pfiff ihm ein paar einfache Melodien vor, die Bruno mehr schlecht als recht brummend wiederholte, und stellte ihm einfache Rechenaufgaben, die durch Kopfnicken und Tatzenschlagen korrekt, aber schleppend gelöst wurden. Als es ans Tanzen ging, holte Balduin eine Flöte hervor und spielte eine einfache Melodie. Der Bär wiegte und drehte sich gemächlich wie ein betrunkener Bauer, ohne groß auf den Rhythmus des Liedes einzugehen.
«Kann er auch kämpfen, dein beißwütiger Bruno?», fragte einer, der ein paar Plätze weiter an unserem Tisch saß, ein breitschultriger Kerl mit Lederweste und Armen, die fast so dick waren wie meine Oberschenkel.
«Natürlich kann er das», sagte Balduin. «Er ist schnell wie Achilles und stark wie Herkules. Will jemand gegen ihn antreten?»
Bruno fletschte die Zähne. Der Kerl winkte ab. «Lass mal.»
«Drückeberger!», kam es aus der Menge.
«Mach’s doch selber!», rief der Breitschultrige.
Bevor ich ihn daran hindern konnte, stand Lupus plötzlich auf. «Ich mach’s!», rief er.
Ich hätte es ahnen können. Lupus war für jeden Spaß zu haben, kannte keine Angst und zeigte gern, was er konnte. Das Bier hatte ihn noch ein bisschen tatenlustiger, furchtloser und eitler werden lassen. Die Aussicht auf einen Bärenkampf vor großem Publikum kam ihm da gerade recht.
Applaus und Gejohle.
Balduin hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass sich tatsächlich ein Freiwilliger finden würde. Er blickte kurz irritiert in die Runde, als erwartete er, dass irgendjemand Lupus zurückhalten würde, was ich gern getan hätte, denn Lupus hatte sich offensichtlich nur aus betrunkenem Übermut gemeldet, um die Zuschauer zu beeindrucken und vor allem Agatha, die hinter ihrem Fass stand und ihn nicht aus den Augen ließ.
«Tu das nicht», zischte ich Lupus zu, aber es war zu spät. Alle Augen waren auf uns gerichtet. Weiter hinten standen sie schon auf den Bänken, um besser sehen zu können, welcher Wahnsinnige sich da gleich vom Bären zerfleischen lassen würde.
«Was kriege ich dafür?», fragte Lupus, mehr an die Umstehenden gerichtet als an Balduin.
Während der noch überlegte und der Bär brummend die Zähne zeigte, schrie der Breitschultrige: «Die Haut des Bären! Was sonst?»
«Genau!», rief ein anderer. «Wer den Bären besiegt, bekommt sein Fell! So gehört sich das!»
Balduin rang um eine Antwort, aber die Menge hatte ihr Stichwort. Die Männer schlugen die Humpen auf die Tische und skandierten: «Die Haut des Bären! Die Haut des Bären!»
«Einverstanden», knurrte Balduin. «Wie heißt du?»
«Lupus.»
«Soso, Lupus. Wolf gegen Bär. Aber ohne Schwert!»
«So ist’s recht!», schrie einer aus der Menge. «Mit bloßen Händen!»
Ohne ein weiteres Wort des Protests schnallte Lupus seinen Schwertgurt ab und legte die Waffe auf den Tisch. Seine Augen glitzerten im Fackelschein.
«Das ist doch Wahnsinn», murmelte ich. Doch anstatt weiter zu versuchen, Lupus zurückzuhalten, tastete ich nach meinem eigenen Schwertgriff, um nötigenfalls einzuschreiten.
Lupus ging unter großem Applaus zum Podest und nahm Aufstellung. Der Bär stellte sich auf die Hinterbeine. Ich war nicht sicher, ob er begriff, was hier vor sich ging, doch dann holte er unversehens aus und verpasste Lupus einen Schlag ins Gesicht, sodass dieser zurücktaumelte. Die Krallen hatten vier blutige Striemen auf seiner Wange hinterlassen, aber anstatt zu Boden zu gehen, fing Lupus sich sofort wieder und ging erneut in Stellung, geschmeidig und sprungbereit wie eine Raubkatze. Eine Weile umkreisten sie sich lauernd.
Die Zuschauer teilten sich nun in zwei Lager: Die einen feuerten Lupus an, die anderen den Bären.
Lupus, dessen nietenbeschlagener Lederpanzer im Feuerschein glitzerte, schlug nach dem Kopf des Bären, verfehlte ihn aber. Seine Unterstützer stöhnten auf. Der Bär hob die Tatzen und machte einen Schritt nach vorn, doch Lupus wich mit katzenhafter Schnelligkeit aus. Die Unterstützer des Bären stöhnten auf.
Der Bär setzte Lupus nach. Seine Bewegungen kamen mir gar nicht mehr bärenhaft und behäbig vor, sondern gezielt und geschmeidig. Wieder umkreisten sie sich. Die Anfeuerungsrufe ebbten ab. Die Spannung stieg.
Plötzlich machte der Bär einen Satz nach vorn, stürzte sich auf Lupus und riss ihn zu Boden. Ich schoss hoch und zog mein Schwert, doch Lupus wand sich unter dem Bären hervor und sprang sofort wieder auf die Füße. Auch der Bär richtete sich auf, doch ehe er zu einem weiteren Angriff ansetzen konnte, tat Lupus etwas vollständig Unerwartetes: Er holte mit dem rechten Fuß aus und trat seinem Gegner mit aller Kraft zwischen die Beine. Die Wirkung war überwältigend: Der Bär sackte zusammen, griff sich mit beiden Tatzen in den Schritt und knurrte ein gepresstes «Scheiße!».
Dann kippte er zur Seite und rollte fluchend auf dem Boden hin und her. Balduin fluchte auch, aber seine Worte gingen im Geschrei der Zuschauer unter.
Lupus ballte die Fäuste und wandte sich triumphierend zur Menge um. Der Bär griff sich mit beiden Tatzen an den Hals und riss sich selbst den Kopf ab. Die Kette fiel klirrend zu Boden. Was blieb, war ein mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht am Boden kniender Mann im Bärenpelz, dessen dicker Hals eine kraftvolle Statur verriet. Sein Schädel war vollständig rasiert, was ihn älter aussehen ließ, als er vermutlich war. Er tat mir ein bisschen leid.
Die Menge raste. Trotz der wenig ehrenhaften Kampftechnik waren fast alle auf der Seite von Lupus und forderten mit sichtbarem Vergnügen den Siegespreis für ihn ein: «Die Haut des Bären! Die Haut des Bären!» Es klang wie ein unerbittlicher und gleichzeitig belustigter Schlachtruf. Es war klar, dass sie Balduin nicht ziehen lassen würden, ohne dass er seine Zusage eingelöst hatte.
Der Glatzköpfige mühte sich stöhnend und schimpfend auf die Beine, riss sich die Tatzen von den Händen, schälte sich aus dem Fell und schleuderte alles auf den Boden. Dann verließ er das Podest und suchte das Weite. Balduin folgte ihm wie ein geprügelter Hund.
Unter begeisterten Zurufen raffte Lupus das Bärenkostüm zusammen und nahm wieder an unserem Tisch Platz, als wäre nichts geschehen. Agatha stellte ihm einen neuen Humpen hin und tätschelte ihm den Kopf.
«Tankred», sagte eine vertraute Stimme hinter mir. «Wie ich sehe, amüsiert ihr euch.»
Ich wandte mich um. Es war Ratwin. Er trug wieder sein blaues Gewand mit der silbernen Knopfleiste, das ich noch von Koblenz her kannte, und strahlte vor Wiedersehensfreude. Er setzte sich neben mich auf die Bank und legte mir einen Arm um die Schulter. Es tat gut, ihn zu sehen. Ohne Kettenhemd und Helm wirkte das Schwert an seiner Seite eher wie ein Zeichen seines Ranges als wie eine Waffe.
Ratwin griff sich den Humpen von Lupus und stieß ihn gegen meinen. Wir tranken uns zu, als wäre unser letztes Zusammentreffen erst gestern gewesen. Die alte Vertraulichkeit zwischen uns war sofort wiederhergestellt. Er hatte in Koblenz viel Wert auf mein Urteil gelegt, und ich hatte ihn als einen umsichtigen und unerschrockenen Anführer kennengelernt. Im Kastorstift waren wir zusammen dem Entführer meiner Schwester gegenübergetreten, umlagert von Hunderten bis an die Zähne bewaffneter Dänen. Ratwin hatte sich nicht einschüchtern lassen, und die Rettung von Koblenz war vor allem sein Verdienst.
«Ich wusste, dass du es schaffen würdest», sagte er und meinte natürlich die Befreiung meiner Schwester. Ich hatte sie vor den Augen der aufgebrachten Dänen aus Ivars brennendem Schiff gerettet und war mit ihr durch die Mosel geschwommen.
«Weißt du auch, was danach passiert ist?», fragte ich.
«Nein», sagte er. «Aber ich weiß, warum du hier bist. Und am Hof weiß man es auch. Bertolf hat deinen Fall vorgetragen. Um deine Sache steht es gut. Komm morgen Mittag zur Pfalz. Man wird dich zum Kaiser vorlassen.»
«Wird er mich begnadigen?», fragte ich und versuchte, mir die Beklommenheit nicht anmerken zu lassen, die mich trotz der anscheinend guten Aussichten befallen hatte. Mein ganzes weiteres Leben hing von dieser Begnadigung ab.
«Davon gehe ich aus. Aber es gibt eine Bedingung.»
Ich konnte mir denken, welche Bedingung das war: «Ich soll an seinem Kriegszug teilnehmen.»
«Richtig. Wir brauchen Leute wie dich. In zehn Tagen brechen wir auf, um dem Spuk in Asselt ein Ende zu machen.»
Wie gesagt, vom Krieg hatte ich eigentlich genug. Aber Asselt sagte mir zu. Die Festung lag auf einer Insel in der Maas, nur einen Tagesritt von meiner Heimatstadt Maastricht und ebenso weit von Aachen entfernt. In Aachen warteten Fidis und Judith auf mich, in Maastricht wahrscheinlich jede Menge Ärger. Aber diesem Ärger würde ich mich stellen müssen, je früher, desto besser.
Ratwin erriet meine Gedanken. «Du kannst anfangen, deine Familienangelegenheiten zu regeln.»
«Das werde ich wohl», sagte ich finster.
Ratwin legte mir wieder den Arm um die Schulter. «Wenn du dich in den Diensten des Kaisers bewährst, steigen deine Chancen, dir dein Erbe zurückzuholen.»
Agatha saß inzwischen bei Lupus auf dem Schoß und hatte die Bärenmaske auf, was für allerhand mehr oder weniger schlüpfrige Zurufe sorgte.
Ratwin blickte belustigt zwischen uns hin und her, dann wurde er kurz wieder ernst.
«Es gibt noch jemanden, mit dem du dich gut stellen solltest, wenn du weiterkommen willst», sagte er.
«Liutbert von Mainz?», fragte ich.
«Eben nicht», antwortete Ratwin. «Liutbert hat abgewirtschaftet. Liutward von Vercelli ist der neue Stern am Firmament des Hofes. Und der neue Erzkanzler.»
«War das der andere Bischof auf der Treppe?»
«Ja. Niemand mag ihn, aber er ist der Ohrenbläser des Kaisers, und ohne seine Zustimmung passiert gar nichts. Sei auf der Hut. Er ist gierig, rücksichtslos und falsch wie die Schlange im Paradies, aber er verbirgt es hinter vollendeten Umgangsformen und geschliffener Rede. Er wurde auf der Reichenau ausgebildet und kennt den ganzen Cicero auswendig.»
Die Reichenau. In Prüm hatte ich eine Abschrift des Reichenauer Bibliothekskatalogs gesehen. Sie hatten dort Schätze, von denen andere Klöster nur träumen konnten. In Prüm hatte mir jahrelang die Bibliothek unterstanden, und ich konnte nicht aus meiner Haut, so als gälte es immer noch, seltene oder verloren geglaubte Werke aufzuspüren und zu beschaffen. Und ein weiterer Gedanke schlich sich in meinen Kopf: Wenn Liutward ein Mann der Bücher war, dann verband uns etwas, ganz gleich, was für einen Charakter er haben mochte. Dann hatte ich ihm etwas zu bieten, das vielleicht eine Gegenleistung wert war.
Ratwin grinste mich an. Er erriet meine Gedanken. «Da wirst du hellhörig, was?»
«Allerdings», bestätigte ich. Wenn ich mich richtig erinnerte, hatten sie auf der Reichenau das einzige vollständige Exemplar der Komödien von Terenz. Ich hatte es von Prüm aus einmal angefordert, aber sie hatten es zu meinem großen Missbehagen nicht rausgerückt.
«Ich warne dich», sagte Ratwin. «Liutward schätzt kluge Männer nur, solange sie nicht klüger sind als er selbst. Tu bescheiden. Ich weiß, dass dir das schwerfällt.»
«Ich werde mir Mühe geben», sagte ich.
«Gut. Und jetzt erzählst du mir mal genau, wie du Ivar nach Walhallo befördert hast.»
«Walhalla.»
«Auch gut. Ich bin ganz Ohr.»
3
Die Flügeltüren schwangen auf. Ich blickte in eine beeindruckend lange Audienzhalle, an deren Ende unter einem dunkelroten Baldachin mit Goldquasten der Kaiser auf einem dreistufigen Podest in einem Faltsessel saß. Er trug auch heute seinen Purpurmantel und den goldenen Lorbeerkranz anstelle der Krone. Zu seiner Rechten stand ein Mann in gestraffter Pose mit hinter dem Rücken verschränkten Armen, dem Anschein nach vielleicht fünfunddreißig Jahre alt; zu seiner Linken, etwas abseits, redeten zwei Priester leise miteinander. Noch weiter links stand ein großer Tisch voller Pergamente, an dem ein Schreiber auf einem Schemel saß und, ohne aufzublicken, etwas notierte.
Ich trat ein. Zwei Wachen kamen hinter den Flügeltüren hervor und schlossen sie geräuschlos hinter mir, während ich gemessenen Schrittes auf den Baldachin zuging: nicht zu langsam, um dem Kaiser keine Zeit zu stehlen, nicht zu schnell, um den Eindruck von bescheidener Ehrerbietung nicht durch allzu forsches Auftreten zu ruinieren. Meine Schritte hallten von den Wänden zurück. Die Halle hatte an beiden Seiten hohe Fenster mit eleganten Messinggittern, durch die viel Licht hereinfiel. Die Wände, vor denen lange Reihen von Kerzenleuchtern standen, waren verputzt, aber nicht bemalt, und der Boden war mit großen Sandsteinplatten belegt. Der ganze Raum strahlte eine schlichte und zeitlose Würde aus.
Das letzte Mal, dass ich einem Kaiser gegenübergetreten war, lag fast dreißig Jahre zurück. Ich war noch ein kleiner Junge gewesen und hatte meinen Vater zu einer Versammlung in Aachen begleitet. Kaiser Lothar, der Onkel des Mannes, auf den ich nun zuschritt, hatte mich auf seinen Knien sitzen lassen und sich einen Spaß daraus gemacht, mir Lästereien über die versammelten Bischöfe, Äbte und Grafen ins Ohr zu flüstern. Aber das war lange her. Hier und heute war ich ein Bittsteller.
Kaiser Karl schien ohnehin nicht zu Späßen aufgelegt zu sein. Mit teilnahmslosem Gesicht sah er geradeaus, und es war unmöglich zu sagen, ob er mich anschaute oder durch mich hindurchblickte. Er war glatt rasiert und hatte rötliche Flecken im Gesicht. Seine schwarzen Haare unter dem Lorbeerkranz waren nach vorn gekämmt, wie um eine beginnende Stirnglatze zu kaschieren.
Als ich die Halle zur Hälfte durchmessen hatte, erkannte ich den Mann an seiner Seite: Es war der Bischof, den ich am Vortag auf der Treppe gesehen hatte, doch statt des geistlichen Ornats trug er ein eng geschnittenes grünes Obergewand aus einem sehr feinen Wollstoff mit silbernen Knöpfen. Mit seiner kerzengeraden Haltung und dem hochgereckten Kinn schien er auf die ganze Welt herabzublicken; der strichdünne Bart, der seinen Mund wie ein Rechteck umrahmte, verriet eine ausgeprägte Eitelkeit. Um seine Lippen spielte ein selbstgefälliges Lächeln, das er für Komplimente und Belobigungen wahrscheinlich ebenso einsetzte wie für Drohungen, Provokationen und Beleidigungen: Liutward, Bischof von Vercelli und wichtigster Berater des Kaisers – der Mann, bei dem laut Ratwin alle Fäden an Karls Hof zusammenliefen.
Als ich mich dem Baldachin bis auf zehn Schritte genähert hatte, beugte ich das Knie und senkte den Blick. Aus den Augenwinkeln sah ich die vergoldeten Löwenpranken und das rot gefärbte Leder des Faltsessels.
Es raschelte, und ich schielte nach links, zum Erzkanzler. Liutward von Vercelli zog einen Zettel aus dem Ärmel seines Gewandes und las etwas ab.
«Tankred, Sohn des Grafen Thegan aus dem Maasgau», sagte er mit leicht rostig klingender Stimme und alemannischem Akzent.
«Du kannst dich erheben», kam die Stimme des Kaisers aus dem Sessel. Ich stand auf und neigte den Kopf leicht, zuerst in seine, dann in Liutwards Richtung.
Nach einem weiteren Blick auf seinen Zettel fuhr der Bischof fort: «Tankred wurde vor zwölf Jahren zu lebenslanger Klosterhaft verurteilt.»
«Weshalb?», fragte der Kaiser. Sein Blick wanderte von Liutward zu mir und zurück.
«Er hat den Gerichtsfrieden gebrochen», sagte Liutward.
«Welches Gericht war das?»
«Ein Königsgericht in Maastricht. Der König wurde durch drei westfränkische Grafen vertreten.» Liutward wandte sich an den Schreiber, der immer noch in seine Pergamente vertieft war oder jedenfalls so tat. «Thiebold, wie hießen die Grafen?», rief er hinüber.
Der Schreiber wollte gerade antworten, aber der Kaiser winkte ab. «Worum ging es in dem Prozess?», fragte er stattdessen.
«Tankred beschuldigte seine Stiefmutter Uta, ihre Tochter Judith in der Maas ertränkt zu haben», antwortete Liutward. «Er behauptete, beobachtet zu haben, wie sie die Tat begangen habe und wie die Leiche vom Fluss fortgeschwemmt worden sei. Uta dagegen schwor, das Kind sei an einem Fieber gestorben. Die Richter erkannten auf Gottesurteil durch Zweikampf, der aber unentschieden ausging.»
«Unentschieden.» Der Kaiser runzelte die Stirn. «So was hat man ja noch nie gehört.»
«Die Grafen ordneten daraufhin die Erhebung des Augenscheinbeweises an», erklärte Liutward.
«Das wird ja immer besser», murmelte der Kaiser und richtete sich in seinem Sessel auf. Mein Fall schien sein Interesse geweckt zu haben.
«Das Grab wurde geöffnet, und es fand sich die Leiche eines Kindes», fuhr Liutward fort. «Nachdem die Anschuldigung sich auf diese Weise als unwahr herausgestellt hatte und Utas Unschuld erwiesen worden war, zog Tankred im Zorn sein Schwert und tötete einen der Eideshelfer.»
Der Kaiser musterte mich mit einem skeptischen Blick, als könnte er sich einen derart unbeherrschten Ausbruch bei mir nur schwer vorstellen.
Um diesen Eindruck zu bekräftigen, bemühte ich mich um eine demütige Haltung, doch innerlich war ich äußerst angespannt, und am liebsten hätte ich meine Stimme erhoben, um unaufgefordert den wahren Hergang zu schildern. Die Kinderleiche war so stark verwest gewesen, dass sie nicht mehr zu erkennen gewesen war, sie erwies mitnichten Utas Unschuld. Meine Anschuldigung war nur zum Teil unwahr gewesen. Ich hatte sehr wohl gesehen, wie Uta versucht hatte, die damals zweijährige Judith zu ertränken, und wie ihr Körper von der Strömung mitgerissen worden war. Unwahr war daran nur, dass Judith tot gewesen war. Ich hatte sie aus dem Wasser gezogen und in Sicherheit gebracht. Mein Freund Folchar hatte sie in Aachen bei einer Familie untergebracht, in der sie aufgewachsen war – bis zu dem Tag vor fast fünf Monaten, an dem die Dänen sie von dort entführt hatten. Uta dagegen war überzeugt gewesen, dass ihre Tochter tatsächlich ertrunken war. Aber weil das vermeintlich tote Kind nirgendwo angeschwemmt worden war und Uta das Verschwinden ihrer Tochter ja irgendwie erklären musste, hatte sie behauptet, Judith sei an einem Fieber gestorben. Uta musste sich dann von irgendwoher eine Kinderleiche beschafft haben, die anstelle von Judith in das Leichentuch gewickelt und in der Familienkapelle bestattet worden war. Ich hätte nun also beweisen können, dass Uta beim Prozess im Hinblick auf den Fiebertod ihrer Tochter gelogen hatte, indem ich die lebende Judith auftreten ließ. Sie war inzwischen vierzehn Jahre alt und hatte nichts mehr mit dem damals zweijährigen Kind gemeinsam, aber mit ihren verschiedenfarbigen Augen verfügte sie über ein unverwechselbares Merkmal, das sie immer noch wiedererkennbar machte. Doch damit wäre auch meine Anschuldigung hinfällig gewesen, dass Judith sie getötet hatte. Kurz gesagt, ich steckte in einer Zwickmühle: Ich konnte Utas Lüge nur beweisen, indem ich mich selbst der Lüge überführte. Ich hatte sie eines Mordes beschuldigt, den sie zwar versucht, aber nicht erfolgreich ausgeführt hatte, und ich war vor Gericht damit gescheitert. Und dann hatte ich auch noch vor drei königlichen Richtern das Schwert gezogen und im Tumult einen Mann erstochen. Jetzt, zwölf Jahre später, stand ich vor dem Kaiser, um meine Begnadigung zu erbitten. Es war also klüger, meinen Trotz hinunterzuschlucken und keinen Anlass zu liefern, mich für unbesonnen und aufbrausend zu halten.
«Wurde für den getöteten Eideshelfer das Wergeld bezahlt?», wollte der Kaiser wissen.
«Ja», antwortete Liutward. «Deshalb wurde Tankred nicht wegen Totschlags schuldig gesprochen, sondern nur wegen Friedensbruchs.»
«Hat er seine Anschuldigung denn nicht beeidet?», fragte Karl erstaunt.
«Doch, selbstverständlich. Er wurde auch wegen Meineides verurteilt.»
Karl ließ seinen Blick an mir hinauf und wieder hinab wandern. «Warum sehe ich dann zwei Hände?», sagte er.
«Bei der Vollstreckung gab es ein Missgeschick. Der Büttel war betrunken und spaltete sich mit dem Beil selbst den Fuß, anstatt dem Verurteilten die Schwurhand abzutrennen. Das wurde als Gottesurteil gewertet. Die Vollstreckung wurde abgebrochen.»
«Auch das noch», sagte der Kaiser. Er wirkte jetzt erheitert.
«Die Haft wurde in Prüm verbüßt. Zwölf Jahre lang gab es keine Klagen. Tankred unternahm keine Fluchtversuche, fügte sich in die Gemeinschaft ein und stieg zum Bibliothekar auf, und zwar zu einem sehr guten, wie man von allen Seiten hört.»
«Was macht er dann hier?»
«Am vergangenen Epiphaniastag wurde das Kloster von den Dänen überfallen. Tankred wurde auf der Flucht von den anderen Mönchen getrennt und begab sich nach Koblenz, wo er sich bei der Verteidigung der Stadt bewährte. Später tötete er in der Schlacht von Remich einen der Anführer des dänischen Heeres. Graf Ratwin und Erzbischof Bertolf haben sich für seine Begnadigung eingesetzt.»
Ich musste ein Lächeln unterdrücken. Ratwin war so klug gewesen, dem Kanzler nicht die ganze Wahrheit zu erzählen. Ich war nicht auf der Flucht von den anderen Brüdern getrennt worden, sondern freiwillig zurückgeblieben, um die Bücher und meinen gelähmten Mitbruder und Freund Wolfhelm zu retten. Ich hatte mich auch nicht auf direktem Weg nach Koblenz begeben, sondern einen Abstecher über Aachen gemacht, wo ich von der Entführung meiner Schwester erfahren hatte. Und schließlich war ich nicht deshalb nach Koblenz gegangen, um gegen die Dänen zu kämpfen, sondern um Judith zu befreien, die vor den Mauern der Stadt im Kastorstift gefangen gehalten wurde. Aber es war besser, wenn die Sache mit Judith am Hof nicht die Runde machte. Denn wenn sich herumsprach, dass sie damals gar nicht ertrunken war, würde auch Uta das sehr bald erfahren, und ich wollte ihr keine Gelegenheit geben, neue Pläne auszuhecken, bevor ich selbst welche geschmiedet hatte. Sollten sie ruhig denken, dass mein Einsatz in Koblenz dem Kampf gegen die Feinde des Kaisers gegolten hatte.
Der Kaiser dachte eine Weile nach. «Was spricht sonst noch für seine Begnadigung?», fragte er schließlich.
«Er wird uns gute Dienste leisten», antwortete Liutward. «Wie gesagt, er hat bei Remich einen der dänischen Anführer getötet, einen gewissen ...»
«Ivar», warf der Schreiber ein. Ich staunte, wie gut er informiert war.
«Haben wir die Schlacht nicht trotzdem verloren?», wandte Karl mit leichtem Spott ein.
«Mit mehr Männern von seiner Sorte in unseren Reihen hätten wir nicht verloren.»
«Und was spricht gegen die Begnadigung?», fragte der Kaiser.
«Das Kloster Prüm verliert den besten Bibliothekar, den es je hatte.»
«Das ist deren Problem. Unser Problem sind jetzt die Dänen.»
Liutward nickte beflissen, und ich wusste, dass ich fast gewonnen hatte. Innerlich jubelte ich auf, doch ich ließ mir nichts anmerken.
Der Kaiser musterte mich wieder, dann blickte er zu seinem Berater. «Also, was tun wir?»
«Begnadigen», sagte Liutward ohne erkennbare Regung, und mehr als in dem ganzen vorherigen Wortwechsel spürte ich, welche Macht dieser Mann hatte. Für ihn war meine Begnadigung ein Geschäftsvorgang, den er mit einem Wort einleiten konnte. Für mich war es die Entscheidung über mein weiteres Leben.
«Dann lass die Urkunde ausstellen», sagte der Kaiser. «Im Gegenzug wird Tankred mir Treue schwören und sich verpflichten, am Zug gegen das Lager der Dänen in Asselt teilzunehmen.»
Liutward nickte dem Schreiber zu, der unverzüglich seine Feder in ein Tintenfass tunkte.
Doch anstatt mich zum Schwur aufzufordern, fuhr Liutward nach einem kurzen Blick auf seinen Zettel an den Kaiser gewandt fort: «Tankreds Fall ist auch in anderer Hinsicht für uns von Interesse.»
«Ich bin ganz Ohr», sagte der Kaiser, während seine grauen Augen weiter auf mir ruhten. Er schien wie ausgewechselt. Der teilnahmslose Blick, mit dem er bei meinem Eintreten vor sich hin gestarrt hatte, war verschwunden und einem Ausdruck höchster Aufmerksamkeit gewichen.
Der Kanzler holte tief Luft, als müsste er weit ausholen, um einen komplizierten Sachverhalt einigermaßen verständlich zu schildern. «Ich sagte, Tankred sei der Sohn des Grafen Thegan. Rechtlich gesehen ist er das nicht. Die Ehe von Thegan und seiner damaligen Frau Gerbirga, Tankreds Mutter, wurde annulliert. Thegan heiratete erneut, und zwar die besagte Uta, mit der er damals schon einen gemeinsamen Sohn namens Gerold hatte. Dieser Gerold ist inzwischen fast dreißig Jahre alt und wird Thegan wahrscheinlich bald beerben. Der alte Graf ist krank. Er hat sich seit zwei Jahren bei keiner Reichsversammlung mehr blicken lassen. Es heißt, er sei geistig verwirrt.»
Ich verfolgte Liutwards Ausführungen mit höchster Aufmerksamkeit. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass die durch Utas Intrigen bewirkte Scheidung meiner Eltern hier auch noch zur Sprache kommen würde. Doch ich begriff, warum der Fall für den Kaiser von Interesse sein musste. Und Karl selbst begriff es auch.
«Von wem wurde das Scheidungsurteil gesprochen?», fragte Karl.
«Von Bischof Franco von Lüttich.»
«Ausgerechnet von dem. Lief das Verfahren korrekt ab?»
«Formal war das Verfahren korrekt.» Liutward lächelte hintergründig. «Was nicht bedeutet, dass das Urteil nicht in einem formal ebenso korrekten Verfahren wieder aufgehoben werden könnte.»
Karl lächelte nun ebenfalls. Er schlug die Beine übereinander, stützte den Ellbogen auf das Knie und das Kinn auf den Handballen. «Hat Franco nicht auch die Annullierung der Ehe von Lothar befürwortet?», fragte er maliziös.