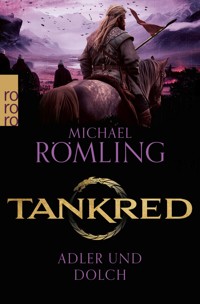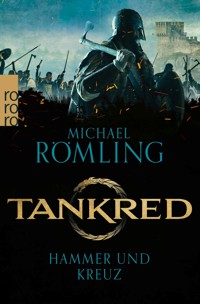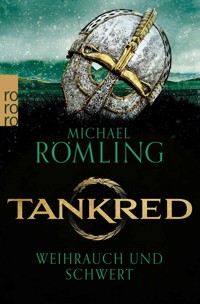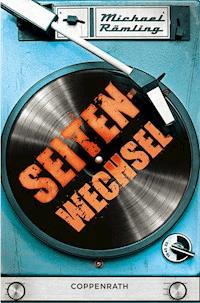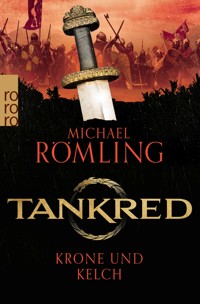
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Im Kampf gegen die Wikinger
- Sprache: Deutsch
Kämpfe und Abenteuer, Machtspiele und Intrigen, Liebe und Rache: Band 3 der spannenden Reihe um den Bibliothekar Tankred, der mit dem Schwert in der Hand gegen Wikinger, für Gerechtigkeit und für sein Erbe kämpft Das Jahr 882: Nach der Belagerung der Wikinger in Asselt fordert Tankred endlich Gerechtigkeit für seine Mutter ein, damit er sein Erbe antreten kann. Doch dafür braucht er die Unterstützung des Papstes. Es trifft sich gut, dass der Kaiser ihn für einen heiklen Auftrag nach Rom schickt. Und so begibt sich der weltgewandte Kämpfer mit seinen Weggefährten in doppelter Mission auf die gefährliche Reise nach Süden. Doch er weiß, dass der größte Kampf ihm nach seiner Rückkehr bevorstehen wird: Sein skrupelloser Halbbruder Gerold hat in Maastricht einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um Tankred aus dem Weg zu räumen und das Erbe ein für alle Mal in die Hände zu bekommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Michael Römling
Tankred: Krone und Kelch
Historischer Roman
Über dieses Buch
Schwert und Buch sind seine Waffen, sein Ziel ist die Gerechtigkeit
882: Nach der Belagerung der Wikinger in Asselt fordert Tankred endlich Gerechtigkeit für seine Mutter ein, damit er sein Erbe antreten kann. Doch dafür braucht er die Unterstützung des Papstes. Es trifft sich gut, dass der Kaiser ihn für einen heiklen Auftrag nach Rom schickt. Und so begibt sich der weltgewandte Kämpfer mit seinen Weggefährten in doppelter Mission auf die gefährliche Reise nach Süden. Doch er weiß, dass der größte Kampf ihm nach seiner Rückkehr bevorstehen wird: Sein skrupelloser Halbbruder Gerold hat in Maastricht einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um Tankred aus dem Weg zu räumen und das Erbe ein für alle Mal in die Hände zu bekommen.
Band 3 der packenden historischen Abenteuerserie um Tankred, den kämpfenden Bibliothekar.
Pressestimmen zu «Tankred»:
«Er kennt die Kampftaktik der Nordmänner, beschreibt ihre furchteinflößenden Schiffe, die notfalls über Land von einem Gewässer zum nächsten getragen wurden... Gute Unterhaltung.» Westfälischer Anzeiger zu «Weihrauch und Schwert»
«Genau das Richtige für Fans von historischen Romanen.» Radio BRF zu «Weihrauch und Schwert»
«Ein gelungener Historienschmöker.» ekz Bibliotheksservice zu «Weihrauch und Schwert»
Vita
Michael Römling, geboren 1973 in Soest, studierte Geschichte in Göttingen, Besançon und Rom, wo er acht Jahre lang lebte. Nach der Promotion gründete er einen Buchverlag, schrieb zahlreiche stadtgeschichtliche Werke und historische Romane. Nach «Weihrauch und Schwert» und «Hammer und Kreuz» ist «Krone und Kelch» der dritte Band der historischen Abenteuerserie um den Kämpfer und Bibliothekar Tankred aus dem 9. Jahrhundert. Des Weiteren erschienen im Rowohlt Taschenbuch die Romane «Pandolfo» und «Mercuria».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg Copyright © 2023 by Michael Römling
Redaktion Susann Rehlein
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Stephen Mulcahey/Arcangel; Shutterstock
ISBN 978-3-644-01526-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Der Tag begann mit strahlendem Sonnenschein. Es war Mitte August, über den Dächern von Lüttich erklang das Gezwitscher der Vögel, und von irgendwoher durchschnitt der spitze Schrei des Turmfalken die Luft. Das Wetter passte zu meiner Stimmung: Das Unrecht, das die vergangenen fünfzehn Jahre meines Lebens vergiftet hatte, würde an diesem Tag rückgängig gemacht werden, die Gerechtigkeit wiederhergestellt, die Schande ausgelöscht, meine Wut und mein Groll besänftigt. Diese Mischung aus Genugtuung und Triumph erfüllte mich bis in die letzte Faser meines Körpers.
Ich stand am Fenster der Empfangshalle des Bischofspalastes und wartete auf den Hausherrn, Bischof Franco, den Mann, mit dessen Urteilsspruch meine Misere vor fünfzehn Jahren begonnen hatte. Es war genau in diesem Raum geschehen: Franco, damals ein vergnügungssüchtiger junger Schnösel, hatte die Ehe meiner Eltern mit einem gelangweilten Wink in Richtung des Gerichtsschreibers annulliert und mich und meinen Bruder Radold damit aller Ansprüche beraubt. Mein Vater hatte seine Konkubine Uta geheiratet, und ihr gemeinsamer Sohn Gerold war zum Alleinerben aufgestiegen. Mein Vater war inzwischen gestorben, aber Uta und Gerold saßen immer noch in Maastricht und lebten von den Einkünften des riesigen Besitzes, der mir und Radold zustand. Aber nicht mehr lange: Mit der Urkunde, die mir gleich ausgehändigt werden sollte, wurde Uta wieder zur Konkubine und Gerold wieder zum Bastard. Und wenn sie nicht freiwillig verschwanden, würde ich sie von meinem Land jagen wie wildernde Hunde.
Ich blickte hinaus auf den Platz. Die Sonne hing noch tief über der halb zerstörten Stadt unter mir; ihre Strahlen streiften die mit Holzschindeln gedeckten Dächer und die verkohlten Balkengerippe der ausgebrannten Gebäude. Trotz des erbärmlichen Zustands von Lüttich lagen Hoffnung und Aufbruchsstimmung in der Luft. Die Leute wollten endlich wieder in Frieden ihren Geschäften nachgehen und ihre Häuser aufbauen. Auf dem Platz wurden Marktbuden aufgestellt. Handwagen und Maultierkarren wurden entladen. Ein paar Frauen und Männer schoben sich zwischen den Buden entlang und prüften die Ware. Hühner gackerten, Gänse schnatterten, und aus den Ruinen hallte der Klang von Hämmern und Sägen.
Die Plage war vorbei, vorerst jedenfalls. Jahrelang hatten die Dänen die Gegend drangsaliert und ausgesaugt, jetzt hatte der Kaiser mit Kisten voller Gold und Silber den Abzug der Invasoren erkauft, nachdem wir sie mehrere Wochen lang in ihrer Inselfestung Asselt belagert hatten.
«Da bist du ja, mein Lieber.»
Ich war so in die Betrachtung der Stadt versunken gewesen, dass ich Franco gar nicht hatte eintreten hören. Die arrogante Eitelkeit seiner jungen Jahre war einer gelassenen Eleganz gewichen, und die Ereignisse der zurückliegenden Monate hatten ihn Demut gelehrt. Das Schriftstück, das er in der Hand hielt, war die Belohnung dafür, dass ich seinen Sohn Osmund aus den Händen seiner dänischen Entführer befreit hatte. Mein Lieber – dass er mich einmal so ansprechen würde, hätten wohl weder er noch ich bis vor Kurzem geglaubt.
Franco trat neben mich und legte mir eine Hand auf die Schulter. Er wirkte erschöpft, aber auf eine behutsame Weise glücklich. Sein Gesicht mit dem sauber gestutzten Bart war hagerer geworden. Er schien noch nicht glauben zu können, dass der Albtraum wirklich ein Ende gefunden hatte.
Ich dagegen war so erfüllt von meiner Genugtuung, dass ich gar nicht an die Kämpfe dachte, die mir bevorstehen mochten. In Gedanken war ich bei meiner Mutter, der so viele Jahre nach ihrem Tod endlich Gerechtigkeit widerfuhr. Angestiftet von Uta, hatte mein Vater sie mit Lügen und Verleumdungen überzogen und schließlich der Schande preisgegeben. Diese Schande war jetzt getilgt. Über zwölf Jahre hatte ich darauf warten müssen.
Ohne ein weiteres Wort reichte Franco mir das kleine rechteckige Pergament. Gestochen scharfe Buchstaben verkündeten: In nomine sanctæ et individuæ trinitatis. Franco divina prædestinante clementiæ Leodinensis civitatis episcopus.
Nicht clementiæ, dachte ich. Clementia. Als Bibliothekar in Prüm hätte ich dem Schreiber für einen derartigen Patzer die Urkunde um die Ohren gehauen. An diesem Tag amüsierte es mich eher.
Auf die üblichen Protokollformeln folgte sodann der entscheidende Satz: … tun wir kraft der Uns durch Unser Amt von Gott verliehenen Gewalt allen Gegenwärtigen und Zukünftigen kund, dass die Annullierung der Ehe des Herrn Thegan, Graf im Maasgau, und der ihm von Gott angetrauten Ehefrau Gerbirga hiermit null und nichtig sein soll und dass die aus dieser Ehe hervorgegangenen Söhne Tankred und Radold als rechtmäßige Nachkommen und Erben des besagten Herrn Thegan und der besagten Frau Gerbirga zu gelten haben. Wer aber, was ferne sei, jetzt oder in Zukunft sich anmaßen sollte, die Rechtskraft dieser Urkunde in Zweifel zu ziehen oder ihren Inhalt zu verfälschen oder ihren Bestimmungen zuwiderzuhandeln, den soll die Strafe der Exkommunikation und der Konfiskation seiner Güter treffen. Es folgte eine Liste von Zeugen, die Siegelankündigung und die Schlussformel: Gegeben in Unserem Hof zu Tongern, am Tag vor den Kalenden des August, im siebenundzwanzigsten Jahr Unserer Herrschaft, in der vierzehnten Indiktion.
Franco lächelte schief und blickte ebenfalls aus dem Fenster, ohne die Hand von meiner Schulter zu nehmen. Ich wusste, was er dachte, aber keiner von uns sprach es aus: Uta und Gerold würden das Feld nicht räumen, nur weil ich ihnen dieses Schriftstück unter die Nase hielt. Ich brauchte Unterstützer, die mir Bewaffnete zur Verfügung stellten, und jetzt fürchtete Franco, dass ich gleich die nächste Gefälligkeit von ihm fordern würde. Sicherlich hätte er es vorgezogen, noch eine Weile in Deckung zu bleiben und abzuwarten, wie die Dinge sich entwickeln würden.
«Was hast du jetzt vor?», fragte er schließlich.
«Ich reite noch einmal zum Kaiser. Er muss Gerold absetzen. Wenn Gerold nicht mehr Graf ist, werden seine Unterstützer von ihm abfallen.»
«Für Gerold ist das aber kein Amt, sondern ein Titel.»
Ich zeigte auf die Urkunde. «Ein Titel, auf den er keinen Anspruch mehr hat.»
Francos Lächeln verbreiterte sich. Mir schien, dass er sich etwas entspannte. Wahrscheinlich hoffte er darauf, dass ich verschwinden würde, ohne ihm weitere Zusagen abzuringen. Sollte sich doch der Kaiser darum kümmern, dass ich mir mein Recht verschaffte. Für Gerold ging es jetzt um seine ganze Existenz, und das machte ihn unberechenbarer und gefährlicher denn je.
«Du musst übrigens nicht reiten», sagte Franco. «Unten liegt ein Schiff, das gleich ablegt. Die letzte Rate für die Dänen.»
«Du willst mich wohl loswerden», konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen.
«Ich kann es mir gar nicht mehr leisten, dich loszuwerden. Wenn du wüsstest, wie viele Feinde ich mir mit dieser Urkunde vor meiner eigenen Haustür gemacht habe, würdest du dir nicht wünschen, in meiner Haut zu stecken.»
«Das habe ich mir noch nie gewünscht.»
«Dann und wann sicherlich schon in den letzten zwölf Jahren.»
«Ich hatte meinen Frieden und die Bücher.»
«Beides hättest du auch so haben können.»
Das war fast schon unverschämt, schließlich hatte Franco selbst maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mir die zwölf Jahre Verbannung im Kloster überhaupt eingehandelt hatte. Und meinen Frieden hatte ich dort auch nicht gehabt, wenn man es genau nahm. Meinen Frieden würde ich haben, wenn Gerold und Uta endgültig zur Strecke gebracht waren. Und Francos Urkunde war der erste Schritt auf diesem Weg. Der zweite würde Gerolds Absetzung sein. Der dritte seine Vertreibung. An jenem Morgen erschien mir das alles ganz klar und einfach.
«Ich bin bald wieder da», sagte ich und fügte in Gedanken hinzu: eher, als dir lieb ist.
«Daran zweifle ich nicht. Viel Glück.»
Ich nickte und wandte mich zum Gehen. Als ich schon in der Tür war, rief er mir hinterher: «Danke für alles. Du kannst auf mich zählen.»
«Solange du nicht nur Gebete anzubieten hast.»
2
Noch am selben Vormittag stand ich am Bug des breiten Frachtschiffs, das von ein paar Männern mit Stangen vom Steg aus ins tiefere Wasser geschoben worden war, wo die zehn Ruderer es auf ein Kommando in die Strömung manövriert hatten.
In ein paar Stunden würden wir in Roermond anlegen und die Kisten ausladen, die rechts und links vom Mast auf dem Schiffsboden standen. Dann würde der Schatz, von einer waffenstarrenden Eskorte begleitet, die letzten paar Meilen auf einem Wagen nach Asselt gebracht und den dänischen Anführern ausgehändigt werden. Damit würde unser Teil der Vereinbarung erfüllt sein. Siegfried und Gottfried würden uns die Festung übergeben und mit ihren Männern abziehen. Der Krieg des Kaisers gegen die Dänen war vorerst zu Ende.
Mein Krieg gegen Gerold würde jetzt erst beginnen.
An Bord befanden sich um die zwanzig Bewaffnete, die unter ihren Helmen und in ihren schweren Kettenhemden schwitzten. Schwerter, Bogen und Speere lehnten griffbereit an der Bordwand. Erkanbert, der Anführer der Truppe, stand neben mir, eine Hand am Vordersteven, die andere auf dem Schwertgriff, und spähte mit zusammengekniffenen Augen ans Ufer. Er war um die vierzig Jahre alt, hatte tiefe Falten um den Mund, graue Bartstoppeln und den scharfen Blick eines Raubtiers. Er sprach den gedehnten romanischen Dialekt des südlichen Lotharingien.
«Bist du der Tankred, der in Asselt alleine den Fluss trockengelegt hat?», hatte er wissen wollen, nachdem ich mich am Anleger bei ihm vorgestellt und gefragt hatte, ob er mich und mein Pferd mit an Bord nehmen könnte.
Die Frage zeigte, was für einen Klang mein Name inzwischen hatte. Während der Belagerung waren nach meinen Plänen zwei Dämme errichtet worden, um einen Seitenarm der Maas abzusperren, damit wir durch das Flussbett stürmen konnten. Der Angriff war abgeschlagen worden, aber die Sperrwerke hatten gehalten und dafür gesorgt, dass man voller Bewunderung von mir redete. Es war nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen, dass ich darauf angesprochen wurde, und jedes Mal erfüllte es mich mit einer tiefen Genugtuung, dass ich endlich wieder jemand war, mit dem man rechnen musste.
«Nicht alleine und nicht den ganzen Fluss», hatte ich geantwortet, woraufhin er mir mit einem Kopfnicken gestattet hatte, an Bord zu gehen.
«Binde das Pferd gut an. Und dann erzählst du mir, wie du das mit dem Fluss gemacht hast.»
Also hatte ich Sleipnir über die federnden Planken auf das Schiff geführt. Und nun stand ich neben Erkanbert am Vordersteven, während wir durch die spätsommerliche Landschaft glitten. Die Maas führte wenig Wasser. Ab und zu wandte Erkanbert sich um und schnauzte die Ruderer an, das Schiff gefälligst in der Flussmitte zu halten, damit wir nicht auf Grund liefen. Er war vor fünf Tagen mit seinen Männern in Metz aufgebrochen, um das letzte Viertel des Lösegeldes nach Asselt zu bringen, zuerst über Land bis nach Verdun, wo die Kisten auf das Schiff umgeladen worden waren, um anschließend den Rest der Reise auf dem Wasserweg zurückzulegen: hundert Pfund Gold und fünfhundert Pfund Silber, zusammengekratzt aus dem Kirchenschatz des vakanten Bistums Metz. Die Kisten wirkten geradezu unscheinbar; abgesehen von den Eisenbeschlägen verriet nichts, dass sie ein Vermögen enthielten, mit dem man ein Dutzend zerstörte Kirchen und Klöster hätte wiederaufbauen können. Bald würden die Dänen es unter sich aufteilen, und dann würden Gold und Silber sich verflüchtigen: beim Würfeln an Lagerfeuern verspielt und in friesischen Tavernen versoffen, eingeschmolzen und zu Armreifen für verdiente Gefolgsleute oder Halsketten für dänische Frauen verarbeitet, für schlechte Zeiten vergraben oder an Bord von gesunkenen Schiffen für immer auf dem Grund der Nordsee gelandet – und das alles nur, weil der Kaiser beschlossen hatte, die Dänen für ihren Abzug aus Asselt zu bezahlen, anstatt sie mit seinem Heer aus dem Land zu treiben, das doch genau für diesen Zweck aufgestellt worden war.
«Was könnte man damit alles machen», sagte Erkanbert, der meinen Blick bemerkt hatte.
Eine Söldnertruppe anheuern und Gerold zum Teufel jagen, dachte ich, sagte aber nichts.
Während Erkanbert herumfantasierte, was für ein Leben er mit solch unermesslichen Reichtümern führen würde, passierten wir die letzte große Flussschleife vor Maastricht. Die Ruder schlugen ihren gleichmäßigen Takt, während Büsche und Bäume vorbeizogen. Ein paar Meilen noch, und ich würde vom Fluss aus auf den Garten und das Anwesen meines Vaters blicken, mit dem mich so viele Erinnerungen verbanden: meine unbeschwerte Kindheit und Jugend, meine Fassungslosigkeit und meine Wut, nachdem mein Vater meine Mutter verstoßen hatte, der erzwungene Umzug auf den benachbarten Hof, die Nächte, die ich dort mit Fidis verbracht hatte, und schließlich Utas versuchter Mord an meiner kleinen Schwester, für den sie immer noch nicht bezahlt hatte. Während der Belagerung von Asselt war ich zweimal dort vorbeigeritten, und vor ein paar Wochen war ich ins Haus eingestiegen und hatte am Bett meines sterbenden Vaters gesessen, der inzwischen in der benachbarten Kapelle begraben lag.
Erkanbert redete immer noch, aber ich hörte gar nicht, was er sagte. Eine Mischung aus Anspannung und wilder Entschlossenheit erfüllte mich. All das gehörte mir, und die Urkunde, die in einer Lederschatulle in meiner Satteltasche steckte, bewies es. Fast hoffte ich, dass Uta, die ich seit meiner Verurteilung nicht mehr gesehen hatte, am Ufer stehen und mich als ihren Unheilsboten erkennen würde. Ich versuchte, mir ihr Gesicht vorzustellen, ihre Angst, ihre Wut und ihre Ohnmacht angesichts der Tatsache, dass ich ihr inzwischen so nah kommen konnte, ohne dass sie etwas dagegen zu unternehmen vermochte.
Noch eine halbe Meile. Ich erkannte eine weit über den Fluss ragende Weide wieder, von der aus ich als Kind gern ins Wasser gesprungen war.
Noch eine Viertelmeile.
Und dann sah ich es.
Ein Wall mit Palisade, davor ein Graben, kurz vor dem Flussufer.
Eine Welle aus Wut durchflutete mich. Gerold ließ das Anwesen zur Festung ausbauen. Ich hieb mit der Faust gegen die Bordwand und stieß ein paar Flüche aus. Erkanbert verstummte und blickte mich fragend von der Seite an. Ich beachtete ihn nicht, sondern starrte zornig auf das Bauwerk.
Natürlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass Gerold das Feld kampflos räumen würde, doch der Anblick der Befestigung war ernüchternd. Als wir näher herankamen, sah ich, dass an den Ecken sogar Türme errichtet wurden; sie waren noch nicht fertiggestellt, hatten aber schon die Höhe der Palisade erreicht. Ein paar Handwerker waren damit beschäftigt, Baumstämme mit Beilen zu bearbeiten. Sie sahen kurz auf, einer zeigte auf unser Schiff, sie wechselten ein paar Worte und wandten sich dann wieder ihrer Tätigkeit zu. Von irgendwo hinter dem Wall kamen Hammerschläge. Offenbar hatte Gerold so viele Männer aufgeboten, wie er hatte bekommen können, um vorbereitet zu sein, wenn es so weit war. Ein paar Bewaffnete würden nicht reichen, um ihn zu vertreiben. Ich würde eine ganze Reihe von Leuten auf meine Seite ziehen müssen, um ein Aufgebot auf die Beine stellen zu können, das Gerold zur Aufgabe zwingen konnte. Gerold hatte fünfzehn Jahre gehabt, um mit der Unterstützung meines Vaters seine Stellung im Maasgau abzusichern. Ich dagegen war gerade erst aus der Versenkung aufgetaucht, und ohne sichere Aussicht auf einen Erfolg würde niemand die Seiten wechseln, nur weil ich im Recht war.
Während ich diese Gedanken wälzte, glitten wir vorbei; Gerolds Festung, die, wenn man es genau nahm, meine Festung war, verschwand hinter einer Biegung. Ich bereute es schon, dass ich ihn nicht einfach umgebracht hatte, als sich mir in Verdun die Chance dazu geboten hatte. Ich hatte es nicht getan, weil es gegen meine Vorstellungen von Anstand verstieß, einem Wehrlosen das Schwert in den Bauch zu stoßen. Ihr mit eurer dämlichen Ehre, hatte mein Freund Lupus kommentiert. Jetzt hatte ich die Quittung dafür.
Verdrossen ließ ich meinen Blick weiter am Ufer entlangschweifen. Wir passierten die Stadt Maastricht mit ihrem Hafen, dem Fähranleger und den Lagerhäusern, zwischen denen sich die Gassen verloren. Von den Zerstörungen, die die Dänen im vergangenen Jahr hier angerichtet hatten, war nicht viel zu sehen; anders als in Lüttich hatten sie in Maastricht keine Brände gelegt, sodass die Stadt sich nach der Plünderung schnell hatte erholen können, obwohl sie durch die Nähe zu Asselt – zu Pferd war die Strecke in fünf Stunden bequem zu schaffen – monatelang ständiger Gefahr ausgesetzt gewesen war. Arbeiter luden Kisten und Säcke von Handkarren und Leiterwagen und schleppten die Fracht zu den im trüben Wasser dümpelnden Schiffen oder stapelten sie auf den Stegen. Kaufleute beaufsichtigten das Treiben oder standen plaudernd in kleinen Gruppen beieinander, Zollbedienstete prüften die Qualität der Stoffballen und die Füllstände der Fässer. Kurz dahinter ragte der Glockenturm der Liebfrauenkirche auf, weiter hinten war die Turmspitze der Servatiusbasilika gerade noch zu erkennen. Am Ende des Anlegers stand eine große Gruppe von Bewaffneten herum, wohl Angehörige des Heeres, das vor wenigen Wochen noch voller Siegesgewissheit die Mauern von Asselt berannt hatte und nun aufgelöst wurde. Wahrscheinlich warteten die Männer auf ihre Verschiffung in die Heimat, während in Asselt nur noch ein paar letzte Abteilungen verblieben waren, um die ordnungsgemäße Übergabe der Festung sicherzustellen und darauf zu achten, dass die Dänen beim Abzug keine Scherereien machten.
Ich hatte Maastricht seit meinem Prozess nicht mehr betreten, und die Erinnerung an das Geschehen vor mehr als zwölf Jahren fachte meine Wut wieder an: die Unschuldsmiene, mit der Uta ihren Eid geschworen hatte, der unentschiedene Zweikampf, der Augenscheinbeweis mit der falschen Kinderleiche und der unbedachte Augenblick, in dem ich einen der Eideshelfer meines Vaters erstochen hatte; meine Verurteilung, die missglückte Vollstreckung der Strafe und meine Verbannung nach Prüm. Ich war sicher, Genugtuung zu bekommen, aber es würde mir schwerfallen, die vielen Enttäuschungen zu vergessen, die den glücklichen Erinnerungen an meine Heimatstadt im Weg standen.
Erkanbert schwieg immer noch, als die Silhouette von Maastricht hinter den Bäumen an einer weiteren Flussschleife versank und wir wieder durch die stille Landschaft glitten. Ab und zu passierten wir einen entgegenkommenden Treidelkahn mit seiner Fracht, dessen Besatzung uns mit gelangweilten Blicken grüßte. Alles war ruhig, und dennoch nistete sich in meinem Hinterkopf eine ungute Ahnung ein: Es lief ein bisschen zu glatt.
Eine weitere Viertelstunde verging, in der nichts zu hören war als der monotone Ruderschlag, das gedämpfte Geplauder der Männer hinten im Schiff und das gelegentliche Quaken von Enten im Gebüsch. Erkanbert beobachtete weiterhin das Ufer mit seinem Raubtierblick, nur ab und zu wandte er sich um und gab ein kurzes Kommando zur Kurskorrektur.
Plötzlich straffte er sich und legte die Hand an den Schwertgriff.
Und dann sah auch ich das Schiff, das hinter einer Flussbiegung zum Vorschein kam. Es war mit zehn oder zwölf Ruderern bemannt und damit erheblich kleiner als die dänischen Langschiffe, die manchmal fünf Dutzend Männer an Bord hatten, doch der spindelförmige, geklinkerte Rumpf, der in einer eleganten Auskehlung in den Kiel überging, und der hoch aufragende und in eine schneckenförmige Schnitzerei auslaufende Vordersteven ließen keinen Zweifel daran, dass es sich um ein dänisches Schiff handelte.
«Da stimmt was nicht», sagte Erkanbert mit zusammengebissenen Zähnen.
Und ob da etwas nicht stimmte. Dänische Schiffe waren auch nach dem Friedensschluss von Asselt kein völlig ungewohnter Anblick auf dem Fluss, schließlich hinderte niemand sie daran, sich frei zu bewegen, solange sie nur Handel trieben und keine Überfälle verübten. Zwar stammte die Ware, die sie zum Verkauf anboten, zumeist ebenso aus ihren Plünderungszügen wie das Geld, mit dem sie ihre Einkäufe bezahlten, aber das wollte keiner ihrer Handelspartner so genau wissen. Doch erstens hatte das Schiff vor uns keine Ware an Bord, sondern vor allem Männer, zweitens trugen diese Männer, jedenfalls soweit sich das aus der Entfernung erkennen ließ, allesamt Rüstungen, und drittens fuhren sie nicht, sondern hielten ihr Schiff durch behutsame und regelmäßige Ruderschläge in der Strömung auf der Stelle, als warteten sie auf etwas. Auf uns? Aber warum? Alles, was es bei uns zu holen gab, würden sie in ein paar Stunden ohnehin zu Füßen gelegt bekommen.
Erkanbert wandte sich zu seinen Männern um: «Schnappt euch mal die Waffen! Vielleicht gibt’s hier gleich Ärger!»
Sofort erhob sich Unruhe an Bord. Alle redeten durcheinander und zeigten zum Bug; Schwerter, Speere und Bogen wurden ergriffen, Kettenhemden zurechtgezogen, Kinnriemen geschlossen. Die Ruderer, die mit dem Rücken zu uns saßen, drehten sich um und reckten die Hälse, um besser sehen zu können. Sleipnir, der wie eine Statue zwischen ihnen aufragte, legte die Ohren an.
Während Erkanbert wieder auf das dänische Schiff starrte, sah ich, wie er in aller Eile die Möglichkeiten durchspielte: Entweder wir kehrten sofort um und versuchten, Maastricht zu erreichen, bevor sie uns einholten, oder wir fuhren weiter und hofften darauf, schnell an ihnen vorbeizukommen.
Nach nur drei oder vier Ruderschlägen fällte Erkanbert die Entscheidung, die ich wohl auch getroffen hätte.
«Weiterrudern!», schrie er. «Schneller!»
Seine schneidende Stimme brachte etwas Ordnung in das Durcheinander. Die Bewaffneten reihten sich an der linken Bordwand auf, das Schiff neigte sich leicht, aber die Ruderer waren gut eingespielt. Sie steigerten den Rhythmus, ohne dabei aus dem Takt zu geraten. Das Schiff zog spürbar an.
«Was wollen die?», rief einer der Männer von hinten.
«Na, was wohl?», antwortete ein anderer.
«Warum sollten sie uns überfallen?»
Erkanbert kniff die Augen zusammen und zählte mit dem Zeigefinger die Besatzung des dänischen Schiffes durch. Mit den Ruderern hatten sie etwa genauso viele Männer wie wir.
«Mir fallen zwei Gründe ein», sagte er halblaut, während sie hinter uns aufgeregt durcheinanderredeten. «Entweder sie wissen nicht, wen sie vor sich haben, oder sie wollen ihre eigenen Leute übers Ohr hauen.»
Ich nickte, ohne die Dänen aus den Augen zu lassen. Meine Gedanken rasten, und mir fiel noch eine dritte Möglichkeit ein: Was, wenn Siegfried und Gottfried selbst dahintersteckten, uns überfielen, Silber und Gold einsackten und hinterher behaupteten, das seien gar nicht ihre Leute gewesen? In diesem Fall hätten sie einen Grund, den Abzug aus Asselt zu verweigern, bis die letzte Rate des Lösegeldes ein zweites Mal beschafft und bezahlt war. Für den Kaiser wäre das eine Demütigung, die er kaum unbeschadet überstehen würde.
Unser Schiff hatte seine Geschwindigkeit inzwischen fast verdoppelt. Der Rumpf knarrte, und die Ruderer keuchten. Kleine Strudel und schaumige Blasen wirbelten durch das Wasser, glitzernde Tropfen flogen durch die Luft. Die Bäume am Ufer zogen vorbei wie eine auf Rollen montierte Kulisse.
Das andere Schiff bewegte sich immer noch nicht von der Stelle. Die Dänen standen reglos wie Statuen hinter der Bordwand und beobachteten uns. Wir waren nur noch knapp vierhundert Schritte von ihnen entfernt, und wenn sie sich jetzt nicht beeilten, dann würden wir an ihnen vorbeiziehen, ohne dass sie uns aufhalten konnten.
Als ich gerade begann, die Begegnung doch für einen harmlosen Zufall zu halten, schrie Erkanbert neben mir auf.
«Scheiße! Noch eins!»
Tatsächlich: Rechts von uns, halb verborgen hinter einer ausladenden Weide, lag in einer kleinen Bucht ein zweites Schiff, etwa genauso groß wie das erste, ebenfalls mit mindestens zwanzig Männern besetzt. Das konnte kein Zufall mehr sein.
Wieder begannen Erkanberts Leute durcheinanderzureden, doch obwohl wir wahrscheinlich geradewegs in eine Falle fuhren, gerieten sie nicht in Panik. Ein paar von ihnen wechselten zur anderen Seite. Bogen wurden gespannt.
«Schneller!», schrie Erkanbert. «Los, los, los!»
Noch einmal steigerten unsere Ruderer den Takt, wir flogen nur so dahin und hatten uns ihnen schon ein ganzes Stück genähert, als ein scharfes Kommando aus der Bucht ertönte. Auf beiden dänischen Schiffen kam Bewegung in die Mannschaften. Sie begannen nun selbst zu rudern, allerdings nicht mit der Strömung, sondern gegen unsere Fahrtrichtung, als wollten sie uns möglichst schnell vorbeilassen.
«Was zum Teufel haben die vor?», zischte Erkanbert.
Plötzlich wurde in dem Schiff rechts von uns ein weiterer Befehl gebrüllt, und mit einem Schlag begriff ich, warum sie sich nicht die Mühe machten, uns zu verfolgen: Im Heck der beiden dänischen Schiffe begannen ein paar Männer mit kräftigen und gut eingespielten Bewegungen, ein Seil aus dem Fluss zu ziehen, das zwischen ihnen über die ganze Breite der Maas verlief. Wie zwei Seeschlangen hoben die Enden sich triefend aus dem Wasser und wuchsen zur Flussmitte hin aufeinander zu; die zunehmende Spannung des Seils drehte die beiden Schiffe, bis sie wie zwei sich schließende Schleusentore zuerst schräg und dann quer zum Flussverlauf standen. Die Lücke zwischen ihnen war vielleicht zweihundert Schritte breit, und indem die Ruderer und die Männer an den Seilenden gegeneinander arbeiteten, strafften sie das Seil immer weiter.
«Schneller!», schrie Erkanbert wieder. «Wir schlüpfen durch!»
Wir waren jetzt fast auf ihrer Höhe. Tatsächlich sah es so aus, als ob wir es schaffen würden, das Seil mit unserem Kiel nach unten zu drücken und darüber hinwegzugleiten, doch als wir die Stelle beinahe erreicht hatten, hob sich das letzte noch untergetauchte Stück aus dem Wasser und offenbarte ein tropfendes und spritzendes Gewirr von Knoten und Maschen: Sie hatten ein Netz aufgespannt. Triumphgeschrei brandete über das Wasser heran, Schwerter und Äxte blitzten auf.
«Ruder hoch!», brüllte Erkanbert.
Und dann geschah alles gleichzeitig: Auf den dänischen Schiffen erhoben sich mindestens zehn Bogenschützen, die ihre Waffen hinter den Bordwänden verborgen bereitgehalten hatten. Die ersten Pfeile zischten heran, Erkanbert wurde in die Brust getroffen und kippte mit einem kehligen Aufschrei kopfüber ins Wasser. Ich duckte mich, die Männer im Schiff rissen ihre Schilde hoch, weitere Pfeile schlugen klackernd irgendwo ein, die Ruderer ließen die Holme los und kauerten sich hin. Ein panisches Wiehern erklang, gefolgt von einem Platschen, das so laut war, als hätte ein Riese einen Findling ins Wasser geworfen. Das Schiff schaukelte. Ein lautes Knarren ertönte, der Rumpf erzitterte und wurde spürbar gebremst.
Ich hob den Kopf. An Bord herrschte Chaos. Zwei Verwundete lagen auf den Planken, unsere Männer hielten ihre Waffen umklammert, Blicke hetzten hin und her, drei oder vier von ihnen spannten ihre Bogen und schossen zurück.
Sleipnir hatte sich losgerissen und war ins Wasser gesprungen; ich konnte nicht sehen, ob er getroffen war oder nicht, sein Kopf mit den panisch aufgerissenen Augen ragte aus den Wellen hinter dem Schiff auf und bewegte sich ruckartig vor und zurück, während mein Pferd versuchte, sich über Wasser zu halten.
Unser Vordersteven war zu steil, um das Netz nach unten zu drücken, wir hatten uns darin verfangen wie ein riesiger Fisch, auch einige der Ruder steckten zwischen den Maschen. Von einem Augenblick auf den anderen waren wir manövrierunfähig geworden.
Der Rumpf ächzte unter dem Zug der Seile, und weil wir immer noch Fahrt hatten, spannten sie sich nur noch straffer und drehten die beiden dänischen Schiffe wie von selbst wieder in die Strömung, wobei sie sich wie eine riesige Greifzange aufeinander zubewegten. Ohne auf die paar Pfeile zu achten, die von unseren Männern auf sie abgeschossen wurden, holten die Dänen mit kraftvollen Bewegungen die Seilenden ein und verkürzten so den Abstand immer weiter. Erkanbert war nicht mehr zu sehen. Sein Kettenhemd musste ihn auf den Grund gezogen haben.
An ein Entkommen war nicht zu denken. Fast alle unsere Männer drängten sich im Heck zusammen, einige versuchten noch, die Ruder aus dem verhedderten Gewirr von Maschen und Knoten zu reißen, schafften es aber nicht, weil sie immer wieder in Deckung gehen mussten. Die Dänen zogen die Seile unerbittlich weiter an, als würden sie einen harpunierten Wal anlanden. Ihre Ruderer hatten inzwischen ebenfalls die Waffen ergriffen und die Ruder eingezogen, damit sie beim Entern nicht im Weg waren. Armlänge um Armlänge arbeiteten sie sich an uns heran. Ab und zu flogen Pfeile hin und her. Als einer von ihnen getroffen wurde und über Bord ging, übernahm sofort der Nächste seinen Platz.
Ich stieg zwischen den kreuz und quer aufragenden Holmen der Ruder mit dem Schwert in der Hand zum Heck des führerlos dahintreibenden Schiffes und griff mir im Laufen einen herumliegenden Schild. Der Hinterhalt an der Flussbiegung, die Länge der Seile, die Geschwindigkeit der Strömung und des Schiffs, das genau im richtigen Augenblick aus dem Wasser gehobene Netz, die Pfeilsalve, die unsere Ruderer im entscheidenden Moment in Verwirrung gestürzt und unseren Anführer außer Gefecht gesetzt hatte: Alles war so geplant und ausgeführt, dass sie uns gleichzeitig von beiden Seiten längsseits packen konnten.
Zwanzig Schritte noch. Niemand sagte mehr ein Wort, alle starrten angespannt auf die Gegner, die sich unaufhaltsam von beiden Seiten an uns heranschoben. Außer dem Knarren der Seile und des Holzes war kaum ein Laut zu hören. Sleipnir war weit zurückgefallen, aber er schien nicht verletzt zu sein, sein Kopf ruckte immer noch vor und zurück, während er auf das rechte Ufer zuschwamm. Ich fragte mich, ob ich ihn jemals wiedersehen würde.
Unsere Leute standen in zwei dichten Reihen zu beiden Seiten im hinteren Teil des Rumpfes und erwarteten den Zusammenstoß. Trotz der fast aussichtslosen Situation waren sie ruhig und konzentriert. Erkanbert hatte eine hervorragende Truppe zusammengestellt. Ich sah aus den Augenwinkeln, wie sie ihre Gegner und deren Bewaffnung musterten und abzuschätzen versuchten, wer wohl als Erstes an Bord springen würde.
«Kommt ruhig näher, ihr Scheißer», knurrte einer.
Unter den Helmen auf den anderen Schiffen sah ich die grinsenden Gesichter der Dänen, allesamt gut genährte Kerle mit kräftigen Armen, denen es in Asselt trotz der Belagerung offenbar an nichts gefehlt hatte. Einige trugen Kettenhemden und silberne Armreifen, die meisten hatten Bärte mit eingeflochtenen Perlen. Vorn im Bug hatten sie einen Pulk gebildet, um die Männer an den Seilenden mit einer Wand aus Schilden vor unseren Pfeilen zu schützen, doch von unserer Seite schoss ohnehin niemand mehr. Alle hielten Schwerter und Speere umklammert.
Waren Siegfried und Gottfried wirklich so dreist? Oder waren das Renegaten, die sich davongestohlen hatten und auf eigene Faust reich werden wollten?
Ich reihte mich zwischen zwei Männern auf der rechten Seite unseres Schiffes ein, fast ganz hinten am Heck. Zwei finstere und entschlossene Gesichter nickten mir zu. Zehn Schritte noch.
Weit hinten kämpfte Sleipnir sich ans Ufer und schüttelte sich. In der durchnässten Satteltasche steckte das Pergament, mit dem Franco mir meine Rechte zurückgegeben hatte. Falls ich diesen Tag überlebe, wird er die Urkunde wohl noch einmal ausstellen müssen, schoss es mir durch den Kopf, dann sirrte eine Pfeilsalve heran, und ich konnte gerade noch rechtzeitig in Deckung gehen. Wieder klackerte es trocken, als die Geschosse rechts und links von mir einschlugen. Niemand wurde getroffen, aber das war auch gar nicht ihre Absicht gewesen. Sie waren auf beiden Seiten inzwischen bis auf zwei Armlängen an uns herangekommen und wollten uns mit ihren Pfeilen ein letztes Mal in Deckung zwingen, um den Augenblick zum Entern zu nutzen. Die Lücke zwischen den Bordwänden unserer Schiffe schrumpfte zu einem Spalt zusammen. Einige unserer Ruder wurden von ihrem Rumpf nach unten gedrückt, sodass die Holme zwischen uns hochschnellten, andere verkanteten sich zwischen Schiff und Netz und zerbrachen.
Dann war es so weit. Einer der Dänen, die in der zweiten Reihe standen, reckte sein Schwert in die Luft und schrie ein Kommando, und im selben Augenblick stießen die Rümpfe zusammen und schlossen die letzte Lücke über dem Wasser. Ein fürchterliches Gebrüll erhob sich, und alle Dänen sprangen auf und stürzten sich auf uns. Mit ohrenbetäubendem Krachen prallten die Schilde aufeinander, und sofort begann ein blindwütiges Hauen und Stechen. Anders als bei einem Kampf an Land mussten sie es beim ersten Versuch schaffen, in unsere Reihen einzubrechen, denn der gleichzeitige Absprung von einem Dutzend Männern schob ihr Schiff wieder ein Stück von uns weg. Während ich versuchte, einen der hinter seinem grün und weiß gemusterten Schild verborgenen Angreifer mit meinem Schwert zu erwischen, flog ein eiserner Haken an einem Seil über meinen Kopf hinweg, landete auf den Planken, schabte über das Holz, verfing sich irgendwo, aber ich achtete nicht darauf, denn nachdem ein Schwerthieb meines Gegners von meinem Schildbuckel abgeprallt war, sah ich plötzlich seinen Fuß vor mir auf der Bordwand, stach zu und säbelte ihm die halbe Wade durch. Mit einem Schrei aus Wut und Schmerz zog er das verletzte Bein zurück, trat ins Leere und verlor das Gleichgewicht, sodass ich ihn mit meinem Schild zurückstoßen konnte. Er ließ seine Waffe fallen, ruderte mit den Armen und stürzte in sein Schiff zurück, wobei er einen der Nachdrängenden mit sich zu Boden riss. Die beiden Männer rechts und links von mir hatten es ebenfalls geschafft, ihre Gegner ein Stück von sich wegzuschieben. Der Spalt zwischen den Rümpfen verbreiterte sich, und ein tollkühner Däne, der mit einem Satz in unsere Reihe einbrechen wollte, sprang direkt in das Schwert eines meiner Nebenmänner, weil er im Flug seinen Schild zu weit hochgerissen hatte. Die kurze Atempause nutzten zwei unserer Leute, um den Rumpf des dänischen Schiffes mit ihren Speeren weiter von uns wegzudrücken, und vielleicht wäre ihnen das auch gelungen, wenn unsere Reihe auf der anderen Seite unseres Schiffes standgehalten hätte. Dort aber waren inzwischen vier Dänen an Bord gelangt und hatten einige unserer Leute niedergestochen, und jetzt kam ihnen ihre Überzahl zugute: Während die vier Angreifer die restlichen Verteidiger auf Abstand hielten, sprangen sechs weitere in ihrem Rücken in den unbesetzten vorderen Teil unseres Schiffes, sodass wir nun auch von dort in Bedrängnis gerieten.
Das dänische Schiff auf unserer Seite war zwar ein Stück weggetrieben worden, aber vorn holten sie das Seil weiter ein, sodass ihr Bug gegen unseren gezogen wurde, woraufhin die gesamte Besatzung ebenfalls zu uns an Bord stieg und bis zum Mast vorrückte. Damit hatten sie uns so weit zusammengedrängt, dass wir uns gegenseitig behinderten. Das inzwischen unbemannte Schiff auf unserer Seite hatte sich wieder ein Stück abgelöst, dafür schleuderten sie von links nun auch noch Speere auf uns, denen wir wegen des Gedränges kaum ausweichen konnten. Zusammen mit drei anderen von Erkanberts Männern versuchte ich, die Reihe der vom Bug herandrängenden Angreifer auf Abstand zu halten; einer von ihnen holte mit seiner Axt aus, ich sprang einen Schritt zurück, und die Klinge zerschlug eine der Schatzkisten. Ein Sturzbach aus Silber quoll heraus, Münzen, Ketten, Kelche und Kannen schlitterten und kullerten über den Schiffsboden und nahmen die Gier und die Aufmerksamkeit des Dänen einen winzigen Augenblick zu lange in Anspruch. Ich erwischte ihn unter dem Schlüsselbein, und er fiel mit dem Gesicht in die glitzernde Lache. Vielleicht nicht das schlechteste Ende für einen wie dich, dachte ich noch, aber in diesem Augenblick traf ein furchtbarer Hieb von der linken Seite meinen Schild und schlug mir die hölzerne Kante gegen die Stirn. Ich taumelte zwei Schritte nach rechts, ließ das Schwert fallen, wollte mich an der Bordwand festhalten, griff aber ins Leere und fiel. Das Letzte, was ich sah, war ein wüstes und von Gebrüll untermaltes Gewoge aus Leibern und Klingen im Heck unseres Schiffes, wo die Dänen die verbliebenen Verteidiger einen nach dem anderen niedermachten. Und das Letzte, was ich dachte, war, dass Franco nun wohl doch keine neue Urkunde würde ausstellen müssen.
Es war das verdammte Netz, das mich rettete. Wäre ich ungebremst in den Fluss gefallen, wäre ich wohl ertrunken. Obwohl ich statt des Kettenhemdes nur einen leichten Lederpanzer trug, schlug ich wie ein Stein auf der Wasseroberfläche auf, doch anstatt im kalten Wasser zu versinken, wurde ich von den Maschen aufgefangen. Ich bekam den Schaft eines Ruders zu fassen und zog mich so weit daran hoch, dass mein Kopf wieder auftauchte. Das Wasser in meinen Ohren verzerrte den Kampflärm, der über die Bordwand herunterschwappte, zu einem gedämpften Geräuschbrei aus Klirren und Dröhnen, der schnell abebbte.
Ich blickte mich um. Offenbar hatten die Dänen das Seil in ihrem Schiff festgebunden, bevor sie uns geentert hatten; das Schiff trieb nicht ab, sondern schwamm etwa fünfzehn Schritte entfernt verlassen mit der Strömung und hielt das Seil so straff, dass das Netz weder versank noch unter unserem Schiff durchrutschte. Das Ruder, an dem ich mich festklammerte, hatte sich irgendwo verkantet, jedenfalls glitt es nicht aus der Öse, als ich mich vorsichtig näher an den Rumpf heranzog und zitternd versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen.
Oben war der Kampf vorbei. Nachdem ich das Wasser aus meinen Ohren geschüttelt hatte, hörte ich noch ein paar Schreie, dann platschte es mehrmals, gefolgt von einem lauten Wortwechsel auf Dänisch. Offenbar massakrierten sie die Verletzten und warfen sie über Bord.
Ich versuchte, das Dröhnen in meinem Kopf zu ignorieren, und überlegte fieberhaft, was ich tun konnte. Wenn sie mich entdeckten, würden sie mich bequem von oben mit einem Speer aufspießen können, aber solange ich mich nicht von der Stelle bewegte und sie sich nicht hinausbeugten, würden sie mich nicht sehen, und wahrscheinlich war ihnen jetzt vor allem daran gelegen, sich schnell aus dem Staub zu machen. Doch auf dem Fluss wäre es unmöglich, einfach spurlos zu verschwinden. Sobald der Überfall bemerkt werden würde, würde man sie jagen. In Asselt konnten sie sich nicht blicken lassen: Wenn sie Siegfried und Gottfried um ihre Beute betrogen hatten, würde sich die halbe dänische Flotte an ihre Fersen heften, und falls sie mit ihnen unter einer Decke steckten, würden sie den Schatz nicht ausladen können, ohne dass die noch in Roermond und in den Lagern vor Asselt verbliebenen Kontingente unseres Heeres sie dabei sahen. Unsere Reiter würden sie am Ufer verfolgen, bis sie irgendwo an Land zu gehen versuchten. Also würden sie die Kisten wahrscheinlich gleich hier ausladen und die Schiffe sich selbst überlassen. Mit dem, was sie gerade erbeutet hatten, konnten sie sich eine ganze Flotte kaufen.
Ich zog mich ein Stück hoch und spähte vorsichtig durch die Ruderöse. Was ich sah, bestätigte meine Vermutung: Die meisten der Dänen, etwa fünfundzwanzig Mann, waren inzwischen in das Schiff auf der anderen Seite umgestiegen und hatten die Ruder besetzt; einige andere sammelten die herumliegenden Waffen ein, und vier weitere wuchteten, begleitet von anfeuernden und triumphierenden Rufen und kehligem Gelächter, die Kisten mit dem Schatz herüber. Kaum mehr als zwei Schritte von mir entfernt waren schließlich zwei Dänen damit beschäftigt, das Silber aus der geborstenen Kiste vom Boden aufzusammeln und in einen Sack zu befördern. Den Toten, der über dem Schatz zusammengebrochen war, hatten sie achtlos an die Seite gewälzt. Hätten sie in diesem Augenblick zur Ruderöse herübergeschaut, hätten sie mich möglicherweise entdeckt, aber natürlich waren sie viel zu gierig, um den Blick von der glitzernden Herrlichkeit abzuwenden, die ihnen irgendwo ein sorgenfreies Leben als Räuber im Ruhestand verhieß. Als sie fertig waren, reichten sie den Sack an ihre Kameraden auf dem anderen Schiff weiter, die ihn mit zufriedenen Gesichtern entgegennahmen.
Ein halbes Dutzend Männer lag über den Schiffsboden verstreut, darunter auch drei Dänen. Als einer von ihnen, der immer noch sein Schwert umklammert hielt, aufstöhnte und sich auf die Seite zu wälzen versuchte, ergriff einer der beiden, die den Sack gefüllt hatten, sein Schwert und stieß es ihm fast beiläufig in den Bauch, während der andere so tat, als würde er es nicht bemerken. Ein gurgelnder Aufschrei, ein kurzes Aufbäumen, und schon war es wieder einer weniger, mit dem sie die Beute würden teilen müssen, abgesehen davon, dass sie es sich ohnehin nicht leisten konnten, auf der Flucht einen Verwundeten durch die Gegend zu schleppen. Immerhin war dieser hier mit dem Schwert in der Hand gestorben und konnte damit rechnen, in Walhalla wieder aufzuwachen. Galt das eigentlich auch, wenn man von den eigenen Leuten abgestochen wurde?
Die beiden warfen einen Blick in die Runde, stiegen dann als Letzte über die Bordwand in ihr eigenes Schiff, von dem aus meiner Position nur der aufragende Achtersteven zu sehen war, und stießen sich ab. Auf einen Ruf hin begannen die Ruder zu schlagen, und sie entfernten sich. Bis auf ein paar halblaute Kommandos und das Gluckern des Wassers unter dem Kiel unseres dahintreibenden Schiffes war kaum ein Laut zu hören.
Als nichts mehr von ihnen zu sehen war, griff ich nach der Bordwand, zog mich hoch, wuchtete mich hinüber und ließ mich auf den Boden fallen. Immer noch zitterte ich. Die Hose klebte an meinen Beinen, der Lederpanzer hatte sich mit Wasser vollgesaugt und zwängte meine Brust ein. Direkt neben meinem Kopf lag eine Silbermünze, die sie übersehen hatten, ein arabischer Dirhem, der irgendwann in Bagdad oder Medina geprägt worden war und nach einer langen Reise über Land und Meer und durch viele Hände hier als letzter Zeuge des Überfalls gelandet war. Mein Kopf dröhnte. Ich nahm den Helm ab und ertastete eine blutige Beule an meiner Stirn. Es war keine schwere Verletzung, aber sie pochte, als würde jemand mit einem Hammer einen zermürbenden Takt gegen meinen Schädel schlagen.
Ich stemmte mich hoch und kroch auf allen vieren zur anderen Seite des Schiffes. Mir war schwindelig und übel, aber ich kämpfte den Brechreiz nieder, arbeitete mich zu einer Ruderöse vor und spähte hindurch.
Es war, wie ich vermutet hatte: Sie ruderten quer zur Flussrichtung auf das westliche Ufer zu, sodass die Strömung sie auf gleicher Höhe mit mir hielt. Das Schiff war mit mehr als dreißig Männern ziemlich überladen, und die breiten Schultern der Kerle, die im Heck standen, verbargen die Ruderer vor meinen Blicken und mich vor ihren. Am Ufer stand ein Stück flussabwärts ein mit zwei Pferden bespannter Wagen bereit, außerdem vier Männer, die das Fuhrwerk begleitet hatten und jetzt ins Wasser wateten, um die Ankömmlinge in Empfang zu nehmen. Nur wenige Augenblicke später lief das Schiff mit einem satten Knirschen auf den Kies auf. Während ich langsam an ihnen vorbeitrieb, beobachtete ich, wie die Männer von Bord sprangen, das Schiff ein Stück auf die Böschung zogen und dann mit dem Ausladen begannen. Zwanzig Dänen bildeten eine Kette, die in Windeseile Beute und Waffen durchreichte. Als alles auf der Ladefläche verstaut war, zogen sie eine lederne Plane darüber, zurrten sie fest, wendeten den Wagen und machten, dass sie vom Ufer wegkamen. Hinter der Böschung fiel das Gelände ab, sodass sie schon kurz darauf aus meinem Blickfeld verschwunden waren.
Ein Dutzend Männer, die zurückgeblieben waren, schoben das Schiff ins Wasser zurück. Sie wateten bis zu den Hüften in den Fluss, und mit einem letzten Ruck beförderten sie es in die Strömung, die es aufnahm und langsam weitertrieb. Es war ein letzter kluger Schachzug: Die drei Schiffe würden von der Maas davongetragen werden, und weil niemand den Überfall beobachtet hatte, würde sich schon bald kaum noch feststellen lassen, wo er genau stattgefunden hatte. Wir befanden uns nach meiner Schätzung etwa fünfzehn Meilen nördlich von Maastricht, wo die sandigen Böden nur wenig Ertrag abwarfen, sodass die Landschaft, die sich westlich des Flusses ausbreitete, vor allem aus Heideflächen und Wäldern bestand. Es gab nur wenige Dörfer, die Wege waren schlecht ausgebaut und kaum befahren. Wenn niemand sie verfolgte, würde ihre Spur sich bald verlieren. Die Schiffe würden mehrere Stunden brauchen, bis sie in Roermond vorbeitrieben, wenn sie nicht vorher irgendwo hängen blieben, sodass die ersten berittenen Suchtrupps sich wahrscheinlich erst am späten Nachmittag auf den Weg machen würden, ohne überhaupt zu wissen, auf welcher Seite des Flusses sie suchen sollten.
Ich überlegte, was ich tun konnte. Der Überfall war so gut geplant gewesen, dass die Dänen zweifellos auch ihre Flucht sorgfältig vorbereitet hatten. Wahrscheinlich hatten sie irgendwo einen Unterschlupf, wo sie Pferde bereithielten, und dann würden sie den Schatz auf ihre Satteltaschen verteilen und auf Nimmerwiedersehen im Land verschwinden: über Brabant ins Westfrankenreich, über Toxandrien an den Unterlauf der Maas oder gleich bis an die Nordseeküste, wo möglicherweise schon ein weiteres Schiff auf sie wartete. Vielleicht teilten sie die Beute auch sofort unter sich auf und gingen dann ihrer Wege. Was auch immer sie vorhatten, eins war klar: Wenn ich mich nicht an ihre Fersen heftete, würden fünfhundert Pfund Silber und hundert Pfund Gold wohl auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Die Vorstellung, dass sie mit ihrem dreisten Überfall durchkommen würden, ärgerte mich maßlos. Aber warum eigentlich? War das vielleicht meine Angelegenheit? Hatte ich für den Kaiser in den letzten Monaten nicht oft genug meine Haut riskiert?
Und doch konnte ich nicht anders. Als am Ufer niemand mehr zu sehen war, richtete ich mich auf. Eine Welle aus Schwindel und Übelkeit schwappte durch mich hindurch, sodass ich mich kurz am Mast festhalten musste. Als das Bild der Landschaft vor meinen Augen endlich aufgehört hatte, sich zu drehen, war ich schon fast fünfhundert Schritte von der Stelle weggetrieben worden, an der die Dänen die Kisten ausgeladen hatten. Das Schiff hatte sich dabei dem Westufer der Maas bis auf Steinwurfweite genähert, und weil der Fluss hier in eine sanfte Linksschleife überging, war das Wasser an dieser Stelle wahrscheinlich schon so flach, dass man stehen konnte.
Mit einem Seufzer stieg ich über die Bordwand und ließ mich vorsichtig ins Wasser hinab. Das Netz hatte keine Spannung mehr, denn die Dänen hatten das Seil ins Wasser geworfen, bevor sie ihr Schiff mit der Beute ans Ufer gebracht hatten. Es war unter den Kiel gerutscht und wurde nur noch von den Rudern gehalten, die sich darin verfangen hatten. Ich spürte, wie die Maschen unter meinem Gewicht nachgaben und träge nach unten sackten. Ich packte eins der Ruder, ließ mich weiter hinuntergleiten, und als das Wasser mir gerade bis zur Brust reichte, fühlte ich den sandigen Boden unter meinen Füßen. Ich ließ das Ruder los, machte einen vorsichtigen Schritt, verhedderte mich, konnte den Fuß aber aus den Maschen ziehen und war mit zwei weiteren Schritten auf sicherem Grund.
Ich watete an Land und fluchte. So wie es aussah, würde ich mal wieder derjenige sein, der den Karren für den Kaiser aus dem Dreck zog.
3
Ich erklomm die Böschung, kauerte mich hinter ein Gebüsch an der Uferstraße und sah gerade noch, wie der Pulk der Dänen mit dem Pferdewagen in einem Wäldchen verschwand. Die Straße lag verlassen da. Zu Fuß würde ich mindestens zwei Stunden bis nach Roermond brauchen, und bis man dort eine Mannschaft zusammengetrommelt hatte, wären sie irgendwo in den Wäldern verschwunden. Wenn ich wenigstens ein Pferd gehabt hätte!
Doch es half alles nichts. Mein Kopf hämmerte immer noch, der Panzer und die nassen Kleider klebten auf meiner Haut, aber wenn ich sie nicht entkommen lassen wollte, musste ich hinterher. Bevor ich mich auf den Weg machte, warf ich einen letzten Blick auf den Fluss, wo die drei verlassenen Schiffe friedlich in Richtung Norden dahintrieben. Unseres hatte sich quer zur Strömung gelegt und das Netz abgestreift. Wenn man nicht genau hinschaute, sah man noch nicht einmal die Toten an Bord.
Es war früher Nachmittag, und der Himmel hatte sich unbemerkt zugezogen. Die Gegend bot einen trostlosen Anblick. Brachland und verlassene Weiden wechselten sich ab. Ich raffte mich auf und folgte mit schmerzendem Kopf und schweren Gliedern der Spur, die der Wagen unter dem Gewicht von Gold, Silber und Waffen auf dem trockenen Grasboden hinterlassen hatte. Immerhin wurde mir beim Laufen wärmer, doch mein Problem war ohnehin ein ganz anderes: Wenn sie mich entdeckten, würden sie nicht lange fackeln. Es reichte, dass ein paar von ihnen kehrtmachten und mich durch den Wald oder über die Heide jagten, und ich hatte noch nicht einmal eine Waffe. Sollte ich wirklich mein Leben aufs Spiel setzen, nur um ihnen die Beute abzujagen? Und wie sollte ich das überhaupt anstellen? Sie waren drei Dutzend, ich dagegen war allein, unbewaffnet und angeschlagen. Doch eine merkwürdige Mischung aus Pflichtgefühl und Unbeugsamkeit, ein kaum zu bändigender und fast tollkühner Drang, sie nicht mit ihrer Dreistigkeit durchkommen zu lassen, trieb mich an und ließ mich weiter einen Schritt vor den anderen setzen.
Als ich den Wald erreicht hatte, kniete ich mich ins Unterholz und lauschte. Tatsächlich waren in der Ferne ihre Stimmen zu hören. Ihr Leichtsinn wunderte mich. Ich hätte die Gruppe aufgelöst und die Männer auf verschiedenen Wegen zu irgendeinem Treffpunkt geschickt oder gleich ganz entlassen. Warum blieben sie überhaupt zusammen, nachdem der Raubzug so reibungslos verlaufen war? Gab es noch andere, mit denen sie teilen mussten?
Während ich darüber nachdachte, folgte ich weiter der Spur. Es war erstaunlich, wie gut der Wald die Geräusche weitertrug. Die Stimmen waren deutlich zu hören, aber schwer zu orten und schienen gleichzeitig von überall zu kommen. Hätten die Wagenspuren mir nicht die Richtung angezeigt, hätte ich noch nicht einmal sagen können, ob die Bande sich überhaupt noch vor mir befand. Ab und zu glaubte ich, in der Ferne eine Bewegung zwischen den Baumstämmen wahrzunehmen, aber ich war mir nicht sicher. Jedes Mal wenn ein Ast unter meinen Füßen knackte, blieb ich stehen und äugte in alle Richtungen wie ein Reh, das ein Wolfsrudel gewittert hat.
Mehrere Stunden lang folgte ich ihnen zwischen Buchen und Eichen hindurch, über knorrige Wurzeln und durch schlammige Wildschweinsuhlen, aber merkwürdigerweise machte das Laufen mich nicht müde, sondern ließ meine Kräfte langsam zurückkehren. Den Lederpanzer hatte ich ausgezogen und mir über die Schulter gehängt, damit er schneller trocknete, und die frische Luft vertrieb Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. In einer kleinen Senke fand ich einen Tümpel, an dem ich, auf dem Bauch liegend, meinen Durst stillte. Das Wasser schmeckte erdig und etwas faul, und als ich mich wieder erhob, war ich über und über mit Schlamm bedeckt. Ich schmierte mir den graubraunen Matsch zusätzlich ins Gesicht, für den Fall, dass ich mich an sie heranschleichen musste. Während ich mir die Hände an den Hosenbeinen abwischte, fragte ich mich erneut, ob ich eigentlich noch ganz bei Trost war. Anschleichen? An drei Dutzend bewaffnete Dänen? Unwillkürlich musste ich in diesem Augenblick an meinen Freund Gauzbert denken. Er hätte genau das getan. Ich musste grinsen.
Und weiter ging es, immer den Spuren und den Stimmen nach. Sie mussten die Gegend vorher genau ausgekundschaftet haben. Mehrmals gabelte sich der Weg, der zwischendurch kaum mehr als ein Trampelpfad durchs Unterholz war. An einigen Stellen reichte er bis dicht an den Waldrand, aber jedes Mal führte die Spur im Schutz der Bäume weiter, anstatt in die offene Heidelandschaft zu münden. Sie mieden freies Gelände und nahmen dafür wiederholte Richtungsänderungen in Kauf, sodass ich bald nicht mehr wusste, in welche Himmelsrichtung wir unterwegs waren.
Überhaupt war mir schleierhaft, wie sie es auf diese Weise anstellen wollten, unbemerkt außerhalb der Reichweite der Suchtrupps zu bleiben, die wahrscheinlich gerade in diesem Augenblick in Roermond und in Asselt zusammengestellt wurden, während Boten nach Maastricht galoppierten, damit auch von dort aus Reiter losgeschickt werden konnten. Ich fragte mich, auf welcher Seite des Flusses unsere Leute die Dänen eher vermuten würden: hier im Westen, wo die schwache Besiedlung ihnen das unbemerkte Vorwärtskommen erleichterte, oder drüben im Osten, wo sie viel mehr Dörfer und Städte umgehen mussten, dafür aber nach zwei Tagen den Rhein erreichen und zu Schiff entkommen konnten? Und was würden Siegfried und Gottfried tun? Würden sie die Räuber jagen und bestrafen, oder würden sie sich heraushalten und es dem Kaiser überlassen, der Bande die Kisten wieder abzujagen, um sie anschließend vereinbarungsgemäß in Asselt zu übergeben?
Irgendwann, es musste schon auf den Abend zugehen, kam die Sonne wieder durch, und ich stellte zu meiner Verwunderung fest, dass die Dänen sich nach Südwesten bewegten. Wenn sie diese Richtung beibehielten, würden sie nach meiner Schätzung irgendwo bei Tongern landen. Hatten sie dort ein Versteck, in dem sie sich vor den Suchtrupps verbergen wollten, um dann ungehindert weiterzuziehen? Aber wohin?
Eine weitere Stunde verging, dann wurden die Stimmen lauter. Ich verlangsamte meine Schritte. Plötzlich bemerkte ich eine Bewegung weit vor mir zwischen den Bäumen. Ich duckte mich hinter den halb vermoderten und von Schwammpilzen überwucherten Stamm einer entwurzelten Buche. Rechts von mir verlief hoch oben parallel zum Waldweg eine Felskante. Zwischen Gestrüpp und Farnen sah ich graues Gestein hervorlugen.
Und dann entdeckte ich einen der Dänen. Er kletterte an einer weniger steilen Stelle den Hang hinauf, wobei er geschickt die aus dem Boden ragenden Wurzeln als Trittstufen benutzte. Als er oben angekommen war, blickte er in die Runde, als wollte er die Umgebung für einen Rastplatz sichern. Während ich ihn beobachtete, kam mir plötzlich eine Idee: Vielleicht wollten sie die Kisten gar nicht durchs Land schleppen, sondern an einer gut geschützten Stelle im Wald vergraben, um sie heimlich zu bergen, wenn die Suche eingestellt worden war. Je länger ich über diese Möglichkeit nachdachte, desto wahrscheinlicher erschien sie mir. Ich musste mich vergewissern, was sie dort trieben. Ich musste näher heran.
Der Späher blieb auf dem Felskamm. Er ging hierhin und dorthin, verschwand ab und zu zwischen den Baumstämmen, erschien aber jedes Mal nach kurzer Zeit wieder in meinem Blickfeld. Die anderen blieben unsichtbar, doch ihre Stimmen waren weiterhin gut hörbar und entfernten sich nicht. Sie hatten angehalten. Bereiteten sie ein Nachtlager vor, oder legten sie nur eine kurze Rast ein? Wahrscheinlich hatten sie Vorräte mitgeführt oder zuvor in ihrem Versteck deponiert, schließlich hatten sie auch sonst an alles gedacht. Beim Gedanken an ein Lagerfeuer mit saftigem Fleisch lief mir das Wasser im Mund zusammen.
Irgendwann setzte die Dämmerung ein, und die Stimmen wurden gedämpfter, aber sie entfernten sich nicht, sondern gaben sich offensichtlich Mühe, leiser zu sprechen. Der Späher wurde von einem anderen Mann abgelöst. Alles deutete darauf hin, dass sie vorhatten, noch eine Weile an Ort und Stelle zu bleiben. Vielleicht waren sie tatsächlich gerade damit beschäftigt, die Kisten zu vergraben und die Stelle mit Laub und Zweigen zu tarnen, um sich dann im Schutz der Dunkelheit aufzuteilen.
Mein Blick wanderte zu der Wagenspur, und ich wunderte mich über ihren Leichtsinn. Spätestens morgen würde einer der Suchtrupps auf die Furchen und auf die Hufabdrücke aufmerksam werden und die richtigen Schlüsse ziehen; es war nicht auszuschließen, dass schon jetzt die ersten Reiter des Kaisers durch die Heide galoppierten und sie entdeckt hatten. Wäre ich an der Stelle der Dänen gewesen, hätte ich zumindest einen Späher auch in diese Richtung zurückgeschickt, um den Waldweg abzusichern und die anderen rechtzeitig vor Verfolgern zu warnen, damit sie nicht überrumpelt wurden.
Ich beschloss, mich ein Stück zu entfernen. Ohne den Wachposten auf dem Felskamm aus den Augen zu lassen, robbte ich rückwärts bis hinter einen Baum. Vorsichtig spähte ich hinüber, und als der Däne mir den Rücken zuwandte, rannte ich geduckt zum nächsten Stamm, ging wieder in Deckung und immer so weiter, bis er nicht mehr zu sehen war. Dann stieg ich selbst die Böschung hinauf, nur um festzustellen, dass der Wald kurz dahinter zu Ende war. Unter Eichen und Buchen zog sich ein Saum aus Gestrüpp entlang, dahinter öffnete sich die Heide, die am Horizont von einem weiteren Waldstreifen begrenzt wurde, über dem gerade die Abendsonne versank. Ich begriff, warum der Wachposten dort drüben stand: Auf der gesamten freien Fläche würde ihm keine Bewegung entgehen. Er würde eventuelle Verfolgergruppen in aller Ruhe durchzählen und beobachten können, in welche Richtung sie unterwegs waren, und dann konnten sie entscheiden, ob sie sich tiefer in den Wald zurückziehen oder ihnen einen Hinterhalt legen wollten.
Ich stieg wieder hinunter und stand eine Weile unschlüssig bei der Wagenspur herum. Mit dem schwindenden Licht schien der Wald die Geräusche noch weiter zu tragen, ich vernahm einzelne dänische Worte und zwischendurch ein wiederholtes Klimpern. Wühlten sie in den Kisten herum? Teilten sie die Beute auf? Versenkten sie den Schatz in einem Erdloch?
Ein Stück abseits des Pfades stand eine alte Eiche. Vielleicht konnte man von ihrem knotigen Geäst aus etwas mehr sehen, also huschte ich zu dem Baum. Äste knackten, Laub raschelte, als ich hinaufstieg und mich rittlings auf einen dicken Ast zwei Manneslängen über dem Boden setzte. Viel mehr war von dort aus nicht zu erkennen, nur der Späher zeigte sich ab und zu zwischen den Bäumen, aber weil ich hinter Zweigen und Laub besser verborgen war als im Unterholz, beschloss ich, dort oben die Dunkelheit abzuwarten. Ich konnte mir immer noch nicht vorstellen, dass sie die ganze Nacht an einer Stelle verbringen und damit wertvolle Zeit verschenken wollten. Irgendetwas hatten sie vor. Irgendetwas würde passieren.
Hinter dem Höhenzug war die Sonne inzwischen untergegangen. Die Dämmerung war so weit fortgeschritten, dass ich den Späher kaum noch sah. Ich wartete weiter.
Eine Eule rief. Es klang nach einem Waldkauz, aber dumpfer, und erst als der Ruf nach einer Weile zum zweiten Mal erklang, wurde mir klar, dass das kein Nachtvogel war, sondern der Späher, der irgendetwas mitteilen wollte. Hatte er Verfolger gesichtet?
Nichts geschah. Wenn es ein Warnruf gewesen wäre, hätte sich irgendetwas tun müssen, aber die Stimmen redeten leise weiter. Eine Ahnung von Rauch schlich sich in meine Nase. Ab und zu knackte und prasselte es. Sie hatten ein Feuer entzündet.
Und dann näherten sich Schritte im Unterholz. Ein junger Kerl mit breiten Schultern und schwarzem Lederwams erschien unter mir. Die blonden Haare hatte er zu einem Zopf gebunden, und sein Blick wanderte nach rechts und links, während er den nur noch undeutlich zu erkennenden Wagenspuren in die Richtung folgte, aus der sie gekommen waren. Er trug einen Bogen in der Hand. Auf dem Rücken hatte er einen Köcher.
Ich beugte mich vor, zog die Beine hoch und versuchte, mit dem Ast zu verschmelzen, auf dem ich saß. In der fortschreitenden Dämmerung war ich in meiner dunklen Kleidung und mit dem geschwärzten Gesicht gut getarnt, doch wenn er nach oben schaute, würde er mich entdecken und einfach vom Baum herunterschießen wie einen Apfel, oder er würde die anderen rufen, und sie würden sich einen Spaß daraus machen, mich mit Äxten zu bewerfen. Ich saß in der Falle.
Doch statt nach oben zu blicken, schaute er sich im Wald um, als suchte er nach irgendeinem Tier, das er zum Zeitvertreib erlegen konnte. Dann schien er sich auf etwas zu besinnen, hob beide Hände an den Mund, formte sie zu einem Hohlraum und blies hinein. Erneut schallte der Ruf des Kauzes durch den Wald. Auf diese Weise meldeten sie also, dass alles in Ordnung war. Und sofort, fast wie ein Echo, kam die Antwort vom Felskamm.
Der Junge stapfte ein wenig umher, schien nach einem bequemen Standort Ausschau zu halten und entschied sich schließlich für einen umgestürzten Baumstamm, nur einen Steinwurf von mir entfernt. Er legte den Bogen neben sich auf den Boden. Mit einem Sprung vom Baum und ein paar schnellen Sätzen hätte ich ihn erreicht, bevor er auf mich schießen könnte, aber er würde schreien und die anderen herbeirufen, also wartete ich ab. Weit vor mir war inzwischen der schwache Widerschein eines Feuers zu erahnen. Von Osten her schickte der aufgehende Mond einen fahlen Schimmer durch die Wipfel der Bäume und tauchte den Wald in ein gespenstisches Licht. Und dann, drei Eulenrufe später, kam meine Chance.