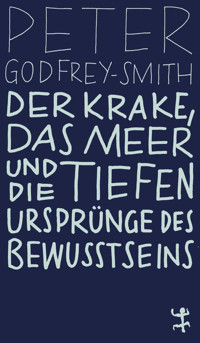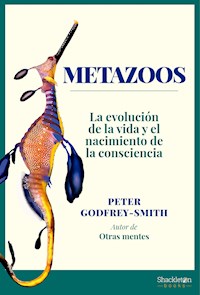Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Metazoa ist nichts weniger als eine Evolutionsgeschichte des Bewusstseins oder, umfassender noch, des Geistes. Anhand von wissenschaftlichen Experimenten, Ausflügen in die Wissenschaftsgeschichte, Anekdoten über eigensinnige Tiere und Beobachtungen, die er bei seinen zahlreichen Tauchgängen gemacht hat, ergründet Peter Godfrey-Smith, wie sich im evolutionären Zusammenspiel Körper und Geist herausbilden. Seine Erkenntnis: Es sind die Erfahrungen der Tiere in ihrer Umwelt, die sowohl den Aufbau des Gehirns als auch die Entstehung eines Bewusstseins vorantreiben. Von empfindungsfähigen Einzellern über wissbegierige Krebse bis hin zu träumenden Tintenfischen: Nicht in einem singulären Ereignis tritt das Bewusstsein ins Leben, sondern entfaltet sich Stufe um Stufe, und zwar stets im engen Wechselspiel mit den vielfältigen Formen, die das Leben seinen Umwelten abgerungen hat. Peter Godfrey-Smith liefert den Entwurf einer Philosophie, die uns daran erinnert, dass das Leben und damit auch das Denken im Wasser seinen Anfang nahm.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 574
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Metazoa
Peter Godfrey-Smith
Metazoa
Die Geburt des Geistes aus dem Leben der Tiere
Aus dem Englischenvon Dirk Höfer
Gewidmet all denen, die 2019–2020 in denaustralischen Waldbränden ihr Leben ließen, undden Menschen, die die Feuer bekämpften.
Und laßt mich an dieser Stelle euch beweglich mahnen, ihr Schiffseigner von Nantucket! Nehmt euch davor in acht, in die klaräugige Mannschaft eurer Walfangschiffe je einen Burschen mit hagern Wangen und mit hohlem Blick anzuheuern, der unzeitigem Sinnen ergeben ist … »Sag mal du Esel«, sagte ein Harpunier zu einem dieser Bürschchen, »wir kreuzen nun an die drei Jahre, und du hast keinen einzigen Wal gesichtet. Wenn du da oben bist, sind die Wale so rar wie die Zähne bei einem Huhn.« Vielleicht. Vielleicht aber trieben sie scharenweise am fernen Horizont; doch wie in müdem Opiumrausch aus leerer unbewußter Träumerei ist dieser weltentrückte Jüngling eingelullt vom wiegenden Rhythmus, in dem Welle und Gedanke ineinanderfluten, daß er zuletzt sich selbst verliert, daß ihm der geheimnisvolle Ozean zu seinen Füßen zum Inbild der tiefen, blauen, unergründlichen Seele wird, die Menschheit und Natur durchdringt; und alles Seltsame, halb Erschaute, alles Schöne, das leicht dahingleitend vor ihm flieht, jede kaum erkannte aufblitzende Finne eines träumerisch geahnten Wesens erscheint ihm als die Verkörperung jener flüchtigen Gedanken, die nur als ewig unstete Bewohner durch die Seele ziehen. In diesem Zauber ebbt dein Geist zurück, dahin, woher er kam, verrinnt durch Raum und Zeit – und gleich dem sprühenden Staub von Cranmers gotterfüllter Asche baut er zuletzt an allen Küsten dieser Erde mit.
Herman Melville, Moby Dick oder der Wal
Inhalt
1. Protozoa
Abstieg * Materie, Leben und Geist * Die Lücke
2. Der Glasschwamm
Türme * Zelle und Sturm * Die Zähmung der Elektrizität * Metazoa * Licht leitendes Glas
3. Der Aufstieg der Weichkoralle
Emporwachsen * Auf der Suche nach den ersten tierischen Aktionen * Der Entwicklungsweg der Tiere * Von Avalon nach Nama * Bodenhaftung
4. Die einarmige Garnele
Maestro * Das Kambrium * Sinnesempfindung * Ein wissbegieriger Krebs * Ein anderer Weg * Der Dekorateur * Goodbye
5. Die Ursprünge des Subjekts
Subjekte, Akteure und das Selbst * Qualia und andere Rätsel * Jenseits der Sinne * Nächtlicher Tauchgang
6. Der Krake
Randale * Herrschaft der Kopffüßer * Kontrollinstanzen * Kraken beobachten * Krake und Hai * Integration und subjektives Erleben * Unten bei den Sternen
7. König Fisch
Kraft * Die Evolution der Fische * Schwimmen * Die Präsenz des Wassers * Andere Fische * Rhythmen und Felder * Ein Strom in vielen Strömen
8. An Land
Treibhaus * Pioniere, von Neuem * Empfindung, Schmerz, Emotion * Spielarten * Pflanzliches Leben
9. Flossen, Beine, Flügel
Schwierige Zeiten * Unser Ast des Stammbaums * Land und Meer
10. Nach und nach zusammenfügen
1993 * Anderswo * Zug um Zug * Konsequenzen * Die Gestalt des Geistes
Danksagung
Anmerkungen
Register
1
Protozoa
Abstieg
Auf einer aus Wellenbrecherfelsen gebildeten Treppe steigst du zehn Stufen direkt ins Wasser hinunter, das jetzt, während des Gezeitengipfels, still und ruhig ist. Beim Eintauchen schwinden mit der Schwerkraft auch die Geräusche und das Licht verblasst zu einem weichen Grün. Du hörst nur noch dein Atmen.
Bald schon gelangst du in einen Schwammgarten, in ein Durcheinander von Formen und Farben. Manche Schwämme sind wie Knollen geformt oder wie Fächer und wachsen aus dem Meeresboden empor. Andere breiten sich seitwärts aus und bedecken alles, was ihnen in die Quere kommt, mit einer unregelmäßigen Schicht. Zwischen den Schwämmen stehen Gebilde, die wie Farne oder Blumen aussehen, und auch Seescheiden, blassrosa Röhrenstrukturen, deren Inneres wie mit Emaille gemustert ist. Die Röhren ähneln den nach unten gebogenen Lüftungsrohren auf Schiffsdecks, nur dass sie sich in verschiedene Richtungen biegen. Sie sind von allen möglichen anderen Lebensformen überzogen und oft so verkrustet, dass sie Teil der natürlichen Umgebung zu sein scheinen, in der zwar Dinge, aber keine eigenständigen Organismen leben.
Die Seescheiden vollführen kleine Bewegungen, als ob sie schliefen und nur halb mitbekommen, dass du vorbeigleitest. Hin und wieder, und für mich immer wieder überraschend, sackt so ein Seescheidenkörper an seinem Standort leicht zusammen und stößt wie mit einem Seufzen und Schulterzucken das in seiner Röhre stehende Wasser aus. Wo du vorbeischwimmst, erwacht die Landschaft zum Leben und macht ihre Bemerkungen.
Zwischen den Seescheiden stehen Anemonen und Weichkorallen. Manche Korallen sehen aus wie ein Büschel aus winzigen Händen. Jede Hand ist so regelmäßig geformt wie eine Blüte, aber eine, die nach dem Wasser in ihrer Umgebung greift. Die Hände schließen und öffnen sich langsam wieder.
Du schwimmst durch eine Art Wald, der vor Leben strotzt. In einem Wald jedoch begegnest du Lebensformen, die meist auf einem völlig anderen evolutionären Weg entstanden sind: dem Weg der Pflanzen. Im Schwammgarten hingegen stammt, was du siehst, zum größten Teil aus dem Reich der Tiere. Die meisten dieser Lebewesen (außer den Schwämmen selbst) besitzen Nervensysteme, elektrische Bahnen, die sich durch den Körper ziehen. Diese Körper bewegen sich, sie niesen, recken sich und zögern. Manche reagieren abrupt, wenn du erscheinst. Kalkröhrenwürmer sehen wie orangene auf dem Riffboden befestigte Federbüschel aus, aber die Federn sind mit Augen besetzt und verschwinden, sobald du ihnen zu nahe kommst. Stell dir vor, du befindest dich in einem grünen Wald und bemerkst, dass die Bäume niesen und husten, ihre Hände ausstrecken und dich mit unsichtbaren Augen ansehen.
Beim langsamen Schwimmen vom Ufer weg stößt du auf Überbleibsel und Verwandte früher Formen tierischer Bewegung. Du schwimmst nicht in die Vergangenheit – die Schwämme, Seescheiden und Korallen sind heute lebende Tiere und das Ergebnis einer evolutionären Zeitspanne, die auch den Menschen hervorgebracht hat. Du befindest dich also nicht unter Vorfahren, sondern unter entfernten Cousinen, lebender, aber sehr ferner Verwandtschaft. Der Garten in deiner Umgebung besteht aus den obersten Zweigspitzen des Stammbaums einer einzigen Familie.
Weiter draußen, unter einem Felsvorsprung, entdeckst du einen Knäuel aus Fühlern und Klauen: eine gebänderte Garnele. Ihr Körper ist nur ein paar Zentimeter groß, doch ihre Fühler und andere Anhänge sind dreimal so lang. Dieses Tier ist das erste hier erwähnte, das dich, anstatt nur auf Lichtveränderungen und undeutliche Massen zu reagieren, als Objekt erkennen dürfte. Noch etwas weiter draußen, oben auf dem Riff, hat sich ein Krake wie eine Katze – eine überaus gut getarnte Katze – breitgemacht; ein paar Arme ausgestreckt, die anderen zusammengerollt. Auch dieses Tier beobachtet dich, viel offensichtlicher als die Garnele, und hebt sogar aufmerksam den Kopf, während du an ihm vorüberschwimmst.
Materie, Leben und Geist
Im Jahr 1857 zog die HMS Cyclops etwas aus den Tiefen des Nordatlantiks. Die Probe sah aus wie ein Batzen Schlamm vom Meeresboden. Sie wurde in Alkohol konserviert und an den Biologen Thomas H. Huxley geschickt.*
Die Probe wurde nicht deshalb an Huxley verschickt, weil sie besonders ungewöhnlich schien, sondern weil es damals ein sowohl wissenschaftliches als auch praktisches Interesse an der Beschaffenheit des Meeresbodens gab. Das praktische Interesse rührte aus dem Vorhaben, Tiefsee-Telegrafenkabel zu verlegen. Das erste Nachrichtenkabel, das durch den Atlantik gelegt wurde, wurde 1858 fertiggestellt, hielt aber nur drei Wochen, da die Isolierung versagte und der Signalstrom in den Weiten des Meers verebbte.
Huxley untersuchte den Schlamm, entdeckte einige einzellige Organismen sowie rätselhafte runde Körper und stellte die Probe ins Regal, wo sie für etwa zehn Jahre ruhte.
Später, im Besitz eines besseren Mikroskops, nahm er sie sich wieder vor. Dieses Mal sah er Scheiben und Kugeln unbekannten Ursprungs, die von einer schleimigen Substanz, einem »durchsichtigen gelatinösen Material« umgeben waren. Huxley glaubte, eine neue Organismenart einer außergewöhnlich einfachen Form gefunden zu haben. Seine vorsichtige Interpretation lautete, dass die Scheiben und Kugeln harte Gebilde waren, die von der geleeartigen und lebenden Substanz produziert wurden. Er benannte den Organismus nach dem deutschen Biologen, Illustrator und Philosophen Ernst Haeckel. Die neue Lebensform sollte Bathybius Haeckelii heißen.
Haeckel zeigte sich sowohl über die Entdeckung als auch über die Namensgebung erfreut, hatte er doch die Existenz einer derartigen Substanz postuliert. Wie Huxley war er ein überzeugter Anhänger der Evolutionstheorie, die Darwin 1859 in Über die Entstehung der Arten veröffentlicht hatte. In ihren Heimatländern, England und Deutschland, gehörte der eine wie der andere zu den führenden Verfechtern des Darwinismus. Beide verfolgten mit großem Eifer Fragen, über die zu spekulieren sich Darwin, von einer kurzen Passage abgesehen, nur zurückhaltend einließ: der Ursprung des Lebens und der Beginn der Evolution. War das Leben nur einmal auf der Erde entstanden oder mehrmals? Haeckel glaubte an die Möglichkeit, dass sich Leben spontan aus unbelebter Materie zeugen würde und dieser Prozess wiederholt stattfinden könnte. Er sah in Bathybius eine elementare Lebensform, die den Tiefseeboden womöglich auf weiten Strecken bedeckte; für ihn handelte es sich um eine Brückenform oder ein Verbindungsglied zwischen dem Reich des Lebens und dem Reich der unbelebten, anorganischen Materie.
Die herkömmliche Organisationsform alles Lebendigen, ein Konzept, das schon seit den alten Griechen bestand, kannte nur zwei Arten von Lebensformen: Tiere und Pflanzen. Alles, was lebte, musste entweder der einen oder der anderen Seite zufallen. Als im achtzehnten Jahrhundert der schwedische Botaniker Carl von Linné ein neues Klassifikationsschema ersann, stellte er neben das Pflanzen- und das Tierreich noch das »Naturreich der Steine«, der Lapides. Diese Dreiteilung zeigt sich heute noch in der geläufigen Frage: »Tier, Pflanze oder Mineral?«
Zur Zeit von Linné waren die ersten mikroskopisch kleinen Organismen beobachtet worden, vielleicht zuerst in den 1670er Jahren von dem holländischen Tuchhändler Antoni van Leeuwenhoek, der die leistungsstärksten frühen Mikroskope herstellte. Linné nahm eine erkleckliche Anzahl winziger, unter dem Mikroskop beobachteter Organismen in seiner Klassifikation der Lebewesen auf und verzeichnete sie unter der Kategorie »Würmer«. (Die zehnte Ausgabe seines Systema Naturae, die Ausgabe, in der er Tiere wie Pflanzen zu klassifizieren begann, schloss er mit einer Gruppe ab, die er als Monas bezeichnete, als »punktgroße Körper«.)
Mit dem Fortschritt der Biologie tauchten, insbesondere im mikroskopischen Maßstab, immer mehr unentscheidbare Fälle auf. Man verfiel darauf, sie entweder den Pflanzen (Algen) oder den Tieren (Protozoa) zuzuordnen, sie also auf die eine oder die andere Seite der Grenzlinie zu bringen. Aber oft blieb es schwierig, zu bestimmen, wohin ein neuentdecktes Lebewesen gehörte, und natürlich bemerkte man, wie sehr die Standardklassifikation damit strapaziert wurde.
1860 brachte der britische Naturforscher John Hogg vor, es sei wohl vernünftiger, für die Kleinstorganismen, die zunehmend als weder den Pflanzen noch den Tieren zugehörige Einzeller erkannt wurden, ein viertes Naturreich einzuführen, als sie zwanghaft dem einen oder anderen zuzuordnen. Diese Organismen bezeichnete er als Protoctista und platzierte sie an der Seite der Tiere, Pflanzen und Minerale in einem Regnum Primigenium, einem »urtümlichen Naturreich«. (Hoggs Ausdruck Protoctista wurde von Haeckel später auf das modernere Protista verkürzt.) Hogg erachtete die Grenzen zwischen den verschiedenen Naturreichen des Lebens als unscharf, sah jedoch eine scharfe Grenze zwischen dem Mineralreich und den lebenden Reichen.
Bisher beschäftigte sich das hier beschriebene Ringen um die Kategorien mit dem Leben und nicht mit dem Geist. Aber Leben und Geist sind schon seit Langem irgendwie miteinander verknüpft, auch wenn der vermutete Charakter ihrer Beziehung Schwankungen unterlag. Im aristotelischen System, das vor über zweitausend Jahren entwickelt wurde, finden sich in der Seele Lebendiges und Geistiges vereint. Für Aristoteles ist die Seele eine Art inneres Gebilde, das die körperlichen Aktivitäten steuert; in den verschiedenen Lebewesen kommt sie in drei unterschiedlichen Abstufungen oder Graden vor. Pflanzen nehmen Nährstoffe auf, um sich am Leben zu halten – dies spricht bereits für eine Art Seele. Tiere tun dasselbe und sind dazu noch in der Lage, ihre Umgebung wahrzunehmen und darauf zu reagieren – sie haben eine andere Art von Seele. Menschen können zusätzlich zu den beiden zuvor genannten Fähigkeiten Überlegungen anstellen und verfügen damit über eine dritte Art. Für Aristoteles verhalten sich sogar unbelebte, seelenlose Gegenstände Absichten oder Zielen entsprechend, da sie ihrem naturgemäßen Platz zustreben.
Als das aristotelische Weltbild im Zuge der »wissenschaftlichen Revolution« des siebzehnten Jahrhunderts umgestürzt wurde, wurden auch diese Verhältnisse neu definiert. Dazu gehörte eine verfestigte Konzeption der physischen Welt – die Durchsetzung einer mechanischen von Stoß und Zug bestimmten Sicht der Materie, bei der der Zweck keine oder nur eine geringe Rolle spielt – sowie eine Erhebung oder Ätherisierung der Seele. Die Seele, die bei Aristoteles fester Bestandteil der lebenden Natur war, wurde zu einer eher geläuterten, intellektuellen Angelegenheit. Sie vermochte zudem durch den göttlichen Willen erlöst zu werden und somit in eine Art ewiges Leben einzutreten.
René Descartes zufolge, einer besonders einflussreichen Figur jener Zeit, existiert eine scharfe Trennung zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen und wir Menschen sind eine Kombination aus beidem; wir sind körperliche und geistige Lebewesen. Wir können erfolgreich beides sein, weil die beiden Bereiche in einem kleinen Organ in unserem Gehirn miteinander in Berührung kommen. Das ist Descartes’ »Dualismus«. Die (anderen) Tiere haben laut Descartes keine Seele und sind rein mechanische Wesen – ein Hund fühlt nichts, ganz gleich, was ihm angetan wird. Die dem Menschen eigene Seele kommt in Tieren und Pflanzen nicht mehr vor, noch nicht einmal als schwacher Abglanz.
Im neunzehnten Jahrhundert, der Zeit von Darwin, Haeckel und Huxley ließen die Fortschritte in der Biologie und anderen Wissenschaften den Dualismus descartesscher Fasson immer weniger überzeugend erscheinen. Mit Darwins Arbeit entstand ein Bild, in dem die Trennlinie zwischen Menschen und anderen Tieren nicht mehr so scharf gezogen war. Verschiedene Lebensformen mit unterschiedlichem Denkvermögen konnten durch allmähliche Evolutionsprozesse entstehen, insbesondere durch Anpassung an die natürlichen Gegebenheiten und Abspaltungen, aus denen andere Arten hervorgehen. Dies sollte ausreichen, um Körper und Geist zu erklären – wenn man denn über einen Ausgangspunkt verfügt.
Es handelte sich um ein großes Wenn. Haeckel, Huxley und andere nahmen sich dieses Problems wie folgt an: Sie glaubten, es müsse einen in Lebewesen vorkommenden Stoff geben, der sowohl Leben ermöglicht als auch die Anfänge einer Art Geist. Dieser Stoff wäre physischer Natur und nicht übernatürlich, würde sich aber von der gewöhnlichen Materie unterscheiden. Würde man ihn isolieren, könnte man ihn zwar mit einem Löffel aufnehmen, es würde sich aber immer noch um einen besonderen Stoff handeln. Er wurde als Protoplasma bezeichnet.
Offenbar ein etwas seltsamer Erklärungsversuch, der aber von einer eingehenden Untersuchung von Zellen und einfachen Organismen veranlasst war. Als man dann in die Zellen hineinsehen konnte, schienen sie für das, wozu sie offenbar fähig sind, keine ausreichende Organisation – zu wenig unterschiedliche Teile – aufzuweisen. Bei dem, was die Forscher zu Gesicht bekamen, handelte es sich anscheinend nur um eine durchsichtige und weiche Substanz. Der englische Physiologe William Benjamin Carpenter wunderte sich 1862 über die Fähigkeiten einzelliger Organismen: Die »vitalen Operationen«, die man bei Tieren »von einem kunstvollen Apparat« ausgeführt sieht, werden hier von »einem kleinen Partikel aus scheinbar gleichförmigem Gallert« vollbracht. Den gallertartigen Partikel sieht man »ohne Gliedmaßen seine Nahrung ergreifen, sie ohne Mund verschlingen, sie ohne Magen verdauen« und »sich ohne Muskeln von einem Ort zum anderen bewegen«. Dies veranlasste Huxley und andere zu der Annahme, dass die Lebensaktivität nicht durch eine komplexe Organisation gewöhnlicher Materie zu erklären sei, sondern durch eine andersartige Zutat, die von sich aus lebendig war: »Organisation resultiert aus dem Leben, nicht das Leben aus der Organisation.«
Vor diesem Hintergrund schien Bathybius außerordentlich vielversprechend. Es schien sich um ein unverfälschtes Muster des Lebensstoffs zu handeln, eines Stoffs, der womöglich jederzeit spontan entstehen kann und einen sich ständig erneuernden organischen Teppich auf dem Tiefseeboden bildet. Weitere Proben wurden untersucht. Bathybius aus dem Golf von Biskaya wurde die Fähigkeit zur Bewegung zugeschrieben. Andere Biologen waren allerdings nicht so überzeugt von dieser vermeintlichen Lebensform und der vielfältigen Spekulationen, die darum erwuchsen. Wie konnte Bathybius dort unten am Leben bleiben? Was könnte es fressen?
Dann kam die Challenger-Expedition – ein vierjähriges, in den 1870ern von der Royal Society in London organisiertes Forschungsvorhaben, bei dem weltweit Proben aus hunderten Tiefseegebieten entnommen wurden. Ziel war die Erstellung eines ersten umfassenden Inventars des Lebens in den tiefsten Regionen der Ozeane. Charles Wyville Thomson, der leitende Wissenschaftler der Expedition war bei aller Skepsis willens, sich der Bathybius-Frage zu widmen. Neue Muster wurden nicht entdeckt, und zwei Wissenschaftler an Bord der Challenger beschlich nach einigem Hin und Her der Verdacht, dass Bathybius keine Lebensform und nicht einmal annähernd lebendig war. Mit einer Reihe von Experimenten bewiesen sie schließlich, dass es sich bei Bathybius lediglich um das Ergebnis einer chemischen Reaktion zwischen Meerwasser und dem Alkohol handelte, der zur Konservierung der Proben verwendet wurde. Das galt auch für Huxleys alte Probe von der HMS Cyclops.
Bathybius war tot. Huxley gestand seinen Irrtum sofort ein. Haeckel, dem an Bathybius als Missing Link viel gelegen war, hielt daran leider noch über zehn Jahre fest. Aber die Brücke war bereits eingestürzt.
Danach hegten noch einige Leute Hoffnung, eine Brücke in etwa der gleichen Art zu finden – eine besondere Substanz, die das Leben mit der Materie verbinden würde. Doch in den folgenden Jahren verschwanden solche Anschauungen von der Bildfläche. Sie wurden im Zuge eines langsamen Entdeckungsprozesses ersetzt, an dessen Ende die Lebensaktivität nicht mehr als rätselhaft erschien. Die Erklärung des Lebens erfolgte nun in der Weise, die zu billigen Huxley und Haeckel nicht imstande gewesen waren: Es war die verborgene Organisation gewöhnlicher Materie.
Wie wir sehen werden, ist diese Materie nicht in jeder Hinsicht »gewöhnlich«, in ihrer Grundzusammensetzung jedoch schon. Lebende Systeme bestehen aus den gleichen chemischen Elementen, die auch das übrige Universum ausmachen, und funktionieren nach physikalischen Prinzipien, die ebenfalls in das Reich des Anorganischen hineinreichen. Wir wissen heute nicht, wie das Leben anfing, aber sein Ursprung stellt kein Rätsel mehr dar, jedenfalls keines, das uns zu der Annahme veranlassen könnte, das Leben würde aus einer eigenen Substanz hervorgehen.
Dies war der Triumph einer materialistischen Sicht auf das Leben – eine Sicht, die keine übernatürlichen Eingriffe mehr zulässt. Es war auch der Triumph einer Anschauung, die davon ausgeht, dass die physikalische Welt in ihren Grundbestandteilen einheitlich ist. Die Erklärung des Lebens erfolgt nicht mittels einer mysteriösen Zutat, sondern über die komplexe, in einem winzigen Maßstab beobachtbare Struktur. Dieser Maßstab ist fast unvorstellbar winzig. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Ribosomen sind wichtige Zellbestandteile, sie sind die Fabriken, in denen die Proteinmoleküle zusammengesetzt werden, und weisen dabei selbst eine ziemlich komplexe Struktur auf. Doch über hundert Millionen von ihnen würden in den am Ende dieses Satzes stehenden Punkt passen.
Über das Leben also haben wir Klarheit gewonnen. Was den Geist angeht, stehen wir noch immer vor vielen Rätseln.
Die Lücke
Ab dem späten neunzehnten Jahrhundert, als Darwins Revolution Fahrt aufnahm, war es offenbar schwierig, eine dualistische Weltsicht des Geistes, wie sie von Descartes geprägt wurde, aufrechtzuerhalten. In einem Gesamtbild, in dem der Mensch als einzigartiger und besonderer Teil der Natur – gleichsam in der Nähe Gottes – verortet wird, mag der Dualismus sinnvoll erscheinen. Wenn wir nämlich eine zusätzliche Zutat haben, kann der ganze Rest, ob lebend oder tot, als rein materiell gelten. Eine evolutionäre Perspektive auf den Menschen, die von einem Kontinuum zwischen uns und anderen Tieren ausgeht, macht es hingegen schwierig, wenn auch nicht unmöglich, den Dualismus beizubehalten. Als solche motiviert sie das Bestreben, eine materialistische Auffassung des Geistes zu entwickeln, die Denken, Erleben und Fühlen mittels physikalischer und chemischer Prozesse erklärt. Die Tatsache, dass das Leben selbst einer materialistischen Betrachtung unterzogen wurde, ist zwar ermutigend, aber wie hilfreich dies wirklich ist, bleibt unklar, ebenso wie sich der Erfolg des Materialismus in der Biologie zu den Rätseln des Bewusstseins verhält.
Schauen wir erneut in die Geschichte, lassen sich zwei alternative Pfade unterscheiden, die bis heute begangen werden. Wie wir gesehen haben, hat Aristoteles mehrere unterschiedliche Seelenstufen erkannt und mit Pflanzen, Tieren und uns selbst in Verbindung gebracht. Was wir als »Geist« bezeichnen, wird als natürliche Erweiterung oder als Version der Lebensaktivität angesehen. Aristoteles’ Sichtweise war nicht evolutionär, aber es ist nicht allzu schwer, sie evolutionstheoretisch umzubauen. Die Evolution komplexer Lebensformen führt durch die Zunahme zweckgerichteten Handelns und einer gegenüber der Umwelt gesteigerten Reizempfindlichkeit ganz natürlich zur Entstehung des Geistes.
Für Descartes hingegen war das Leben eine Sache und der Geist eine ganz andere. Geht man von dieser Betrachtungsweise aus, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sich mit einem besseren Verständnis für Lebensprozesse viel an den im Zusammenhang mit dem Geist stehenden Problemen ändert.
Waren das gesamte vergangene Jahrhundert hindurch die meisten Anschauungen auf diesem Gebiet materialistischer Natur, haben sie sich jedoch in einem Aspekt Descartes angenähert. Ab Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts tendierten die Theoretiker immer weniger dazu, enge Verbindungen zwischen dem Leben als solchem und dem Geist zu sehen. Eine Tendenz, die mit dem Aufkommen von immer besseren Computern noch verstärkt wurde. Die Computertechnologie, wie sie sich in den mittleren Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts entwickelte, versprach eine andere Brücke zwischen dem Geistigen und dem Physischen, eine Brücke eher der Logik als des Lebens. Die neuartige Mechanisierung logischen Denkens und seiner Speicherung – das Rechnen – schien einen besseren Weg zu versprechen. Mit der Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) entstanden Systeme, die so etwas wie Intelligenz zu besitzen schienen, aber es gab keinen Grund zu der Annahme, sie seien lebendig. Der tierische Körper spielte anscheinend keine allzu große Rolle – er schien im Grunde völlig optional zu sein. Die Software war der entscheidende Punkt. Im Gehirn läuft ein Programm, und dieses Programm könnte ebenso gut auch auf anderen Maschinen (oder Gebilden, die keine Maschinen sind) ablaufen.
Damals gewann das Körper-Geist-Problem aber auch eine schärfere Kontur. Das Rätsel des »Geistes« wurde durch eine spezifischere Fragestellung abgelöst. In der neuen Sichtweise lassen sich einige Aspekte des Geistes ziemlich einfach in materialistischen Begriffen erklären, wobei sich ein bestimmter Aspekt der Erklärung widersetzt: subjektives Erleben oder Bewusstsein. Man denke zum Beispiel an die Erinnerung. Bei verschiedenen Tieren dürfte sich so etwas wie ein Gedächtnis feststellen lassen; sie legen in ihren Gehirnen Spuren der Vergangenheit an, die sie später, wenn sie entscheiden, was sie tun sollen, abrufen. Sich vorzustellen, wie ein Gehirn so etwas bewerkstelligt, ist nicht allzu schwierig. Das Problem ist zwar noch nicht annähernd vollständig gelöst, aber es ist mit Sicherheit lösbar; wir dürften früher oder später in der Lage sein, herauszufinden, wie dieser Aspekt der Erinnerung funktioniert. Zumindest aber beim Menschen fühlen sich manche Erinnerungen auch nach etwas an. Wie Thomas Nagel 1974 formulierte, gibt es etwas, das so ist wie – sich so anfühlt wie – einen Geist zu haben. Es löst ein bestimmtes Gefühl aus, sich an ein gutes Erlebnis zu erinnern – oder ein schlechtes. Die »informationsverarbeitende« Seite des Gedächtnisses, die Fähigkeit, nützliche Information zu speichern und wieder abzurufen, kann von diesem zusätzlichen Merkmal begleitet sein oder auch nicht. Das Schwierige am Geist-Körper-Problem ist die Erklärung dieses Aspekts unseres geistigen Lebens. In biologischen, physikalischen oder computerbasierten Begriffen ist es kaum zu erklären, wie es in der Welt ein gefühltes Erleben geben kann.
Oft wird das Problem über eine Reihe klassischer Herangehensweisen betrachtet. In der Hauptsache verläuft die Scheidelinie zwischen den materialistischen (oder »physikalistischen«) Anschauungen auf der einen und den dualistischen Sichtweisen auf der anderen Seite. Auch radikalere Möglichkeiten werden bemüht. Der Panpsychismus geht beispielsweise davon aus, dass jede Materie, auch die Materie in Gegenständen wie Tischen, einen geistigen Aspekt besitzt. Dabei handelt es sich nicht um die Vorstellung, dass das gesamte Universum aus Erleben besteht – das wäre Idealismus. Ein Panpsychist hingegen akzeptiert die physische Anlage der Welt, wie sie erscheint, fügt aber hinzu, dass das Material, aus dem die Welt besteht, eine auf vage Art geistige Seite aufweist. Dieser geistige Aspekt der Materie bringe, sobald die Materie in Gehirnen organisiert ist, Erleben und Bewusstsein hervor. Trotz seiner offenkundigen Extravaganz besitzt der Panpsychismus ernstzunehmende Verfechter. Der bereits erwähnte Thomas Nagel argumentiert, der Panpsychismus sollte als Option beibehalten werden, da sich auch in allen anderen Sichtweisen signifikante Probleme ergeben und verglichen damit die Probleme des Panpsychismus nicht schlimmer seien. Auch Ernst Haeckel liebäugelte in den Jahren nach der Bathybius-Entlarvung mit dem Panpsychismus. Huxley wiederum zeigte sich von einer weiteren ungewöhnlichen Sichtweise angezogen. Er vermutete, dass das bewusste Erleben zwar auf materielle Vorgänge zurückgehe, aber keineswegs deren Ursache sei. Das ist zwar eine ungewöhnliche Variante des Dualismus, aber auch sie hat heute ihre Verfechter.
Auf diesem wilden Feld alternativer Sichtweisen des Universums wird ebenso wie in profaneren Diskussionen sichtbar, dass hinsichtlich der Frage, wo überall Geist waltet, eine große Bandbreite an Vorstellungen herrscht. Für manche ist der Geist überall oder fast überall. Für andere ist er auf den Menschen und höchstens noch auf ein paar Tiere in seiner näheren Verwandtschaft beschränkt. Die eine Person wird auf ein Pantoffeltierchen schauen, einen einzelligen Organismus, der energisch durch einen Wasserfilm schwimmt, und sagen: Was in diesem Geschöpf vor sich geht, reicht hin, dass es Gefühle hat. Das Pantoffeltierchen reagiert und hat Ziele. Es wird sogar, in kleinem Maßstab, Erlebnisse haben. Jemand anderes wird nicht bloß das Pantoffeltierchen verächtlich abtun, sondern sich ein komplexes Tier, etwa einen Fisch, vor Augen führen und sagen: Der Fisch fühlt wahrscheinlich gar nichts. Er besitzt zwar viele Reflexe und Instinkte und ziemlich komplizierte Gehirnaktivitäten, aber all diese Aktivitäten finden »im Dunklen« statt. Wenn diese zweite Person falsch liegt, dann fragt sich doch, warum? Wenn auch der Panpsychismus falsch liegt und es keinen Hinweis darauf gibt, dass ein Sandkorn Gefühle hat, fragt sich, warum dies nun falsch ist. Verhält es sich vielleicht doch so? Oft scheint sich Beliebigkeit breitzumachen. Die Leute sagen, was sie wollen. Wenn ich raten sollte, wie die meisten Menschen auf die Frage antworten, ob bestimmte Lebewesen ihre Welt »erleben«, dann, so vermute ich, wird die Antwort üblicherweise bei Säugetieren und Vögeln positiv ausfallen, bei Fischen und Reptilien »vielleicht«, und bei allen anderen »nein« lauten. Wenn aber jemand nachhakt und die Frage etwa auf Ameisen, Pflanzen und Pantoffeltierchen ausweiten oder enger fassen möchte (nur Säugetiere), wird die Debatte rasch beliebig. Wie ließe sich also herausfinden, wer Recht hat?
Der Eindruck von Beliebigkeit hat mit einem Umstand zu tun, den der Philosoph Joseph Levine als »Erklärungslücke« bezeichnet hat. Selbst wenn wir uns darüber ziemlich klar geworden sind, dass der Geist eine rein physische Grundlage ohne weitere Zutat haben muss, möchten wir doch auch wissen, warum dieses bestimmte physiologische Szenario genau dieses Erleben und kein anderes hat entstehen lassen. Warum fühlt sich das eine bestimmte Gehirn, das man besitzt, auf ebendiese Weise an, wenn es den Prozess durchläuft, in dem es sich gerade befindet? Selbst wenn uns die Schwierigkeiten, mit denen andere Sichtweisen konfrontiert sind, davon überzeugen, dass der Materialismus wahr sein muss, fällt es doch schwer, zu verstehen, auf welche Weise er wahr ist, wie die Dinge so sein können, wie sie sind.
Genau das ist der Problemzusammenhang, den ich in diesem Buch behandeln möchte. Es geht nicht darum, Antworten auf Levines Fragen zu bestimmten Erlebnisformen zu finden, etwa, welche Gehirnaktivitäten sich mit dem Farbensehen oder dem Schmerzempfinden in Verbindung bringen lassen. Dafür ist die Neurowissenschaft zuständig. Ziel ist es vielmehr, sich Klarheit darüber zu verschaffen, warum es sich nach etwas anfühlt, ein materielles Wesen der Art zu sein, wie wir es sind. Dieses Wir soll ziemlich breit gefasst sein; mein Hauptanliegen gilt nicht den komplexen Fragen des menschlichen Bewusstseins, sondern dem bewussten Erleben im Allgemeinen, das sich womöglich auf zahlreiche andere Tiere erstreckt. Indem ich diese Fragen des bewussten Erlebens behandle, möchte ich den oben beschriebenen Eindruck der Beliebigkeit mindern, jenes Gefühl, dass man je nach Laune ja bei Bakterien und nein bei Vögeln sagen kann.
Meine Herangehensweise an das Körper-Geist-Problem ist biologisch und entspricht einem materialistischen Weltbild. »Materialismus« ist ein Wort, das für viele nach einer nüchternen und kompromisslosen Sicht der Dinge klingt: Die Welt ist kleiner, als man denkt, weniger besonders oder weniger heilig, und besteht nur aus aneinanderstoßenden Atomen. Atome, die gegeneinanderstoßen, sind tatsächlich nicht ganz unwichtig, aber ich möchte die Geschichte nicht in einer von Härte und Verengung geprägten Atmosphäre vorbringen. Die »physikalische« oder »materielle« Welt besteht aus mehr als nur dumpfen Kollisionen und trockener Struktur. Es handelt sich um eine Welt mit Energien, Feldern und verborgenen Wechselwirkungen. Wir sollten uns davon überraschen lassen, was sie alles enthält.
Der in diesem Buch gewählte Ansatz ist ein biologischer Materialismus, doch in vielerlei Hinsicht zentral für meine Anschauung ist eine umfassendere Position, die bisweilen als Monismus bezeichnet wird. Der Monismus ist der Annahme verpflichtet, dass der Natur ein einheitliches Prinzip zugrunde liegt, ein alle Phänomene umfassendes Grundprinzip. Der Materialismus ist eine Ausprägung dieses Monismus, denn er verfolgt die Idee, das geistige Phänomene, darunter auch das subjektive Erleben, Manifestationen weit grundlegenderer Aktivitäten sind, wie sie in der Biologie, Chemie und Physik beschrieben werden. Der Idealismus, die Vorstellung, dass alles geistig verursacht sei, ist wiederum eine andere Form des Monismus, eine andere Einheitlichkeitsthese. (Ein Idealist muss erklären, dass scheinbar physikalische Objekte und Abläufe eigentlich Manifestationen des Geistes sind.) Man kann aber auch ein Monist sein, wenn man annimmt, dass sowohl das sogenannte Physikalische als auch das sogenannte Geistige Manifestationen eines weiteren Grundprinzips sind, diese Anschauung wird neutraler Monismus genannt. Anstatt das »Geistige« in physikalischen Begriffen und das »Physikalische« in geistigen Begriffen zu erklären, wird beides, das Physikalische und das Geistige, mit etwas anderem erklärt. Dieses »etwas andere« bleibt eher rätselhaft. Wenn ich kein Materialist wäre, wäre ich ein neutraler Monist, doch Letzteres ist in meinen Augen eine Außenseiterposition. Ich werde so vorgehen, dass ich mit dem materialistisch verstandenen Leben beginne und aufzuzeigen versuche, wie die Evolution lebender Systeme den Geist entstehen lässt. Ich möchte – zumindest teilweise – die Erklärungslücke zwischen dem Geistigen und dem Materiellen schließen.
Bevor wir jedoch fortfahren, sollten wir einen eingehenden Blick auf die geistige Seite des Rätsels werfen sowie auf die Worte, die wir zu seiner Beschreibung verwenden. Der Aspekt des Geistes, auf den Nagel verweisen wollte, als er sagte, dass »es irgendwie ist, wie etwas zu sein«, wird heute häufig als Bewusstsein bezeichnet. (Nagel selbst nennt es so.) In diesem Sinne ist man sich seiner bewusst, wenn es sich irgendwie anfühlt, man selbst zu sein. Aber der Ausdruck »Bewusstsein« führt hier meist in die Irre, da er in der Regel etwas sehr weit Entwickeltes unterstellt. Die Wendung »irgendwie ist es, als ob/wie …« ist dazu gedacht, alle möglichen Formen des Fühlens zu umfassen. Schon wenn die vagsten und undeutlichsten Gefühle zum Leben gehören, ist es ein bestimmtes Gefühl, etwas zu sein, etwa ein Fisch, ein Schmetterling. Dass das Wort »Bewusstsein« mehr als dieses Gefühl unterstellt, macht die Problematik nicht leichter.
Neurowissenschaftler behaupten zum Beispiel oft, das Bewusstsein beruhe auf der Großhirnrinde, dem gefältelten, zuoberst liegenden Teil unseres Gehirns, der nur bei Säugetieren und einigen anderen Wirbeltieren vorkommt. Hier ein Zitat des Arztes und Essayisten Oliver Sacks; es handelt von einem Patienten, der infolge einer Gehirninfektion die Fähigkeit einbüßte, neue Ereignisse im Gedächtnis zu behalten. Sacks fragte: »In welchem Verhältnis stehen Aktionsmuster und prozedurale Erinnerungen, die mit relativ primitiven Bereichen des Zentralnervensystems assoziiert sind, zu Bewusstsein und Empfindungsvermögen, die in der Großhirnrinde angesiedelt sind?« Sacks stellt hier zwar eine Frage, unterstellt aber, Bewusstsein und Empfindungsvermögen seien in der Großhirnrinde verankert. Meint Sacks damit, dass einer Person, die, oder etwas, das keine Großhirnrinde besitzt, auch Bewusstsein in seiner Hierbin-ich-Fülle fehlt, sie/es gleichwohl aber noch Gefühle haben kann? Oder geht er davon aus, dass ohne Kortex die Lichter völlig ausgeschaltet sind und jedes derartige Wesen, auch wenn es zu einem bestimmten Verhalten befähigt ist, überhaupt kein Erleben hat? Die meisten Tiere, und vor allem die Mehrzahl derjenigen, die in diesem Buch vorkommen, weisen keine Großhirnrinde auf. Haben sie ein Erleben, das sich von dem unsrigen unterscheidet, oder haben sie überhaupt kein Erleben?
Manche Leute glauben, ohne Kortex könne es keinerlei Erleben geben. Vielleicht sehen wir uns am Ende zu einer solchen Auffassung genötigt, was ich aber bezweifle. Wir müssen uns stets vorsehen, nicht der Denkgewohnheit nachzugeben, dass alle Formen des Erlebens irgendwie menschenähnlich sein müssten. Wenn das Wort »Bewusstsein« für die sehr umfängliche Vorstellung gefühlter Erfahrung benutzt wird, gerät man schnell auf Abwege. Von manchen allerdings wird heute das Wort »Bewusstsein« oder eine Abwandlung davon (»phänomenales Bewusstsein«) in diesem weiten Sinne verwendet. Ich möchte mich hier nicht weiter an den Begriffen aufhalten; keine Terminologie ist perfekt. In mancher Hinsicht ist »Empfindungsvermögen« (sentience) ein gutes Wort für ein weiter gefasstes Konzept. Wir können fragen: Welche Tiere sind empfindungsfähig? Dies ist etwas anderes oder könnte etwas anderes sein als die Frage, welche Bewusstsein haben. Der Begriff »Empfindungsvermögen« wird allerdings häufig für besondere Formen des Erlebens herangezogen, etwa für Lust, Schmerz und damit verwandte Erlebnisse, die Wertungen wie gut und schlecht beinhalten. Diese Erlebnisse sind sicherlich wichtig und wahrscheinlich ist die Annahme sinnvoll, es könnte sie auch ohne ein entwickelteres Bewusstsein geben. Möglicherweise sind dies jedoch nicht die einzigen Formen elementaren oder einfachen Erlebens. In einem späteren Kapitel werde ich die Möglichkeit untersuchen, dass die sensorischen und die bewertenden Aspekte des Erlebens voneinander abweichen – wahrzunehmen, was vor sich geht, dürfte sich von der Einschätzung, ob es gut oder schlecht ist, unterscheiden. Das »Empfindungsvermögen« wird gewöhnlich nicht für die sensorische Seite dieser Unterscheidung herangezogen.
Ein weiterer Ausdruck ist das etwas sperrige »subjektive Erleben«. Der Begriff wirkt redundant (gibt es eine andere Art des Erlebens?) und es lässt sich nur schwer ein Adjektiv wie »bewusst« oder »empfindungsfähig« daraus bilden. »Subjektives Erleben« weist jedoch in eine gute Richtung, da es die Vorstellung eines Subjekts aufruft. Das vorliegende Buch handelt in gewisser Hinsicht von der Entwicklung der Subjektivität – davon, was Subjektivität ist und wie sie entstand. Subjekte sind für das Erleben wie ein Zuhause, es lebt in ihnen.
Manchmal werde ich auch einfach nur die Bezeichnung Geist (mind) verwenden, denn ich denke, dass wir durch die vorliegende Geschichte zu einem Verständnis der Evolution des Geistes gelangen und verstehen werden, wie er in die Welt eingepasst ist. Dabei wechsle ich, ohne allzu strikt zu sein, zwischen den Terminologien. Wir wissen gegenwärtig noch nicht genug, um auf der einen oder anderen Sprachregelung zu bestehen.
Das Anliegen, das ich voranbringen möchte, lässt sich zwar unterschiedlich beschreiben, aber wie auch immer wir es betrachten, es wird schwierig bleiben. Es geht darum aufzuzeigen, dass ein Universum voller Prozesse, die selbst nicht geistig oder bewusst sind, sich so organisieren kann, dass gefühlte Erfahrungen entstehen. Irgendwie muss sich ein Teil der oft geistlosen Aktivitäten der Welt in den Geist eingefaltet haben.
Dualismus und Panpsychismus, aber auch etliche andere Anschauungen gehen davon aus, dass dies nicht möglich sei; Geist lasse sich nicht, jedenfalls nicht gänzlich, aus etwas völlig anderem, aus vollständig ungeistigen Bestandteilen herstellen. Entweder muss Geist in allem enthalten sein oder er muss zusätzlich »obendrauf« gesetzt werden – nicht im wörtlichen Sinne obendrauf, aber einem physikalischen System zugefügt werden, das prinzipiell auch ohne ihn vollständig wäre. Ich hingegen glaube, dass man – oder dass die Evolution – Geist aus etwas anderem aufzubauen vermag. Wenn Dinge, die selbst nicht geistig sind, auf eine gewisse Weise angeordnet sind, entsteht Geist. Geist ist eine evolutionäre Hervorbringung, die durch die Organisation anderer, nichtgeistiger Elemente der Natur zutage tritt. Dieses Zutagetreten ist das Thema des vorliegenden Buchs.
Ich habe gesagt, dass der Geist ein evolutionäres Produkt und etwas Gebautes ist, möchte aber gleich der Entstehung eines häufigen Irrtums vorbauen. Eine materialistische Sicht behauptet nicht, dass der Geist ein Effekt, eine Konsequenz oder ein Produkt physikalischer Prozesse in unserem Gehirn ist. (Huxley war offenbar dieser Auffassung.) Vielmehr gestaltet sich das Ganze so, dass das Erleben und andere mentale Vorgänge aus bestimmten biologischen und von daher physikalischen Prozessen gemacht sind. Unsere geistigen Vorgänge sind in Materie und Energie angelegte Ordnungen und Aktivitäten. Diese Ordnungen verdanken sich der Evolution; sie sind langsam entstanden. Diese einmal entstandenen Ordnungen sind jedoch nicht die Ursachen des Geistes; sie sind Geist. Vorgänge im Gehirn sind nicht Ursachen von Gedanken und Erfahrungen; sie sind Gedanken und Erfahrungen.
Das ist das biologisch-materialistische Projekt, wie ich es sehe: darzulegen, dass eine solche Position sinnvoll ist und dass die Dinge höchstwahrscheinlich so funktionieren. Ziel des vorliegenden Buchs ist, diesen Pfad so weit wie möglich zurückzuverfolgen. Ich glaube nicht, dass sich das Problem mit einem einzigen Federstrich erledigen oder sich seine Lösung wie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern lässt. Das Ganze wird nach und nach geschehen. Im Verlaufe des Buchs werde ich eine positive Sicht entwickeln, einen Lösungsansatz, der grob gesagt drei Elemente in einem, wie ich denke, sinnvollen Bild vereinigt. Aber nicht auf jede Frage gibt es eine Antwort und zahlreiche Rätsel werden ungelöst bleiben. Wie dieser Weg meines Erachtens verlaufen wird, findet sich lebhaft ausgedrückt in einer Passage, die ich über Jahre in den Vorstufen dieses Buchs als Epigraf vorgesehen hatte. Der Passus stammt von dem Mathematiker Alexander Grothendieck.
Das Meer rückt unmerklich und in aller Stille vor, anscheinend geschieht nichts und nichts wird durcheinander gebracht … Doch schließlich umgibt es die störrische Substanz, die nach und nach zu einer Halbinsel wird, die zu einer Insel und schließlich zu einem Inselchen wird, das irgendwann untergeht, als habe es sich aufgelöst in einem Ozean, der sich, so weit das Auge reicht, erstreckt.
Grothendieck arbeitete an äußerst abstrakten Problemen, selbst nach den Standards der reinen Mathematik. Das Zitat beschreibt seine Herangehensweise an Probleme seines Fachgebiets. Ein vor uns stehendes Rätsel scheint allen gängigen Lösungsmethoden zu widerstehen. Wir können oder sollten darauf reagieren, indem wir immer mehr um das Problem gelagertes Wissen ansammeln und darauf hoffen, dass das Rätsel sich wandeln und verschwinden wird. Die Situation gewinnt neue Konturen und wird schließlich begreiflich. Grothendieck verwendete dafür das Bild eines im Wasser versinkenden Objekts, einer Masse.
Ich trage dieses Bild bereits seit langem mit mir herum. Anders als manche Philosophen glaube ich nicht, dass es sich bei den Rätseln auf diesem Gebiet um reine Illusionen handelt, die sich überwinden lassen, wenn wir eine etwas andere Sprache verwenden. Neues muss gelernt werden. Aber indem man es lernt, ändert das Problem selbst seine Gestalt und verschwindet.
Grothendiecks Vergleich schien mir so passend, dass ich ihn zunächst als Eröffnungsmotto des Buches verwenden wollte. Doch in einer Zeit, in der auf einer sich rasch erwärmenden Erde das Eis an den Polkappen schmilzt und wunderschöne pazifische Inseln verschwinden, hat das Bild einen neuen Beiklang bekommen. Deshalb erschien es mir schließlich falsch, das Buch damit beginnen zu lassen. Aber noch immer beeinflusst Grothendiecks Metapher mein Denken, und die dort dargelegte Perspektive ist ausschlaggebend für den Aufbau des Buchs. Metazoa nähert sich dem Geist-Körper-Rätsel, indem es die Natur des Lebens, die Stammesgeschichte der Tiere und die zahlreichen uns heute umgebenden Ausprägungen tierischen Seins erforscht. Mit der Erkundung der tierischen Lebensformen bauen wir um das Problem herum, wir sehen, wie es sich wandelt und schließlich verebbt.
Dieses Buch ist die Fortsetzung eines Projekts, das seinen Anfang mit Der Krake, das Meer und die Ursprünge des Bewusstseins nahm. Darin ging es, geleitet von einer besonderen Tiergruppe, den Kopffüßern, zu denen auch der Krake gehört, um die Evolution und die Entstehung intelligenten Lebens. Am Anfang von Der Krake standen Erlebnisse mit diesen Tieren im Wasser, beim Tauchen und Schnorcheln. Diese Begegnungen mit den Kopffüßern in ihrer proteischen, bunten und irisierenden Komplexität motivierten dazu, verstehen zu wollen, was in ihnen vorging. Dies wiederum war Veranlassung, ihren Evolutionsweg nachzuzeichnen, der schließlich an einen Schlüsselmoment in der Geschichte der Tiere führte, an eine uralte Abzweigung in der Genealogie des Lebens. Diese vor über einer halben Milliarde Jahre erfolgte Gabelung führte an ihrem einen Ast zum Oktopus (neben anderen) und auf dem anderen Ast zum Menschen.
In Der Krake waren bereits einige Ideen zu Geist, Körper und Erleben am Beispiel der Tiere, denen ich folgte, skizziert worden. Im vorliegenden Buch werden diese Ideen weiterentwickelt und verbessert. Dies ergab sich aus einem näheren Blick auf die philosophische Seite, der Erforschung weiterer Äste des Stammbaums des Lebens und vieler Stunden unter Wasser, die ich mit anderen Vertretern unserer tierischen Verwandten verbracht habe. Während ich in dem Kopffüßerbuch immer wieder auf die Kraken zurückgekommen bin, ist es die Absicht des vorliegenden Werks, diesen Pfad anhand von vielen verschiedenen Tieren zu beschreiten, solchen, die uns auf dem Baum der Evolution näher und anderen, die uns ferner stehen. Für manche dieser Tiere war auch ich ein Lebewesen, das sie beobachten und dem sie begegnen konnten; für andere war ich noch nicht einmal ein Schemen in einem Traum. Gegen Ende des Buchs wenden wir uns näher stehenden Verwandten zu, mit Körpern und Intelligenzen, die den unseren ähneln. Insgesamt aber ist die historische Erkundung auf die früheren Evolutionsstufen ausgerichtet mit dem Ziel, zu verstehen, wie das Erleben überhaupt auf die Erde kam, zuerst im Wasser und später auf dem Land.
So also sieht der Weg dieses Buchs aus. Wir gehen – kriechen, wachsen, schwimmen – durch die Geschichte des tierischen Lebens von seinen Anfängen an und begleitet von einer Reihe heutiger Geschöpfe. Wir lernen von jedem einzelnen Tier, von seinem Körper, wie es fühlt und agiert, wie es sich auf die Welt einlässt. Mit ihrer Hilfe versuchen wir nicht nur die Geschichte nachzuvollziehen, sondern auch die verschiedenen Formen von Subjektivität zu erkennen, die es heute um uns herum gibt. Mein Ziel ist keineswegs enzyklopädischer Natur und ich versuche nicht, die Tiere in ihrer ganzen Breite abzudecken. Ich konzentriere mich auf jene, die in der Evolution des Geistes Übergänge markieren, also vor allem jene Stadien, durch die der Geist entstehen konnte. Bei den meisten handelt es sich um im Meer lebende marine Lebensformen. Steigen wir also die Stufen hinab.
* Am Ende des Buchs finden sich zahlreiche Anmerkungen mit Quellenangaben und weitergehenden Einlassungen. Sie sind nach Seiten angeordnet und durch den Satzanfang kenntlich gemacht, auf den sie sich im Haupttext beziehen.
2
Der Glasschwamm
Türme
Oft befindet sich, gleich unterhalb jener Wasserschichten, die vom Sonnenlicht noch gut durchdrungen werden, vor allem dort, wo Strömungen herrschen, ein Schwammgarten. Sobald das Licht nachlässt, stößt man auf Landschaften aus bewegungslosen tierischen Körpern. Sie haben die Form von Bechern, Knollen, Kelchen oder verzweigten Bäumen. Manchmal sehen sie aus wie Hände in dicken Fäustlingen, als ob etwas von unter dem Meeresboden sich mit weichen, halb ausgebildeten Gliedern nach oben zu strecken versucht.
In dieser Flachwasserzone halte man Ausschau und stelle sich ein viel kälteres Meer vor, das ganze Szenario dort in äußerste Schwärze gehüllt, durch die einige wenige Partikel von oben herabrieseln. Auf dem Ozeanboden, tausend Meter unter der Oberfläche, steht ein blasser Turm, etwa dreißig Zentimeter hoch und zylindrisch in einer Ansammlung anderer Türme, die unten fest auf dem Boden sitzen und oben ein bisschen breiter und teilweise offen sind. In ihrer weichen Außenhülle steckt ein Gitter aus winzigen harten Nadeln, deren kleinste die Form von Sternen, Haken oder schmalen Kreuzen mit gestauchten Winkeln haben und zusammen das turmartige Geflecht ergeben. Die Türme haften mit feinen Ankern am Boden. Die Anker und die Kreuze sind aus Siliziumdioxid gebildet, dem Hauptbestandteil von Glas.
Ein Schwamm, sei es auf einem Riff der temperierten Zone oder in der Mondlandschaft der Tiefsee, wirkt tot und unbeweglich, ist es aber bei genauerem Hinsehen nicht. Er funktioniert wie eine geräuschlose Pumpe und zieht Wasser durch sich hindurch. Dabei hat er Empfindungen und reagiert. Der Tiefseeturm, der Glasschwamm, hat einen Körper, der zudem wie eine Glühbirne auf dem Meeresboden (Bling, ein Licht geht auf) Licht und elektrische Ladung leitet.
Zelle und Sturm
Hintergrund für die Evolution des Geistes ist das Leben selbst – nicht alles, was mit dem Leben zu tun hat, nicht die DNA und wie sie funktioniert, aber andere Merkmale. Am Anfang steht die Zelle.
Das früheste Leben, noch vor der Entstehung von Pflanzen und Tieren war einzellig. Tiere und Pflanzen sind riesige Zellzusammenschlüsse. Auch bevor solche Zusammenschlüsse entstanden, lebten die Zellen wahrscheinlich nicht immer völlig vereinzelt, sondern häufig in Kolonien und Klumpen zusammen. Gleichwohl war eine Zelle ein winziges eigenständiges Selbst.
Zellen haben ein Inneres und ein Äußeres, sie sind begrenzt. Die Grenze ist eine Membran, die den Zellkörper teilweise abdichtet, dabei aber über Kanäle und Öffnungen verfügt. So herrscht ein unablässiges grenzüberschreitendes Hin und Her und im Inneren herrscht hektischer Betrieb.
Eine Zelle besteht aus Materie, aus verschiedenen Molekülen. Ich weiß nicht genau, was Ihnen vorschwebt, wenn ich »Materie« sage, aber häufig denkt man bei dem Wort an eine reglose, massige Daseinsform, bei der schwere Gegenstände in Bewegung versetzt werden müssen. Diese Vorstellung von Materie verdankt sich den Gegebenheiten auf festem Boden und bei mittelgroßen Objekten wie Tischen und Stühlen. Geht es aber um Zellmaterial, muss man anders denken.
In einer Zelle finden Ereignisse im Nanobereich statt, in dem die Objekte in millionstel Millimeter gemessen werden, und das Medium, in dem diese Ereignisse ablaufen, ist wässrig. In einer derartigen Umgebung verhält sich Materie völlig anders als in unserer mittelgroßen Welt auf dem Trockenen. In dieser Größenordnung laufen Aktivitäten spontan ab, sie müssen nicht erst angestoßen werden. Nach einem auf den Biophysiker Peter Hoffmann zurückgehenden Ausdruck findet in jeder Zelle ein »molekularer Sturm« statt, ein unaufhörlicher Tumult bestehend aus Zusammenstößen, Anziehungen und Abstoßungen.
Wenn wir uns eine Zelle wie ein kompliziertes Aggregat vorstellen, mit Teilen, die verschiedene Aufgaben zu bewältigen haben, so werden diese Einzelapparate ständig von Wassermolekülen bombardiert. Ein Objekt in einer Zelle wird etwa jede zehn Billionstel Sekunde von einem sich rasch bewegenden Wassermolekül getroffen. Das ist kein Tippfehler; die Größenordnung, in der sich in einer Zelle Dinge ereignen, ist intuitiv kaum zu erfassen. Diese Zusammenstöße sind alles andere als trivial; gegenüber den Kräften, die dabei freigesetzt werden, sind jene, die von den kleinen Apparaten ausgeübt werden, geradezu winzig. Die in der Zelle arbeitenden Apparate vermögen den Ereignissen höchstens eine bestimmte Richtung zu geben und so ein gewisses Maß an Kohärenz in den Sturm zu bringen.
Das Wasser als Medium ist wichtig, um den Sturm aufrechtzuerhalten. In einer solchen räumlichen Größenordnung würden viele Objekte, wenn sie auf dem Trockenen wären, einfach aneinanderhaften und sich zu einem Klumpen zusammenballen; im Wasser verklumpen sie aber nicht. Stattdessen werden sie fortwährend in Bewegung gehalten, was die Zelle zu einem Ort selbstständig erzeugter Aktivität macht. Wir denken, wie schon gesagt, Materie sei inaktiv und bewegungslos. Das Problem, mit dem Zellen umgehen müssen, besteht aber nicht darin, etwas anstoßen, sondern Ordnung erzeugen und Sinn und Rhythmus in den spontanen Ablauf der Ereignisse bringen zu müssen. Unter den Gegebenheiten der Zelle liegt die Materie nicht einfach untätig herum, sondern läuft Gefahr, sich zu sehr zu regen; das Problem besteht also darin, das Chaos zu organisieren.
Wenn wir Überlegungen über das Leben und seine Entstehung anstellen, führen fast alle Assoziationen, die wir gewohnheitsmäßig im Zusammenhang mit Materie geltend machen, in die Irre. Hätte sich das Leben an Land aus Objekten in der Größe von Tischen oder Stühlen entwickeln müssen, hätte eine solche Entwicklung nicht stattgefunden. Aber das Leben entwickelte sich im Wasser – vielleicht in dünnen Wasserfilmen auf einer Oberfläche, jedenfalls aber im Wasser, und zwar durch die Entstehung von Ordnung in einem molekularen Sturm.
Leben entstand schon ziemlich früh in der Erdgeschichte, vielleicht vor etwa 3,8 Milliarden Jahren auf einem Planeten, der heute etwa 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Das erste Leben war wahrscheinlich noch nicht zellförmig, aber es muss eine Möglichkeit bestanden haben, eine bestimmte Reihe chemischer Prozesse zu kontrollieren, abzugrenzen und daran zu hindern, sich wieder in der Umgebung zu verlieren. Irgendwann gab es dann Zellen, die zunächst wohl noch durchlässig und schwach ausgebildet waren, sich aber schließlich zu Bakterien oder dergleichen entwickelten, zu Zellen also, die ihre Organisation auf Dauer aufrechterhalten und sich reproduzieren konnten.
Mit dem Erwerb der Fähigkeit, sich selbst in Gang zu halten – Stoffe umzuwandeln, Ordnung zu schaffen, Methode in den Wahnsinn zu bringen –, gewann eine entscheidende Errungenschaft die Oberhand über die elektrische Ladung.
Die Zähmung der Elektrizität
Die Zähmung der Elektrizität war ein Kardinalereignis in der jüngeren Menschheitsgeschichte. Im neunzehnten Jahrhundert wandelte sie sich von einer rätselhaften, oft gefährlichen Kraft in ein Technologieelement, das die moderne Welt gestalten sollte. Wenn Sie dieses Buch im Schein einer elektrischen Lampe oder auf einem Computerbildschirm lesen, findet der Akt des Lesens mithilfe elektrischen Stroms statt. Der elektrische Fortschritt, der die Moderne begleitete, war bereits das zweite Ereignis dieser Art. Denn schon vor Milliarden Jahren, in sehr frühen Stadien der Evolution des Lebens, war die elektrische Ladung gebändigt worden. In Zellen und Organismen bringt die Elektrizität vieles, was sich dort abspielt, auf den Weg. Sie ist die Grundlage der Hirnaktivität – unsere Gehirne sind elektrische Systeme – und von vielem anderen mehr.
Was ist Elektrizität? Selbst für viele Physiker ist diese Frage nicht leicht zu beantworten. Elektrische Ladung ist ein Grundmerkmal der Materie. Die Ladung kann positiv oder negativ sein. Objekte mit der gleichen Ladung (zum Beispiel positiv und positiv) stoßen sich ab, und solche mit ungleichen Ladungen (positiv und negativ) ziehen sich an. Der Stoff, aus dem gewöhnliche Gegenstände bestehen, enthält beide Ladungen. Jedes Atom ist eine Kombination aus noch kleineren Teilchen, manche davon positiv (Protonen), andere negativ (Elektronen) und in den meisten Fällen gibt es noch Teilchen ohne Ladung (Neutronen). Normalerweise enthält ein Atom die gleiche Anzahl Elektronen wie Protonen, sodass ein Atom selbst keine Nettoladung aufweist, da die positiven und negativen Ladungen exakt ausbalanciert sind.
Die Anziehungs- oder Abstoßungskräfte der elektrischen Ladung sind stark. Hier ein Zitat des unvergleichlichen Richard Feynman aus seinen Vorlesungen über Physik:
Materie ist eine Mischung aus positiven Protonen und negativen Elektronen, die einander mittels dieser großen Kraft anziehen und abstoßen. Das Gleichgewicht ist jedoch so vollkommen, dass jemand, der neben einem anderen steht, diese Kraft überhaupt nicht spürt. Doch schon die kleinste Unausgeglichenheit würde wahrgenommen. Stünden wir eine Armeslänge von jemandem entfernt und hätte jeder auch nur ein Prozent mehr Elektronen als Protonen, so wäre die abstoßende Kraft unfaßbar groß. Wie stark wäre sie? Stark genug, um das Empire State Building hochzuheben? Nein! Um den Mount Everest hochzuheben? Nein! Die Abstoßung wäre so stark, daß sie ein »Gewicht« hebt, das dem der ganzen Erde entspricht!
In dem Mix geladener Teilchen, aus dem Materie gewöhnlich besteht, befinden sich die Elektronen, die negativen Teilchen, auf der Außenseite der Atome, während die Protonen (zusammen mit den Neutronen) das Innere bilden. Die auf der Außenseite befindlichen Elektronen können mitunter hinzugewonnen werden oder verloren gehen, sodass ein Ion entsteht. Ein Ion ist ein Atom (bisweilen auch ein aus mehreren Atomen aufgebautes Molekül), dessen geladene Teilchen sich durch einen derartigen Verlust oder Gewinn nicht mehr im Gleichgewicht befinden, und weist daher selbst eine Ladung auf. Wenn sich chemische Stoffe im Wasser lösen, bilden sich umherdriftende Ionen. Salzwasser ist Wasser mit gelösten Ionen. Ein Tropfen Meerwasser enthält zahllose geladene Partikel, die untereinander und mit den Wassermolekülen in einem Wechselverhältnis stehen und sich anziehen und abstoßen.
Elektrischer Strom ist eine Bewegung positiv oder negativ geladener Teilchen. In einem Metalldraht ist der Strom eine Bewegung von Elektronen, wobei der Rest all jener Atome, aus denen der Draht besteht, an seinem Ort bleibt. Der in der Technik, in Lampen, Motoren oder Computern verwendete elektrische Strom funktioniert vorwiegend auf diese Weise. Ein Strom kann aber auch eine Bewegung ganzer Ionen sein. Wenn positiv oder negativ geladene Ionen im Wasser dazu gebracht werden können, beständig in eine Richtung zu fließen, handelt es sich um elektrischen Strom. Das Ganze lässt keinen Strom fließen, sondern ist einer. Jeder Salzwasserbehälter kann einen solchen Strom enthalten, wenn man es irgendwie hinbekommt, ein Gesamtbewegungsmuster von Ionen der richtigen Art zu erzeugen. Anders als bei menschengemachten Erfindungen nehmen in lebenden Systemen die meisten Ströme diese Form an.
Ladung an sich ist nicht lebensähnlich oder geistig, sie bringt zahlreiche Ereignisse in der unbelebten – und der belebten – Welt hervor. Lebensaktivitäten allerdings laufen über die elektrische Ladung ab, insbesondere durch das Einsammeln, Pumpen, Treiben oder Freisetzen von Ionen.
Eine Zellmembran sorgt dafür, dass manches draußen, anderes drinnen bleibt, besitzt aber Kanäle, die für ausgewählte Stoffe durchlässig sind. Bei vielen dieser Kanäle handelt es sich um Ionenkanäle. Manchmal – und gegebenenfalls unter spezifischen Umständen – macht es ein Kanal den Ionen möglich, passiv von einer Seite auf die andere zu wandern; in anderen Fällen pumpt die Zelle Ionen durch die Membran.
Ionenkanäle finden sich mehr oder weniger abgewandelt in allen möglichen lebenden Zellen, auch in Bakterien. Die Gründe, weshalb Bakterien Öffnungen und Durchlässe für Ionen bauen, sind nicht immer eindeutig. Kanäle sind vielleicht ursprünglich nur entstanden, damit Zellen ihre Gesamtladung gegenüber der Umgebung anpassen, sie einstellen und bändigen können. Findet aber ein Verkehr über die Grenzen eines lebenden Systems hinweg statt, spielt er meist noch eine andere Rolle. Ein Ionenfluss kann als Minimalform des Empfindens fungieren, zum Beispiel, wenn ein Kontakt mit einem bestimmten externen chemischen Stoff einen Kanal öffnet und Ionen in die Zelle lässt. Diese geladenen Teilchen können dann im Zellinneren neue Ereignisse in Gang setzen.
Eine nächste Wirkung des Ionenflusses hat mit diesem Pendelverkehr zu tun, stellt aber eine umfassendere Veränderung für die Zelle dar. Dieser nächste Schritt ist die Erregbarkeit. Kanäle kontrollieren den Strom geladener Teilchen, und diese Kanäle können ihrerseits kontrolliert werden: Sie lassen sich öffnen und schließen. Dies kann chemisch oder durch physikalische Einwirkung stattfinden, es kann aber auch aufgrund der Ladung selbst geschehen. Spannungsabhängige Ionenkanäle sind Kanäle, die sich als Reaktion auf elektrische Ereignisse in ihrer unmittelbaren Umgebung öffnen. Dadurch wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt; ein Stromfluss bewirkt einen größeren Stromfluss, der sich über die Zellmembran verbreitet.
Dies scheint nicht unbedingt ein großer Schritt zu sein und auch seine Nützlichkeit springt weniger ins Auge als bei der oben beschriebenen Anordnung, wo der Ionenfluss auf die chemischen Stoffe reagiert, denen die Zelle bei ihren Bewegungen begegnet. Aber die spannungsabhängigen Ionenkanäle sind die Grundlage für eine weitere Neuerung, das Aktionspotenzial. Dabei handelt es sich um eine wandernde Kettenreaktion von Veränderungen in der Zellmembran, wie sie vor allem in unserem Gehirn stattfindet. Positive Ionen strömen an einem bestimmten Punkt in die Zelle ein und beeinflussen dadurch benachbarte Ionenkanäle, die sich öffnen und weitere Ionen in die Zelle lassen und so fort. So wandert eine Welle elektrischer Spannungsänderungen wie ein Impuls über die Membran. Ein Aktionspotenzial ist das blitzartige Ereignis, das bei Gehirnzellen als »Feuern« beschrieben wird. Dieses »Feuern« geschieht mittels spannungsabhängiger Ionenkanäle.
In einem spannungsabhängigen Ionenkanal wird ein Stromregler von den Ladungen beeinflusst, denen er ausgesetzt ist, das bedeutet, der Stromfluss wird elektrisch kontrolliert. Dies entspricht dem Prinzip eines Transistors. Zu Beginn dieses Abschnitts habe ich die Fortschritte erwähnt, die im neunzehnten Jahrhundert Elektrizität für technologische Anwendungen einsetzbar machten. Ein weiterer wichtiger Fortschritt war im zwanzigsten Jahrhundert die Erfindung des Transistors. Siliziumchips in Computern und Smartphones bestehen aus Verbünden winziger elektrischer Schaltungen nach seinem Modell. Der Transistor wurde um 1947 in den Bell Laboratories in den Vereinigten Staaten – oder jedenfalls um diese Zeit herum – erfunden. Der erste Transistor der Bell Laboratories maß etwa zweieinhalb Zentimeter und ist seither immer weiter verfeinert worden und in seiner Größe geschrumpft. Die gleiche Schaltung war bereits vor Milliarden Jahren, während der Evolution der Bakterien, erfunden worden.
Wenn Bakterien Transistoren erfunden haben, was haben sie mit ihnen angestellt? Warum bestand für sie die Notwendigkeit, Elektrizität durch Elektrizität zu steuern? Soweit ich beurteilen kann, ist auf diese Frage noch keine allgemein akzeptierte Antwort gefunden worden. Bakterien könnten die Transistoren benutzt haben, um das elektrochemische Gleichgewicht der Zelle aufrechtzuerhalten. Vielleicht haben sie sie zur Steuerung ihrer Schwimmfähigkeit benutzt. Vielleicht war es Zufall, dass Kanäle, die externe chemische Stoffe wahrnehmen, empfindlich auf Spannungsänderungen reagieren und dass Bakterien, die Kolonien in Form von »Biofilmen« bilden, Ionen als Signale von Zelle zu Zelle verwendeten. Allerdings haben Bakterien keine Aktionspotenziale – die blitzartigen Kettenreaktionen in unserem Gehirn –, sodass mir die ganze Situation etwas merkwürdig vorkommt. Vor mehreren Milliarden Jahren erfand die Natur die für die Computertechnologie grundlegende Hardwareschaltung – eine komplizierte und teure Schaltung zudem –, und zwar in Bakterien, aber offenbar haben die Bakterien damit nicht unbedingt nach Art eines Computers gerechnet.
Warum auch immer spannungsabhängige Ionenkanäle entstanden sind, für die Bändigung der Elektrizität waren sie ein Meilenstein. Wie ich weiter oben sagte, haben diese Kanäle keinen offenkundigen und eindeutigen Nutzen. In gewisser Hinsicht gilt dies auch für Transistoren und in beiden Fällen macht dieser Umstand ihre Bedeutung aus. Ein Transistor ist ein Mittel zur Steuerung, eine Vorrichtung, mit der gewährleistet wird, dass sich Ereignisse an einer Stelle verlässlich und rasch auf Ereignisse an anderer Stelle auswirken. Die zu steuernden Ereignisse können mannigfache Formen annehmen – je nachdem, was sich gerade anbietet. Spannungsabhängige Ionenkanäle, die Aktionspotenziale ermöglichen, befähigen eine Zelle auch zu Aktivitäten »digitaler« Natur; ein Neuron feuert oder es feuert nicht, ja oder nein. Nicht alle Tiere verfügen über Neuronen, die so blitzartig feuern. Nervensysteme funktionieren auch mit schwächeren Erregungspotenzialen, aber das digitale Moment ist sicherlich nützlich. Bemerkenswert, dass diese Steuerungsschaltung schon vor so langer Zeit erfunden worden war, als die meisten ihrer heutigen Verwendungen sich noch nicht einmal am Horizont der Evolution abzeichneten.
In unseren Tagen, da Computer und KI überall zu finden sind, ist es nur normal, ja geradezu unvermeidlich, danach zu fragen, wie sich diese Artefakte zu lebenden Systemen verhalten. Machen denn Organismen und Computer im Wesentlichen das Gleiche, nur auf Basis anderer Materialien? Ähnlichkeiten treten durchaus auf, häufig unerwartete, es ist aber auch wichtig, Unterschiede zu erkennen. Einer liegt darin, dass vieles, was eine Zelle tut, ihr Hauptgeschäft, ein Computer nie tun muss. Die Zelle ist zum größten Teil damit beschäftigt, sich selbst am Leben zu erhalten, sie muss dafür sorgen, dass genug Energie hereinkommt und trotz Zerfalls und Materialfluktuation ein bestimmtes Aktivitätsmuster in Gang gehalten wird. In lebenden Systemen sind die Aktivitäten, die denen von Computern gleichen – elektrisches Schalten und »Informationsverarbeitung« –, stets in einem Meer, in einer Miniökologie anderer chemischer Prozesse eingebettet. In Zellen finden alle Vorgänge in einem flüssigen Medium statt und sind der Wechselhaftigkeit des molekularen Sturms und all jenen chemischen Umwegen ausgesetzt, auf die sich lebende Systeme einlassen müssen. Wenn wir einen Computer bauen, bauen wir einen Apparat, dessen Operationen regelmäßiger und einheitlicher vor sich gehen; wir bauen etwas, das so wenig wie möglich von den richtungslosen Prozessen seiner Chemie abgelenkt wird.
Damit sind wir bei einem allgemeineren Punkt angelangt. In diesen ersten Kapiteln versuche ich immer wieder, das Durcheinander von Elementen und Vorgängen in Zellen und einfachen Organismen zu beschreiben. Es gibt ein Wort, das sich dabei für viele Stadien wie selbstverständlich anbietet: »Maschinerie«; wir schauen auf die Maschinerie der Sinnesempfindungen, die Maschinerie der Erregbarkeit. Ich tippe das Wort »Maschinerie« und bin mir nie im Klaren darüber, ob ich es nicht lieber löschen sollte. Im weitesten Sinne des Wortes sind spannungsabhängige Ionenkanäle Teile einer Maschinerie, ebenso wie Nerven und Gehirne. Dies abzustreiten, käme einem Schritt in Richtung dualistischer (Leib + Seele) oder vitalistischer (»Lebenskraft«) Anschauungen gleich. Deshalb sage ich mir, lösche das Wort nicht. Aber auch die Gegensätze zwischen Maschinen und lebenden Systemen sind von Belang. Zu den Lebensprozessen in den Zellen gehört es, Ordnung in einen molekularen Sturm zu bringen und Ionen wie einen Sack Flöhe zu hüten. In keiner von uns gebauten Maschine läuft etwas Vergleichbares ab. Wir bauen Maschinen in der Regel so, dass sie in ihren Tätigkeiten vorhersagbar und eingegrenzt sind – selbst dann, wenn wir sie später dazu heranziehen, chaotischere Abläufe zu simulieren. Die kompliziert organisierten Materialien in einer Zelle als Maschinerie zu beschreiben ist also in mancherlei Hinsicht richtig, in anderer nicht.
Ich möchte noch einen weiteren Gesichtspunkt im Inventar jener Lebensmerkmale, die es schon vor den Tieren gab, hervorheben. Zuvor habe ich ihn bereits einige Male gestreift, möchte ihn aber nun für einen Moment in den Mittelpunkt rücken. Es handelt sich um »Verkehr«, ein Hin und Her zwischen lebenden Systemen und ihren Umgebungen. Zu diesem Verkehr gehören der bereits beschriebene Ionenfluss, aber auch die Aufnahme von Rohmaterial und die Entsorgung von Abfall. Zellen sind zwar von Grenzen umgeben, aber sie sind nicht von der Welt abgeschlossen. Ich möchte darauf hinaus, dass Zellen eine Art Fenster haben.