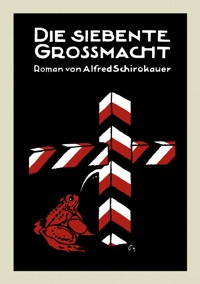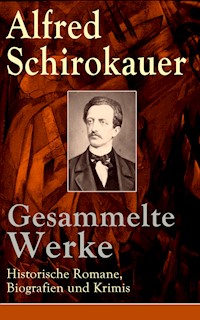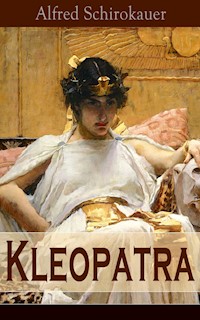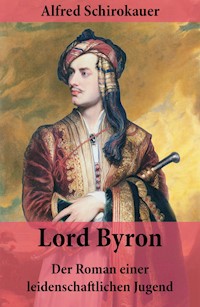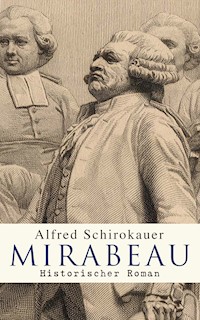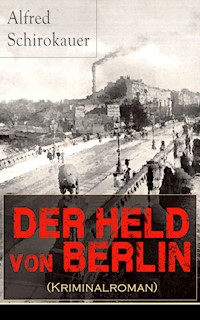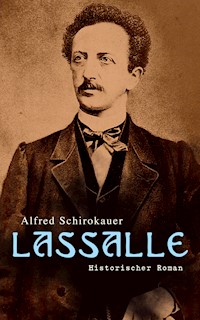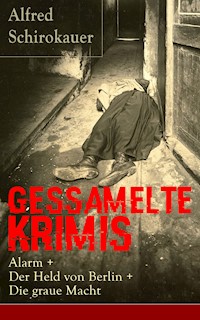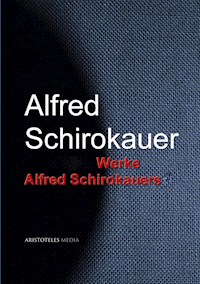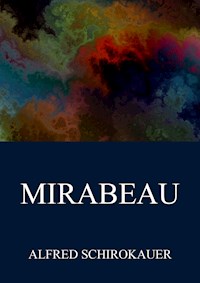
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Schirokauers historischer und biografischer Roman hat die Person des französischen adligen Revolutionsführers Mirabeau zum Thema. Nach der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten emigrierte der jüdischstämmige Schirokauer in die Niederlande und dann nach Wien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mirabeau
Alfred Schirokauer
Inhalt:
Alfred Schirokauer – Biografie und Bibliografie
Mirabeau
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
Mirabeau, A. Schirokauer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849635251
www.jazzybee-verlag.de
Alfred Schirokauer – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Jurist, geboren am 13. Juli 1880 in Breslau, verstorben am 27. Oktober 1934 in Wien. Nach einer Zeit in England schloss er seine schulische Laufbahn mit dem Abitur in Hamburg ab. Das folgende Jurastudium beendete er mit einer Promotion. S. arbeitet danach als Rechtsanwalt und entdeckte erst um 1904 sein Faible für die Schriftstellerei. Neben seinen Romanen zählen auch Biografien wie z.B. über Lassalle, Napoleon oder Lucretia Borgia zu seinen Werken. Ab 1912 widmete sich S. verstärkt dem Film und schrieb und verfilmte viele Drehbücher. Da er jüdischen Wurzeln hatte wanderte er mit dem Erstarken der NSDAP nach Wien aus, wo er auch verstarb.
Wichtige Werke:
1906: Junges Volk
1908: Marta Riel.
1910: Messalina
1910: Die graue Macht
1911: Einsame Frauen
1912: Das Lied der Parzen
1912: Einige Jugendsünde
1912: Ferdinand Lassalle. Ein Leben für Freiheit u. Liebe
1914: Die siebente Großmacht
1914: Satan
1916: August der Starke
1919: Die Stürmer
1920: Irrwege der Liebe
1921: Mirabeau
1922: Die lieben jungen Frauen
1923: Napoleons erste Ehe
1924: Ilse Isensee
1925: Lord Byron.
1925: Lukrezia Borgia
1926: Hinter der Welt
1927: Die Bunten Schleier
1927: Der Tanz auf der Weltkugel
1928: Gegen Mensch und Schicksal, München
1928: Die Frau von gestern und morgen
1929: Hat's Hoff getan?
1929: Die unmögliche Liebe
1929: Der Tanz auf der Erdkugel
1930: Kleopatra
1930: Alarm
1930: Acht im Urwald
1931: Die einen weinen, die anderen wandern
1932: Don Juan auf der Flucht
1932: Der erste Mann
1932: Schüsse in Shanghai
Mirabeau
I.
Am Rande des Olivenhaines, mit dem das Städtchen Manosque sich gegen das flache Land gürtete, schritt Mirabeau auf und nieder. Trotz der südlich sengenden Hitze des Maitages lief er mit hastigen gehetzten Schritten von einem Ende des Wäldchens zum anderen. Der Mann glühte und dampfte in innerem Aufruhr, dicke Schweißtropfen sickerten aus dem dichten Haare hervor, rieselten über das pockennarbige wuchtige Gesicht. Er spürte es nicht. Seine Gedanken siedeten.
Er wandelte in den Wehen seiner ersten ernsthaften literarischen Arbeit. Ein Posaunenruf sollte sie werden! Ein Fanfarenstoß, daß die Perücken wackelten. Eine Kampfansage an die Regierung und ihre Mißbräuche. »Über den Despotismus.« So sollte sie heißen.
Die Gedanken überstürzten sich. Die Hände gestikulierten in der flimmernden Luft.
Die Grundlagen dieser Regierung wollte er angreifen. Wilde Schmähungen gurgelten in ihm auf, gewaltige bombastische Phrasenklötze ballten sich in seinem Hirn zusammen. Die Willkür dieses Regierungssystems wollte er niederschmettern, ihre selbstmörderische Finanzverwaltung, ihre ruchlose Rechtlosigkeit – ja, diese Rechtlosigkeit! Wer war dazu vom Schicksal hehrer berufen als er, er, der mit seinen Fünfundzwanzig seit fast zehn Jahren ein Opfer dieser gesetzlosen Regierungswillkür war?!
Eine lettre de cachet nach der andern hatte ihn von Gefängnis zu Gefängnis gehetzt. Im Jahre 1765, mit sechzehn Jahren, hatte der erste königliche Haftbefehl ihn in die Zitadelle der Insel Ré geworfen. Freilich auf Bitten und Veranlassung seines Vaters. Aber war eine Willkür deshalb entschuldbarer, weil sie sich zum Handlanger eines tyrannischen verfolgungswütigen Vaters erniedrigte!
Ha, sie sollten seine Stimme hören, die Herren in Versailles, die Frankreichs grausame Geschichte machten, hören sollten sie und erbeben!
Er rannte und schmiedete Zorn und Haß im Feuer seines unbändigen Temperamentes, in der Glut seines umfassenden Wissens, in der Lohe seines wortbildenden Genies zu singenden Schwertern.
Ab und zu warf er das mächtige Haupt mit der gepuderten, sorgfältig frisierten buschigen Haarmähne heftig zurück und blickte hinaus in das unter der Provencesonne dunstende Land.
»Wo sie bleibt, wo sie bloß bleibt?!« schnaufte er ingrimmig und stürmte weiter, ein überhitztes, kochendes, zum Springen überfeuertes, lebendiges Kraftwerk.
Endlich blieb er stehen. Der Schweiß rann ihm in den Mund. Der bittere Geschmack ekelte ihn. Er zerrte das Taschentuch aus den blauseidenen Kniehosen, riß den Zweispitz vom Kopfe und trocknete sich Stirn und Gesicht. Die Spitzenmanschetten des Rockes waren feucht und klebrig.
Er lehnte sich gegen den Stamm eines Olivenbaumes und blickte hinaus in die Flur voller Hügel, die den Ausblick beschränkten.
»Wo sie bloß bleibt?!« dachte er wieder voller Zorn. »Längst könnte sie zurück sein.«
Ein Drang, ihr entgegenzueilen, packte ihn. Er löste sich von dem Baume und tat einige Schritte vorwärts. Doch zur rechten Zeit gewahrte er den Polizeikommissär des Städtchens, der auf einem Dienstgange querfeldein schritt. Er flüchtete zurück in den bergenden Schutz der Oliven, knirschend vor Wut und dumpf ungezügelt aufheulend in seiner gefesselten Ohnmacht.
Diese Ketten! Diese Folter! Hier stand er im Schraubstock und mußte tatenlos harren, bis dieses Weib ihm endlich die Bücher brachte, deren er so dringend für seine Arbeit bedurfte! Festgeschmiedet durch die letzte lettre de cachet, eingerammt in dieses elende Nest Manosque, ein Gefangener des Königs. Weshalb? Warum? Weil der Vater es wollte. Weil der Vater willfährige Freunde unter den Ministern besaß, weil der Herzog von Vrillière gegen den wehrlosen Sohn den Bannstrahl des königlichen Haftbefehls schleuderte, ohne Prüfung, ohne Verhör, blindlings, in feiler Willkür, bloß weil ein erbarmungsloser Vater es begehrte.
Er wütete berserkerhaft, er schlug sich Fäuste und Stirn blutig an dem Stamm einer Olive. Der Schmerz beruhigte ihn. Er betrachtete gelassen die zerschundenen Hände. »Bluten muß man aus den Wunden, die dieser Despotismus schlägt,« sann er, »um den Schrei gegen ihn mit Blut schreiben zu können. Ich blute, ich werde schreien, blutgurgelnd schreien!«
Von der Hitze des Tages und seines Ungestüms erschöpft, setzte er sich auf den Stumpf eines gefällten Baumes nieder. Die Wäsche klebte widrig am Körper, im Rücken war eine peinlich feuchte Kühle.
Er stützte den Ellenbogen auf das Knie, legte das Löwenhaupt in die Handfläche und starrte hinaus in den Glast dieser Stunde des großen Pan.
Vor ihm breitete die Provence ihre glühende Sommerherrlichkeit. Wolkenloser tiefblauer Himmel, rein wie Glas, aber tückisch. In Minuten verdüsterte er sich oft und schleuderte seine Blitze, als rase er in jähem Haß wider die Welt, die er wochenlang leuchtend mild überdacht hatte. Kein Blatt der Oliven regte sich. Doch der Verrat lauerte. In Sekunden erwachte bisweilen der schlafende Mistral und tobte über das Land hin, zauste die Blätter, fegte sie vor sich her, knickte die Reben, wirbelte einen Blütenschwall zum Himmel empor.
Mirabeau sah hinaus in diese attische Landschaft mit ihren harmonischen beglückenden Linien, mit ihren lavafarbenen Felsen, mit ihrer kochenden Erde, die rötlichbraun glänzte, als wäre zerstäubter Backstein über sie hingestreut. Das war diese rätselvolle ausgedörrte Scholle der Provence, die doch in trächtigem Überflusse Frucht trug: Wein und Olive, Korn und grünende Wälder. Und mit einem Meer von Blüten jedes Fleckchen Erde farbenselig überschwemmte und die Luft schwelgerisch sättigte mit dem betäubenden Dufte des Lavendel, des Thymian, der Salbei, des Rosmarin, der Rosen in allen Schattierungen.
Mirabeau blickte hinaus in dieses Wunderland, und eine inbrünstige Liebe zur Heimat quoll in ihm auf.
In südfranzösischem Gefühlsüberschwange flüsterte er vor sich hin: »Du geliebte, arme, reiche, treue, verräterische Muttererde bist ich, und ich bin du. Aus deinem Staube bin ich gebildet, zu dir werde ich zurückkehren, wenn mein Weg – mein leuchtender Kometenweg – getan ist. Wie du, bin ich. Deine Säfte schäumen in mir, deine Quellen brausen in meinen Adern, all dein Gutes und Böses lebt auch in mir. Süßes, geliebtes Mutterland!«
Er sprang wieder empor. Lange sitzen konnte dieser überschäumende Mann nicht.
»Wo sie bloß bleibt, dieses infernalische Weib?!«
Er blickte angestrengt aus seinen funkelnden Augen ins Weite. Gegen den flirrenden bläulich-roten Horizont standen matt vier Rundtürme mit gezackter Zinne und ein Hügel, auf dem sie ragten.
Dort lag das Stammschloß seines Geschlechtes, Schloß Mirabeau. Von dort mußte sie kommen. Früh am Morgen war sie aufgebrochen, die väterliche reiche Bibliothek für ihn zu plündern. Trotz des strengen Verbotes des Marquis, die geringste Kleinigkeit aus dem Schlosse zu entfernen.
Freilich hatte der Sohn, als er kurz nach der Hochzeit mit seinem jungen Weibe das Château bezog, Möbel, Einrichtungsgegenstände, Bücher, alles, was nicht niet- und nagelfest war, verschleudert. Freilich! Aber war es seine Schuld, daß diese Dinge zum Trödler wandern mußten? Konnte er von der kargen Rente leben, die der Vater und der Krösus von Schwiegervater ihm boten?! Er hätte Luxus getrieben, die junge Frau mit Brillanten und Firlefanz überschüttet! Nun ja – sie war ein junges Weib und Schloß Mirabeau eine Öde. Etwas muß man den Weibern schon bieten. Trotz dieser Verkäufe hatte er zweihunderttausend Livres Schulden gemacht. Wer konnte dafür, daß der elende Mammon wie Wasser zwischen den Fingern verrieselte? Er? Nein. Sein Blut! Der Vater ersoff ja auch in seinen Schulden. Warum spielte er ihm gegenüber den gewissenhaften Hausvater! Er verpuffte das Geld in närrischen Bodenreformspielereien. Nun ja. Und er, der Sohn, in anderen närrischen Kinkerlitzchen. Chacun à son goût. Aber deswegen lettres de cachet, Haft, Gefangenschaft! Der Satan hole die Welt, die Väter und die Ungerechtigkeit! Zum Teufel, wo blieb dieses infernalische Weib?!
Aber jetzt – dort auf dem Feldwege – ein bewegter Punkt. Ohne Zweifel, ein Mensch. Das war sie!
Aller Vorsicht zum Trotze eilte er ihr entgegen. Er fieberte, endlich diese Bücher in Händen zu halten, die den Brennstoff der Wissenschaft in die Flamme seiner Abhandlung über den Despotismus schleudern sollten.
Doch bald erkannte er, daß er sich geirrt hatte. Der gemächlich nahende Mensch war nicht die sehnlich Erwartete, es war der Briefträger, der von der ländlichen Villa des Chevalier de Guibal zurückkehrte.
Enttäuscht blieb Mirabeau stehen und erwartete den Mann. Der grüßte devot den Grafen.
»Sagen Sie ja nicht, daß Sie mich hier draußen getroffen haben,« lächelte Mirabeau, »Sie wissen ja.«
»I, wo werde ich was sagen«, beruhigte der Beamte. »Ich weiß doch Bescheid.«
»Haben Sie was für mich, Tartarin?«
»Ich glaube fast.« Er kramte in der großen Ledertasche, die er am Riemen über die linke Schulter trug. »Mir war's doch so, als hätt' ich was für Euer Gnaden gehabt. Hier ist es schon. Ein Brief aus Bignon. Und hier noch einer. Aus Tain. An die Frau Gräfin. Aber den kann ich wohl gleich dem Herrn Grafen geben?«
Mirabeau nickte und zahlte das Porto.
Der Briefträger entfernte sich grüßend. Langsam schritt Mirabeau zum Olivenhaine zurück. Den Brief an die Gräfin barg er in der Tasche des Rockes, den anderen, aus Bignon, wog er unschlüssig in der Hand. Ein Gefühl des Unbehagens hielt ihn von der Lektüre zurück. Er war von dem Vater. Er enthielt sicher wieder nichts als Vorwürfe, Bosheiten, widrige Anwürfe dieses harten verschrobenen Mannes. Wozu sich ärgern!
Er drehte das Schreiben in den Händen. Doch als er den Schatten des Haines erreicht hatte, überkam ihn ein trotziger Mut.
»Pah,« dachte er, »fort mit der Feigheit! Ich werde mich über die Marotten dieses Menschen eben nicht ärgern. Basta.« Und flitzte das Schreiben auf.
»Mein Sohn,« schrieb der Marquis, »ich erfahre aus Mirabeau zu meinem Leidwesen, daß Du fortfährst, meine Bibliothek zu devastieren. Ich verbitte mir das. Ich werde mich gegen Dein impertinentes Freibeutertum zu schützen wissen. Du beschwerst Dich über meine Strenge und Ungerechtigkeit. Du! Wann bin ich ungerecht gewesen! Sind alle meine Maßregeln, Deine Haft, nicht jede einzelne durch Deine Vergehen, unerhörte Unbesonnenheiten, gemeine Tollheiten begründet worden? Wo ist der Vater, der nicht das Recht hat, seinen Sohn zu strafen, wenn der Sohn Dummheiten macht!?« Dann folgte die übliche Flut der Beschimpfung.
»Du bist eigensinnig, aufbrausend, unbotmäßig, zu allem Schlechten geneigt, ein struppiger Eisenfresser, von unglaublicher Niedrigkeit, Seichtheit, Lasterhaftigkeit, versunken in gemeine Leidenschaften, die Dein mütterliches – dieses verruchte – Blut verraten. Du kennst – wie sie – kein Schamgefühl, keine Wahrheit, keinen Glauben.«
Mirabeau lachte schallend. Diesen Kapuzinerton kannte er nun nachgerade. Der wirkte nur noch erheiternd wie die grotesken Zuckungen eines Polichinells.
Er las in angeregter Laune weiter. Doch da wurden seine weitläufigen breiten Züge steinern vor Staunen und Wut.
»Ich habe nun den letzten Schritt gegen Dich getan, der mir notwendig schien. Am 8. dieses Monats bist Du durch den Familienrat bei dem Zivilrichter des Châtelet in Paris entmündigt und unter Kuratel gestellt worden. Richte Dich danach!«
Eine Weile saß Mirabeau gelähmt, seine großen kastanienbraunen Augen waren erloschen. Doch dann wich die Erstarrung einer tobsüchtigen Lebendigkeit. Er sprang empor von dem Baumstumpf, auf den er sich zum Lesen niedergelassen hatte, er zerfetzte das Schreiben, er fuchtelte mit den Armen, er warf sich zur Erde nieder und biß tierisch in den grünen warmen Moosboden. Er schrie haßtolle Worte des Jähzorns. Dann kamen ihm Tränen. Diese Schmach konnte er nicht überleben. Diese nicht mehr. Zum willenlosen Kinde hatte ihn dieser entmenschte Vater gedemütigt. Wofür? Weshalb? War dessen eigene Jugend nicht toller gewesen als die seine? Hatte er nicht das Vermögen seiner Frau vergeudet? Hatte er nicht eine skandalöse Ehe geführt? Lebte er nicht heute – er, der Alte – öffentlich mit seiner Geliebten? War der zu seinem Richter berufen, gerade der? Heimtückisch hatte er den Familienrat bei dem Pariser Gericht beeinflußt und belogen und verhindert, daß man auch ihn vernahm!
Er weinte bittere Tränen der Verzweiflung. Dann überkam ihn wieder der Trotz. Ha, er würde sich gegen diesen entehrenden arglistigen Beschluß wehren! Ihn nicht lammsgeduldig hinnehmen. Bei Gott nicht! Zum König vordringen – nach Versailles eilen – trotz Haftbefehl – trotz Gefangenschaft. Er würde – er würde – tausend unausführbare Pläne drangen auf ihn ein.
Endlich straffte er sich. Jetzt galt es harten Kampf gegen diesen Vater. Jetzt! Er strich mit den kleinen schönen weißen Händen – seltsame Gegensätze zu seinem ungeschlachten Leibe – an seinen Flanken nieder, die ungeheuren Kräfte fühlend, die in seinem Herkuleskörper gärten. Da knisterte der Brief an seine Frau in der Tasche. Er hatte ihn vergessen. Jetzt zog er ihn hervor und betrachtete ihn sinnend.
Hm, aus Tain. Dort stand bei den Musketieren der Chevalier Gassaud in Garnison. Schau, schau! Sie hatten ja immer in Mirabeau zusammengehockt. Fast jeden Nachmittag seiner Urlaubszeit war der Herr Leutnant der Musketiere von Manosque nach dem Schlosse herübergeritten. Schau, schau! Nun schrieb er ihr!
Der Graf hob das Schreiben an die gewaltige Nase, die sein Gesicht arg verunstaltete, und roch an den Klebestellen des Briefes, als könne er seinen Inhalt erschnüffeln.
Plötzlich riß er das Schreiben auf. Starrte – starrte – und taumelte.
Dann raste er davon. Der Brief wehte in seiner Hand.
Er stürzte durch die kulissenhaften engen Gassen der kleinen Stadt. Die Buben rannten johlend hinter dem »verrückten Grafen«. Die Leute stutzten und zuckten die Achseln. Man war an seine seltsamen Launen gewöhnt. Er stürmte die Villa der Gassauds, in der er sich bei seiner Verbannung nach Manosque eingemietet hatte. Im Flur traf er auf die alte Frau von Gassaud, die Mutter des Verführers seines Weibes. Er stob an ihr ohne Gruß vorüber in sein Zimmer. Die alte Dame blickte ihm bestürzt nach, trippelte in den Garten, in dem der Chevalier mit seinem Bruder friedlich bei der Pfeife saß und über alte gemeinsame Kriegsfahrten plauderte.
Sie wollte den beiden ehrwürdigen Offizieren gerade ihr sonderbares Erlebnis mit dem Grafen berichten, als ein Poltern und Krachen sie lähmte, das aus den offenen Fenstern des Zimmers drang, in dem die Familie Mirabeau hauste. Auch die beiden Herren waren betroffen aufgesprungen. Ihre schwarzgewickelten Zöpfe hüpften ratlos hin und her.
Mirabeaus geköpfter Gattenstolz war gerade dabei, über alle Nippesfigürchen, Lampen, Vasen, kurz, über alles, was zerbrechbar war, für die Untreue seiner Gattin ein vernichtendes Scherbengericht zu halten. Es klirrte, splitterte, barst, zerplatzte. Dazwischen wetterte seine gewaltige Stimme unverständliches Donnergeroll. Die drei Alten sahen sich entgeistert an, dann liefen sie, wie aufgescheuchte flatternde Hühner, auf das Haus zu.
Sie traten ins Zimmer ... Der Graf stand in einem knisternden Trümmerhaufen und suchte neue Opfer seiner Massakerwut.
»Mein Gott, Graf,« keuchte der alte Herr von Gassaud, der Vater, »was beginnen Sie?!«
»Graf, sind Sie des Teufels!« ächzte Gassaud, der Onkel.
»Meine lieben armen Sachen!« schluchzte Madame Gassaud, die Mutter.
Nun begann auch der kleine Gogo, Mirabeaus Kind, im Nebenzimmer die Furcht seiner neun Monate kläglich herauszuwimmern.
Sein Vater blickte in zynischem Triumphe auf die drei ängstlich starrenden Alten. Ein stolzes Bewußtsein des Rechtes schwellte seinen gewaltigen Brustkasten.
»Ha,« rief er in provenzalischer Gefühlspose, »was ich beginne? Das fragen Sie! Hier, lesen Sie diesen Brief Ihres sauberen Herrn Sohnes und Neffen. Lesen Sie! Aber ich werde vernichten – alles. Alles! Das ganze Haus – und Sie – und das Weib. Und diesen Burschen. Frikassieren werde ich ihn. Frikassieren!!«
Er sah sich um, packte einen Stuhl mit lieblich geschwungenen Beinen, schwenkte ihn hoch empor und schmetterte ihn gegen die Wand. Unter entsetzter Triobegleitung starb er eines krachenden Todes.
Da stelzte Gassaud, der Vater, auf den Mann zu, der in komischer Gelassenheit raste.
»Graf, um Gott, fassen Sie sich! Was ist geschehen?«
»Was geschehen ist? Oh, nichts. Gar nichts. Ihr sauberer Herr Sohn hat mir mein – –«
Er brach jäh ab. In der offenen Tür stand die Gräfin Mirabeau, erhitzt und staubbedeckt von dem weiten Wege vom Schlosse nach Manosque, mit Büchern bepackt, im bauschigen weißen Perkalkleide, ein Gazefichu um die entblößten gelblichen Schultern der südlichen Brünetten, einen großen gebogenen Strohhut auf dem blauschwarzen dichten Haare, einen Musselinschleier im Nacken. Klein und zierlich, ein wenig, nach ihrer Weise, zur Seite geneigt, stand sie da, den Pack Bücher im Arme.
Neugierig und erstaunt blickte sie auf die Zerstörung und die vier Menschen.
Die Alten wandten sich in der Richtung der starrenden Augen des Grafen. Eine lautlose Pause entstand.
»Was geht hier vor?« fragte arglos Emilies bestrickender Mezzosopran.
Da setzte der Graf mit einem Tigersprunge über die Trümmerhaufen, griff wortlos zu, umkrallte den nackten Hals der Gräfin. Vor dem wuchtigen Anprall taumelte sie, brach in die Knie, die Bücher polterten zu Boden.
Das Trio schrie gellend auf.
Emilie gurgelte unter dem furchtbaren Griffe.
»Gabriel – Himmel – Gabriel – meine Stimme –«
Er grölte: »Deine Stimme – deine kostbare Stimme!! Du wirst nicht wieder Theater spielen, du Dirne!«
Und würgte.
Sie verdrehte die dunkelblauen Augen, wurde weiß, daß die schwarzen dichten Brauen stark hervortraten, und rang nach Luft.
»Er tötet sie«, schrie Madame de Gassaud und schlotterte ohnmächtig gegen die Wand.
Da erwachten in den beiden alten Offizieren die Männer und die Kavaliere. Instinktiv sprangen sie gegen den Würger an, zerrten ihn zurück. Doch seine Faust hielt fest. Emilie hüpfte grotesk unter seiner drosselnden Hand nach vorn.
Da riß Gassaud, der Onkel, ein Pistol vom Tisch und legte auf Mirabeau an.
»Lassen Sie Madame, oder – bei Gott! – ich drücke ab.«
Mirabeau sah ihn erstaunt an – langsam lösten sich seine Finger. Emilie torkelte zur Erde, rollte hin und her und winselte klagend.
Die beiden alten Offiziere bemühten sich um sie, hoben sie behutsam empor und legten sie auf das Kanapee. Die alte Dame war inzwischen wieder zu sich gekommen und blinzelte benommen mit den Augen.
Mirabeau kreuzte die Arme über der Brust und blickte drein wie ein von seinem Walten befriedigter Jupiter tonans.
Emilie richtete sich jetzt auf, rieb den Hals, den die roten Streifen seiner Fingerabdrücke gürteten, und schluchzte:
»Bist du wahnsinnig geworden, du furchtbarer Mensch!?«
Da ging der Graf wortlos zum Tisch, nahm das Schreiben und reichte es der Gräfin dar.
»Lies«, gebot er großartig. Er spielte die Tragödie des betrogenen Gatten und fühlte sich als den erhabenen Träger der Titelrolle.
Die drei Alten blickten neugierig und erwartungsvoll drein.
Harmlos nahm die Gräfin den Brief, warf einen raschen fragenden Blick hinein, schrie leise auf, errötete unter dem Morbidezzateint und las. Las sehr langsam, Zeit und Ausflucht zu gewinnen. Der Bogen bebte in ihren Fingern. Dann ließ sie das Blatt in den Schoß fallen und blickte in kindlicher Angst zu Mirabeau hinüber.
»Was hast du darauf zu erwidern?« fragte er gewaltig.
Emilie suchte zu sprechen. Ihre Kehle war rauh. Sie räusperte sich und entgegnete heiser und leise:
»Ich meine, Gabriel, das haben wir beide doch wohl miteinander abzumachen.« Die alte Dame erhob sich hastig.
»Bleiben Sie«, wetterte der Graf. »Vor Ihnen, meine Herrschaften, soll dies erledigt werden. Sie sollen hören, wer Ihr Herr Sohn und Neffe, wer diese Dame ist. Den Brief her!«
Er riß ihn an sich, ehe Emilie es verhindern konnte. »Hören Sie, hören Sie, meine Herrschaften:
›Mein süßes Lieb! Träge schleichen die Stunden dahin. Ich denke Dein. Jede Nacht hat tausend Stunden. Ich denke Dein. Ich gedenke der göttlichen Wonnen, die Du mir geschenkt hast. An jeden Deiner Küsse, an jede Liebkosung, die mich zu einem Gotte erhob, denke ich! Wann werde ich wieder an Deiner warmen Brust liegen? Wann, wann endlich?‹
»O Gott!« stöhnte die alte Dame und verbarg ihr Gesicht.
»Sapperment!« ächzte Gassaud, der Onkel. Gassaud, dem Vater, hatte es den Odem verschlagen.
»Hören Sie weiter:
›Wie erträgst Du unseren grausamsten Feind? Trotze seiner Willkür, seinen Launen. Oh, wenn ich Dich doch bald von ihm befreien könnte! In Liebe, Liebe, Liebe Dein sich in Leidenschaft nach Dir verzehrender Laurent-Marie de Gassaud.‹«
Mit Triumphatorenblick überflog Mirabeau sein Auditorium.
»Entsetzlich!« Madame Gassaud rang nach Luft.
Die Herren schwiegen unter der Last der Familienschmach und blickten voll Verachtung auf die Ehebrecherin.
Die aber hatte sich gesammelt.
»Was hast du zu sagen?« herrschte der Graf sie an.
»Daß ich nur Gleiches mit Gleichem vergelte. Du schwärmst doch so sehr für Freiheit und Gleichheit«, erwiderte sie trotzig.
Da brauste der Jähzorn wieder über ihn hin. Mit einem Riesensatze seiner schweren langen Beine war er bei dem Kanapee, warf sich über die Frau und würgte sie von neuem. Sie schrie auf, strampelte mit den Beinen, daß die Unterwäsche weiß aufleuchtete, kratzte mit ihren schöngepflegten spitzen Nägeln und wehrte sich aus Leibeskräften. Ihr Widerstand reizte seine Wut. Sie wurde zur Besessenheit. Er würgte und würgte. Schaum zischte zwischen seinen Zähnen. Ihre Gegenwehr erlahmte, sie röchelte. Madame schrie um Hilfe, die Männer zerrten mit vereinten Kräften an den Rockschößen des Rasenden – ohne Erfolg. Da lief die Alte aus dem Zimmer, kam zurück mit wehenden Röcken, Gogo, das schreiende Kind, im Arme.
»Ihr Kind – sehen Sie Ihr Kind! Haben Sie Erbarmen! Machen Sie es nicht zur Waise!« flehte sie und sank auf die Knie, das zappelnde kreischende Kind hoch erhoben. Die beiden alten Herren fielen auch auf die Knie nieder. Es war ein Getümmel von Lallen, Bitten, Kindergeschrei, Todesächzen der Frau, wutbrünstigem Knirschen des Mordgierigen.
Plötzlich hielt er inne, blickte auf, sah die kniende Gruppe, sah sein Kind – hob den Kopf – lächelte seltsam – stand auf und ordnete sein zerrauftes Jabot. Die Herren erhoben sich und bürsteten ihre seidenen Strümpfe mit den Händen.
Madame Gassaud eilte zum Kanapee, legte das Kind nieder, richtete den Oberkörper der kraftlos zur Seite gebrochenen Frau empor und strich ihr zaghaft die anschwellende Kehle. Dabei dachte sie: »Mein Gott, mein Gott. Diese entsetzlichen Ereignisse! Daß schreckliche Unsittlichkeit herrscht, weiß man ja. Aber doch nur draußen in der Welt. In Paris und den größeren Städten und in unserer Hauptstadt Aix. Das weiß man ja. Da soll es ja toll zugehen.«
Sie strich sanft die Kehle mit Daumen und Zeigefinger. Emilie öffnete matt und erstaunt die Augen. Die Alte strich weiter. »Ja, da draußen geht es wild zu. Sogar die Dauphine – ach ja, jetzt ist sie ja Königin seit einigen Tagen – soll ja böse Dinge treiben. Aber hier – in Manosque – im eigenen Hause – der eigene Sohn – diese liebe kleine Frau – –«
Sie zog hastig die Finger zurück, denn erst jetzt ward ihr bewußt, daß sie das lebendige Laster streichelte.
Die beiden alten Offiziere blickten stumm und finster zu Boden. Mirabeau grübelte. Seine Gedanken hasteten. Ihm war eingefallen, daß es keinen rechten Zweck hätte, die Frau dort zu erwürgen. Ihre Untreue hatte im Grunde nur seine Manneseitelkeit verletzt. Er legte kein allzu großes Gewicht auf diese Körperlichkeiten. Er liebte sie auch nicht mehr allzu heftig. Er erkannte, daß ihr Fehltritt sich gewinnbringend ausmünzen ließ. Er hatte sie jetzt in der Hand. Nun wollte er ihrem Vater, diesem edlen Herrn Emanuel von Covet, Marquis von Marignane, Seigneur von Vitrolles, Gignac, Saint-Victoret und anderen Orten, Gouverneur der Isles d'Or und der Festungen Portiros und der Levante, diesem Midas der Provence, die Daumenschrauben anlegen. Jetzt sollte er den Verrat seines Geizes büßen. Dieser lockere Held mit den pomphaften Titeln, der mit seiner Geliebten den Liebeshof zu Tourves zierte, hatte ihn übel betrogen. Er hatte sehr wohl gewußt, daß der arme Graf Mirabeau auf eine reiche Mitgift der reichen Erbin rechnete. Und hatte ihn mit der Hungerrente von dreitausend Livres abgefunden. Dieser Harpagon war im Grunde schuld an allem Elend. Ihm fielen gerechterweise die hohen Schulden zur Last, für die er hier in jämmerlicher Gefangenschaft schmachtete. Aber jetzt hielt er ihn in der Faust. Es würde ihm nicht gerade angenehm sein, wenn von Herrenhof zu Herrenhof der Provence die Flüsterkunde lief, daß sein einziges Kind die Ehe gebrochen hatte. Jetzt zappelte dieser alte Lüstling im Netze.
Während der Graf die freudigen Aussichten dieser kleinen artigen Erpressung übersann, war ihr schuldvolles Objekt langsam zu vollem Bewußtsein erwacht. Emilie hob das brünette hübsche Gesicht und sah scheu zu dem Manne auf, der nachdenklich zu Boden blickte. Jetzt warf er die Löwenmähne zurück, daß der Puder stäubte, und rief in edlem Pathos:
»Meine Damen und Herren!«
Alles blickte ihn erwartungsvoll an. Selbst das Kind, das jetzt friedlich den Daumen lutschte, sah mit großen runden Augen auf den von erhabener Milde umstrahlten Vater.
»Meine Damen und Herren! Ich habe mich entschlossen, Gnade zu üben. Ich werde dieses verräterische Weib nicht töten.«
Er hob die Hand, der drei Alten Ausbruch der Freude, ihre Erlösung vom Grauen zu bannen. Er wollte reden. Er wollte, in schauspielerischer Selbsttäuschung, die Wollust seiner hohen Güte auskosten.
»Eine unglückliche Kreatur, die ich vernichten könnte, windet sich zu meinen Füßen, umschlingt sie.« Er wies auf die Frau, die gelassen auf dem Sofa saß.
Trotz ihrer kaum verflatternden Todesfurcht entging Emilies ironischer Begabung die dichterische Lizenz dieses Bildes nicht. Sie biß die herrlichen weißen Zähne in die Unterlippe, ein Lächeln zu verbergen. Die Triole blickte ehrfurchtsvoll und dankbar drein und nickte.
Der Graf aber fuhr, hingerissen von seiner Großmut, in ekstatischem Schwunge fort:
»Ich sehe ihre Reue. Ihre Gewissensqualen entwaffnen mich. Ich denke an ihr schwaches Geschlecht, ihre Zweiundzwanzig, die zwei Jahre, die ich im Glück mit ihr gelebt. All mein Grimm fällt auf den Schurken zurück, der uns beide, sie und mich, vernichtet hat.«
Madame Gassaud hob flehend beide Hände, öffnete den Mund. Wieder hob der Redner die Rechte, Ruhe heischend.
»Aber muß ich ihn vernichten? Nein!«
Ein Atmen allgemeiner Erleichterung.
»Sein Vater wird sein Richter sein.«
Eifriges Nicken des Chevaliers de Gassaud, des Vaters.
»Ich brauche nur zu seinem Oheim zu sprechen, und sein Schicksal ist besiegelt.«
»Bei Gott!« rief heftig bestätigend Chevalier de Gassaud, der Onkel.
»Mein ist nicht die Rache. Ich kann mich nicht entschließen, das Leben einem Menschen zu entreißen, der zwar ein infamer Bursche, aber Sohn und Neffe der Menschen ist, die ich über alles achte und ehre.«
Jetzt gab es kein Halten mehr. Die drei Alten stürmten auf den Redner zu, umhalsten, küßten ihn, übergossen ihn mit den Strömen ihrer Dankbarkeit, ihrer Erschütterung ob seines Seelenadels und seiner gottähnlichen Vergebung.
Emilie lag in den Kissen des Kanapees behaglich zurückgelehnt und lächelte, lächelte nun schon ohne Verbergen.
Mirabeau war enttäuscht. In ihm ballten sich noch so herrliche Gefühle zu herrlichen Worten, die sich hatten entladen wollen. Der Ansturm des Kleeblattes hatte seine Rede schmählich untergraben. Er zürnte. Da er aber starkes Gefühl für szenischen Aufbau besaß und die Lage irgendwie gerettet werden mußte, entriß er sich den Händen der Dankbarkeit, schritt zum Tische, ergriff den unseligen Brief des Musketiers, entzündete eine Kerze und verbrannte ihn mit der Miene eines Hohenpriesters, der den Gewalten der Rache und des Zornes ein erhebendes Sühneopfer darbringt.
»Bravo, erhaben, ein herrlicher Mensch!« murmelte der Chorus.
»Und nun«, schloß Mirabeau die Feier, »wirst du diesem – diesem – jungen Manne schreiben. Komm her!« Er reichte ihr den Gänsekiel. »Schreib!«
Mirabeau schrieb seine Abhandlung über den Despotismus und ließ sich von den vier Insassen des kleinen Hauses in Manosque paschahaft verwöhnen. Die drei Leutchen überboten sich in Liebesdiensten, in Bewunderung seiner Seelengröße, in Verhimmelung, daß er ihren Sohn und Neffen geschont hatte.
Emilie umdiente ihn mehr aus Furcht, denn aus Bewunderung. Sie kannte ihn zu genau, um seine Erhabenheit nicht in ihrer richtigen Verkürzung zu sehen.
Wenn sie auch nicht ahnte, daß er ihr Schreiben an den Musketier nicht abgesandt hatte, so wußte sie doch, daß sie sich ihm durch ihre Torheit in die schonungslose Hand gegeben hatte. Sie fürchtete den Zorn ihres Schwiegervaters weit mehr als den ihres Vaters. Doch auch diesem würde ein Skandal sehr peinlich sein.
So umhätschelte sie denn den großen heftigen Mann mit der Seele eines heftigen großen Kindes und fügte sich seinen Wünschen und Launen. Nur selten hatte er Gelegenheit, ihren Trotz mit der Zauberformel zu brechen: »Du weißt doch, was du auf dem Kerbholz hast, wie?«
Ja, sie wußte es. Sie bereute nicht die Tat, nur die Torheit ihres unvorsichtigen Briefwechsels. Leichtlebig, wie der Vater, der sie erzogen oder vielmehr wild hatte heranwachsen lassen, war ihr der Ehebruch kein umstürzendes Geschehnis, sondern eine gesellschaftliche Zerstreuung. Sie fehlte ihr jetzt sehr. Der Graf war, trotzdem er von sich mit Recht behauptete, er sei ein »Athlet der Liebe«, kein ausdauernder Liebhaber. Wenn sie sich ihm in ihrer bedürftigen Begehrlichkeit nahte, wehrte er scherzend ab: »Du weißt, ich bin in der Liebe ein schlechter Schauspieler für ein Zugstück. Die Wiederholungen langweilen mich. Dafür ist, das mußt du doch zugeben, meine Premiere etwas, woran du mit Zärtlichkeit zurückdenken kannst.«
Nun ja, darin hatte er recht. Die erste Vorstellung hatte ihre Reize gehabt. Aber von einer Galavorstellung kann das Theater der Ehe nicht leben.
Sie langweilte sich, sie langweilte sich sehr, die kleine, hübsche, schwarze Frau mit den brennenden Sinnen. Sie saß im Garten der Villa – der kleine Gogo spielte neben ihr im Grase – und ärgerte sich über die schonende Güte der drei biederen Alten, die sie wie eine aus schwerer Krankheit Genesende behandelten, und dachte an die hellen Tage ihres Mädchentums in Aix.
Ach Aix, diese lustige flotte Hauptstadt der Provence, mit ihren Olivenhainen, ihren klappernden Ölmühlen, ihren weißen, heiteren, an die sonnigen Flanken der Hügel angekletteten Villen! Aix mit seinem alles überhauchenden Blumenduft! Aix mit seinen schattigen Alleen und seinen kostbaren Heilquellen! Aix mit seinem alten, stolzen, lebensgenießerischen Adel, diese wirbelnde sinnenfrohe Stadt des guten Königs René. Aix, die Stadt des Lebenskünstlers, ihres reichen, verschwenderischen Vaters!
Wie sorglos war dort das Dasein verronnen! Keiner kümmerte sich um sie. Die Mutter wohnte weit fort, kam aber dann und wann und lebte friedlich im Hause zusammen mit der Geliebten des Vaters, der nonchalanten gutmütigen Madame de Croze. Ach, und die übermütigen, liebestollen Tage auf dem nahen Schloß des Grafen Valbelle, des Intimus des Papas, Schloß Tourves, weit berühmt als »der Liebeshof der Provence«. Dort vereinigte sich fröhliche, ausschweifende, liederliche, unbedenklich glückliche Gesellschaft, die nur eine Sorge kannte: in ihrem Vergnügen gestört zu werden. Hier wurde geflirtet, geliebelt, die Cour geschnitten. Hier sammelte sich die Jugend und das amoureuse Alter unter dem Fröhlichkeitszepter der Madame des Rollands, der Königin des Liebeshofes. Hier wurde Theater gespielt und gesungen. Hier pulste das Leben, das leichtfertige, unbekümmerte, sonnendurchglühte Leben der Provence.
Das Herz zog sich der jungen gelangweilten Frau schmerzlich zusammen in der Erinnerung an die Tage ihrer Mädchenschaft. Und sie grübelte, weshalb sie gerade den Grafen Gabriel-Honoré Riquetti de Mirabeau geheiratet hatte, ihn, der berühmt war wegen seiner Häßlichkeit, seiner tollen Streiche, seiner Liebeleien, der nichts war und nichts hatte. Gerade ihn hatte sie erwählt, sie, um die sich die reichsten, elegantesten und flottesten Kavaliere des provenzalischen Adels bewarben. Weshalb hatte sie gegen den Willen des Vaters gerade diesen Mann erwählt? Welche unheimlich zwingende Gewalt strömte damals aus von ihm, daß sie sich ihn ertrotzte gegen den Vater, gegen die scharmanten Werbungen der Jeunesse dorée von Aix und Tourves?!
Sie fand den Grund nicht mehr. Sie grübelte und ärgerte sich und langweilte sich sehr, jetzt, da ihr auch die kleine Sensation der Liebelei mit dem Musketier Gassaud genommen war.
Bisher hatte seine amüsante Gegenwart oder die Spannung des Harrens auf seine Briefe die Gleichförmigkeit des Lebens auf Schloß Mirabeau und in Manosque erträglich gestaltet. Aber jetzt?! Ach Aix, du Jugend, du Fröhlichkeit – du Leben!
Madame Gassaud rief zu Tisch. Aufseufzend erhob Emilie sich, nahm Gogo auf den Arm und schritt langsam ins Haus. Nun nahte wieder der Stumpfsinn dieses gemeinsamen Philistermahles.
Als man sich gesetzt hatte und das provenzalische Fischgericht aufgetragen war, begann Chevalier de Gassaud, der Vater:
»Mein lieber Graf, ich habe heute einen sehr niederschmetternden Brief des Marquis von Tourettes erhalten. Er weigert sich plötzlich schlankweg, seine Tochter mit meinem Sohne zu verehelichen. Und alles war doch schon so gut wie geordnet. Meine Hochachtung für Sie verbietet mir die Vermutung – – –«
»Mit Recht, Chevalier«, fiel Mirabeau heftig ein. »Mit Recht verbietet Ihnen Ihre Hochachtung für mich die Vermutung, ich hätte dem Marquis das geringste über – den Fehltritt Ihres Sohnes –«, hier traf Emilie ein schmerzlicher Blick – »verlauten lassen.«
»Siehst du,« rief Madame, »ich habe gleich gesagt, dessen ist unser Graf nicht fähig.«
»Auch ich habe diesen kränkenden Verdacht weit von mir gewiesen«, versicherte Gassaud, der Onkel, mit Nachdruck.
»Ich habe ja nur –«, murmelte der Vater.
»Andere Gründe müssen den Marquis bewegen. Wir werden sie erfahren.« Der Graf sandte seine Loderaugen langsam rings um die Tischrunde und verkündete dann: »Ich werde nach Tourettes reiten und sie ermitteln!«
»Wie?« fragte Emilie erstaunt.
»Das ist unmöglich«, rief Gassaud, der Onkel. »Sie dürfen doch Manosque nicht verlassen!«
»Ich werde es verlassen. Kein Haftbefehl wird mich hindern, diesen Verdacht von mir zu schleudern.«
»Ich hege keinen Verdacht,« Gassaud, der Vater, hob die Serviette in abwehrendem Schrecken, »keine Spur von Verdacht!«
»Gleichwohl«, entschied Mirabeau fest, »werde ich reiten. Ich habe Ihrem Sohne verziehen. Ich werde dieser Verzeihung dadurch die Krone aufsetzen, daß ich das Mißverständnis tilge, das sich zwischen ihn und den Marquis eingeschlichen hat. Ich reite heute nacht!«
Und alle Vorstellungen und alle Warnungen konnten ihn von diesem gefahrvollen Vorsatz seiner Großmut und Laune nicht abbringen. Sein ungebärdiger Freiheitsdrang litt schon lange unter der fesselnden Enge seines Arbeitszimmers und der Gassen des Städtchens. Es trieb ihn hinaus. Der edle Vorwand kam ihm mehr als gelegen. Als die Dunkelheit durch die Straßen Manosques wandelte, sprengte er auf dem besten Rosse Gassauds, des Onkels, in die Nacht. Unbemerkt gewann er die Landstraße. Seine gewaltige Brust dehnte sich – Freiheit – Freiheit!!
Er kam nach Tourettes, verfocht mit Feuereifer die Liebe des Verführers seines Weibes, errang ihm die Braut und machte sich unangefochten auf den Heimweg. Ein Ritt von zwanzig Stunden lag vor ihm. Um Mitternacht würde er in Manosque eintreffen, sicherlich ungesehen ins Haus gelangen. Man schlief fest in diesem Ackerstädtchen der Provence.
Doch während er in der Freude der Ungebundenheit und des Erfolges seiner Reise dahintrabte, packte ihn der Wagemut. Das Städtchen Grasse lag nicht allzu weit. Dort wohnte Louise, die Lieblingsschwester, sein Ebenbild an Geist und Flamme, auch äußerlich ihm ähnlich, doch jede Linie zur vollendeten Schönheit veredelt, ein Frauenwunder der Provence.
Der Gedanke ward zugleich zur Tat. Er wandte den Kopf des Vollblüters in einen Seitenpfad und galoppierte dahin. Das würde eine Überraschung geben! Sie hatten sich seit Louisens Verheiratung im Jahre 1769, seit fünf Jahren, nicht gesehen.
Als der Graf in den Gassen des Städtchens einen jungen Burschen nach dem Hause des Herrn Jean-Paul de Clapiers, Marquis de Cabris, fragte, lachte dar breit und wies ihm den Weg.
»Was grinst du so affig?« fuhr Mirabeau ihn an.
»Oh,« lachte der Mann, »Sie sind fremd hier, Herr. Es ist das verrückteste Haus in der ganzen Gegend.«
Als Mirabeau in den Hof dieses »verrücktesten Hauses«, eines gefälligen kleinen Barockpalais, einritt, trat ein Diener auf ihn zu, nahm ihm das Pferd ab und meldete, daß nur der Herr Marquis zu Hause sei. Er führte ihn in einen Gartensaal, der die ganze Tiefe des Hauses durchmaß und aus hohen rundgeschweiften Türen vorn in den Garten, hinten in den sauberen Hof blickte.
In diesem Saale fand Mirabeau seinen Schwager emsig damit beschäftigt, Puppen mit verrenkten Gliedern aus blauem Papiere auszuschneiden. Als der Diener den Grafen meldete, stand der Marquis langsam auf und sah dem Eintretenden mit blöden wasserblauen Augen entgegen. Sein Anzug war unsauber und vernachlässigt, die Manschetten schmutzig und zerschlissen.
»Ah, der Herr Schwager Gabriel!« sagte er mit verblichener müder Stimme, ohne Erregung, ohne Überraschung. »Komm, setz dich.«
Mirabeau sah ihn verwundert an und folgte der Aufforderung.
»Ich schneide Puppen,« erläuterte der Marquis seine Nachmittagsbeschäftigung, »das macht mir viel Freude.«
Damit griff der Sechsundzwanzigjährige wieder zur Schere.
»Mein Gott,« dachte der Graf, »viel Verstand hat der arme Mensch ja nie gehabt. Hat dieses verteufelte Weib ihn auch noch um diesen schäbigen Rest gebracht!«
»Wo ist Marie-Louise?« fragte er.
»Marie-Louise?« wiederholte der Kretin und beugte sich hastig zu dem Schwager hinüber. »Fort!« Er machte eine weite, umspannende Bewegung mit der Schere, daß ihr Sonnenreflex über die mit einem bunten Feston bemalten Wände tanzte. »Sie ist fort mit ihm.«
»Ihm? Wer ist ›ihm‹?«
»Er!«
»Er? Wer ist ›er‹?!«
»Nun der Briançon, der Lump.«
»Und wer ist Briançon, der Lump?«
»Du weißt doch! Sie denken, ich weiß es nicht. Weil mein Kopf mich oft so schmerzt.« Er beugte sich dicht zu dem Schwager und flüsterte heiser. »Aber ich weiß. Ich guck' durch das Schlüsselloch. Ich seh', was sie treiben. Hui, was ich sehe!«
Mirabeau horchte gespannt.
»Aber sie sollen sich hüten. Ich ermorde ihn. So – so – so!«
Er stach gehässig mit der Spitze der Schere in die Luft.
»Hm«, machte der Graf, um etwas zu sagen.
»Und Geld gibt sie ihm, dem Lumpen, und meine besten Anzüge und Hemden und Essen und alles. Alles ihm. Mir nichts. Aber ich werd' ihn töten – so – so – so. Wenn mein Kopf nur nicht so weh täte – so sehr – weh.«
Er sank in sich zusammen, die Hand mit der Schere glitt schlaff hinab, das Gesicht ward noch stupider, die Augen erloschen – ein armseliges Menschenwrack lag der Marquis de Cabris im Sessel.
Der Graf taumelte zwischen Erschütterung und Staunen. Er hielt plötzlich einen Fetzen des Schicksals der geliebten Schwester in Händen, eines Schicksals, von dem er nichts gewußt hatte. Er stand auf und trat an eine der mit weißem Musselin bespannten Türen und starrte hinaus in den blühenden Sommergarten. Da sah er sie langsam mit einem Herrn den Kiesweg heraufkommen. Er lachte.
Das war sie, das war ganz die ausgelassene, bizarre Marie-Louise Mirabeau. Ganz sie. In Männerkleidung kam sie daher. Einen roten seidenen Rock, schwarze seidene Kniehosen, schwarze Strümpfe und Schuhe mit breiten Silberschnallen. Auf dem Kopf den Federhut der Hofkavaliere.
Der Anzug lag prall um die Büste, zeigte keck die Hüften, die rassigen Schenkel und die reine Linie der Beine. Das gepuderte Haar hing lockig unter dem Hut hervor.
Jetzt konnte der Bruder ihre Züge erkennen. Das Herz schlug ihm in ästhetischem Entzücken. Ja, sie war das schönste Weib ihrer Zeit. Die Reife ihrer Einundzwanzig hatte das Versprechen ihrer knospenden Siebzehn gehalten. Jetzt sah er die Leuchtkraft ihrer schwarzen Augen, die Frische ihres Teints, ihre stolze freie Miene, diese Züge, die an antike Statuen gemahnten, die Geschmeidigkeit ihrer rockbefreiten Glieder, die Grazie und den Zauber ihrer Bewegungen, die jedem Männerauge zur Verführung werden mußten.
Und dieser geschniegelte Geck da neben ihr in der blauen Uniform des Regiments Royal-Roussillon? Das war wohl der »Lump«, dem der arme Schwager den Scherenerdolchungstod geschworen hatte? Hm, der also! Allzu vertrauenerweckend war der just nicht!
Jetzt standen sie vor der Tür. Da riß Mirabeau sie auf. Ein geller Jubelschrei. Die Geschwister lagen sich in den Armen. Sie hing an seinem Halse, küßte ihn mit ihrer hemmungslosen Leidenschaftlichkeit und stammelte dazwischen die zeitlosen Worte überraschter Freude: »Gabriel – du? Du!! Wie kommst du hierher? Welch ein Glück! Welch eine Freude, dich endlich wieder einmal zu sehen, zu fühlen, zu haben!«
Als sie sich gefaßt und er sein Kommen erklärt hatte, stellte sie vor.
»Mein lieber, liebster Bruder Gabriel-Honoré – Herr Denis-Auguste de Jausserandy-Briançon, Seigneur de Verdache, Hilfsunterarzt im Regiment Royal-Roussillon.«
Die Herren verneigten sich. Eine Feindseligkeit, eine unbewußte Eifersucht sprang zwischen ihnen auf. Mirabeau durchforschte das fremde Gesicht scharf. Es mißfiel ihm. In den grauen Augen des jungen Offiziers flackerte ein fahler Schein der Falschheit und Ehrlosigkeit.
Doch Louises feuriges Temperament riß den Bruder aus der sorgenvollen Betrachtung.
»So läßt dich der Trottel hier sitzen. Wegmüde und bestaubt! Komm in mein Zimmer, da kannst du dich waschen und erfrischen.« Flugs legte sie den Arm um seine mächtigen Schultern – sie waren von gleicher Größe – und entführte ihn im Wirbelsturme.
Als er vor ihr stand und sich die Hände trocknete, sagte er nachdenklich: »Schade um dich!«
»Wieso?« fragte sie und setzte sich verwegen auf die Kante ihres Toilettentisches.
»Ich habe sehr oft an dich gedacht. Du weißt, wie sehr du mir ans Herz gewachsen bist. Aus dir hätte ein ganz großes Weib werden können, wenn du einem ehrenhaften und gescheiten Manne in die Hände geraten wärest, der dich liebte und dir Kopf und Herz gemeistert hätte.«
»Ja – wenn!« lachte sie.
»Deine Heftigkeit, deine Beweglichkeit, deine Phantasie verschleudern, wenn du nicht klug gezügelt wirst, alle diese edlen Kräfte. Du warst ein wundervolles Mädchen, das der Großmut aus Eigenliebe fähig war, der Hingabe aus Einbildung, der Treue und Ausdauer aus Hartnäckigkeit. Und das Ende von alledem – Herr von Briançon«
»Gefällt er dir nicht?«
»Nein. Ich bilde mir ein, etwas Menschenkenntnis zu besitzen. Er ist ein Roué, der an deiner Schönheit und deinem Reichtume schmarotzt.«
»Laß ihn. Er tut meinen Sinnen gut. Das genügt mir. Und ich brauche ihn. Oder glaubst du, daß der Trottel mir genügt. He? Und die Auswahl in Grasse ist nicht reich, mein Lieber.«
Sie sprang von der Tischkante und stand vor ihm, sprühend vor Schönheit und Begehrlichkeit, die Brust scharf herausgedrückt durch das Tuch des Männerrockes.
»Ein verteufelt herrliches Weib«, flüsterte der Graf. »Selbst ich könnte mich in dich verlieben!«
Da gab sie ihm einen leichten Klaps auf den Arm und lachte: »Das wäre ungefähr das einzige, das in unserer wahnsinnigen Familie noch fehlte. Bruder und Schwester. Aber lassen wir es bei diesem Manko. Komm!«
Sie gingen hinunter in den Saal, wo der Diener inzwischen Tee und Gebäck aufgetragen hatte. Man setzte sich und plauderte. Der Marquis fiel wie ein wildes Tier über die Kuchen her und stopfte gierig in sich hinein. Keiner beachtete ihn. Nur als er alles allein zu verschlingen drohte, entriß Louise ihm die Silberschüssel und schalt:
»Nun ist's genug, du Vielfraß!«
Er duckte sich angstvoll, wie ein Hund, der an Schläge gewöhnt ist.
Mit ausdrucksvoller Mimik und ihrem glockenklaren Lachen erzählte Louise ihre letzte übermütige Heldentat.
»Gabriel, haben wir einen Spaß gehabt! Die ganze Stadt hat sich gegen uns erhoben. Die braven Spießer waren über unser Verhältnis entsetzt. Als ob sie es besser trieben! Der einzige Unterschied ist doch der, daß Denis-Auguste und ich den Mut unserer Leidenschaft haben. Das können diese Philisterseelen nicht vertragen. Sie klatschten, brodelten, grüßten uns nicht mehr. Wenn wir ausgingen, war es ein Spießrutenlaufen durch eine Kette hochnäsiger, sittlich triefender Entrüstung. Da haben wir beide uns gerächt.«
Sie lachte und bog sich schabernackfroh in den Sessel zurück. Briançon lächelte mit schmalen Lippen. Der Marquis leckte mit der Zunge die Kuchenkrümel auf seinem Teller zusammen.
»Denis-Auguste und ich haben uns eines Nachts hingesetzt und Spottverse gemacht. Ich glaube, sie haben an Freiheit nichts zu wünschen gelassen. Du weißt ja, ich war immer groß in schlüpfrigen Knittelversen. Diesmal habe ich mich an Frivolität und Gemeinheit selbst übertroffen. Die haben wir drei Tage lang mit verstellter Schrift fein säuberlich abgeschrieben. Etwa hundert Zettel. Und eines Nachts mußte der Trottel sie an alle ›hochangesehenen‹ Haustüren der Stadt kleben.«
»Ja – ich – ich!« brüllte der Trottel plötzlich selbstbewußt dazwischen.
»Wirst du wohl schweigen! Du weißt von nichts!« herrschte sein Weib ihn an.
Er verkroch sich ängstlich in den Sessel und faßte mit einem Affengriffe die Tasse, die er laut schlürfend leerte.
Louise erzählte weiter: »Du kannst dir den Aufruhr am nächsten Morgen denken. ›Zu Ehren der Damen von Grasse‹ lautete die Widmung unserer Verse. Natürlich vermutete jeder in uns die Urheber. Alles berstet vor Wut. Aber nachweisen können sie uns nichts. Es siedet in Grasse wie in einem Kessel. Die schockierten Seelen platzen. Und wir – wir lachen – lachen!«
Sie warf die Beine hoch und tat es. Auch Mirabeau lachte. Das war das überschäumende Blut seiner Familie. Wie verwandt ihn dies alles berührte, dieses Ungebärdige, Maßlose, Engensprengende.
»Louise,« rief er, »darin erkenne ich uns. Das ist der Teig, aus dem auch ich geknetet, das ist der Ofen, in dem auch ich gebacken bin. Das sind unsere Ahnen, die in uns umgehen.« –
Als dann der Abend kam, warf Louise rücksichtslos den verdutzten Hilfsunterarzt der Royal-Roussillon zur Tür hinaus mit den Worten: »Nun pack' dich. Jetzt will ich meinen Bruder allein genießen.« Den Trottel schickte sie zu Bett.
Im traulich erleuchteten Zimmer saßen die Geschwister sich gegenüber. Die Türen standen offen, die milde Provencenacht hing in den Blättern der Platanen im Garten, Falter flatterten in die Flamme der Kerzen und fielen mit verbrannten Flügeln in Todeszuckungen zu Boden.
Sie sprachen von den alten Tagen der Kindheit zu Bignon, von den Spielen, den Streichen, dem Schwärmen, den Lebensphantasien.
»Und was ist aus uns Kindern dieses unseligen Hauses geworden!« klagte Mirabeau mit leiser Melancholie. »Die Älteste von uns, Marie, die sicher viel geistige Stärke besaß, die man für Verrücktheit hielt, weil ihre Sinne sie zum Äußersten trieben, ist eine geistig umnachtete Nonne. Die Zweite, Karoline, eine gutmütige Gebärmaschine, die nach elfjähriger Ehe ihr achtes Kind trägt. Ich, ein heimatloser unnützer Verschwender, ein Entmündigter, der von Gefängnis zu Gefängnis taumelt. Du, das Weib eines Schwachsinnigen. Und Boniface, unser Jüngster, der mit viel Geist und Witz geboren wurde, war geschaffen, es am Hofe zu hohen Ehren zu bringen, wenn diese abscheuliche Erziehung ihn nicht in Grund und Boden verdorben hätte. Heute ist er ein entarteter untauglicher Wüstling.«
Louise blickte träumerisch vor sich hin. Dann sagte sie: »Wir sind alle die unseligen Früchte dieses verruchten Hauses. Der Vater mit seiner unsinnigen, strengen, geistlosen, martervollen Erziehung ist unser aller böser Dämon. Er ist an allem schuld. Du bist mit dem Keim zu allem Großen geboren. Was hat der Vater aus dir gemacht – von mir nicht zu reden? Zuerst seine Knauserei, dann seine Härte, seine Vorurteile, seine Habsucht, sein Haß haben uns alle miteinander entstellt, verstümmelt, zugrunde gerichtet. Aber am beklagenswertesten, Gabriel, bleibt doch die Mutter.«
»Vielleicht!«
»Bestimmt!« rief sie heftig. »Du nimmst, ich weiß es, für den Vater, für diesen Vater, gegen sie Partei. Du, der so furchtbar unter seiner brutalen Faust leidet!«
»Gerade deshalb. Wie darf ich es wagen, ihn noch mehr zu erzürnen! Ich hänge von seiner Gnade ab. Nur er kann mich aus der Haft lösen, in der ich schmachte. Ach, wenn du wüßtest, wie ich ihn hasse, diesen Menschen. Wenn Haß töten könnte – längst wäre er martervoll verreckt.«
»Du Armer«, nickte sie. »Aber ich bin frei, gegen ihn zu kämpfen. Ich habe der armen Mutter 20000 Livres gesandt zum Kampf gegen dieses Ungeheuer.«
»Mutter trägt auch viel Schuld«, warf er ein. »Sie ist eigensinnig, wunderlich, mürrisch, zänkisch, launisch. Und verschroben und toll ist sie auch, wie wir.«
»Ja – ja – ja«, rief Louise ungeduldig. »Aber sie hat ihn lange angebetet, sie liebte ihn abgöttisch, obwohl er sie nur des Geldes wegen geheiratet hat, wie du deine Frau. Sie hätte ihn immer geliebt, wenn er es gewollt hätte. Es war so leicht, sie zu führen, ihre Fehler auszumerzen. Aber er legte es darauf an, sie zu unterjochen, weil er herrschsüchtig und ein Tyrann ist. Man unterjocht aber nicht einen starken, ganzen Charakter und eine heiße Einbildungskraft, wie Mutter ist.« Plötzlich lachte sie klingend.
»Eine Verteidigungsrede habe ich für ihn ausgearbeitet, die er in dem Prozeß, der jetzt beginnt, halten kann. Ich habe sie ihm gestern gesandt.«
Sie eilte zu einem Vertiko, suchte, fand und lief mit einem Bogen Papier zum Lichte. »Höre:
›Meine Tochter Louise habe ich gegen ihren Willen, gegen ihren Abscheu, gegen ihr Flehen gezwungen, einen Narren zu heiraten, weil er reich war und ich mir davon materielle Vorteile versprach. Damit habe ich ihr Glück begründet. Denn das höchste Glück ist die Wahrheit. Kinder und Narren sprechen sie. Also lallt der Marquis de Cabris Wahrheit in höchstem Grade. Also ist meine Tochter Louise ›in Wahrheit‹ sehr glücklich. Das ist erwiesen.
Mein Sohn ist ein Verbrecher. Denn alle meine Güter sind ihm als ältestem Sohne zugesichert. Trotzdem habe ich das meiste verkauft. Aber dennoch hemmt mich diese verwünschte Erbfolge. Ich kann mich nicht mehr nach meinem Belieben ruinieren, und das ist hart. Mein Sohn ist ein Verbrecher, weil er es seiner Mutter, die er liebt, ausgeschlagen hat, für sie Partei zu ergreifen, weil er zwischen den Urhebern seiner Tage neutral bleiben will – das ist eine höllische Scheinheiligkeit. Er hat Schulden gemacht, und