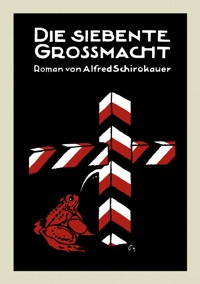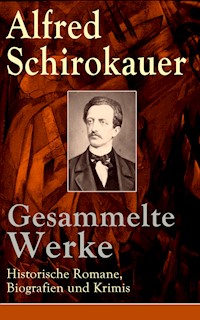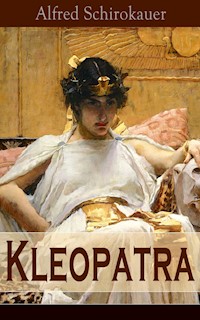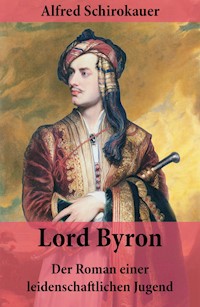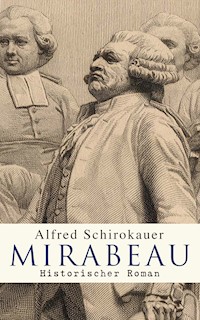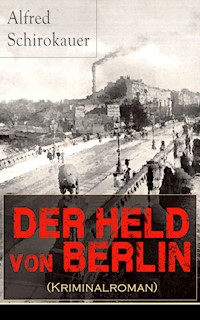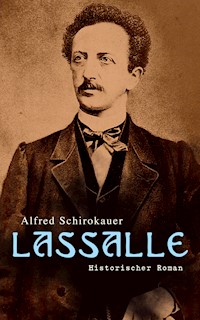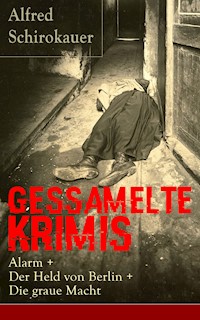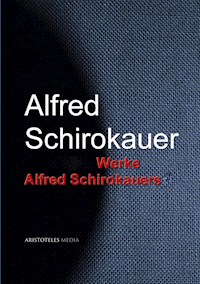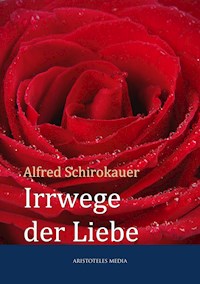Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dieses eBook: "Der erste Mann" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Sie verehrte den Vater als ein überirdisches Wesen. Sie wußte, daß er für den besten und beliebtesten Lehrer der Schule galt, kannte die Verehrung, mit der die Schülerinnen der obersten Klassen – o ferner Traum! – an ihm hingen. Ein Abglanz seines Glorienscheins leuchtete auch auf sie herab unter Lehrern und Schülern. Sie fühlte, daß sie um ihren Vater beneidet wurde. In ihrem Herzen war er der bedeutendste und größte lebende Mensch. Auch von Mama hatte sie ähnliche Urteile vernommen." Alfred Schirokauer (1880-1934) war ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der erste Mann
Roman einer Primanerin
Inhaltsverzeichnis
I
Ulrich Just ging mit kräftig ausholenden Schritten, als befände er sich auf weitzielender Wanderschaft, in seinem Arbeitszimmer auf und nieder. Der Raum war groß. Doch der kühne Schritt führte rasch von dem breiten Fenster zu der Schiebetür, die das Zimmer des Hausherrn von dem Eß- und Wohnraum trennte.
Just spürte die trennenden Wände nicht. Er war weit entrückt dieser gutbürgerlichen Sphäre, fort in der Welt seiner Gedanken, seines Strebens, seines Schaffens.
Dieser Klassenlehrer der O Ia war ein Künstler. Jede Unterrichtsstunde in der Oberprima des Gottfried-Keller-Mädchen-Gymnasiums lebte er voraus mit dem gleichen schöpferischen Eifer und einer Gewissenhaftigkeit, die nur wenig dem Zufall und der Eingebung überließ. Er wußte, es blieb immer noch genug Raum für die beglückenden Einfälle des Augenblicks, für die Anregung durch die Schülerinnen, für die Hingerissenheit durch ihre lebendige Teilnahme, und für die ewig neu aufflammende Begeisterung.
Doktor Just war Lehrer geworden aus innerer Notwendigkeit, wie einer Maler oder Bildhauer wird oder Schriftsteller. Sein Amt war ihm kein Beruf, sondern eine Berufung. In Momenten des Erfolges und der Ekstase erschien es ihm etwas fast Heiliges: Menschen zu bilden, Charaktere zu formen, Generationen zu erziehen. Das bloße Fachwissen, das er vermittelte, schätzte er gering. Deutsch und Geschichte, seine Hauptfächer, boten ihm strahlende Möglichkeiten seelischer und geistiger Beeinflussung, des Beispiels und Vorbildes. Daneben lehrte er neue Sprachen. Die beiden ersten Semester, grade vor dem Kriege, hatte er in Paris und London studiert.
Getrieben von dem Stoff, der in ihm nach Leben rang, schritt Just immer rascher auf und nieder. Die Zigarette zwischen die Lippen geklemmt, den durchgeistigten, seherhaften Kopf vorgebeugt. Sein Alter war ein dankbares Streitobjekt für seine Primanerinnen. Es war unbestimmbar. Sein dichtes dunkles Haar zeigte an den Schläfen schon graue Streifen. Aber die Haut war frisch und straff, und die braunen Augen – »Goetheaugen« nannte sie die O Ia, seitdem er vor kurzem begonnen hatte, ihr den Menschen Goethe zu verlebendigen – sprühten Jugend und Enthusiasmus. Er war sechsunddreißig.
Die »Marienbader Elegie« wollte er morgen diesen achtzehn-und neunzehnjährigen Weibchen ins Blut und ins Hirn ergießen. Diese letzte junge vulkanische Leidenschaft des Vierundsiebzigers vor ihnen aufflammen, sie mitfühlen lassen, wie die Liebe in dem weisesten und menschlichsten und größten aller Deutschen gewaltet und –
Just blieb vor dem Bücherschrank stehen, der die eine Wand des Zimmers ausfüllte. In der dunklen Glasscheibe der Tür stand gespiegelt sein Gesicht, bleich, mit weiten, angstvollen Augen. Lange blickte er sich an.
Und in diesem Augenblick tauchte zum erstenmal ehrlich, scheulos und durchdringend, fest umrissen, aus spukhaftem Nebel verkörpert und geboren, das klare Bewußtsein in ihm empor, daß er sie liebe. Leidenschaftlich, ungebärdig, verzweifelt begehrend.
Langsam löste er sein Gesicht aus der dunklen spiegelnden Scheibe der Bibliothek. Ging wieder auf und nieder. Doch der mutige Wanderschritt war gebrochen. Leise, unhörbar, schlich er über den Teppich. Ein Schuldbeladener. Ein Ertappter. Ein Verräter an seiner Kunst, seinem Werk, seinem Leben. Er liebte eine seiner Schülerinnen. Fanatisch, mit allen Sinnen. Lange schon. In einer Wut des Bekennens gab er es jetzt zu. Ja, ja. Wie ein Wetterstrahl war ihr erstes Erscheinen in der Klasse auf ihn niedergezuckt. Nicht lügen, nicht leugnen, nicht mehr dieses größte, grausamste Wunder seines Lebens verleugnen! Jeden Morgen, wenn er zur Schule ging, tobte das Glück des Wiedersehens in ihm. Nur sie sah er im Unterricht, nur für sie sprach er. Ihre Gegenwart verlieh seinen Gedanken Flügel, für sie erhob er sich zu Höhen wie nie zuvor. Sie umtastete sein Blick, sie umkosten seine Worte – sie –
Er liebte eine Schülerin, verlangte nach ihr, wie er nie nach einem Weibe verlangt hatte, er, dem seine Lehrerschaft Priestertum gewesen war an der heranwachsenden Menschheit, bis »sie« in seinen Lebenskreis getreten war.
Die Schiebetür glitt leise zurück. In der Öffnung stand Julie.
»Verzeih«, stieß sie verwirrt hervor, als sie sah, wie er zusammenschrak, »ich habe deinen Schritt nicht mehr gehört und glaubte, du bist fertig.«
»Nein, nein«, stammelte er und strich mit der Hand über die Stirn, »ich – ich habe nur ein Buch gesucht.«
»Entschuldige.« Sie schloß die Tür, ging zum Tisch, blieb betroffen und aufs neue tief beunruhigt stehen. Er war anders geworden seit einiger Zeit. Unwirsch, fahrig, versonnen, in sich versponnen. Seine Heiterkeit, die ewig frohe Gleichheit seiner Laune war irgendwie getrübt. Sie wagte nicht, ihn zu fragen. Aus einer Scheu heraus, die letzten Grundes eine lähmende Angst war.
Die Angst der beglückt liebenden Frau, jene zweifelnde Ahnung, die grade in den glücklichsten Ehen umgeht. Die bange Frage: warum sollte grade mir dieses unwahrscheinliche Heil beschieden sein, mir allein unter den Millionen Frauen, nicht einen Tag des Kummers an dem geliebten Mann zu erleiden?! Wird nicht doch eines bösen Tages die andere kommen, die ihn mir nimmt? Warum sollte es grade mir vergönnt sein, ihn dauernd zu halten und zu fesseln?
Liebe macht demütig und raubt den Glauben an ewiges Glück.
Sollte jetzt – die andere? Aber wo? Aber wie? Er ging doch kaum allein aus. An die Schule dachte Julie Just nicht. Sie wußte, wie hoch ihm sein Amt stand. Nie würde er in einer Schülerin das Weib sehen. Niemals. Aber wo? Aber wie denn?
Sie grübelte voll Angst und wußte nicht, daß alles was Menschen vom Menschen, auch dem vertrautesten und nächsten, wissen, brüchiges Stückwerk ist und Selbstbetrug.
Sie wartete lange auf ihn. Er kam nicht. Sie ging zu Bett. Er kam nicht. Lange nicht, bis er meinte, sie schlafe. Er konnte nicht in das Schlafzimmer gehen, in dem sie lag und auf ihn wartete, wie seit elf Jahren, weil ihm heute bewußt geworden war, daß es Verrat bedeutete – an Julie und an Ute Haink.
II
Am nächsten Morgen ging Ulrich Just in bebender Erwartung, wie seit Wochen, zur Schule. Noch heute pochte zum ersten Male in diese froh-beglückende Erregung ein dunkler Mißklang der Schuld. Eine dumpfe Bedrücktheit, deren er sich, aller Vernunft und allem Trotz zuwider, nicht erwehren konnte.
Gaby machte, wie immer stolz auf ihren schönen, berühmten Papa, mit ihren nackten, besockten, sonnen-braunen Beinchen neben ihm komische Springeschritte. Es war ihr Ehrgeiz, mit »Papsel« Tritt zu halten. Sonst verwehrte er es ihr lachend und mäßigte die Gangart. Heute beachtete er ihre drolligen, eigenwilligen Bemühungen nicht. Sie gingen immer zusammen zur Schule, wenn Just die erste Stunde hatte. Dann plauderte er lebhaft, ergriff jede Gelegenheit, spielerisch, unauffällig den Wissenskreis seines einzigen Kindes zu erweitern und zu klären. Heute, wie oft in der letzten Zeit, schwieg er. Auch Gaby hielt die plauderfrohen Lippen fest geschlossen.
Sie verehrte den Vater als ein überirdisches Wesen. Sie wußte, daß er für den besten und beliebtesten Lehrer der Schule galt, kannte die Verehrung, mit der die Schülerinnen der obersten Klassen – o ferner Traum! – an ihm hingen. Ein Abglanz seines Glorienscheins leuchtete auch auf sie herab unter Lehrern und Schülern. Sie fühlte, daß sie um ihren Vater beneidet wurde. In ihrem Herzen war er der bedeutendste und größte lebende Mensch. Auch von Mama hatte sie ähnliche Urteile vernommen.
Sie war andachtsvoll überzeugt. Wenn Papa, wie heute, schwieg, türmten sich in ihm große Gedanken. Mit Riesenschritten kämpfte sie sich neben ihm dahin, bemühte sich trotzdem, leise aufzutreten, und schoß zornige Blicke auf jedes Auto, das es wagte, hupend oder ratternd die Gedankenarbeit ihres Abgotts zu stören.
In der Nähe des Gymnasiums gerieten sie in den Strom der Schülerinnen. Sie wußte, wie ein kleiner Soldat, der mit einem hohen Offizier geht, daß sie nicht mitgrüßen dürfe, wenn Papa die Knickse der Jüngeren, die Verbeugung der obersten Vierhundert dankend quittierte. Aber ganz steif und gereckt vor Zugehörigkeit ging sie doch.
Da rief eine Stimme sie mit Namen. Sie wandte sich um. Es war ihre Busenfreundin Liselotte. »Willst du mit ihr gehen?« fragte Just. Er lechzte nach Alleinsein; das Kind störte ihn heute sonderbar.
»Aber nein!« empörte sich Gaby und nahm seine Hand, eine Anhänglichkeit, die sonst, als einer großen Gymnasiastin unwürdig, voller Verachtung streng verpönt war.
»Ich mag Liselotte überhaupt nicht mehr. Sie schimpft immer so auf ihren Vater.«
»Schimpft?« fragte Just automatisch. Seine Gedanken waren weit weg von den Worten des Kindes.
»Ja«, berichtete Gaby wichtig, »er hat Liselottes Mutter doch verlassen. Ist aus dem Hause weg. Er liebt eine andere.«
Justs Teilnahme war plötzlich gepackt. »Was ist das?«
»Ja. Und Mutti hat gestern auch gesagt, als ich es ihr erzählt habe, es wäre eine Gemeinheit, die Frau mit ihren drei Kindern zu verlassen.«
»Man soll nicht Geschichten aus andern Häusern weitertragen«, tadelte er sanft. »Das führt stets zu schiefen Urteilen. Kein Fernstehender kann in eine fremde Ehe hineinsehen.«
»Nicht wahr?!« rief Gaby kindlich feurig. »Ich habe auch zu Mutti gesagt, man weiß doch nicht, wie sie zu ihm gewesen ist, wenn keiner dabei war!«
Just stutzte schuldbewußt über den verteidigenden Eifer des Kindes.
»Wir wollen uns nicht um anderer Leute Privatangelegenheiten kümmern«, wehrt der Pädagoge in ihm. Dann aber fuhr er fort, als suche er bei seinem Kinde Hilfe und Verstehen in seiner Seelennot.
»Es kommt in einer Ehe nicht allein darauf an, Gaby, wie die Menschen zueinander sind. Liebe ist etwas unendlich Schweres – und Zartes. Schuld und Nlchtschuld spielen darin keine ausschlaggebende Rolle. Auch nicht Güte und Unverträglichkeit. Liebe kommt und geht. Liebe ist kein Verdienst für Treue und Zärtlichkeit. Liebe ist eine unverdiente Gnade und unverschuldete Schuld. Aber das verstehst du wohl noch nicht, kleine Gaby.«
Sie sah zu ihm auf aus ihren klugen braunen Augen, die den seinen wundersam glichen, und sagte nichts. Aber in der leuchtenden Iris stand ein altkluges ererbtes Begreifen, weit über ihre Jugend hinaus.
Sie kamen in das Vestibül der Schule, das widerhallte von dem stürmischen, lebensvollen Andrang Hunderter junger Menschen. Just strich über Gabys dunkles, unbedecktes Haar.
»Auf Wiedersehen, Gaby.«
»Auf Wiedersehen, Papsel.«
Sie stob kindlich wild davon.
Langsam stieg er die Treppe zum Lehrerzimmer hinauf. Auf dem Flur des ersten Stockes zögerte er. Er wollte nicht zu den Kollegen, konnte jetzt keine Gesellschaft ertragen.
Ruhelos ging er auf und nieder. Die Worte Gabys hatten ihn aufgewühlt. Kinder sprachen schon weise über Ehen! Jeder meinte, sich über Ehen ein Urteil anmaßen zu dürfen. Was wußte man von fremden Ehen – und von der eigenen?
Es zuckte verzagt um seinen bartlosen Mund. Nichts, nichts wußte man. Man lebte Jahre, elf Jahre, im Wahn der glücklichsten körperlichen und seelischen Gemeinschaft, und plötzlich – – Unsinn. Er liebte Julie. Ja doch. Wie immer, wie alle diese langen Jahre. Sie war sein bester, sein einziger Kamerad und Freund.
Er war immer in seiner Ehe aufgegangen. Hatte alles, alles Geistige und Wirtschaftliche, mit Julie besprochen, sie teilnehmen lassen an seinem Werden und Wachsen und Planen, seinen literarischen, pädagogischen Arbeiten und seinen Erfolgen. Hatte außer ihr keinen Geistesgenossen. Auch nicht unter den Kollegen, von denen mancher ihm wissenschaftlich nahestand. Aber Freund? Freund war ihm nur Julie mit ihrer seelischen Einfühlung und ihrem rasch erfassenden Verstand. Und dennoch – trotz allem – liebte er Ute Haink! Ja, warum eigentlich nicht? Es war doch töricht und anmaßend, zu glauben, die Liebesfähigkeit eines Menschen erschöpfe sich in einer Liebe. Mit fünfundzwanzig, nach dem Staatsexamen, hatte er geheiratet. Und damit sollte jede weitere Liebe ihm verschlossen sein!
Ein Wahn, ein Vorurteil, ein Aberglaube, den die Ehe aus Selbsterhaltungstrieb und Notwehr erfunden hatte. Eine Frauenerfindung. Er war ein lebendes Zeugnis dafür, daß Männer zur gleichen Zeit zwei Frauen lieben konnten. Frauen liebten anders. Aber Männer! Männer konnten zwei – vielleicht auch mehr – Frauen zur selben Zeit lieben mit der gleichen Kraft und Tiefe. Der Mann liebte ja in jeder Frau etwas anderes, andere Eigenschaften, andere Gaben, andere Verführungen und Beglückungen.
Just blieb stehen.
Hm, belog er sich nicht? Wahrhaftig nicht?! Liebte er Julie noch so ausschließlich, wie er sie geliebt hatte, ehe Ute in sein Leben getreten war? War er ganz ehrlich gegen sich – gegen sie?
Er ging gesenkten Hauptes durch den einsamen Korridor, in den der Atem des belebten Hauses hineinfauchte.
Ganz ehrlich sein! Keinen Lug und Trug in sein Leben einschleichen lassen! War nicht schon seit Monaten, noch ehe Ute Haink auf die Schule gekommen war, eine Müdigkeit in ihm gewesen, eine Sehnsucht nach Jugend und Rausch, nach Abenteuer und neuen Spannungen? Ein Fluchtwunsch aus dem geruhigten Gleichmaß des Altgewohnten, eine seelische Bereitschaft und ein tief innerlich bohrendes Verlangen nach Umschwung, nach Abwechslung, nach Aufruhr? War das alles in ihm gewesen, unbewußt vielleicht, oder bildete er es sich jetzt nur ein, weil das Neue, dieser Ausbruch aus der umzäunten Bahn einer elfjährigen Ehe über ihn gekommen war?
Die Glocke schrillte durch die Korridore. Just ging langsam auf seine O Ia zu.
III
Als Just die Klasse betrat, sah er unter den Mädchen, die sich zu seinem Empfang erhoben, nur sie.
Nicht, weil sie die Schönste der Oberprima war. Andere waren schöner. Nicht, weil ihr weißhelles dicht an die Kopfform geschmiegtes Haar wie eine Fackel leuchtete. Nicht, weil sie die Größte war, ihre hohe Gestalt hatte Ebenbürtige an Anmut, Schlankheit und Biegsamkeit. Nein, weil von ihr ein Fluidum von Natürlichkeit und Wärme und lebendigster Gegenwart ausströmte, und weil der Studienrat Doktor Ulrich Just für ihre geistige und körperliche Ausstrahlung der natur-und schicksalbestimmte Empfänger war. Mit anderen Worten, weil er sie liebte.
»Guten Morgen, meine Damen!«, rief er, und erkannte seine Stimme nicht wieder.
»Guten Morgen, Herr Doktor!«, antwortete der Chor der hellen und tiefen, der durchpulsten und trägen Stimmen. Dann sprach die Vertrauensschülerin das Gebet.
Just senkte gewohnheitsmäßig das Gesicht, sah dabei aber unter den Lidern hervor auf Ute. Sie hielt das Gesicht gradeaus gerichtet, die dunkle Bläue ihrer Augen, von dem blauen Lackanstrich der Tische und der Sitze der Stahlstühle, der Klassenschränke, der Tür und der Fensterkreuze kräftig vertieft, leuchtete ihm ins Herz.
Jetzt, in ihrer Gegenwart, war jedes Empfinden einer Schuld in ihm erloschen. Sie beherrschte die Stunde und sein Leben. Nur Freude an diesem Prachtexemplar modernen jungen Frauentums und ein helles Glück durchläuteten ihn. Es schien ihm, als atme er von seinem Platz die duftende Frische ihrer Haut, als spüre er bis hierher die blitzblanke Reinheit ihres Gemüts und ihrer Kleidung.
Das Gebet war gesprochen. Rascheln: Sechsundzwanzig junge Damen rauschten auf ihre Sitze nieder. Die Luft, die am Ende der Stunden gesättigt war von junger Lebenswärme und verbotenem Parfüm, war jetzt noch morgenkühl und würzig.
Just setzte sich an seinen Platz. Der Lehrertisch stand in der Öffnung des Hufeisens, das die blauen Stahlstühle bildeten. Formalitäten wurden erledigt, Fehlende ins Klassenbuch eingetragen. Dann stand Just auf, trat dicht an den ersten Tisch heran, an die Seite, an der Ute nicht saß. Er wollte jede verräterische Näherung vermeiden.
Jetzt hatte er sich in der Hand, auch seine Stimme hatte ihren gewohnten hart-metallischen Klang wiedergewonnen, als er sprach. Wohl fühlte er – wie immer – stark Utes Gegenwart. Es war gut, daß sie dort drüben saß, ihr heller Kopf scharf abgezeichnet gegen die Beigefarbe der Wand, und ihm aus erwartungsvollen schimmernden Augen auf die Lippen sah. Es beschwingte ihn. Er sprach für sie, doch nicht nur für sie. Er war so beflügelt und schaffensheiter in ihrem anspornenden Lauschen, daß in seinem geistigen Schwelgen auch Raum blieb für die fünfundzwanzig anderen.
In der Klasse war es lautlos still. Er eröffnete jede Stunde mit einem Vortrag, der einer jeden, auch der Teilnahmlosesten, auch der Denkfaulsten eine Anregung gab, ein Aufmerken abzwang.
»Ich möchte gern«, begann er, faltete die Hände auf dem Rücken und wippte sacht auf den Sohlen, »daß Sie von der Schule einen Begriff Goethe mitnehmen, der etwas Blutwarmes ist, der lebendig in Ihren Adern rollt, wenn Sie draußen im Leben stehen. Nicht ein ragender kalter Koloß, nicht ein unbegreiflich fernes Wunder soll der Mann für Sie sein, der den »Fischer« gedichtet und den »Faust« geschrieben hat und die »Morphologie der Pflanze«. Ich möchte Ihnen, einer jeden von Ihnen, persönliche, eigene Beziehungen zu dem größten deutschen Menschen, grade dem Menschen mitgeben, daß er in Ihnen weiterwirkt als Führer und Helfer, als Tröster und Wegweiser.«
Es war jetzt so still in der weiten Klasse, daß man durch das offene Fenster die welken Blätter auf dem Boden des Schulhofes rascheln hörte. In Justs Stunden vergaßen auch die Ausgelassensten den Schabernack, den sie sonst ausgiebig austobten.
»Den Menschen Goethe möchte ich Ihnen als Begleiter und Geleiter ins Leben mitgeben. Nie ist eines schöpferischen Mannes Erleben unlöslicher mit seiner Dichtung zusammengeströmt als bei ihm. Irgend jemand hat einmal gesagt – ich weiß im Augenblick nicht, wer es war – ist auch unerheblich – man könnte immer nur den Goethe des Alters verstehen, in dem man selbst stehe. Das bezweifle ich herzlich. Dann könnten Sie allenfalls noch den Goethe von Straßburg mit ihrem Hirn und Herzen erfassen. Ich nehme an, Sie protestieren gegen diese Unterstellung.«
Die braunen, schwarzen, blonden Köpfe in allen Farbennuancen, wenige mit Haarknoten, andere mit hängenden Locken und Pagenschnitt, stimmten ihm heftig bei.
»Ich gebe gern zu«, fuhr er lächelnd fort, »es gibt einen Goethe in den Sechzigern, der uns verhärtet und versteint erscheint. Aber dann, zu Beginn der Siebzig, nach der schweren Krankheit von 1822, wird dieser angeblich verhärtete Gelehrte wieder so erschütternd menschlich und zum Opfer und Dichter der gewaltigen, ewig jungen Leidenschaft.«
Er hatte es bisher vermieden, Ute anzusehen. Jetzt zwangen seine großen, braunen Augen sich zu ihr Bahn.
»Der Vierundsiebzigjährige verliebt sich mit der unbedenklichen Vehemenz eines Jünglings von Zwanzig in Ulrike von Levetzow. Sie war neunzehn. Sie hat ihn abgewiesen. Ob sie ihn nicht geliebt hat, ob andere Gründe sie trieben, weiß man nicht. Jedenfalls hat sie seinen Eheantrag, den der Großherzog von Weimar in Marienbad überbrachte, hinzögernd abgelehnt.«
»Und auf der Heimreise von Karlsbad nach Weimar dichtete er den verzweifeltsten Schmerz und das tragischste Verzichten, das in deutscher und fremder Sprache geklagt worden ist. Er nimmt den erschütterndsten Abschied von der Liebe dieses Lebens, der jemals in menschlichen Worten laut geworden ist. Ich spreche von der »Elegie«, die als Motto die Worte aus dem Tasso trägt:
»Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide.«
Er machte eine Pause. In seiner Stimme bebte eine Erregung, von der er nur wußte, wie persönlich sie war. Die Mädchen saßen ohne Regung, ihr Atem ging unhörbar und schwer. Jede war gepackt von einem Leid, das vor hundert Jahren geschehen und ewig war, weil Leid und Liebe ewig-menschlich sind.
Mit leichteren Worten fuhr er fort:
»Bevor wir uns in den Schmerzgesang dieses abgewiesenen großen alten Mannes versenken, will ich eine Frage an Sie richten. Ulrike von Levetzow war neunzehn. In Ihrem Alter. Und nun bitte ich Sie: stellen Sie sich das Erlebnis dieser jungen Dame vom Jahre 1823 einmal als das Ihre vor. Denken und fühlen Sie sich mit allen Kräften Ihrer Phantasie und Ihres Empfindens in die Vorstellung hinein, ein Mann wie Goethe liebe Sie und halte um Ihre Hand an. Denken Sie, Sie liebten ihn – oder auch nicht. Wie Sie wollen. Und bedenken Sie alles. Er war damals 74. Noch erkannten nur wenige seine übernationale Größe. Noch wußten sehr wenige, daß es nichts gibt in der geistigen Welt, was er nicht gedacht oder geahnt hat. Daß er das Weltgenie schlechthin ist. Aber vergessen Sie auch nicht: er galt schon damals für den größten Dichter und den größten Mann seiner Zeit. Er war geehrt wie ein Fürst. Er erhob Weimar zu einem Heiligtum und zum Mekka der Geistigen aller Nationen. Und stellen Sie sich vor, dieser erlauchteste Mann seiner Tage begehre Sie zum Weibe. Bedenken Sie: er hätte jede Frau zur ersten Frau des Jahrhunderts erhoben. Beachten Sie: schon durch seine Werbung hat er Ulrike von Levetzow unsterblich gemacht. Wer wüßte heute etwas von ihr? Aber die Weihe der Liebe Goethes trägt sie durch die Jahrtausende. Und nun sagen Sie mir: wie hätten Sie entschieden?«
Die Abteilung A der Oberprima des Gottfried-Keller-Gymnasiums war an Ueberraschungen bei ihrem Klassenlehrer gewöhnt. Man mußte bei ihm stets auf etwas Bestürzendes vorbereitet sein. In jeder Stunde. Diese höchst intime Frage aber überrumpelte diese Mädchen von 1931. Ein Knistern geisterte durch die Reihen der Tische, als die Körper der jungen Frauen sich in verlegener, belustigter oder ernster Überlegung vor-oder zurückbeugten auf den Stahlstühlen. Keine wagte sich zum Worte.
Just wartete. Er sah auf Ute. In diesem Augenblick des Harrens wußte er untrüglich, daß die Liebe zu ihr und die Erwartung ihrer Antwort ihn zu der »Elegie« geführt hatten. Er wollte sie über Liebe und Leidenschaft sprechen hören.
»Nun, meine Damen?« Er zwang seiner fiebernden Hoffnung das ermutigende Lächeln ab, mit dem er seiner Klasse manche heikle Antwort abgewonnen hatte.
Da fand Dina Quenz ihre flinke Zunge. In allem Schriftlichen war sie erbärmlich, auch im Mündlichen an Qualität keine Freude, an Quantität der Antworten aber die erste. Ihre Selbsteinschätzung stand in umgekehrtem Verhältnis zu ihrem wahren Wert.
Sie reckte ihre kleine zierliche Gestalt – so zierlich, wie sie glaubte, war sie freilich auch nicht – bot dem Lehrer ihr hübsches – auch über ihre Schönheit war ihre Ansicht übertrieben – brünettes Gesicht entgegen und rief: »Wie kann man einen 74jährigen Greis lieben! Ich finde es eine Zumutung von einem 74jährigen Mann, ein 19jähriges Mädchen heiraten zu wollen. Ob es nun Goethe ist oder ein anderer. Eine Ehe ist doch nicht nur Literatur! Es gibt doch auch Momente, in denen –«
Sie stockte verrannt. Die Klasse begann zu kichern. Jede der Mitschülerinnen wußte, daß Dina in sehr engen Beziehungen zu dem Mitglied einer fremden Gesandtschaft stand. Sie prahlte scheulos mit ihrer Eroberung.
»Ruhe!« donnerte Just. »Sprechen Sie weiter, Fräulein Quenz. Ich denke, wir sind alle hier reif genug, über Natürlichkeiten ohne albernes Getue zu reden.«
»Ich meine –« Dina hatte ihre selbstbewußte Unverfrorenheit wiedergewonnen – »eine junge Frau will –« sie brach wieder ab.
»Wenn ich Sie recht verstehe, meinen Sie, von Ihrem Standpunkt aus völlig gerechtfertigt, eine junge Frau verlange in der Ehe auch eine Befriedigung ihrer Sinne, und Sie glauben, daß ein alter Mann ihr diese nicht gewähren könne.«
»Allerdings«, rief Dina emphatisch. »Ich finde es überhaupt furchtbar unästhetisch und widerlich.«
Die Klasse siedete. Erörterungen über geschlechtliche Dinge waren bei Just nichts Neues. Alles wurde in den Kreis der Debatten gezogen, auch die Erotik. Kein Thema schien ihm von würdiger Behandlung ausgeschlossen.
Dann brach ein Sturm los, ein Orkan der Zustimmung und des Widerspruchs. Der Bann war gebrochen, die erste Scheu gelöst. Viele meldeten sich drängend zum Wort. Die kluge, stille Esther Mayer, schon seit der Sexta die Beste der Klasse, erhielt es.
Ihr bleiches, von schwerem, glänzendem schwarzem Haar umschattetes Gesicht leuchtete alabastern, wie von innen erhellt.
»Ich finde nichts Unästhetisches oder gar Widerliches in dem Gedanken. Eine Ehe mit einem Genie bietet, wenn man ihn liebt – und das ist doch die Voraussetzung jeder wahren Ehe –, andere Beglückung als eine Ehe mit einem ruhmlosen Mann. Das Körperliche tritt dabei völlig zurück.«
Unterdrückter Widerspruch bei den Leidenschaftlichen wurde laut.
»Und dennoch hätte ich gehandelt wie Ulrike von Levetzow.«
Atem der Überraschung wehte durch das Zimmer. Von der feinen klugen Esther hatten alle das Gegenteil erwartet.
»Bitte«, mahnte Just zur Fortsetzung.
»Ich denke mir das Zusammenleben mit solch einem überragenden Geist sehr lähmend und erdrückend.«
»Nanu?« rief eine vorlaute Stimme. Just drohte mit dem Blick in die Richtung der Unterbrechung.
»Selbst wenn die Frau von hervorragender Klugheit und ungewöhnlichem Wissen wäre. Was kann alle Klugheit und alles Wissen neben einem Goethe bedeuten! Nichts. Man muß sich dauernd klein und nichtig, töricht und erbärmlich vorkommen. Man wird aus Furcht und Hochachtung, und weil man sich in seiner Nichtigkeit aufdringlich erscheint, aus Scham noch unbedeutender, als man wirklich ist. Lebt ständig unter dem Alb der eigenen Unzulänglichkeit, wagt keine Meinung mehr zu äußern, kurz, erstickt unter dem ungeheuren geistigen und seelischen Übergewicht, das auf einem lastet. Verliert aus Befangenheit jede Selbständigkeit und jeden Mut des Gedankens –« sie warf den ausdrucksvollen Kopf zurück – »nein, ich hätte aus Selbsterhaltungstrieb gehandelt wie Ulrike, und ich glaube fast, sie hat aus meinen Gründen darauf verzichtet, die erste Frau ihres Jahrhunderts zu werden.«
Wieder folgte ein Raunen, ein Flüstern nachdenklichen Wägens und überzeugter Beistimmung.
Da hob sich Utes Stimme aus dem dumpfen Schwall. Ihre Stimme war wie ihr Haar. Hellweiß und funkelnd schien sie Just, und warm wie ihr Wesen, und erregt wie ihr lebhaftes Blut. Er sah sie nicht an, er genoß nur diese so körperlich wohltuende Stimme. Er wußte, noch ehe sie sprach, wie sie entscheiden würde.
»Wir sprechen von Goethe«, begann sie langsam, suchend. »Aber wir können verallgemeinern. Wir sprechen von der höchsten Liebe und Leidenschaft überhaupt.«
Just wandte sich ihr langsam zu, sah ihr von der Glut innigsten Erlebens erhitztes Gesicht. Ihre Wangen – schmale ovale Wangen – waren gerötet. Ihm war, als spräche sie Geheimstes ihres Gemüts aus, ein Geheimnis zwischen ihr und ihm.
»Da spielen die Jahre keine Rolle. Liebe ist zeitlos.«
Sie sah ihm klar und fest in die Augen. Der Blick schien ihm Bekenntnis und Verheißung.
»Wenn ein Mann von Goethes hoher Ethik Ulrike zum Weibe begehrte mit der Leidenschaftlichkeit, die aus der Elegie loht – ich denke an die Verse« – sie nahm das Buch auf und las:
»Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, Der ich noch erst den Göttern Liebling war; Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren So reich an Gütern, reicher an Gefahr; Sie drängten mich zum gabeseligen Munde, Sie trennten mich und richten mich zugrunde –