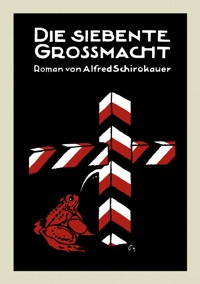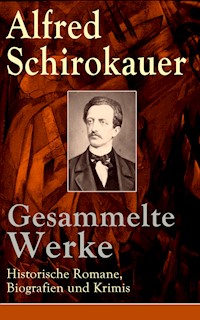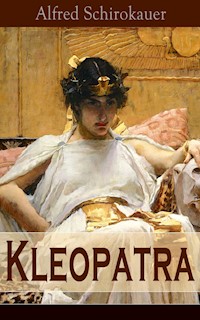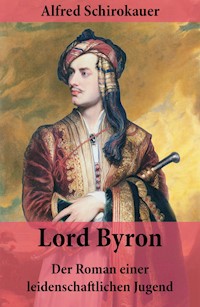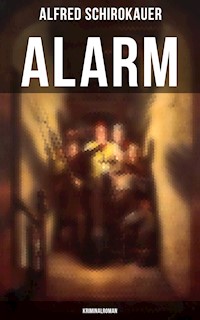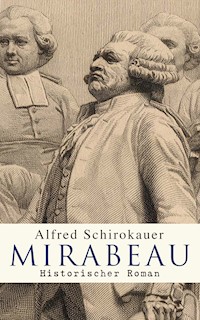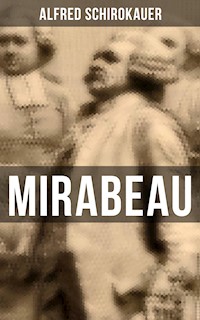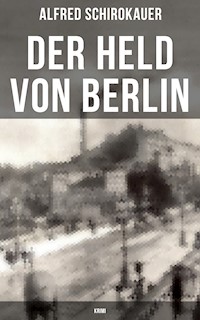Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die graue Macht (Krimi-Klassiker)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Alfred Schirokauer (1880 - 1934) war ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur. Er verfasste Romanbiografien über Ferdinand Lassalle, Lord Byron, Napoleon und Lucretia Borgia sowie historische und Gegenwartsromane. Seit 1912 schrieb Schirokauer auch häufig Drehbücher. Aus dem Buch: "Assessor Hoff kam die Wilhelmstraße herauf und bog in die "Linden" ein. Jung, stolz und hochgewachsen ging er dahin. In seinem Gesicht strahlte ein verwegenes Siegeslächeln. Wirklich, ja, er war stolz beglückt und zukunftssicher. Er hatte zwar immer dunkel geahnt, er würde seinen Weg machen. Aber daß der Erfolg so bald kam! Daß man ihn beim ersten zaudernden Schritt anerkannte! Das war fast wie ein Reifen aller bunten Blütenträume. Als der erste Band seiner "Geschichte des deutschen Strafrechts" vor einigen Wochen erschien, war er von der wissenschaftlichen Kritik und einigen Tagesblättern sehr lobend begrüßt worden. Das hatte seine Reize und Werte für einen jungen Autor. Aber was bedeutete das dem heutigen Erfolg gegenüber! Heute, ja - das war eine staatliche Prämiierung, obrigkeitliche Patentierung seines Könnens und seiner Auserwähltheit."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die graue Macht (Krimi-Klassiker)
Ein fesselnder Detektivroman
Inhaltsverzeichnis
1.
Assessor Hoff kam die Wilhelmstraße herauf und bog in die »Linden« ein. Jung, stolz und hochgewachsen ging er dahin. In seinem Gesicht strahlte ein verwegenes Siegeslächeln. Wirklich, ja, er war stolz beglückt und zukunftssicher. Er hatte zwar immer dunkel geahnt, er würde seinen Weg machen. Aber daß der Erfolg so bald kam! Daß man ihn beim ersten zaudernden Schritt anerkannte! Das war fast wie ein Reifen aller bunten Blütenträume. Als der erste Band seiner »Geschichte des deutschen Strafrechts« vor einigen Wochen erschien, war er von der wissenschaftlichen Kritik und einigen Tagesblättern sehr lobend begrüßt worden. Das hatte seine Reize und Werte für einen jungen Autor. Aber was bedeutete das dem heutigen Erfolg gegenüber! Heute, ja – das war eine staatliche Prämiierung, obrigkeitliche Patentierung seines Könnens und seiner Auserwähltheit.
Hoff überschritt den Platz vor dem Brandenburger Tor und durchschwelgte immer wieder die Überraschung der letzten halben Stunde. Er konnte es sich jetzt leisten, ehrlich einzugestehen, daß ihm das Herz recht unsanft gepocht hatte während der Viertelwartestunde im Anmeldezimmer des Ministeriums. Er wußte, daß es sich um sein Buch handelte. Das war ihm sofort klar, als er gestern die Order bekam, sich bei dem Dezernenten vorzustellen. Aber wer konnte wissen, was zwischen diesen zwei knappen dienstlichen Zeilen lauerte! Er jedenfalls, trotz allen Grübelns, nicht. Im großen ganzen liebte man oben die schriftstellernden Leute nicht enthusiastisch. Papier ist geduldig, und die Menge leichtgläubig. Man konnte ihr mit einer überzeugenden Geste alles mögliche Staatsgefährliche vorfabeln. Freilich war sein Buch rein wissenschaftlich und historisch. Ja, war es das wirklich? War es im Grunde nicht höchst aktuell? Blitzten nicht, wie von einem fernen Leuchtturm, immer wieder Streiflichter herüber auf die Strafrechtspflege von heute? Und dann. Hoff wußte sehr wohl, daß er aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hatte. Für scharfe Augen – und der Dezernent stand weiß Gott nicht im Rufe der Kurzsichtigkeit – war zwischen jeder Zeile zu lesen, daß der Herr Verfasser zunächst Mensch war, dann Gelehrter und erst in allerletzter Linie preußischer Beamter. Und ob man diese Reihenfolge oben gerade besonders sympathisch empfand?
Kurz und gut, das Herz hatte ihm gar bänglich gepocht, als er in das Arbeitszimmer des Ministerialdirektors eintrat. Es hatte diese unnötige Kraftvergeudung aber sofort eingestellt, als der sonst so streng blickende Herr mit freundlicher Miene auf den Angemeldeten zukam, ihm die Hand entgegenstreckte und erklärte, er freue sich, die persönliche Bekanntschaft des Herrn Assessors Hoff zu machen.
Als Hoff dann in der bescheidenen Schwebestellung des nichtigen Beamten vor der Allgewalt des Vorgesetzten auf dem angewiesenen Sessel pendelte und der Geheime Oberjustizrat versicherte, er habe das Buch mit großem Interesse gelesen, kehrte die übliche frische Farbe zusehends in Hoffs bleiches Gesicht zurück.
»Es ist ein sehr interessantes Werk«, wiederholte der Direktor und bearbeitete mit einem elfenbeinernen Buchaufschlitzer die Fläche seiner weißen Hand. »Wissenschaftlich – ja, im höchsten Grade wissenschaftlich und, und das ist das Wertvolle daran, mit den Augen eines Dichters geschaut.«
Hier wurde Hoff rot vor Freude, rot wie ein kleines Mädel.
»Sie sind der geborene Geschichtsschreiber«, fuhr der Direktor bedächtig fort. »Das ist mir von Kapitel zu Kapitel klarer geworden. Ihre Menschen leben. Sie geben keine toten Tatsachen. Denn sonst könnten Sie sich und uns die Arbeit auch schenken, Enzyklopädien des Strafrechts und des Strafprozesses haben wir zur Genüge. Aber ein groß angelegtes Geschichtswerk dieser Materie, das sich liest wie ein gutes Drama, ja Drama, Herr Assessor. Denn es lebt in dem Buche. Ich sehe einzelne Gerichtsszenen, zumal aus der überaus plastisch gelungenen karolingischen Zeit, noch jetzt lebhaft vor mir. – Solch Werk brauchen wir für die studierende Jugend und vielleicht auch ein wenig für uns Praktiker im Wirbel des Aktenstaubes.«
Da der Direktor hier eine längere Pause machte, ließ Hoff sich darüber vernehmen, wie sehr er sich freue, daß der Herr Geheimrat seinem ersten Versuch ein so lobendes Anerkennen zolle.
Hierauf erklärte der Geheime Oberjustizrat, er hoffe und glaube nach diesem Anfange auch erwarten zu können, daß die folgenden Bände sich dem ersten würdig anreihen würden. Hoff, dem immer behaglicher ums Herz wurde, schloß sieh diesen Hoffnungen und Erwartungen teilnehmend an. Als der Assessor jetzt in der Annahme, die Audienz sei beendet, Anstalten traf, die Ecke des Sessels, die er bisher okkupiert hatte, freizugeben, trat jäh das – große Ereignis ein.
»Herr Assessor«, räusperte sich der Direktor, »sagt Ihnen Ihre Beschäftigung bei der Staatsanwaltschaft zu oder würden Sie eine Betätigung im Ministerium vorziehen?«
Da öffneten sich plötzlich strahlende Fernen vor Hoffs geblendeten Blicken. Eine funkelnde Leiter sank von irgendwo herab und baute sich schwindelnd hinauf in den Himmel staatsbürgerlicher Herrlichkeit. Ehe er recht wußte, daß er etwas erwidert hatte, lächelte der Direktor sehr gütig, erhob sich, reichte ihm die Hand und sagte: »Dann hoffe ich, Sie demnächst hier als Mitarbeiter begrüßen zu können. Und wenn ich Ihr Buch recht gelesen habe, wird Ihnen die Tätigkeit bei uns zusagen. Sie wissen, wir arbeiten mit dem Reichsjustizamt an dem großen Werk der Reform des Deutschen Strafprozesses.«
Hoff wußte noch dunkel, daß er sich tief verbeugt und etwas davon gemurmelt hatte, er würde sich bemühen, das in ihn gesetzte Vertrauen einigermaßen zu erfüllen. Dann war er wieder im Anmeldezimmer.
Den alten Diener, der ihm den Mantel hielt riß er in seinem berauschten Ungestüm beinahe um. Aus dem in Demut ersterbenden Eifer, mit dem der alte Knabe ihm den Zylinder reichte und die Tür aufriß, ersah Hoff, daß er hier für einen kommenden Mann galt. Solch alter Ministerialdiener hat die untrüglichste Witterung.
2.
Die Hoffs bewohnten drei kleine Zimmer im dritten Stock eines Hauses der Frobenstraße, das aus einer Zeit stammte, da »reichliches Zubehör« und »aller Komfort der Neuzeit« und »Rollstube und Vakuumreiniger« noch im Schoße der Zukunft und die Häuserspekulation den Schlaf der Ungeborenen schlief.
Hieher waren sie vor sieben Jahren gezogen, nach dem jähen Ende der Herrlichkeit in der Landgrafenstraße. Ja, die Wohnung in der Landgrafenstraße mit ihren weiten, trauten Gemächern und den blätterumrauschten Veranden! Sie trauerten und sprachen darüber, wie Eva mit ihrem Nachwuchs vom Paradies geschwärmt haben mag. So oft die Äußerung fiel: »Wißt ihr noch, in der Landgrafenstraße, da –« – und sie fiel oft – – wurden aller Augen hell, und sie zogen die Luft ein, als atme der Duft blühender Akazien wieder durchs Zimmer.
Die Familie lebte im Grunde nicht in den drei Stuben der Frobenstraße. Es war, als hätten sie die Augen fest geschlossen und träumten. Träumten von der warmen, grünumrankten Vergangenheit und den leuchtenden Tagen der Zukunft. Nein, diese Not der letzten sieben Jahre, dieses Hinvegetieren in Niedrigkeit und Kümmernis war kein pulsierendes, bewußtes Leben. Es war ein bleicher Wartezustand, ein blutleeres Hinüberdämmern zu dem Guten, Strahlenden, Kommenden. Und nur mit der ehernen Hoffnung auf einstige Erlösung hatten sie all das Schmerzliche nicht recht empfunden, und nur so hatten sie es still und stark ertragen können.
Das Glück der Landgrafenstraße hatte ihnen der Vater gebaut. Er war Elektrotechniker und hatte eine sehr auskömmliche Stellung bei einer Berliner Maschinenbauanstalt. Äußerlich war der Sohn ihm ähnlich. Nur war der Vater breiter und wuchtiger, körperlich und geistig. Er stand so fest und sicher mit seinen starken Füßen auf der Erde, daß der Gedanke, er könne straucheln, nie recht Raum in seinem Hirn fand. Wenn seine kluge, vorsichtige Frau dann und wann darauf hindeutete, daß wir alle in Gottes Hand ständen, und daß er »für alle Fälle« für die Zukunft der Familie sorgen sollte, und etwas von Lebensversicherung und Unfallpolizze andeutete, fuhr Hoff großmächtig mit den Daumen in die Armlöcher seiner properen weißen Weste, sog die Lungen voll Luft, daß die Brust sich wölbte wie ein Panzer und lachte sein schönes, sieghaftes Lachen. »Geh. Mutter«, sagte er dann behaglich, »solange die Maschine hier funktioniert, werdet ihr keine Not leiden. Und nach meiner Kenntnis von der Dauerkraft eines solchen Pumpwerkes dürfte sie noch die nächsten zwanzig Jahre ihre Schuldigkeit tun. Wozu also das schöne Geld 'ner Versicherungsgesellschaft in den Rachen werfen, statt es in den guten Dingen dieser Welt anzulegen. Hab' doch recht, Kinder, was? Wollen uns lieber aufsetzen und den Brocken unsicher machen, he?«
Und die Kinder jauchzten und tanzten mit Vatern im Zimmer herum, und das Ende vom Liede war, daß Mutter die Rucksäcke packen und ihre Mahnung vertagen mußte. Fing sie dann das nächste Mal wieder damit an, sagte Hoff: »Liebe, zwanzig Jahre habe ich noch. Darein laß ich mir nicht reden. Sonst wird die Kalkulation falsch. Na, und in zwanzig Jahren, Jotte doch! Da ist der Junge längst in Amt und Würden, und die Mädels helfen ihren Bengels längst nicht mehr bei den Schulaufsätzen. Na, und du – und wirst dann wohl auch nicht mehr in Seidenroben Bälle schmücken.«
Und damit war die Sache vorläufig wieder einmal abgetan.
Es zeigte sich aber, daß eine gute Maschine auch ohne Konstruktionsfehler jäh stoppen kann.
Zunächst war es nichts weiter als eine lumpige Grippe, über die Vater Hoff seine gewohnheitsmäßigen Witze riß. Dann war eines Nachts in allen Gliedern solch ermüdender Schmerz und in den Adern solch zehrende Glut. Und in der starken breiten Brust rasselte es dumpf und dräuend. Bis es eines Abends nach einem letzten Verzweiflungskampfe ganz still wurde. Ganz still. Und dann trugen sie ihn hinaus in das wirre Schneegestöber, in das der lange Schleier der Witwe hineinschlotterte wie eine klagende Trauerfahne.
Das war das Ende der Herrlichkeit der Landgrafenstraße. Am nächsten Tage saß ein anderer Elektrotechniker an Walter Hoffs Arbeitstisch, und das Leben und die Räder der Maschinenfabrik rollten weiter. Und die Chefs hatten vergessen, daß der verstorbene Direktor Hoff zwanzig Jahre ihren Maschinen Odem eingehaucht hatte. Denn es war eine moderne Bauanstalt – mit allen Errungenschaften der Neuzeit.
Eines Abends saß Frau Hoff mit ihrem zwanzigjährigen Sohn in des Vaters Zimmer und zog die traurige Bilanz einer mittellosen Witwe mit drei brotlosen Kindern. Sie saßen lange und starrten vor sich hin. Schließlich sagte Frau Hoff: »Wir werden etwas tun müssen.« Ewald nickte.
»Ich werde arbeiten«, sagte er.
»Was willst du arbeiten?« fragte die Mutter. »Du hast genug zu tun mit deinem Examen.«
»Ich werde die Juristerei aufgeben«, entschied Ewald. »Wovon soll ich vier Jahre als Referendar leben, und dienen muß ich auch noch.«
Die Mutter schüttelte den Kopf. »Du mußt dabei bleiben, Ewald«, sprach sie fest, »das ist sicher. Ich werde nachdenken.«
»Nein«, sagte Ewald, »ich werde in ein Geschäft gehen.«
»Und ich auch«, fiel Liesbeth ein, die leise hereingekommen war. Zugleich schlüpfte auch Herta durch die Portieren und rief: »Ich gehe auch ins Geschäft, Mama. Und morgen gehe ich nicht mehr zur Schule. Das hat nun doch keinen Zweck mehr.« Sie war ganz beseligt über die frohe Aussicht.
Da erhob sich Frau Hoff, ging zweimal durch das geräumige Gemach. Dann stand sie bleich vor ihren Kindern.
»Meine armen Lieblinge!« sagte sie, und ihre Lippen zuckten nervös, »nur das nicht. Nur das nicht! Dann ist eure Zukunft verloren. Von dir, Ewald, spreche ich nicht. Es wäre Wahnsinn, wenige Wochen vor dem Examen das Studium aufzugeben.«
»Aber –« wollte Ewald einwenden. Die Worte der Mutter hasteten weiter: »Auch die Mädchen – nein, nein – dann ist ihre Zukunft verriegelt. Daran ist nicht zu denken.«
»Nein – wir müssen es anders versuchen. Es muß sich etwas finden. Ich darf eure Aussicht auf Heirat nicht in der ersten Verzweiflung über Bord werfen. Ich werde nachdenken.«
Und sie dachte und grübelte viele schlaflose Nächte, und Herta mußte zu ihrem Verdruß am nächsten Morgen nun doch zur Schule.
Bei jedem Plane, den sie ersann und wieder verwarf, durchbebte die Witwe beklemmend die Angst, die Wohlanständigkeit der Familie zu untergraben. Den Schein nach außen wollte sie um jeden Preis und jedes blutige Opfer wahren. Sie wußte, besser als ihre weltunkundigen Kinder, daß nur so die Mädchen in ihrem Kreise heiraten konnten. Und sie war noch die »unmoderne« Frau, der es als ein Evangelium galt, daß Mann und Kind und ein eigenes Heim am letzten Ende doch das einzige wahre Glück des Weibes sind. Und glücklich werden sollten ihre Mädel.
So begann dieser zermürbende heimliche Kampf der Familie Holl um den Schein. Die Frucht des Grübelns waren zahllose Besuche Frau Holls bei den Inhabern mannigfacher Geschäfte. Und endlich fand sie für sich und Lisbeth die ersehnte Heimarbeit. Seit jungen Tagen hatte sie künstlerische Stickereien gefertigt. Jetzt machte sie aus der Spielerei den Broterwerb. Und Lisbeth nähte. Verbrauchte man von dem kleinen Kapital, das geblieben war, jährlich einen Teil, so konnte man mit dem Verdienst dieser Arbeit auf einige Jahre wenigstens auskommen. Es gibt ja so viele Arten von »Auskommen«.
So zogen sie in die Frobenstraße und kämpften ihr hartes Leben. Und als die fünfzehnjährige Herta die Schule verließ, ward ihrer Hände Arbeit ein Zuschuß mehr. So konnten sie »ihre Drohne«, wie Ewald sich in bitterer Selbstironie nannte, durch das Dienstjahr und die Referendarzeit hindurchfüttern.
Aber der junge Mensch hätte das vernichtende Gefühl, von den drei Frauen ausgehalten zu werden, nicht überwunden, und Mutter und Töchter wären der Herz und Geist abtötenden Arbeit und der zermürbenden Not ermattet erlegen, wenn nicht die Hoffnung in ihren Herzen gezittert hätte. Eine seltsame Hoffnung war es. Doch sie leuchtete hell und warm durch das kalte Dunkel ihres Lebens.
Es war in den ersten Wochen ihres verbissenen Kampfes um das tägliche Brot des Anstandes. Sonntag war's und Frau Hoff wanderte durch den frühlingsfeuchten Tiergarten hinaus auf den Kirchhof. Unterwegs begegnete ihr eine Bekannte. Trotz ihres Kummers fiel das veränderte Aussehen der anderen den scharfen Augen der Witwe auf. Soviel blühender, voller, jünger schien die gute Dame. Und soviel besser gekleidet war sie als ehedem. Es dauerte auch nicht sehr lange, so hatte Frau Hoff den Grund dieser Wandlung erfahren. »Ja, denken Sie nur«, berichtete Frau Burgstaller und blieb vor Eifer mitten auf dem Wege stehen, »unser Sohn Anton hat sich doch verheiratet. Sie haben gewiß davon gelesen. Nein? Na ja, in Ihrer Trauer nur zu begreiflich. Aber es ist so. Er ist verheiratet. Denken Sie bloß, Frau Hoff, mit Fräulein Bernsdorff. Ja – Sie sehen mich groß an. Sie wundern sich. Natürlich. Und doch ist's Wahrheit. Von dem reichen Bernsdorff aus der Stülerstraße. Denken sie bloß mal!«
Frau von Hoff dachte doch an ihre Not daheim.
»Eine Aussteuer hat das Mädchen bekommen!« ergänzte Frau Burgstaller ihre Familienfreudenchronik, »mindestens für vierzigtausend Mark. Alles Batist und echte Spitzen. Und dreißigtausend Mark kriegt Anton jährlichen Zuschuß. Und wenn der alte Bernsdorff mal – Gott vorhüte es – zu seinen Vätern versammelt wird, erbt Anton bestimmt vier Millionen, eine aber mindestens. Min – de – stens! Natürlich ist Anton zur Regierung gegangen. Und nächstens soll er ins Auswärtige Amt. Na, – und sie wissen ja, Frau Hoff, wie'n zärtliches Kind unser Anton immer war. Es ist rührend, was er alles für mich und 'n Fritz tut. Mit Fritz, unserm Jüngsten, ist ja leider nicht viel Staat. Es kann eben nicht alles beisammen sein. Man muß es tragen, wie Gott es gibt. Adieu, liebe Frau Hoff, ich muß nun hier in die Tiergartenstraße abbiegen. Bei meinem Sohn ist heute abends große Gesellschaft, da soll ich der jungen Frau ein bißchen helfen. Sie wohnen in der Hohenzollernstraße. Grüßen Sie Ihren Herrn Sohn und die Fräulein Töchter, Adieu, Frau Hoff!«
Ganz wirr von dem Geschwätz ging Frau Hoff ihres Weges. Sie hatte übrigens kaum recht hingehört. Als sie dann aber an dem schwarzen kahlen Erdhügel stand, auf dem die frühe Jahreszeit noch jedes lebende Grün versagte, stieg aus dem Grabe etwas auf von dem unverwüstlichen, lebenstrotzenden Optimismus des Toten. Das Gefabel der Burgstaller ward jäh wach in der Witwe, erhielt Lebensodem und warm rieselndes Blut. Und in der Verzweiflung, die sie hier an dem Grabe mit herzzerpressender Gewalt packte, schien ihr die Begegnung von vorhin ein sichtbarer Fingerzeig Gottes.
Seit diesem Sonntag war des jungen Referendars Berufung zum Retter und Erlöser im Hoffschen Kreise fixe Idee geworden. Es ward nach und nach etwas Selbstverständliches, etwas wie ein unumstößliches Naturgesetz, daß irgendwo ein sehr begütertes liebliches Jungfräulein heranblühe, just für Herrn Ewald Hoff heranblühe, das er finden und beglücken und somit alle Not und alle Pein vertilgen würde wie weiland St. Georg den üblen Drachen. Keiner von den vier Beteiligten hätte heute mehr Rechenschaft darüber ablegen können, wie die Idee unter ihnen Wurzel gefaßt hatte und üppig ins Kraut geschossen war. Der Gedanke an diese Erlösung spukte bei Tag und Nacht durch ihre Sinne. Diese Hoffnung hing wie eine ewige Lampe zu Häupten der drei arbeitenden Frauen und leuchtete ihnen Geduld und Zuversicht in die müden Seelen. Der helle Schein dieser Lampe ließ die Finger der drei Frauen sich geradestrecken, wenn sie klamm und steif wurden vom Halten der Nadel; er richtete ihre Rücken wieder empor, wenn sie schmerzten vom Beugen über die Arbeit; er gab ihnen die Kraft, das Haupt wieder stolz durch die Straßen zu tragen, wenn sie es verschämt und verängstigt gesenkt halten beim Hineinhuschen in die Hoftüren ihrer Arbeitgeber.
Und diese Aussicht allen verlieh auch Hoff während seiner Referendarzeit die geduldige Ergebung, sich von den Frauen unterstützen zu lassen. Er ließ die Frauen Körper und Seele aufreiben, in dem sicheren Bewußtsein, ihnen einst für jede mühevolle Stunde eine reich beglückte zu bescheren. Er fühlte sich als ihr Heiland und ihr Stern in dunkler Nacht.
3.
Freudebeschwingt sprang Hoff die Treppen hinauf. Ganz leise öffnete er die Wohnungstür und schlüpfte in sein Zimmer. Es galt unbemerkt den Frack mit dem Wochentagsanzug zu vertauschen, sonst merkten sie gleich etwas. Sie waren so hellsichtig, seine drei Frauen. Und bei Tisch wollte er dann ganz unauffällig damit anfangen, daß man immer von verkannten Genies rede, die trotz alles Könnens nicht durchdrängen. Und dann würde Herta eifrig in die Debatte springen und Lisbeth würde wohl auch einige durchdachte Worte einwerfen und die Mutter würde mit ihren ernsten, braunen, klugen Augen der Diskussion folgen. Und wenn dann als ganz unwiderlegbare Wahrheit festgestellt war, daß die Mitwelt immer töricht ist und alle großen Geister erst nach ihrem Tode oder frühestens zu ihrem siebzigsten Geburtstag »entdeckt« werden – Herta würde mit Beispielen sofort bei der Hand sein – dann wollte er mit seinem Erfolg herausrücken und sich weiden an dem stolzen Staunen und der beglückten Begeisterung.
Als Hoff ins Eßzimmer trat (es war zugleich Wohnzimmer, Arbeitsraum und Salon), trug Lisbeth gerade die Suppe auf. Die Mutter und Herta legten die Arbeit nieder und setzten sich zu Tisch.
Nur die Hälfte der schwarzen Eichentafel war gedeckt. Denn der Tisch war für die vier Personen viel zu groß. Überhaupt drückten die engen Wände ein wenig auf die wuchtigen stolzen Möbel, die einst ganz anderen Maßen bestimmt gewesen. Aber seligst in diesen kleinen Zimmern wahrten sie ihre schöne Würde. Man hatte nur verkauft, was auch die liebevollste Raumkunst nicht unterzubringen vermochte. Die prächtigsten Stücke aber zeigten wie einst in der Landgrafenstraße ihre edlen Formen und taten ihr Bestes, den Schein einer kleinen, gut bürgerlichen Behaglichkeit vorzutäuschen. Die dunklen, glänzenden Eichenflächen, die strahlenden venezianischen Spiegelaugen blickten pflichtbewußt wohlhabend drein. Es gehörte zum Lebensplan der Hoffs, ihren früheren Verkehr aufrechtzuerhalten. Denn Frau Hoff vergaß nicht einen Augenblick, daß ihre Ziele Verbindungen heischten. Und deshalb scheute sie kein Opfer, ihr Heim zu erhellen und zu erwärmen – für die Gäste. Jetzt freilich hätten die herumliegenden Leinenhaufen und Stickereifetzen allerhand zweifelnden Argwohn erweckt und genährt.
Nun schritt Hoff zur Enthüllung.
»Ich las da heute«, begann er arglistig, »daß sie jetzt Almquist für den größten schwedischen Dichter halten. Zu seinen Lebzeiten haben ihn sehr wenige anerkannt. In Not und Elend haben sie ihn leben und sterben lassen.«
Lisbeth hob die kluge bleiche Stirn: »Almquist?« sann sie. »Ich glaube, ich las einmal von ihm das ›Buch der Dornenrose‹. Ein ganz seltsames« – Hier unterbrach lebhaft Herta.
»Du, Ewald, daß du heute nachmittags nicht fortgehst. Elfriede Damerow kommt zum Kaffee. Ich meine nur, da du gerade von in Not und Elend leben und sterben sprichst.«
Es war, als zöge eine dunkle Wolke über den freundlichen Familienhimmel. Aus Hoffs Augen wich aller schelmische Glanz.
»Ich habe euch doch gesagt«, begann er und seine Stimme klang belegt, »daß Elfriede Damerow nicht in Betracht kommen kann. Ich denke nicht daran, mich an diesen Petrefakten fortzuwerfen.«
»Petrefakt?« rief Herta hastig. »Wieso Petrefakt? Was ist denn überhaupt: Petrefakt?! Sie ist ein sehr schönes Mädchen und gar nicht petrefakt.«
»Es gibt auch schöne Petrefakten«, sagte Hoff etwas ruhiger. »Ich mag aber keine versteinerte Frau. Was soll ich damit? Elfriede Damerow ist hart – steinhart. Sie hat nicht für fünf Pfennig Gemüt.«
»Du kennst sie ja kaum«, wehrte sich Herta. »Nicht drei Worte hast du mit ihr gesprochen.«
»Ich kenne sie gerade genug, um ihr jede Spur von Gefühl abzusprechen. Sie protzt geradezu mit ihrer Seelenroheit. Neulich, wie sie das von ihrer Mutter erzählte! Na –! Also kurz und gut – die Sache ist für mich erledigt.«
Darauf verstummte das erregte Gespräch. Lisbeth beugte ihr Kinn tief zur Brust nieder. Die Mutter spielte mit dem Löffel und sagte endlich: »Ja – aber lieber Ewald, es muß doch mal etwas geschehen.«
»Natürlich muß etwas geschehen«, riß Herta das Wort wieder an sich und streifte energisch die Ärmel ihrer Bluse bis über die Ellenbogen. »So geht's nun schon das ganze Jahr, seit du Assessor bist. Die ist ihm zu dumm, die zu klug, die zu dick, die zu dünn, die zu sentimental, die wieder zu petrefakt. Glaubst du, wir können dir die Mädel malen?!«
Hoff schwieg verbissen.
Lisbeth stand still auf, räumte die Teller ab und brachte eine Schüssel mit »armen Rittern« und Gemüse zurück.
»Ich glaube wirklich, Ewald, du täuschst dich in Fräulein Damerow«, knüpfte Frau Hoff wieder an.
»Ich kenne sie doch auch ganz gut. Aber daß sie hartherzig wäre. Und dann – ein Mann, wie du erzieht die Frau.«
»Gemütsroheit läßt sich nicht aberziehen.«
»O doch. Mit –«
»Ach, Mama, gib doch keine Ratschläge«, rief Herta. »Es sind ja nur faule Ausreden. Ist sie denn gemütsroh?! So ein Unsinn. Weil sie gesagt hat, sie wünschte, ihre Mutter wäre damals gestorben! Das hat sie so unüberlegt hingesprochen. Es ist unerhört, einen Menschen auf ein unbedachtes Wort festzunageln. Ich finde sie reizend.«
»Es kommt doch in diesem speziellen Falle mehr darauf an, wie ich sie finde.«
»Allerdings. Aber du solltest dich wirklich entschließen, einmal eine von unseren vielen Bekannten annehmbar zu finden. Früher, als du Referendar warst, da hattest du immer den großen Mund. Was du alles für uns tun würdest. Und jetzt – nichts ist dir gut genug. Aber –« und plötzlich schlug ihre Stimme über – »ich kann nicht mehr sitzen und sitzen und nähen – und nichts vom Leben haben.«
Und sie warf Messer und Gabel klirrend auf den Teller und schluchzte bitterlich.
»Aber, Kind, Herta!« tröstete die Mutter.
»Ja«, jammerte sie, »du sagst ihm nichts und Lisbeth schweigt sich mit aus. Immer muß ich drängen und stoßen. Und dabei denkt ihr ganz dasselbe. Als ob ich allein die Schlechte wäre. Will ich ihn denn unglücklich machen?! Aber wir können doch alle nicht weiter. Sieh dir Mamas Augen an, wie entzündet die sind von dem ewigen Sticken. Und Lisbeth sagt es nur nicht. Aber sie kann kaum noch sitzen vor Kreuzschmerzen.«
»Ach – nein«, lehnte Lisbeth ab.
»Doch – ich sehe es dir ja an, wie du immer den Mund schmerzhaft verziehst. Glaubst du, ich habe keine Augen – wenn ich auch Petrefakten und so 'n Zeugs nicht sehen kann? Und – und« – sie hatte sich wieder gefaßt, nur zwei dicke Tränen kugelten noch über ihre hübschen rosigen Wangen – »immer älter werden wir. Lisbeth ist bald sechsundzwanzig und ich bin nächstens dreiundzwanzig. Und wir sitzen hier und nähen und nähen und lassen uns zum Narren halten und haben noch nicht angefangen zu leben.«
»Es wird schon kommen«, besänftigte die Mutter, »Ewald wird sich entschließen.«
Hoff blickte düster vor sich hin.
»Die Ehe ist doch kein Blinde-Kuh-Spiel«, murmelte er. »Ich kann doch nicht die erste beste nehmen.«
»Es waren schon sehr nette Mädel, die du ausgeschlagen hast«, blieb Herta unerbittlich. »Wie ein regierender Fürst kannst du natürlich nicht wählen.«
»Gerade die können es am allerwenigsten«, meinte er mit einem vagen Versuch zu lächeln. Da spricht die Staatsraison.«
»Jetzt suchst du mit einem schlechten Witz alles beizulegen«, blieb Herta bei der Stange. »Das tust du immer. Und an jeder hast du etwas auszusetzen, wie nun wieder mit dem Petrefakt. Aber ich schwöre dir, ich rühre keine Nadel mehr an und laß alles gehen wie es will, wenn du nun wieder was hast. Und immer im letzten Augenblick kommst du, als ob das gar nichts kostet! Gerade als ob du keine Ahnung hättest, daß ich eine Nacht durchnähen muß, um bloß das Geld für die Schokolade und die Schlagsahne und den Kuchen zusammenzubringen.« Ihre Stimme drohte wieder feucht zu werden. Sie bezwang sich aber tapfer.
»Es ist doch jetzt wahrhaftig nicht mehr so schlimm«, begütigte Hoff, »seitdem ich die zweihundert Mark von meinem Kommissorium beisteuere. Und nächstens bekomme ich sicher was von meinem Verleger –«
»Du vergißt«, belehrte die Mutter, »daß wir keinen Pfennig mehr auf der Bank haben.«
Darauf schwiegen alle.
Lisbeth saß immer noch tief vornübergebeugt. Diese Gespräche lasteten schwer auf ihrem feinfühligen Sinn.
Herta hatte jetzt ihre Selbstbeherrschung wiedergefunden. Sie lächelte dem Bruder herzhaft zu. »Also gib dir 'nen Ruck, alter Junge! Ich bin fest überzeugt, du wirst glücklich mit ihr. Ich habe so 'n bißchen auf den Busch geklopft und herausgehört, daß Elfriede dich sehr lieb hat. Denke nur, Ewald, wie gut wir es dann alle hätten. Du selbst doch am besten. Und wir alle. Weißt du gar nicht mehr, wie du uns immer das Blaue vom Himmel versprochen hast? Und sie ist doch ein schönes Mädchen.«
»Ja – schön ist sie«, bestätigte Hoff zaghaft. »Ich will es ja noch einmal versuchen – wenn ihr alle meint.«
»Na – also«, jubelte Herta. »Ach, wenn es was würde! Dann –« Und instinktiv preßte sie die Hände an ihren warmen, festen Busen. Sie fühlte ihre Jugend in allen Gliedern. Und sie dachte an den jungen Schauspieler, mit dem sie sich heimlich traf. Wenn sie nur etwas Geld hätten! Dann hatte diese aufreibende Qual des Versagens ein Ende. Und sie heirateten, und dann – dann kam das Glück, das helle, duftende, berauschende Glück. –
Als Frau Hoff vom Tisch aufstand, fiel es Hoff ein, daß er noch nichts von seiner Berufung gesagt hatte. Ein schmerzliches Zucken glitt um seinen Mund.
»Ich bin ins Ministerium berufen worden«, sagte er rauh und unvermittelt.
Alle blickten ihn starr an.
»Ins Ministerium – berufen?« wiederholte Lisbeth.
»Berufen noch nicht. Aber es ist sicher. Ich war heute vormittags bei dem Dezernenten. Er sagte allerhand über mein Buch und daß ich als Hilfsarbeiter ins Ministerium soll.«
»Aber Ewald«, sprudelte die stille Mutter hervor, »das ist doch ein ganz unerhörtes Glück!«
»Ja, es ist schön«, nickte er.
Hertas schneller Geist begann sofort ein Hürdenrennen. »Dann wirst du sicher mal Minister«, entschied sie bündig. »Ganz sicher.«
Die anderen lachten hell auf. Sie hatte es aber gar nicht scherzhaft gemeint. Es war ihre feste Überzeugung. Und sofort überwand ihr fixer Verstand ein weiteres Hindernis.
»Mama«, rief sie, »dann ist es freilich nichts mit Elfriede Damerow. Obwohl ich dabeibleibe, daß sie nicht petrefakt ist. Aber für einen Minister! Gott, was machen wir nur mit der Schlagsahne und all dem Kuchen!«
Und hinaus schwirrte sie, kam jedoch gleich wieder zurück, den Hut auf dem Kopf. »Kinder«, rief sie, »jetzt hab ich's. Esther Honigmann. Die ist's. Schneid' keine Fratze, Ewald. Erstens sind sie getauft und dann sagst du ja immer, dir gilt nur der Mensch. Und die wird dir gefallen!«
»Wie kommst du auf Esther Honigmann?« fragte Lisbeth lächelnd. »Mit der bist du doch ganz auseinander.«
»Auseinander? Keine Spur. Gestern stieg sie vor Wertheim gerade in ihr Auto. Du Ewald, ein Auto! Zum Verlieben! Wir erkannten uns sofort. Sie lud mich ein, mitzufahren. Na – ich habe gleich so 'n bißchen geprüft. Für alle Fälle. Fragte, warum sie noch nicht verheiratet ist und so. Hörte heraus, sie stellt große Ansprüche. Kann sie auch. Sie soll unseren Minister haben.« Damit huschte sie hinaus. Die Mutter eilte ihr nach, um Näheres zu hören.
Hoff setzte sich in des Vaters Arbeitsstuhl und starrte vor sich hin. Ihm war sehr traurig zu Mute. Da fühlte er plötzlich Lisbeths weiche Wange an seinem Kopf.
»Ich freue mich so – sehr – über – das – das« – stotterte sie scheu.
Er wußte, wie lieb sie es meinte. Sie allein von den drei Frauen hatte Verständnis für seine Arbeit. Er nahm ihre beiden Hände und streichelte sie.
»Ach, Ewald«, flüsterte sie, »wie ist das alles schwer – und – häßlich.«
Da lächelte er leise und strich über ihr feines schwarzes Haar. »Es wird schon werden«, sagte er. »Für uns alle. Und vor allem für dich, du Liebe. Das Glück wird noch kommen.«
Eine tiefe Röte strömte in ihr blasses Gesicht. Sie dachte an den Bildhauer, den sie schon so lange liebte, ohne Hoffnung auf ein Heim. Von Jahr zu Jahr glaubte er, jetzt werde ihm der große Wurf gelingen. Aber er hatte keinen Stern.
Dann schwiegen sie und hielten sich stumm bei den Händen.
4.
Der Frühling wob seinen bunten Schleier über das märkische Land. Goldbraun glommen die Stämme der Kiefern und über dem Waldboden wiegten sich zarte rötliche Dunstfäden.
Assessor Hoff wanderte die Landstraße auf Wannsee zu. Seine Schritte waren lang und elastisch. Er fühlte in seinen Gliedern den Frühling und seine eigene auf perlende Jugend.
Diese einsamen Wanderungen durch die Mark, die er mit einer andächtigen Zärtlichkeit liebte, waren seine reichsten Stunden. Wenn er den Dienst erledigt und die Enge der Häuslichkeit abgeschüttelt hatte, zog er hinaus in die Schönheit seiner sanften großen Heimat. Dann fiel aller Druck und jede Bürde von seinen Schultern und die Schaffensfreudigkeit quoll reich und saftig auf.
Hier draußen in der Einsamkeit waren der Plan und die besten Stücke seines Geschichtswerkes entstanden. Die Mark vergalt ihrem Sohn die Liebe. Sie gab mit warmen, segnenden Händen. Wenn er am Ufer der Havelseen stand und hinausblickte auf die Weite des Wassers, war ihm zuerst der Sinn aufgegangen für das ewig wallende, gleichmäßig flutende Schicksal der Menschheit. Und sein starkes historisches Empfinden erwachte. Oben auf den Höhen des Wannsees war zuerst in ihm der Plan aufgetaucht, eine Geschichte ringenden Menschengeistes zu schreiben. Die Idee war dann gewachsen; und hatte feste Gestalt gewonnen. Das Großzügige der Seelandschaft hatte ihm die Kraft und das Selbstbewußtsein gegeben; das leis Melancholische der Forste und Sandebenen reifte in ihm das Verstehen für menschliches Streben, menschliches Irren und menschliche Ohnmacht.
Hoff stand jetzt in der Konzeption des zweiten Bandes. Das Herz pochte ihm schaffensfroh und sein Ahnen war lebendig. Er wußte, dieser zweite Band würde seinen jungen Ruf nicht schmälern. Der Stoff lag ihm wie kaum ein anderer. Die Geschichte des Hexenprozesses wollte er jetzt behandeln. Bei seinem stark ausgeprägten Verständnis für alte, ewig junge Narretei, für menschlichen Irrwahn und menschliche groteske Kleinheit mußte ihm dieser Teil prächtig gelingen. Während er dahinging, den Blick nach innen gekehrt, fühlte er den Odem der Zeit, die er schildern wollte, ihn umwehen. Wie eine schwere blutgetränkte Wolke lag religiöser Wahnwitz über dem gewitterschwülen Lande. Eine Luft schwelte über den deutschen Gauen, die den Atem benahm, die auf dem Hirn lastete und jedes natürliche freie Denken herauspreßte. Benommen taumelte die Menschheit einher. Oh, er hatte seine Modelle für seine Hexenrichter. Das Geschlecht war auch im zwanzigsten Jahrhundert nicht ausgestorben. Er sah sie vor sich, borniert, asketisch streng, fanatisch, aberwitzig, bald wieder brutal, grausam, mit einem wissenden lüsternen Zwinkern in den Augenwinkeln. Ja, die Rolle würde er zeichnen können, daß sie wandelte. Und die Opfer! Es war ein Unsinn, zu glauben, die Hexen, die man gepfählt, ertränkt und verbrannt hatte, seien immer schnurrbartbehaftete Knusperhutzelweibchen aus dem Märchenbilderbuch gewesen. Durch sein Buch sollte das holde Lächeln all dieser kindlichen Arglosigkeit und Reinheit läuten, die man durch den widerlichsten Morast in den Tod gehetzt hatte. Er würde in das Chaos der Berichte hineingreifen und die armen jungen Dinger zu Lichte heben, mit ihrem fliegenden Atem, zitternd, das Hirn zu keuchendem Wahnsinn gepeitscht, den jungen Leib wie Stahlgerten auf der Folter zerbogen.
Plötzlich wurde Hoff durch eine seltsame Erscheinung am Wegesrand aus dem Mittelalter jäh in die Gegenwart zurückgerufen.
An der Böschung der Landstraße stand eine weibliche Gestalt an einem Telegraphenpfahl, die Arme über den Kopf hinausgeredet, die Hände an die Stange geklammert, und preßte Wange und Ohr hart an das Holz des Pfahles. Der Gedanke, das Mädchen sei schwach geworden und suche eine Stütze, und hilfsbereit beispringen, war eins. Als Hoff aber jäh zu ihr trat, sah er zu seinem Staunen zwei große Augen verzückt in die Ferne träumen. Nein, der junge Mensch bedurfte keiner Hilfe.
Das alles währte nur Sekunden. Das Mädchen fuhr erschreckt empor, stieß einen wirren Laut aus, Hoff griff an seinen Hut, und stammelte: »Verzeihung, ich glaubte, Ihnen wäre nicht wohl.« Dann war alles vorbei und Holl schritt wieder seine Straße auf Wannsee zu, ohne sich umzublicken. Er empfand bitter, daß er tolpatschig in das scheue Geheimnis einer tiefen, jungen Seele hineingegriffen hatte. Und so ging er immer geradeaus, ohne sich umzublicken. Neugier wenigstens wollte er ihr und sich ersparen.