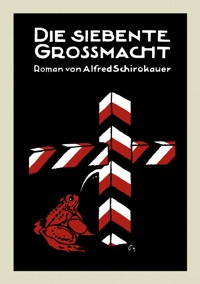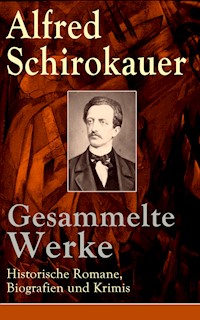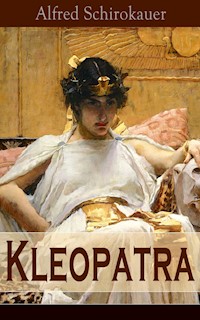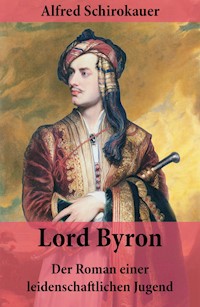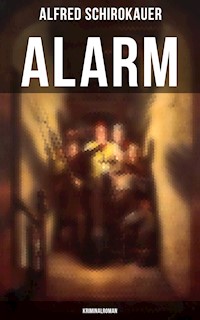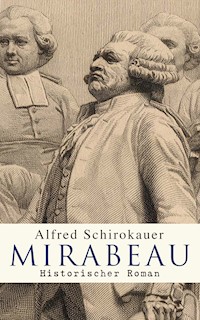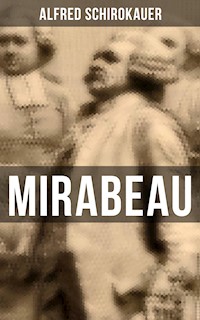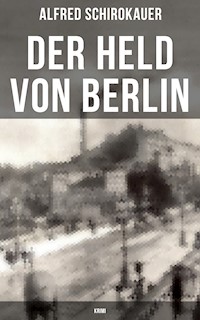1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alfred Schirokauers Buch 'Der Tanz auf der Weltkugel' ist ein faszinierender Mix aus Historienroman und Abenteuergeschichte, der die Leser auf eine Reise durch die Welt des 16. Jahrhunderts mitnimmt. Der Autor porträtiert meisterhaft das Leben und die Abenteuer des Kartografen Martin Waldseemüller, der sich auf die riskante Suche nach der Quelle des Amazonas begibt. Schirokauers prägnanter Schreibstil und die detailreiche Darstellung der historischen Ereignisse machen das Buch zu einem spannenden und informativen Leseerlebnis. Durch seine Verwendung von historischen Fakten und psychologischer Tiefe hebt sich 'Der Tanz auf der Weltkugel' von anderen historischen Romanen ab. Alfred Schirokauer, selbst ein erfahrener Historiker, bringt sein umfangreiches Wissen und seine Leidenschaft für die Geschichte in dieses Buch ein. Sein Interesse an vergangenen Epochen und sein Talent für die Schaffung atmosphärischer Welten spiegeln sich in jedem Kapitel wider. 'Der Tanz auf der Weltkugel' ist ein absolutes Muss für Liebhaber von historischer Fiktion und Abenteuergeschichten, die einen tieferen Einblick in die Vergangenheit suchen und sich von einer mitreißenden Erzählung verzaubern lassen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Tanz auf der Weltkugel
Inhaltsverzeichnis
I.
Renate Gedon trat aus der Tür des Wohnhauses. Geblendet blieb sie stehen, von der jähen Helle überfallen. Trotz der frühen Stunde siedete der kaum dem Dunkel entwichene junge Morgen schon in der Wut des tropischen Tages.
Sie giebelte beide Hände wie ein Schutzdach über die Augen und eilte durch den Hof, der die Estanzia umgürtete, nach links, dem bergenden Walde zu. Die Felder, das gerodete Land, breiteten sich nach rechts, stromabwärts, am Ufer hin.
Bald nahm der Wald S sofort Urwald – sie in seinen behütenden feuchtwarmen Schatten.
Noch schlief die kleine Siedlung. Doch schon lebte der Wald. Ein erwachendes Rauschen rieselte durch die weitstrahligen Blätter der Farnbäume, überzitterte die Kronen der eleganten Kokospalmen, ließ die Riesenblätter der Pacovabäume erbeben und bewegte wiegend die grotesken dunkelblau-grünen Kandelaberäste der Aurakarien.
Und mit den Herren erwachten ihre Schmarotzer. Die farbenglühenden Guirlanden, die sich von Ast zu Ast schwangen, die grünen Netze, die sich in den Lüften verstrickten, diese dickgeschnürten Hängematten, die sich von Baum zu Baum seilten, schaukelten leise im jungen Morgen. Die Kelche der Mimosen entrollten sich der Sonne, die weiß durch den grünen Dom sickerte; die Orchideen öffneten sich im Erwachen und atmeten schwer und wollüstig ihren aufgespeicherten brünstigen Odem dem Tage zu. Und rote Hängefuchsien, lila Begonien, blaue Heliconien, die heiße Blütenpracht dieses unabsehbaren Treibhauses des brasilianischen Urwaldes schüttelte die Last der Tropennacht von sich und reckte sich dem neuen schwülbelebenden Lichte entgegen.
Auf der Heerstraße der Brücken in den Lüften wanderte schwatzend und lärmend eine Affenherde, Papageien schrieen und schüttelten ihr metallisch glänzendes Gefieder, die roten Füße des Wiedehopfs hüpften von Ast zu Ast. Mit seinem eintönigen Kreischen begrüßte er den Morgen.
Unter dieser bunten und buntbelebten Wölbung des Urwaldes schritt Renate rasch und unbekümmert dahin. Sie kannte diese schillernde Bewegtheit in der grünen, glasigen Ruhe nun schon fast ein Jahr.
Gewandt schlüpfte sie zwischen dem Gewirr von Baumstämmen und wucherndem Wachsen den schmalen Pfad entlang, den die Machete, das scharfe Haumesser, durch das Gestrüpp geschlagen hatte und offen hielt.
Sie kam zu einer Lichtung am Ufer. Fedrige Bambuswände umschirmten den Halbkreis wie eine Kulisse. Renate ließ den leichten Bademantel zur Erde gleiten, reckte die Arme hoch über den Kopf und genoß schwelgend die nackte Freiheit ihres Körpers. Das unendliche Grün des Urwaldes übergoß den weißen Leib mit einer schattenhaft wechselnden Patina. Sie strich mit den Händen über die Glieder, ihre Haut trank den feuchten Atem der Wildnis. Schlank, zierlich, grünüberhaucht stand die junge Frau inmitten der Lichtung, noch fast mädchenhaft der Körper mit den kleinen spitzen Brüsten und überzarten nervösen Gelenken.
Sie blickte über das graue, rasch fließende Wasser des Castanho hin. Drüben, nach links, lag die Estanzia, weiß und sonnenübersprüht. Stromauf wand der Fluß sich zwischen der lebendigen Einöde des Urwaldes dem fernen Gebirge zu.
Kleine glitzernde Schweißperlen traten aus den Poren, als Renate ihre Morgenübung begann. Sie dehnte und beugte sich, federte auf den Zehen, wand sich in den Hüften.
Doch schon fielen die Mosquitos über sie her. Da schüttelte sie unwillig ergeben den Kopf und rannte das flache Ufer hinab in das Wasser.
Kaum hatte sie die Lichtung verlassen, da wurden die Bambusstauden auseinander gebogen und das braune Gesicht eines Gauchos drängte sich zwischen den Stämmen hindurch. Lüsterne, kleine schwarze Augen verfolgten funkelnd den enteilenden Frauenkörper.
Dieser Mischling von Neger und Brasilindianer hatte vor Wochen durch Zufall das morgendliche Bad der Herrin erspäht. Seitdem opferte er Stunden der Ruhe, hier auf der Lauer zu liegen. Morgen für Morgen stahl er sich lautlos aus dem Schlafraum der Vaqueiros, stand hier geduldig im Hinterhalte, bis Renate kam, und bebte vor qualvoll beherrschter Gier beim Anblick dieses rassereinen Leibes einer Europäerin.
Er wußte, daß der Tag nicht mehr ferne war, an dem er diese geheime Lust büßen mußte. Einmal wird er über sie herfallen, die weiße Frau nehmen wollen. Sie wird schreien, man wird vom Rancho herbeieilen, er wird sie an sich gerissen, sie berührt haben – sie werden ihn hetzen – er wird in die Wildnis fliehen, wie viele vor ihm. Er weiß alles. Er ist klug und verschlagen. Die Gefahren des Urwaldes drohen. Aber er muß diesen weißen Körper haben, der grün schimmert im Schmelze des Waldes. Er muß.
Vielleicht auch wird sie nicht schreien. Wenn er rasch zuspringt und sie an der weißen, zarten, durchsichtigen Kehle packt. Dann wird sie vielleicht nicht schreien.
Dann wird sie sein werden. Aber auch dann bleibt nur die Wildnis. Dann ganz gewiß. Doch dann hat er einmal ein weißes Weib, dieses schöne, zierliche, weiße Weib besessen. Dann schreckt die Öde dort stromaufwärts, dem Gebirge zu, nicht so sehr. Nicht ganz so sehr.
Joao stiert auf die weiße Frau. Sie steht bis zu den Armen im Wasser, das um die Brüste gurgelt. Jetzt wirft sie sich vorwärts, breitet die Arme, schwimmt. Nur der Kopf mit dem dunkelblonden knabenhaften Haare ist noch sichtbar.
Weit beugt der Gaucho das verzerrte Gesicht aus dem Bambus, sein Zittern erschüttert das Gehölz. Es erbebt unter dem aufgepeitschten Verlangen des Mannes.
Da – ein geller Schrei vom Wasser her. Die Frau ist in der Mitte des Flusses, der hier 300 m in der Breite mißt. Sie hebt einen weißen Arm – hilflos – wie ein Signal der Todesfurcht. Ein zweiter Schrei, schon dumpfer, erstickt von Angst und Entsetzen. Dann wirft sie sich dem Ufer zu. Schwimmt verzweifelt, wird matt. Rote Flecken quillen aus dem grauen Wasser. Blut.
Im nächsten Augenblick ist Joao im Strome, schleudert sich mit gewaltigen eckigen Bewegungen vorwärts. Auch ihn packt es. Er fühlt den rasenden Schmerz, er stößt, er wehrt sich vergeblich. Das Gesicht der Frau ist unter Wasser. Der Mund steht offen in Todesgrauen. Der Fluß sprudelt hinein. Jetzt ist Joao bei ihr, packt ihren Haarschopf. Wütend schneidet es ihn, bis auf die Knochen jeder Biß. Doch er arbeitet sich durch, die Faust im dichten seidigen Haar der Frau. Er gewinnt das Ufer, zieht den weißen Körper ans Land. Blut strömt aus zwanzig tiefen Wunden. Bei ihr wie bei ihm. Auf der schmutzig-dunklen Haut seiner nackten Beine sieht man die roten Ströme nicht so grell wie auf dem Weiß der Frau. Doch er denkt nicht an Blut und Schmerz, er sieht nur das bewußtlose Weib. Er knickt in die Knie, neben dem hingestreckten Körper. Er betastet die feuchte, glatte, kühle Haut. Doch plötzlich fällt er mit dem Gesicht über ihre Brust. Dann saust er kopfüber ins Dickicht.
Ein furchtbarer Tritt in das Gesäß hat ihn über die Frau hinweg geschleudert. Neben Renate steht Simplizio, ganz in Weiß, das die Ebenholzschönheit seines edlen Suaheligesichtes noch verdunkelt. Er greift den Bademantel, hüllt die Ohnmächtige hinein, trägt sie sorgsam mit seiner herkulischen Kraft durch die schmalen Windungen des Pfades dem Hause zu.
Mühsam, mit zerschundenem Gesicht, schmerzendem Rücken, zerbissenen Gliedern, erhebt sich der Gaucho.
II.
Die Schreie des Grauens hatten die Estanzia geweckt. Aus dem Gesindeschuppen stürzten die Vaqueiros. Über den Hof eilte, dem Walde zu, Rudolf Gedon. Als der riesenhafte Neger mit seiner stillen Bürde auf die Hoflichtung trat, prallte er auf den Herrn. Die Angst um das geliebte Weib erwürgte dessen Fragen.
»Piranha«, gab Simplizio lakonisch Auskunft.
Da wußte Gedon alles und verfärbte sich durch den braunen Sonnenbrand seines Gesichtes hindurch. Piranha sind die Todesgefahr dieser Gewässer, drohender als die Cayman. Kleine Fische, nicht viel größer als Forellen, mit grotesken grausamen Köpfen, die Mensch und Tier anfallen. Und fließt erst Blut, ist das Opfer fast immer verloren. Der Blutrausch packt diese kleinen Ungeheuer. In wenigen Minuten zerfressen sie die Beute bis auf das Gerippe, in Rudeln herangelockt von dem bittersüßen Geschmack, irrsinnig vor Lust und Gier.
Endlich fand Gedon die Sprache.
»Piranha?« flüsterte er, kaum hörbar im Entsetzen, »wir haben nie Piranha hier gehabt.«
Der Neger deutete mit dem glänzenden schwarzen Haare stromaufwärts.
»Fische kommen mit Strömung,« erwiderte er auf Portugiesisch.
Sie traten ins Haus, durchschritten die Wohnstube mit ihren rohen Wänden aus Palmenstämmen und dem festgestampften Urwaldboden und gingen ins Schlafzimmer. Hier legte Simplizio die Frau auf das Bett aus Palmenblättern. Der Bademantel öffnete sich. Der Neger wendete das Gesicht ab. Renate schlug die Augen auf und blinzelte verloren.
»Brauchen Senhor mich?« fragte der Suaheli.
Gedon schüttelte den Kopf. Er war bereits bei der kleinen, sorgsam gepflegten Hausapotheke. Rasch und geschickt – er hatte Kriegserfahrungen – wusch und verband er die tiefen Risse an den Beinen, den Schenkeln, den Zehen, den Hüften. Dabei sprach er leise, tröstende Worte. Sie lag stumm, zuckte nur hin und wieder schmerzhaft zusammen, wenn er die Wunden berührte.
»Es war furchtbar,« raunte sie und erschauerte in der Erinnerung.
Er nickte verstehend und strich Salbe auf den Verband.
»Ich wußte sofort, daß es Piranha waren.«
»Du Armes!« Zärtlich küßte er ihre Wange.
»Und dachte an alles, was ich von ihnen gehört habe. In einem Augenblick stürzten sie sich über mich.«
»Mein armes Mädel,« wiederholte der Mann und legte ganz lind die Binde um die angefressenen Zehen.
Nach einer Weile fragte sie: »Wie wurde ich gerettet?«
»Simplizio,« gab er Bescheid und schmiegte behutsam einen Hautlappen, den die bluttollen, kleinen, scharfen Zähne abgefetzt hatten, an die Wade.
Da lächelte Renate und sagte leise: »Der Treue.«
Als sie dann vor Erschöpfung eingeschlafen war, ging Gedon hinaus. Im Hofe standen die Gauchos, Mischlinge aller Schattierungen vom brasilianischen Gelb bis zum dunkelsten Kupfer, beisammen und besprachen eifrig die Sensation des Tages. In ihrer Mitte hockte Joao und verband seine Wunden, ein bestauntes Objekt. Zum zehnten Male berichtete er seine Heldentat.
Gedon trat hinzu. Sofort verstummte das Gespräch. Er war gefürchtet und geachtet. Verwundert blickte er auf den Gaucho.
»Was hast du?« fragte er.
Joao erhob sich. Er hatte seine Bandagen beendet.