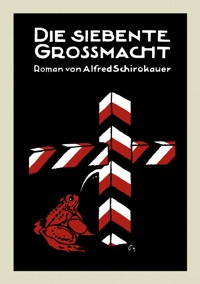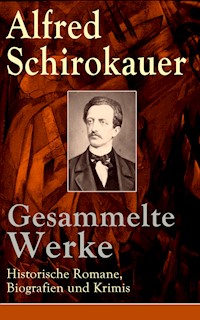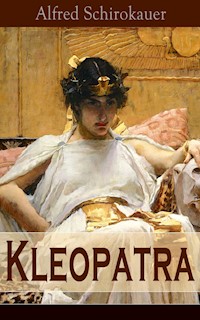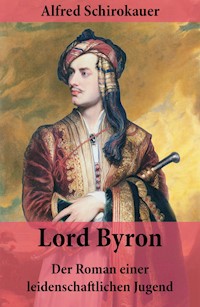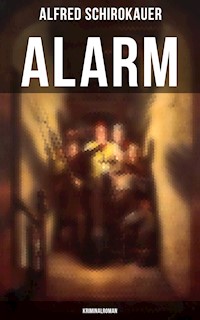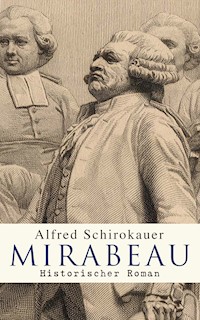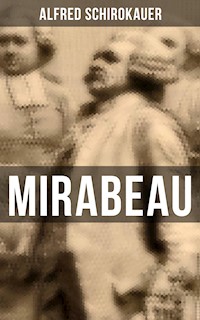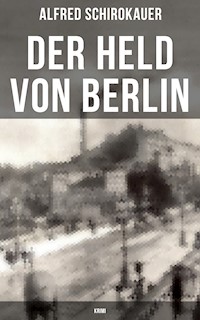Historische Romane: Kleopatra + Mirabeau + Lassalle + Lord Byron + Messalina E-Book
Alfred Schirokauer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Historische Romane: Kleopatra + Mirabeau + Lassalle + Lord Byron + Messalina" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Alfred Schirokauer (1880-1934) war ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur. Schirokauer erhielt seine schulische Ausbildung in England, wo er als Amateur erste Regieerfahrungen sammelte. Dann ging er nach Hamburg und machte dort sein Abitur. Danach studierte er Jura und schloss sein Studium mit der Promotion ab. Nach einer Zeit als Referendar arbeitete Schirokauer sieben Jahre lang als Rechtsanwalt. Zu dieser Zeit begann er seine schriftstellerische Tätigkeit. 1904 veröffentlichte er seinen ersten Roman Ilse Isensee. Es folgten zahlreiche weitere Werke, von denen einige verfilmt wurden, darunter Unmögliche Liebe, 1932 mit Asta Nielsen in der Hauptrolle. Er verfasste Romanbiografien über Ferdinand Lassalle, Lord Byron, Napoleon und Lucretia Borgia sowie historische und Gegenwartsromane. Inhalt: Kleopatra Mirabeau Lassalle Lord Byron Messalina
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2333
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Historische Romane: Kleopatra + Mirabeau + Lassalle + Lord Byron + Messalina
Inhaltsverzeichnis
Kleopatra
I.
Der weißlackierte Wagen mit den fleckenlosen Schimmelhengsten blitzt durch die Straßen. Überrumpelt, verblüfft springen die Fußgänger zur Seite. Sehr selten macht eine Römerin von der neuen Verkehrsordnung Gebrauch, die den Frauen, nur den Frauen, erlaubt, durch die engen Gassen zu fahren. Noch herrscht die Sänfte. Doch sie fährt. Sie prescht mit ihrer kleinen federnden ägyptischen Cart und ihren arabischen Vollblütern durch die winkligen Straßen Roms. Führt selbst die Zügel. Hinter ihr sitzt würdesteif mit starrem Gesicht der numidische Kutscher.
Über den tiefen Schluchten der Gassen steht ein knallig blauer Himmel. Man ahnt, daß die junge Märzsonne schon sticht. Doch in diese Täler kann sie nicht hinabsickern. Aber jetzt – heraus aus den Cañons der hohen Häuser birst der Wagen. Breit umfaßt ihn das heftige italische Frühlingslicht, verzaubert ihn zu einem glitzernden Pfeil. Er saust über die Aemilische Brücke – hoch geht der graue Tiber, vom Lenzwasser geschwellt – über die Steinplatten des Forums prasselt der Wagen – sie braucht die Peitsche – alles steht, alles starrt. Eine Frau, die kutschiert! – Eine Frau, die in Rom kutschiert! So kutschiert!! Diese Frau!! Es ist diesen gewichtigen Männern in den langwallenden Togen, als rasselten die erzumschienten Räder dieses fremdartigen Zweisitzers über ihre altgeheiligten Sitten und Rechte hinmähend fort.
Schon hat der kühle Schatten des Häusergewirrs des Velabrums das Gefährt verschluckt. Hoch auf spritzt der Straßenkot der letzten Frühlingsregen, spritzt über die Fußgänger hin, die sich in Angst und Erschrecken und Zorn zu beiden Seiten des schmalen Pfades an die Häuser pressen.
»Verflucht nochmal! Die hat’s eilig!« schnaubt einer und reibt sich den Dreck vom Gesicht. »Wer ist denn das Luder?«
»Die Ägypterin.«
»Wer – die?!« Er pfeift durch die schwarzen Zähne. »Sapperment, der hat Schwein, der alte Kahlkopf, der Cäsar!« Er wischt sich genießerisch über die dicken Lippen.
Flüche, unflätige Rufe wettern hinter ihr her. Sie hört nichts. Der Widerhall der Räder zwischen den Häuserfronten ist zu stark, ihr spornender Eifer zu ungestüm. Schon ist sie in der verrufenen Subura.
Ein Kind vor den Hufen! Weibergekreisch. Im Bruchteil einer Sekunde prellen die Hengste auf die Hinterhand, knicken zurück, stehen mit zitternden Beinen, keuchenden Flanken. Ein Zungenlaut. Weiter. Um eine Ecke schwingt der Wagen, auf der Kante der rechten Felgen. Steht.
Die Zügel fliegen dem Numider zu. Sie ist heraus, eine kleine schlanke, sportlich gegürtelte Gestalt. Ist in dem verrotteten, zerfallenen Hause verschwunden.
Innen ist es wirtlicher. Die Hexe Canidia könnte im feinsten Viertel Roms wohnen. Sie scharrt das Gold zusammen. Aber sie weiß, Unheimlichkeit gehört zum Handwerk. Im Atrium, ihrem Wartezimmer, harren die Damen. Alle kommen sie zu dieser Zauberin mit ihrem Liebesleid und ihrem erotischen Kummer. Jede hat ihren Hausfreund, der Sperenzchen macht, untreu werden, zu ihrer besten Freundin hinüberwechseln will. Canidia kennt jeden Liebeszaubertrank, kennt jedes geheime Mittelchen, Sehnsucht und Lust zu wecken. Und kennt jedes sacht schleichende Gift der Rache der Verschmähten. Es ist keine sehr fröhliche Gemeinde, die sich hier versammelt. Nur die häßlichen, nur die älteren Damen, Frauen im gefährlichen Alter, harren hier auf den Eintritt ins Allerunheiligste der Hexe und ihrer Zauberkraft. Jugend und Schönheit bedarf ihrer nicht. Jugend und Schönheit sind selbst Zaubermittel.
Als Kleopatra in das Atrium einbricht – alles an ihr ist Verve und Schwung und stürmende Energie – allein ohne Gefolge, jede der andern Damen hat ihr Geleit, wendet sich jeder Kopf ihr zu. Da ist sie, diese Schande und Schmach Roms! Cäsar, der große Cäsar, Cäsar, der viele dieser erlauchten Damen intim, sehr intim kennt – welche Frau konnte ihm widerstehen, als er noch in den feudalsten Schlafzimmern pirschte ? – Cäsar hat diese Fremde, diese Ägypterin, aus Afrika mitgebracht – sie wohnt in seiner Villa drüben jenseits des Tiber – eine goldene Bildsäule von ihr hat er im Tempel der Venus Genetrix aufgestellt, befohlen, dieses Laster, seine Geliebte, als Göttin anzubeten!
Alle starren auf die kleine anmutige Gestalt in dem blaßlila Kleide, das eng und seidig an ihren geschmeidigen Gliedern niederrieselt. Unter der Brust ist es amazonenhaft gestrafft. Einige Zaghafte erheben sich – verneigen sich. Wer kann wissen? Cäsar ist allmächtig, und sie ist eine Göttin – Cäsar gebietet es. Andere, Kühnere, Stolzere, wenden sich rasch ab – übersehen die Königin des Nils.
Kleopatra grüßt liebenswürdig die Grüßenden, übersieht die empört Abgewandten. Ihr Gesicht ist sanft gerötet von der raschen Fahrt im Frühlingswinde. Eine Übereifrige bietet ihr den Sessel an. Sie dankt höflich.
Da gleitet der Vorhang von einer Tür. Die Hexe geleitet eine Kundin heraus. Sieht die Königin. Humpelt diensteifrig auf sie zu. Entführt sie.
Zornig, sensationslüstern, neugierig, flirrt es auf unter dem sonnenoffenen Dache. Man munkelt heftig durcheinander. »Wieso sie zuerst? Außer der Reihe? Ich warte seit zwei Stunden.« »Die arme Calpurnia!« »Arm? Gerade du hattest doch allen Grund, sie einst um Cäsar zu beneiden!« »Aber offen vor aller Welt seine Maitresse in seinem Hause zu unterhalten! Das ist doch ein starkes Stück für die offizielle Frau!« »Ich weiß nicht, was die Leute von ihrer Schönheit fabeln. Die Nase ist doch viel zu lang.« »Ich bitte dich, eine Negerin!« »Eine Negerin? Lächerlich. Sie ist Griechin vom reinsten Geblüt.« »Die – Griechin!«
Eine winkt ihrer Sklavin. Läßt sich Tafel und Griffel reichen. Notiert sorgsam Schnitt, Faltenwurf und Farbe des Kleides, das Kleopatra trägt. Andere sehen es, lächeln verächtlich und wissend. Und merken sich alles ohne Niederschrift. Die Königin gibt die Mode an in Rom.
In ihrem halbdämmrigen, absichtlich schaudervollen Sprechzimmer treibt Canidia ihren Hokuspokus. Läßt Dämpfe aufsteigen, wohlduftende Essenzen verqualmen und widerlichen Gestank aufätzen. Ihre Gehilfinnen Sagana, Veja, Folia jagen hin und her. Ab und zu schreien die Weiber rhythmisch auf.
»Künde mir die nächste Zukunft!« hat Kleopatra befohlen.
Canidia mixt in Mörsern, murmelt, seufzt, ächzt, als ringe sie sich unter Qualen die Prophezeiung ab. Die Königin kennt diesen Mumpitz. Auch in der Heimat ist sie Göttin. Wird sie als Isis verehrt. Hat hinter die Kulissen von Opferdienst und Mysterien geblickt. Weiß selbst nicht, ob sie an das Geheimnis glaubt oder nicht. Es ist in ihr, wie in den meisten Frauen, Menschen. Sie glauben nicht an ihren Aberglauben und frönen ihm doch. Sie ist nicht hier, um Entscheidendes zu hören. Nur um die Zeit zu betrügen, ihre Unrast zu betäuben. Sie hält es nicht aus in der einsamen Villa draußen auf dem Janikulum. Eine Laune, eine Verzweiflung hat sie aus den engen vier Wänden hergepeitscht.
Jetzt liegt Canidia flach vor ihr auf dem Bauche.
Aus hohler Brust keucht sie hervor: »Königin einer Welt wirst du sein – ehe zweimal die Sonne sinkt und – –«
Da packt Kleopatra der Ekel. Vor der Hexe und vor sich und ihrer Erniedrigung. Was soll ihrem skeptischen hellen Verstande dieser Mummenschanz! Sie greift in den Seidenbeutel am Gurte ihres Kleides. Schleudert dem Weibe ihren Goldbeutel an den Kopf. Ist draußen. Die Sonne, das grelle Stahlblau des Himmels, das aus dem offenen Viereck in der Decke des Atriums über sie herfällt, blendet sie. Doch rasch und hoheitsvoll, Königin, geht sie durch die Sitzreihen der Damen. Erwidert ehrerbietigen Gruß.
Draußen hat sich um den exotischen Wagen das Gesindel der Subura angestaut. Schmierige Kinder staunen aus runden kohlschwarzen Augen. Der Numider kann der Herrin nicht Bahn brechen. Er muß die Hengste halten, die unruhig den Sand der Straße scharren. Schaumspritzer zerrinnen auf ihren heftig atmenden Flanken. Kleopatra bricht sich selbst Bahn. Das Volk weicht zurück. Um ihre kleine Figur weht etwas Bezwingendes, Achtunggebietendes, Unwiderstehliches. Sie springt hinauf, ehe der Numider helfend zugreifen kann. Faßt die Zügel.
»Platz da!« warnt der Begleiter.
Die Kinder stieben zurück.
Sie bewegt kaum die Zügel, kaum die Lippen. Die Renner beugen sich in dem Gelenk der Hinterbeine – setzen mit starkem Sprunge an. Die Gassen läuten das Gerassel der Stahlräder wider.
Heraus aus der Subura. Schon winken sonnenüberglänzt Tempel und Basiliken des Forums. Ein Senator in roten Schuhen, den Purpursaum am Kleide, springt zurück vor den Hufen der Tiere. Der Schreck entlockt ihm einen unbeherrschten Zornesruf: »Verfluchtes Weibsstück!«
Sie streckt ihm gassenbübisch die kleine spitze Zunge heraus. Und lacht ausgelassen. Und ihre unbedeckten Haare flattern um ihr schmales Haupt.
Dort am Tempel der Vesta steht die Bildsäule Cäsars. Scharf lugt Kleopatra aus, vermindert kaum das Jagen der Hengste. Ein Laut bricht von ihren Lippen. Ein Jauchzen. Übermütig schwingt sie die lange Peitsche.
Sie hat es gesehen. Deutlich. Cäsars Bildsäule trägt die Königskrone.
II.
Sie ist wieder in der Villa auf dem Janikulum. Wirbelt in das Ankleidezimmer. Charmion, die Griechin, Eiras, die Ägypterin, Vertraute, Zofen, einst Gespielinnen, entkleiden sie.
»Ein ganz dünnes Hauskleid, Charmion. Mir ist gräßlich heiß.«
»Sei vorsichtig, Herrin. Diese ersten Frühlingstage sind tückisch.«
Kleopatra zieht die grünen Augen schmal, katzenhaft zusammen. Die Dienerin weiß genug, hastet davon, bringt das fast durchsichtige koische Gewand.
Die Königin läßt sich kleiden, hält gegen ihre flatternde Gewohnheit fügsam still. Ihre Gedanken sind weit fort. Unten auf dem Forum. Seine Bildsäule ist gekrönt. Seine Bildsäule ist gekrönt! Nichts anderes hat Sinn in dieser gewaltigen historischen Stunde.
Das Mahl ist bereitet, der Hofstaat wartet. »Sie sollen ohne mich essen.« Charmion drängt. »Laß mich«, wehrt Kleopatra nervös. Sie sitzt vor dem Toilettentisch mit dem großen silbernen Spiegel. Charmion, die treue, bringt ihr eine kräftige Brühe. Sie kostet, mag nicht. Die Gewißheit, daß unten auf dem Forum Cäsars Bildsäule die Krone trägt, raubt ihr den Appetit.
Sie sitzt mit zusammengekniffenen Augen, die Finger der Linken in das Kinn, dieses starke, feine, tatbewußte Kinn verkrallt, den Ellbogen des nackten Arms auf den Schenkel gestemmt, der über das rechte Knie geschlagen ist. Und sinnt.
Endlich! Vier Jahre hat sie auf diesen Tag gewartet. Ihn Cäsars Bedachtsamkeit abgerungen, abgetrotzt. Der Alexandertraum wird endlich zur Tat. In den ersten Nächten, damals, als Cäsar nach Alexandrien kam und sie in der ersten Nacht nahm, hat sie ihm diesen Plan des Weltkönigtums, diesen Herrschaftsgedanken über Ost und West als süßes Gift eingeträufelt, eingeküßt, eingehaucht. Ihren Plan! Ihren Gedanken! Ihre heilige Sehnsucht! Und heute endlich –
Sie federt empor. Klatscht in die Hände. Befiehlt Cäsarion. Die pompöse mazedonische Kinderfrau im Hauptschmuck der vielen wehenden bunten Bänder bringt das Kind. Es läuft auf die junge Mutter zu. Kleopatra hebt es hoch über sich empor. Erstaunlich ist die Kraft in der kleinen zarten Gestalt, mit der sie den großen dreijährigen Knaben hochschwingt. Er lacht fröhlich und beginnt ihr eine große Wichtigkeit seines Kinderdaseins zu erzählen. Sie winkt die Frau hinaus.
Doch sie hört nicht auf das Kindergeplapper. Sie ist zerstreut. Sie sieht in ihm nicht ihr Kind, heute nicht. Sie sieht durch ihn hindurch auf Reiche, auf die Erde, die ihr und Cäsar gehören soll für ihn – einst für ihn. Er ist für sie Symbol und Verkörperung ihrer Weltherrschaftsidee. Nur für ihn, seinen einzigen Sohn, hat Cäsar –
Unrast packt sie. Sie klatscht in die Hände. »Die Frau soll das Kind holen! Wo sind die Läufer?! Wo bleiben die Nachrichten aus der Stadt?!«
»Ein Bote harrt draußen.«
»Draußen?! Warum kommt er nicht herein? Seleukos soll gepeitscht werden. Und sag ihm, ich lasse ihn fragen, ob er seines blöden Kopfes müde ist. Herein mit dem Boten!«
Bis er kommt, fingert sie unruhig an ihren Gliedern hin. Der Läufer wirft sich vor ihr nieder. »Auf, auf! Was geschieht in der Stadt?«
»Eine ungeheure Menge ist auf dem Forum zusammengeströmt. Alles blickt auf die gekrönte Bildsäule, Herrin.«
»Weiter!«
»Weiter nichts, Herrin. Sie stehen und deuten und starren darauf und flüstern miteinander.«
»Was flüstern sie?«
»Teils sind sie dafür, teils heftig dagegen, daß Cäsar als König geehrt wird.«
»Welche Meinung ist in der Mehrzahl? Muß ich dir jedes Wort abringen, du Tölpel!«
Sie stampft heftig auf mit dem unwahrscheinlich kleinen Fuß in dem Seidenschuh.
»Es ist schwer zu sagen, Herrin. Die Leute sind in ihren Äußerungen sehr vorsichtig.«
»Gut. Ich verlange dauernd Bericht.«
Der Läufer verbeugt sich tief und geht.
Für und wider. Ja, ja. Das hat sie gewußt und erwartet. Und Cäsar auch, als er einem Vertrauten den Befehl gab, seine Säule zu krönen. Ein Versuch. Ein Fühler am Pulse des Volkes.
Sie stöhnt auf. Der Tag vergeht nicht. Die Schwingen der Stunden sind gelähmt. Cäsar ist in Alba. Hat am frühen Morgen die Stadt verlassen. Absichtsvoll. Am Nachmittag will er zurückkehren. Die Rückkehr wird alles entscheiden. Alles. Königtum, Weltreich von Ost und West.
Sie geht hinaus in den weiten Park. Erschauert. Es ist kühl. Die Sonne ist verschwunden. Sie hetzt zurück ins Atrium. Betrachtet fahrig die Bildsäulen, die Kunstwerke, die Cäsar aus aller Welt zusammengetragen hat. Und sieht nichts. Wo bleiben die Boten?!
Atemlos stürmt einer herein.
»Cäsar ist auf dem Rückwege, kurz vor der Stadt.«
»Was geschieht auf dem Forum?«
»Ich habe es nicht gesehen, Herrin. Mein Weg hat mich nicht darüber geführt.«
Im Speisezimmer wird gedeckt. Sie hört das leise Klirren der Gefäße. Jeden Nachmittag kommt Cäsar zu ihr zu einem kleinen Imbiß.
Sie geht ins Ankleidezimmer. Läßt sich schmücken für ihn, schminken, pudern. Den schmalen Bogen der Brauen nachziehen. Dann ist sie wieder allein im Wohnzimmer. Wartet, wartet. Draußen auf dem Forum entscheidet sich das Geschick der Welt. Sie sitzt in einem tiefen, weichen Sessel, schlägt gewohnheitsmäßig die Beine übereinander. Und plötzlich rieselt eine Welle der Sinnlichkeit über ihre Glieder. Seit zwei Jahren, seit ihrer Ankunft in Rom, hat Cäsar sie nicht mehr berührt. Er ist sehr gealtert – sehr –, diese epileptischen Anfälle! Älter geworden in diesen letzten Jahren als seine Sechsundfünfzig bedingen. Ganz gleich – sie liebt ihn. Sie lächelt sphinxhaft. Kann sie lieben? Irgend etwas lieben außer sich – außer der Macht –?
Ihre Gedanken schwimmen. Gut und wohlig war die erste Zeit – vor vier Jahren. Nach ihrer Erweckung als Weib. Der erste Mann, dem sie gehörte. Der erste Mann, der einzige, der ihr geistig ebenbürtig – hm –, vielleicht überlegen ist. Wie jung er damals noch war! Wie aus Stahl der Körper und Geist. Schmerzlich gealtert ist er.
Sie seufzt aus der Tiefe der Brust. Ballt unwillkürlich die kleinen Hände zu willenseisernen Fäusten.
Sie wird ihm neue Kraft und neue Jugend einatmen. Sie und die Herrschaft über die Erde und die Krone. Sie faltet die Hände und verrenkt die Finger. Sie ist jetzt nur Wille und Energie. Sie wird in ihm die Natur bezwingen. Sie wird ihm Jugend und Kraft in die alten Adern gießen! Sie wird! Sie wird! Sie wird die Glut ihrer Vierundzwanzig in seine Gefäße strömen lassen und in sein ermüdetes Hirn! Wenn sie erst sein Weib ist, öffentlich – die Königin des vereinigten Ost und West der Welt.
Sie dehnt den kleinen, katzengelenken Körper, fühlt ihr heißes Blut in jedem Gliede, reckt die Arme über den Kopf hinaus – fühlt ihre Jugend und ihren Körper und sein Begehren – nein, nein, sie wirft sich nicht fort – irgendeinem jungen Gecken in die Arme. – Nein!
Und doch hat sie Visionen. Jung – stark – reckenhaft ist das nebelhafte Gebilde ihres Verlangens. Sie schließt die grünen Augen – es ist, als würde die Welt dunkel, wenn das gläserne Feuer dieser Augen sich bedeckt – die langen schwarzen Wimpern reichen bis auf die ovalen Wangen herab – sie fühlt Arme um sich – eine Kraft, die sie an sich reißt und durchglüht – öffnet hastig die Lider – blinzelt in den fallenden Tag – nein – nicht sich an irgendeinen enghirnigen, hübschen Laffen vergeuden. Cäsar wird wieder stark werden, wenn er die Krone trägt. Eine magische Gewalt strömt von dem goldenen Reif aus – sie weiß das – sie kennt den Zauber des Diadems. Er ist nur übermüdet, überreizt von der Ungewißheit, zermürbt von den letzten Kriegen in Spanien und Afrika – trägt eine Welt auf den Schultern, schon jetzt, ohne den Herrentitel. –
Sie sinkt lässig im Schoße zusammen. Es ist der Frühling, der in ihrem Blute rumort. Weiter nichts. Die Müdigkeit des Lenzes und seine Sehnsucht. Es ist –
Pferdegetrappel auf der Straße reißt sie aus der wollüstigen Versunkenheit. Die Kavalkade. Cäsars Kavalkade! Sie stürmt hinaus, nicht Königin, nicht Herrin der Welt, nur Weib, nur Geliebte, nur Sehnsucht und Hoffen auf das Größte, Letzte, Allerletzte.
III.
In der Halle trifft sie mit ihm zusammen. Er kommt allein. Das Gefolge blieb im Garten. Er ist sehr blaß, gelblichweiß hebt das Gesicht sich ab von dem Purpur des Triumphatorenmantels, den er trägt. Sterbensbleich ist er, wie die Imperatorenbinde um die hohe Stirn. Unmut dunkelt in jeder der vielen tiefen Falten und Runen, die das Grandseigneurgesicht durchkerben. Doch er hält seine Züge beherrscht wie immer.
»Sei gegrüßt, Gajus.« Ihre Stimme, diese zauberhafte Stimme, die er so liebt, klirrt verräterisch.
»Tag, Liebste.« Er küßt ihre Stirn. Ihren Mund hat er lange nicht mehr geküßt.
»Was ist?!« Ihre Augen sind grüne, sprühende Fragezeichen.
»Sie haben das Diadem von dem Standbild gerissen.«
»Wer?«
»Ein Volkstribun.«
»Was hast du mit ihm gemacht?«
»Ich werde ihn seines Amtes entsetzen lassen.«
»Weiter nichts?!«
Er schüttelt den Kopf.
Sie faßt seine Hand. Sie stehen noch in der Halle. Er ist zweimal so groß wie sie.
»Warum hast du ihn nicht sofort ans Kreuz hängen lassen?« Es scheint, als wachse sie zu ihm empor.
Er lächelt müde. »Wir sind nicht in Alexandrien, mein Kind.«
»Dann mach endlich Alexandrien aus diesem Misthaufen !«
Er hebt kaum merklich abwehrend die Hand, geht voran in das Speisezimmer. Sie folgt hart hinter ihm.
An den Tisch in der Mitte des Raumes setzt er sich, eckig, krank, marode. Sie sieht, wie gipsig das Gesicht ist. Wie eine Totenmaske. Alter Mann, denkt sie bös.
Ein Sklave bringt eine große silberne Schüssel. Tücher. Er wäscht sich die großen Hände mit den langen nervösen Fingern, befeuchtet die Stirn. Sie blickt von unten her, zornig auf ihn. Er tut, als sähe er sie nicht. Doch er beobachtet aus den Augenwinkeln ihr Gesicht und freut sich wie ein Künstler an ihrem Mienenspiel.
Schön ist sie, denkt er. Ist doch die schönste Frau, die mein gewesen ist. Es ist heut viel Resignation in seinem Fühlen und Sinnen. Aber schön waren auch andere. Er trocknet langsam, bedächtig, fast pedantisch die Zwischenräume der Finger, das Spiel ihres Zornes und ihrer Verachtung zu genießen. Doch etwas hat sie, was keine andere besitzt. Etwas Einziges, nie Gewesenes, vielleicht nie Wiederkehrendes. Das lebendigste Gesicht hat sie, das je eine Frau besessen hat, eine bebende Lebendigkeit um Mund und Nase und Schläfen, eine vibrierende Heftigkeit, eine Wandlungsfähigkeit ohnegleichen, oft ohne Übergang. Das ist das Lockende an ihr, diese ewige Gespanntheit, die spannt, diese atemlose Gegenwart, die aufpeitscht, diese zitternde Leidenschaft, die mitreißt. Das lebendigste Gesicht, das je ein Mensch dem Dasein geboten hat. Das Seltsamste sind die Augen. Weltwunder, wie der Leuchtturm ihrer Königsstadt – Pharus ihres Gemütes.
So sinnt er und reicht langsam dem Diener das Tuch.
Sie steht noch, gießt ihm Wein ein. Stets bedient sie ihn selbst. Er dankt, trinkt saugend, der edle Massiker labt ihn nach dem langen Ritte. Er blickt in den Kelch. Sie schweigt erbittert. Da sagt er zögernd:
»Übrigens Misthaufen –« er leckt mit belegter Zunge die Lippen – »Alexandria ist schöner, auch hygienischer. Sicher. Das ist der Vorzug neuer, planmäßig angelegter Städte, die hingestellt, nicht naturgewachsen sind. Rom ist Rom!«
Er stellt den Pokal auf den Tisch, daß es knallt. Beim Klang seiner Stimme, die sehr tief ist und rein, wunderbar beherrscht und kultiviert, schwindet der Groll aus dem länglichen schmalen Oval ihres Gesichts. Leidenschaft flammt auf. »Gajus, was schert mich Rom und Alexandrien als Stadt in diesem Augenblick! Sei nicht so abgeklärt. Du marterst mich. Erzähl, wie es war!«
Sie steht ganz dicht bei ihm, lehnt an seine Knie. Er wischt mit der gehöhlten Hand über Stirn und Gesicht.
»Ein Fehlschlag. Als ich auf das Forum kam, war die Säule noch umkrönt. Einige jubelten mir zu. Riefen: »Heil dem König.« Meist bezahlte Subjekte. Aber die andern schwiegen dumpf. Ich fühlte sofort das Fiasko. Da riß Marullus, der Volkstribun, das Diadem von der Säule. Laut klatschte alles Beifall. Ich stand mit meinem Pferde nun mitten in der Menge. Riß die Toga auf, bot dem Volke meinen Hals und rief: »Stoße zu, wer will.« Er lacht leise auf. »Da wichen alle zurück.«
Er schweigt, lehnt sich im Sessel zurück, im Gedenken der Szene versunken.
Sie tritt von ihm fort, setzt sich ihm gegenüber. Die frühe Dämmerung der Märzmitte steht in dem Zimmer. Aus dem Halbdunkel glänzt wächsern seine Stirn. Wie ein flackerndes Irrlicht leuchtet ihr Gesicht.
»Was nun?« stößt sie endlich zwischen den Zähnen hervor. Sie schießt die Worte gegen ihn ab. »Was nun?!«
Er sitzt ohne Bewegung. Seine blassen Lippen formen die Antwort: »Warten, mein Kind.«
Sie schnellt von dem Sessel auf. »Warten!« Gemartert wirbelt sie sich um ihre Achse und stampft ungebärdig mit dem Fuße das Mosaik des Bodens. »Wie lange noch warten! Seit zwei Jahren sitz’ ich hier in Rom, vernachlässige mein Reich und warte. Ich halte es nicht mehr aus. Ich ersticke in diesen engen Wänden.«
»Ich bedauere, daß ich dir hier keinen alexandrinischen Königspalast bieten kann.«
Sie überhört seinen Spott.
»Warten! Warten! Immer nur warten. Und das Leben vergeht!!«
»Du hast mehr Zeit zu warten, als ich«, sagt er sanft.
»Aber weniger Geduld.«
»Leider.«
Da ist sie wieder bei ihm, packt ihn mit den kräftigen Kinderfäusten an beiden Schultern, schüttelt ihn und weint vor Zorn und Enttäuschung hervor: »Quäl’ mich nicht so unmenschlich! Leg’ endlich diesen Panzer erhabener Lebensweisheit ab. Laß mir gegenüber doch diese glatte diplomatische Hülle fallen. Ich kenne die Feuer, die in dir brennen. Gajus, sprich mit mir, wie mit deinesgleichen. Wir beide sind doch eins. Leg doch vor mir die Maske ab!«
Sie drängt sich an ihn.
Er streichelt ihren Rücken, ihre Arme und zieht sie an sich.
»Liebes«, flüstert er heiser, »wir haben heute verspielt. Es geht nicht. Die Zeit ist noch nicht reif. Ich mache dir keine Vorwürfe. Narren machen anderen für ihr Tun Vorwürfe. Ich hätte mich von dir nicht verleiten lassen sollen. Du kennst diese Römer nicht wie ich. Wie solltest du auch? Mit exotischen Maßstäben lassen sie sich nicht messen.«
»Ich bin nicht exotisch!«
Seine Stimme wird sehr zart. Als spräche er zu einem Kinde, als wolle er einen Schmerz, den er ihr angetan hat, fortstreicheln, sagt er sänftigend: »Sie sind hohl. Aber diese Höhlung ist von der fixen Idee des Republikanertums angefüllt. Sie wissen kaum noch, was Republik ist. Aber gerade darum klammern sie sich an diese Phrase. Wer regiert Rom? Ich. Aber das Wort Monarch – König meiden sie wie die Pest.«
Er schweigt, hält sie in den Armen, wartet, daß ihr gespannter Körper sich löst, ihr Ärger verebbt. Als sie spricht, ist ihre Stimme noch voller Gegnerschaft.
»Und wegen dieser Marotte soll unser gewaltiger Plan – ?«
»Alles braucht seine Zeit der Reife«, bedenkt er.
»Du hast die Armee!« ruft sie ungezügelt. »Schaff die Reife.«
Er schüttelt den Kopf. »Auf Lanzen und Schwerter kann man kein Königtum bauen.«
Sie lodert auf. »In Alexandrien warst du kühn.«
Er lächelt. »Da galt es auch, dich zu erobern.«
Doch ihr Sinn steht nicht auf Scherz und Galanterie. Sie setzt sich wieder, kauert sich unnahbar, igelig zusammen.
Da beugt er sich zu ihr vor. Seine tiefliegenden Augen liebkosen sie, seine braunen Hände strecken sich nach ihr aus, seine Stimme ist eine Zärtlichkeit. »Kleo, nimm deinen durchleuchtenden Verstand zusammen. Vergiß deine Enttäuschung. Du verlangst, daß ich zu dir wie zu meinesgleichen spreche. Jetzt tue ich es. Ich –«
»Ach, was nutzt das alles!« wehrt sie ergrimmt.
»Aber, Liebste«, tadelt er sacht, »weil nicht alles gleich im ersten Ansturm gelingt!«
»Gleich – ist ausgezeichnet!« höhnt sie. »Nun sag mir bloß noch, daß Rom nicht an einem Tage gebaut worden ist.«
»Ich pflege nicht in Sprichwörtern zu reden«, verweist er kühl.
Da springt sie wieder empor. »Herrgott, wohin verlieren wir uns! Wie aufgezogene Puppen radebrechen wir miteinander. Rede doch endlich rotes Blut, Gajus! Was soll nun geschehen? Was wird aus unserem Reich? Wir disputieren, als wären wir langbärtige Philosophen.«
»Na, na!« scherzt er.
»Sie reißen die Krone von deinem Haupte und wir sitzen hier und drechseln Worte. Was gedenkst du nun zu tun, nachdem alles mißlungen ist?«
»Du übertreibst, Kleo. Alles ist nicht mißlungen. Wir haben die Dinge nur unklug überstürzt. Aber etwas haben wir erreicht.«
»Was – bitte?« fordert sie messerscharf.
»Ich habe den Gedanken des Königtums in die Massen geworfen«, sagt er langsam. »Den Keim ausgesät. Trotz allem. Die Idee lebt.«
Sie will unterbrechen, doch er hemmt ihr Ungestüm mit einer leichten Bewegung der Hand.
»Noch vor Monaten – vor Wochen noch, wäre der Gedanke einer Monarchie in Rom allen als glatter Irrsinn erschienen. Heute ist er schon eine Möglichkeit, eine –«
»Ich will Wirklichkeit!«
»Ich auch, Kind«, stimmt er eifrig zu. »Ich bin Zeit meines Lebens ein sehr realer Politiker gewesen.« Er lächelt überlegen. Es scheint, als gehöre dieses Lächeln nicht zu dem verfallenen Gesicht.
Kleopatra hebt das Kinn, ihre Augen sind halb geschlossen. Spitz fragt sie: »Und was gedenkt der große Realpolitiker jetzt zu tun?«
»Wenn du Geduld hast, will ich es dir sagen, Kleo. Ich werde tun, was ich immer tun wollte. Was ich bis zum letzten Panzerriemen vorbereitet habe. Wovon ich mich nur durch deine – meine Liebe zu dir habe abtreiben lassen. Ich ziehe in vier Tagen in den Partherkrieg.«
Da wächst sie steil empor von ihrem Sitze. Es ist, als hätten seine Worte sie mit noch intensiverem Leben erfüllt. Fortgeweht ist ihre Keckheit, ihre harte Stimme, ihr unduldsamer Mund. Sie spricht wie eine Frau in höchster Angst.
»Du willst erst nach Persien?!«
»Ja.«
»Das ertrage ich nicht! Hörst du! Das kann ich nicht ertragen.«
Er beugt sich wieder zu ihr vor und packt sie in den Bann seiner strahlenden schwarzen Augen, das einzige an ihm, das stark und jung geblieben ist. »Kleo, du mußt es ertragen!«
»Hier sitzen und harren –«
»Nicht hier.«
»Sondern?«
»In Alexandrien.«
Ihr Körper bebt vor Zorn und Verzweiflung.
»Komm her«, sagt er weich.
Sie rührt sich nicht. Ihr kleiner Körper zuckt und windet sich in Ungemach.
Mit einem leisen Lächeln faßt er ihr Kleid, zieht sie an sich, zieht sie auf seinen Schoß, birgt sie in seine Arme wie ein klagendes krankes Kind. Flüstert zu ihr herab. Er ist zärtlich, wie ein Vater, gütig wie ein Freund, und bisweilen wird es die Stimme eines erschütterten Geliebten.
»Sei vernünftig, du Klügste auf Erden. Sei doch bloß ein bißchen vernünftig. Komm, komm, weine nicht, mein geliebtes Mädchen. Begreif doch, so geht es nicht. Das hast du nun doch selbst gesehen. Sie sperren sich gegen mich und dich. Mit Gewalt kann man Verfassungen nicht erzwingen – nicht für die Dauer. Ich brauche noch eine große Tat. Eine gewaltige, hinreißende. Eine, die diese Plebejer begeistert, ihre Hirne umnebelt. Eine Alexandertat. Nur kriegerische Lorbeeren wirken auf diese stumpfen Gemüter. Bis nach Indien muß ich meine Legionsadler siegreich tragen. Und wenn ich dann mit den Schätzen Indiens beladen heimkehre, dann Geliebte, dann – wenn sie neben dem Kriegsruhm sehr reale greifbare Erfolge sehen – wenn ich dann meinen Triumph feiere – dann sollst du sehen, wie sie dem Könige zujubeln.«
Sie liegt ganz still an seine Brust gebettet. Schluchzt nur noch vom Weinen nach.
»Ich wollte es immer. Ich will mich vor dir mit meiner politischen Einsicht nicht brüsten. Ich bin ein alter Routinier. Du ein leidenschaftliches junges Weib. Dein Plan ist groß und herrlich. War er immer, wird er immer bleiben. Es handelt sich nur um das Tempo seiner Verwirklichung. Unser Weltreich, Kleo, wird, so wahr ich dich liebe und in meinen Armen halte. Dann, mit der Erde zu deinen kleinen herrlichen Füßen, wirst du mein Weib, alle unsere Träume werden Wahrheit.«
Der Klang seiner Stimme ändert sich, wird härter, rauher. Es wird die Stimme des Staatsmannes. Der Geliebte ist verschwunden.
»Aber hier kannst du nicht bleiben, während ich in Persien bin. Deine Anwesenheit arbeitet gegen uns. Erinnert sie stets an unseren Plan. Der muß tief und unbemerkt fortwuchern, wie ein Saatkorn im Mutterschoße der Erde. Auf dem Rückwege hole ich dich aus Alexandrien.«
Wieder wandelt sich die Stimme, wird zum Trompetenton, tapfer, hell, voller Vertrauen.
»Dann ist unser Tag gekommen. Dann ziehst du mit mir, als mein Weib und die Königin des Ostens, auf dem Triumphwagen des Königs des Westens in Rom ein – die heilige Straße hinab – zum Kapitol – alles Volk jubelt uns zu – die siegreiche Riesenarmee tut das Ihrige –«
Sie setzt sich jäh auf seinen Knien auf, sieht ihm ins Gesicht. Ein Ton aus alten Tagen, aus alexandrinischen Nächten ist in seiner Stimme, reißt sie empor. Das ist der Cäsar, den sie einst gekannt hat, der feurige Geliebte, der Mann, den kein Alter berühren, noch antasten kann. Ihre Augen glänzen wie in den Tagen, da er sie in die Arme nahm und ihr wilde, leidenschaftliche Worte ins Ohr raunte. Auch in seinen Zügen flammt ein Feuer aus den ersten Zeiten ihrer Liebe. Ja, das ist Cäsar, ihr Cäsar, ihr Geliebter, ihr Erwecker und Meister.
Lange sieht sie ihn stumm an. Dann fragt sie leise: »Wie lange wird es dauern?«
»Weiß ich nicht. Dauer der Kriege läßt sich nicht vorausschätzen.«
»Ungefähr.«
»Zwei bis drei Jahre.«
»Unmöglich!« Sie fiebert von seinem Schoß, rennt in dem fast dunklen Zimmer umher wie ein kleiner Irrwisch.
»Solange halte ich es nicht aus.«
»Man hält vieles aus« –, sagt er ruhig, »um ein Weltreich – selbst wenn man alt und morsch vom Fieber ist.«
Da ist sie wieder bei ihm. In seiner Stimme hat sein Alter und seine Müdigkeit geschluchzt. Sie beugt sich über ihn, legt die Hände auf seine Schultern, preßt ihre Wange gegen die seine. Voll Sorge, Angst und Liebe fragt sie:
»Bist du denn gesund genug für die Strapazen dieses großen Krieges?! Kannst du die Entbehrungen eines Feldzuges ertragen?! Wenn du krank würdest – weit von mir –, ich würde vor Angst um dich vergehen!«
Er wendet das Gesicht zu ihr empor.
»Nur für diesen Krieg bin ich gesund und stark genug. Ein altes, mürbes Streitroß. Wenn die Fanfaren schmettern, richtet es sich auf und sprengt los.« Er lächelt so schmerzlich und zag, daß ihr empfängliches Herz ihm entgegenspringt.
Sie liegt an seiner Brust. »Du – du – ich wußt es – wenn die Krone winkt – wieder ganz jung wie vor vier Jahren in Alexandrien würdest du werden. Unsere Nächte damals – unsere –«
Sie wühlt sich an seinen Leib, schmiegt sich an ihn, sucht seine Lippen.
»Küß mich – nimm mich –«
Da zieht er sich in sich zurück. »Liebste, nicht jetzt«, wehrt er in milder Trauer. »Ich muß gleich fort. Letzte Vorbereitungen. Und abends bin ich bei Lepidus eingeladen.«
Schmerzlich ernüchtert gleitet sie von seinen Knien. Streicht das Haar an beiden Seiten aus den Schläfen. Feindlich glimmen ihre Augen durch das Dunkel.
»Geh«, faucht sie.
Jetzt erst begreift er ihre Enttäuschung.
»Verzeih«, bittet er schlicht. »Ich brauche in diesen Tagen meine Kraft und Besonnenheit.«
»Geh.«
Er überhört ihre Frechheit. »Eine geniale Frau hat noch andere Verbindung mit einem Manne, dachte ich.«
»Genial!« höhnt sie, »genial ist man nur in der Ausführung großer Gedanken. Pläne, Ideen, Sehnsüchte haben auch kleine Weibchen. Meine geniale Ausführung bist du, und du – behandelst mich wie eine Dirne. Läßt mich um Liebe betteln – vergebens.«
Er steht auf. Seine Augen sind kalt.
Sie weiß, sie hat ihn grausam verwundet.
»Nicht immer«, sagt er, »nicht immer laß ich dich vergebens – bitten. Am achtzehnten März schreite ich zur Ausführung eines Planes, der mehr ist als Erfüllung einer erotischen Laune – für dich.«
Sie schweigt beschämt.
»Laß das Kind kommen«, gebietet er nach einer kleinen Pause.
Sie klatscht in die Hände, der Sklave bringt die Lampe. Die Kinderfrau den Kleinen.
Cäsar stellt das Bübchen vor sich auf die Knie. Das Kind ist scheu und schweigt. Lange betrachtet es Cäsar. Die Ähnlichkeit mit ihm ist verblüffend. Unter den weichen Kinderzügen zeichnet sich schon der scharfgeschliffene Römerkopf des Vaters ab.
In einer jähen wehmütigen Aufwallung küßt er es auf den Mund und gibt es der Kinderfrau zurück. Sie trägt Cäsarion hinaus.
Kleopatra kauert niedergeschlagen, den Kopf tief gebeugt. Er blickt in der Helle der Lampe zu ihr hinüber.
»Kopf hoch, Kind«, ermuntert er. »Was sind zwei Jahre, wenn es ein Weltkönigtum gilt!«
Sie hört nicht auf ihn. Das Licht spiegelt sich in dem Schwarz ihres gebeugten Haares.
»Laß mich nicht so von dir gehen«, drängt er. »Laß mich – wie immer – etwas Liebes von dir mitnehmen.«
Sie rührt sich nicht, verstockt.
»Sing mir eins deiner schönen ägyptischen Lieder – wie einst.«
»Einst ist lang vorbei«, murrt sie. Steht aber doch auf, holt die Laute aus dem Winkel, stimmt und singt. Singt mit dieser Stimme, die jedes Frauen-und Männerherz bestrickt und bezaubert. Singt in den einfachen uralten Weisen des Volkes, das sie beherrscht. Ihre Züge sind angespannt und in Weiten verloren.
Nie war sie so schön, denkt Cäsar und fühlt, wie ein undeutbares Gefühl des Abschiednehmens ihm das Herz dehnt.
»Siehe die Häuser der Lebenden! Ihre Mauern zerfallen, ihre Stätte ist hin. Sie sind, als wären sie nie gewesen. Alles, was wird, muß gehen dahin. Die Jünglinge und Mädchen Schreiten ins Dunkel, Die Sonne steigt im Aufgang und geht nieder im Westen. Männer werben und Frauen empfangen. Auch die Kinder schon torkeln ins frühe Grab. Darum sei glücklich! Komm! Düfte und Räusche stehen vor dir, Mahublumen und Lilien lechzen Nach dem Nacken der Geliebten. Komm! Sang und Musik harrt deiner. Vergiß alle Sorgen, denk nur an Freude, Bis der Tag kommt, an dem auch du In das Land wanderst, Das Schweigen heißt.«
Langsam haben sich die Augen des Mannes von dem still verklärten Gesicht der Königin gelöst. Sein Kopf sinkt. Er hört nur diese beglückende Stimme, die Worte der Trauer klagt.
Doch sie sieht. Während sie singt, umtasten ihre Blicke das Gesicht, das von unten her, vom Scheine der Öllampe, sanft bestrahlt ist. Sie sieht, wie seine Züge sich lösen, wie die Maske sinkt und die blauen Schatten unter den Augen sich weh vertiefen und purpurn dunkeln. Das zergerbte Gesicht dieses alten verbrauchten Staatsmannes und Soldaten wird weich und lind, und wie hinter bergenden Wänden tritt seine tiefe Menschlichkeit und Größe hervor. Über seine markigen Züge ist etwas Vergeistigtes gehaucht, etwas ihr Verwandtes, das Feinste und Beste, das sie geeint hat und immer einen wird.
Sie vergißt die Kränkung. Vergißt alles Trennende. Fühlt nur eine hingebende Zärtlichkeit und alle Liebe, deren sie fähig ist. Weiß wieder, daß dort der einzige Mann sitzt, den sie sich ebenbürtig und überlegen gefunden hat.
Als sie schweigt und leise die Saiten nachhallen läßt, hebt er ganz langsam den Kopf.
»Von wem ist das Lied?« Immer will er wissen und lernen.
»Von dem Pharao Imhotep. Er bestieg den Thron etwa zweitausendzweihundertfünfzig Jahre vor der Gründung Roms.«
»Traurig ist sein Lied«, sinnt er vor sich hin.
Da wirft sie die Laute hin, breitet ihm die Arme entgegen und jubelt zukunftssicher: »Nein, voller Lebensinbrunst ist es, mein König der Welt.«
IV.
Am folgenden Morgen nimmt Kleopatra ein Bad. Gedämpftes Licht fällt bläulichrot durch die bunten Scheiben des Fensters in das Badezimmer. Weich ausgestreckt liegt sie in der warmen, duftenden Flut, hat das Kinn gegen die Brust gepreßt und betrachtet prüfend den kleinen Körper.
Ich habe ja einen Bauch, denkt sie erschreckt, und streicht über den kaum gewölbten Leib. Die Haut hat den seidigen Glanz alten Elfenbeins. Mehr turnen! Mehr gymnastische Übungen, beschließt sie. Gleich anfangen, sofort nach dem Bade. Und Eiras muß schärfer massieren. Sie befühlt ängstlich die Brüste. Nein, die sind fest und hart – ganz jungfräulich, und füllen mit ihrem glatten spitzen Kegel grade ihre kleinen Handhöhlungen. Kein Mal ist an ihrem Leibe, kein Zeichen der Mutterschaft. Die Kunst der ägyptischen Ärzte ist groß, größer noch Kleopatras Geduld und verbissener Eifer, ihren kleinen ebenmäßigen Körper in seiner schimmernden jungen Makellosigkeit zu erhalten.
Ungestüm will sie sofort einen Plan erweiterter Leibesübungen entwerfen und festlegen. Sie ruft Charmion, Eiras. Da stürmt die Griechin schon herein. Schwenkt triumphierend ein kleines Bündelchen. Man kennt unter den Vertrauten die Holztäfelchen, die Cäsars Briefe bergen. Oft schickt er sie in plötzlicher Laune, jäher Notwendigkeit.
»Gib her – gib rasch her!« Die Königin streckt den schlanken muskelkräftigen Arm aus der Wanne. Wasserperlen rieseln nieder. Charmion bastelt an der grünen Schnur, die versiegelt die Täfelchen zusammenhält. Kleopatras Hand fingert ungeduldig, nervös, gierig. Sie fühlt bis ins Mark und ins Herz, der Brief bringt Gutes. Ein Fluidum geht von ihm aus. Plötzlich ist in ihrer Brust etwas von der Lust, dem staunenvollen Frohsinn, der sie entzückt und emporgetragen hat in den ersten glücksquellenden Tagen ihrer Liebe zu Gajus Cäsar. In dem Briefe brennt unerwartet Gutes! Her damit – her damit!
Sie drängt, sie treibt. Ihre Hast hetzt die geschickten Finger der Griechin zu Mißgeschick. Jetzt haben die Schnüre sich zu einem Knoten verwirrt. »Zerreiß das Band!« Es knallt auf. Mit feuchten Fingern klappt die Königin die Täfelchen auseinander. Liest die kühne herrische Schrift auf dem schwarzen Wachse. Ihr Herz klopft so heftig, daß Charmion seinen Schlag gegen die nasse Brust pochen sieht.
Dann schlägt Kleopatra die Täfelchen zusammen. Das Holz ist feucht durchtränkt von ihren Fingern. Sie reicht es Charmion, »leg es auf das Tischchen dort« – und springt, einen Wasserschwall mit sich reißend, aus der Wanne.
Ihre grünen Augen funkeln. Das Programm der neuen Leibesübungen ist vergessen. Sie wird getrocknet, gerubbelt, Eiras tritt an, die gewiegte Masseuse, die kunstbegabte Friseuse und Haarpflegerin. Die Königin merkt nichts. Ihre Gedanken irren ins Weite, hinüber über den Tiber, in den Senat. Ihr kluges Hirn weiß den Brief auswendig. Jedes Wort.
»Mein Liebstes, alles scheint noch gut zu werden. Dein Geist und deine Wünsche liegen waltend über Rom. Habe elend geschlafen, böse dumme Träume. Fühlte mich hundsmiserabel. Wollte gar nicht in die Sitzung gehen. Da kommt eben Decimus Brutus Albinus, einer meiner intimsten Freunde, und verrät mir, daß der Senat gestern in geheimster Sitzung einstimmig, bitte einstimmig! beschlossen hat, mir heute den Königstitel anzubieten. Unter gewissen Modalitäten, die nicht interessieren. Wie dein alter politischer Roué, der mit allen Hunden gehetzt, mit allen Wassern gewaschen ist, sich doch irren kann! Du behältst wieder einmal recht – wie immer. Freue dich. Ich komme vom Senat und Königszuge zum Forum sofort zu dir. C.«
Sie eilt in den Garten, rennt sinnlos umher. Ein kleiner hochmütiger Triumph ist in ihr. Sie kennt diese Römer besser als er, der Kluge, Gerissene, Kühne, Altersbedächtige, der einer von ihnen ist! Sie wissen, daß die Republik faul und morsch ist. Daß Einer den verrotteten Staat führen muß. Ihm wollen sie die Last aufbürden und die Verantwortung. Sie begreift es. Das ist es natürlich, nicht Liebe, nicht Dankbarkeit. Dankbarkeit und Liebe! Sie weiß, was die in der großen Politik wiegen. Nicht eine Flaumfeder.
Jetzt – grade jetzt – vielleicht – bieten sie ihm die Krone an –
Sie eilt zurück ins Haus, vor Ungeduld knisternd. Weiß nicht, womit sie die Zeit morden soll. Die Zeitung! Vielleicht steht schon etwas davon in der Zeitung. Vielleicht war die Sitzung gestern doch nicht so geheim, vielleicht ist etwas durchgesickert.
Charmion stürzt mit der Zeitung herbei. Auch diese »Tagespost« ist ein Werk Cäsars. Kleopatra überfliegt die Blätter. Sie, die zehn Sprachen geläufig spricht, liest Latein wie eine Römerin. Nichts. Nichts davon. Aber viel anderes. Andere politische Maßnahmen, Anordnungen, Regierungsakte Cäsars. Ein Mieterschutzgesetz: auf ein Jahr wird wegen der Geldnot die Miete für alle Wohnungen bis zu 2000 Denaren gesetzlich gestundet. Die Arbeitslosenversorgung neu geordnet: statt 320 000 Empfänger öffentlicher Speisung nur noch 150 000. Der Arbeitslosigkeit wird auf anderem Wege gesteuert. Neubauten in Rom – sie werden einzeln angeführt – Verschickung von 80 000 Bürgern in die überseeischen Kolonien zur Urbarmachung, Abschiebung der Bevölkerung der Großstädte auf das Land. Ausbau des Hafens von Ostia. Ferner eine kleine Änderung der Straßenverkehrsordnung in Rom.
Ein Tag aus seinem Leben und seiner Verwaltung. Inmitten der Vorbereitung auf den größten Krieg, den er je geführt hat, Sorge für das Soziale, Wichtigste und Geringste.
Ein Gefühl des Fremdseins, der Vereinsamkeit überschleicht die Königin. Was weiß sie im Grunde von diesem Manne! Wie fern steht er ihr im Letzten! Nie hat er über diese in ihm reifenden Pläne gesprochen. Freilich, freilich, sie hat immer nur von dem großen Staatsgedanken geredet, die heilige Flamme in ihm anzufachen und zu behüten. Wie fern und fremd und überlegen ist dieser Mann ihr in seinem Eigensten!
Sie beißt unmutig die regelmäßigen weißen Zähne in die Unterlippe. Dann wirft sie nach ihrer Gewohnheit den Kopf zurück. Muß anders werden. Alles würde anders werden, wenn sie erst sein Weib war – seine Königin vor aller Welt. Wenn Ost und West unter seinem und ihrem Szepter vereint ist. An jeder seiner Regierungspläne und Verwaltungstaten will sie teilhaben, an jedem –
Sie horcht auf. Ein Läufer draußen. Sie hört Flüstern. Ist Seleukos wahnsinnig, ihn aufzuhalten? Hat er noch nicht genug an der Peitsche von gestern! Totpeitschen! durchtobt es sie, während sie in das Peristyl hinausstiebt.
»Warum läßt du den Boten nicht zu mir?!« keucht sie den Aufseher der Läufer gefahrdrohend an.
»Herrin –« Der Mann hebt verstört machtlos den Arm.
»Später«, zischt sie. Der Mann wird weiß wie die im Sonnenlicht glimmenden Kiesel des Gartenweges. Er weiß, der Aufschub bedeutet Tod.
»Was bringst du?«
Der Bote stockt. Furcht lähmt ihm die Zunge. Böse Kunde bringt dem Überbringer oft Untergang.
»Was bringst du, Mensch!« Sie packt den nackten Arm des Mannes, zwickt ihn, daß dem Läufer die Sinne aufflammen in Schmerz.
Was haben diese Menschen? Warum sprechen sie nicht? Es kann doch nur Gutes –
»Herrin, laß nicht mich entgelten –«
Hinter ihrer Stirn ist es weich, wolkig. Eine Ahnung. Irrsinn! Im Senat haben sie den Antrag gestellt. – Was haben diese Menschen? Da noch mehr – das Gesinde – der Hofstaat – was wollen die alle hier? – Was bedeutet dieser Auflauf? Täuscht sie sich oder sehen die wirklich alle so bestürzt – zerflattert aus?
»Was ist?« stößt sie trotz aller Härte unsicher hervor.
Der Bote starrt auf seinen verletzten Arm. Ein blutblauer Fleck hat sich dort gebildet. Sie pufft den Mann mit der geballten Faust in die Brust. »Willst du endlich reden?«
Er taumelt auf. »Herrin – Cäsar –«
Er bricht ab.
»Was ist mit Cäsar?« Cäsar ist jetzt doch König. Warum stockt der Mann schon wieder, Todesgrauen weiß in den Pupillen? Warum blickt er zerquält, Hilfe suchend auf die andern? Was stehen sie alle und senken schreckhaft den Blick –?
»Was ist mit Cäsar?« Ihre Stimme klingt ihr fremd und nie gehört.
»Cäsar ist – ermordet!«
Sie hat das Gefühl, daß sie stürze. Klaftertief, von einem hohen Turm zur Erde nieder. Gleich wird sie auf den Boden aufschlagen – furchtbar, zerreißend, zerschmetternd. Sie wartet auf den Aufschlag auf die Erde. Fühlt das Vorübersausen der Luft an den Schläfen – in den Ohren – wartet auf den Aufprall – weiter nichts – weiter weiß sie noch nichts.
Der Aufprall kommt nicht. Sie sinkt, sinkt in rasender Eile – immer tiefer – tiefer. Sie weiß nicht, daß sie steht und schwankt – hin und her – nach vorn und zurück schwankt auf den Sohlen der Schuhe.
Dann hört das brausende Hinabstürzen plötzlich auf. In dem Hirn wird eine Öffnung. Eine Helle klafft herein. Was hat er gesagt? Aus den Tiefen des Bewußtseins klimmt es schwarz empor. Da hat doch Einer etwas gesagt. Wer? Sie hebt den Blick. Die Augen sind umflort, die unteren Lider schwimmen in Blut.
»Was hast – du – gesagt?« fragt sie, jedes Wort regnet nieder, schwer, einzeln wie dicke Gewittertropfen auf ein Kupferdach.
»Cäsar ist im Senat ermordet worden«, flüstert der Läufer. Er weiß, gleich wird ihr Jähzorn ausbersten und ihn vernichten.
»Noch einmal!«
»Cäsar ist im Senat ermordet worden.«
Sie blickt den Mann starr an. Ihre grünen Augensterne, die in einer blauen Iris stehen, sind wie die Augen einer Schlange, die zum Angriff vorstoßen will.
Langsam umklammert das Gehirn die Kunde. Langsam, schwerfällig begreift das fein ziselierte flinke Gehirn. Dann öffnen sich die Lippen. Es dauert noch, ehe ein Laut hervorbricht. Dann gellt diese wunderbare Altstimme, die ein Menschenruhm ist von Alexandrien bis Rom über alle Lande des Mittelmeeres hin, zerrissen, zerfetzt zum Himmel empor.
»Nein – nein – du lügst – du Hund. Du lügst!«
Der Läufer beugt das schwarze Haupt unter sein Geschick.
»Du lügst! Das ist nicht wahr! Das kann nicht wahr sein!!«
Es schrillt hinaus in die weiten Gärten, die rings die Villa umhegen. Sie weiß längst, daß es wahr ist. Ein Krampf, ein Wahn, der nach ihr tastet, eine widerstrebende Wut will es nicht wahr haben. Da taumelt sie. Mardion, der Eunuch, greift zu. Bewahrt sie vor dem Fall. Charmion schiebt ihr den Rand eines Sessels in die Kniekehlen. Sie bricht rücklings nieder. Fällt hinein, steif, ungelenk, ohne Beugung der Hüfte. Liegt ausgestreckt. Charmion, die sorgsame, selbst vernichtete, weht das Gefolge aus dem Raum. Nur den Boten hält sie zurück. Eiras bringt Essenzen, Belebungsmittel, reibt der Herrin die Schläfen, die Stirn, das Herz.
Kleopatra richtet sich auf. Ihr Gesicht ist gelb und verfallen. Doch sie hat sich in der Hand. Sie winkt dem Boten, ganz matt, kaum merklich.
»Wer hat – Cäsar ermordet?«
Der Mann muß sich tief zu ihren Lippen hinabbeugen. Ihre Frage ist ein Hauch.
»Marcus Brutus, Gajus Cassius – Decimus Brutus, viele – alle.«
Sie neigt wieder den Kopf, die Hände auf die Armlehne des Sessels gerammt, den Oberkörper vorgebeugt, das Gesicht nach unten. Ihr Nacken steht wachsweiß gegen das schwarze Haar.
Ohne sich aufzurichten, stöhnt sie hervor, es ist wie würgendes Erbrechen:
»Auch – Decimus – Brutus?«
»Ja, Herrin.«
Da sackt sie zusammen. Das Gesicht schlägt auf die Oberschenkel nieder. Der Mund preßt sich auf die Knie, ein Aufheulen pfeift zwischen Mund und Knien wimmernd hervor. Im Augenblick weiß ihr unbeirrbarer Verstand alles. Sie haben ihn in die Senatssitzung gelockt, ihm vorgegaukelt, sie wollten ihn zum König erheben, – um ihn zu ermorden. Sie sieht alles, sie weiß alles. Ihr Gehirn rast weiter. Sie züngelt auf wie eine verheerende Flamme. Der Bote, die Mädchen sehen sie entsetzt. Sie lodert durch die Veranda. Von ihrem Munde schäumen Worte.
Nein, nein. »Ermordet« – »List« – »Verrat« – das sind Worte – Worte nur – Laute. Worte können das Weltgeschehen nicht ändern – nicht aufhalten – können nicht Reiche stürzen. Das ist nicht wahr – das kann keine Wirklichkeit sein, die zählt, die gilt! Sie läuft ziellos umher, kommt zurück, wirft sich wieder in den Sessel. Der Kopf fällt wieder haltlos tief herab. Laute, zerpreßte Schreie gurgeln hervor. Dann wird sie still, ganz still. Ihr Scheitel zittert.
Andere Boten. Nachrichten prasseln auf sie nieder. Sie winkt nur mit einem Finger Gewährung. Keiner weiß, ob sie hört, begreift.
»Dreiundzwanzig Dolchstiche – er liegt am Fuße der Säule des Pompejus – alles flieht – schließt die Häuser – die Straßen sind von Entsetzen verödet.«
Sie versteht alles, hält das verwüstete Haupt dem Hagelschauer der Nachrichten hin. Der schimmernde schwarze Scheitel zittert.
V.
Dann schnellt die Ewig-Ruhelose wieder empor. Die Mädchen, die selbst zu erschüttert, zu verloren sind, Trost zu finden für sie, weichen ängstlich zurück. So fremd, so furchtbar ist sie.
»Ich will – hin.«
Da platzt ein neuer Bote herein. Sie haben die Leiche in sein Stadthaus getragen.
Kleopatra lehnt gegen die Wand des Peristyls. Sie will Haltung bewahren. Sie muß. Noch ist sie Königin. Im Hause Calpurnias ist er! Der gehört er nun. Sie ist nur die Geliebte.
Sie wankt ins Haus. Charmion will sie stützen. Mit hängenden Händen winkt sie ab. Ihre blauen Lippen flüstern: »Geht – geht alle.«
Dann sitzt sie mutterseelenallein, wie jeder im furchtbarsten letzten Weh allein ist, an dem Tische, vor dem Stuhle, auf dem er gestern – vor kaum sechzehn Stunden gesessen hat, leibhaft, lebendig, wohl krank und siech, aber voll Odem, voll Plänen, voll Zukunft. Voll Leben! Sie starrt auf den leeren beredten Stuhl. Sie will den Geliebten hinzaubern. Doch sie kann sein Gesicht plötzlich nicht mehr sehen. Starrt hin, bis ihr die Augen übergehen. Weinen kann sie nicht mehr. Nur denken, erfassen, zweifeln, verzweifeln.
Aber das volle Grauen, von dem nun die Welt und ihre Welt voll ist, kann sie doch noch nicht geistig umspannen. Noch weiß sie nur, Cäsar, ihr Cäsar, ihr Licht, ihre Liebe, ihr Lehrer und Meister ist tot. Liegt von dreiundzwanzig Dolchstößen durchlöchert im Hause seiner Frau, steif, kalt, ohne Leben. Hingeschlachtet von seinen besten Freunden, die ihn hingelockt haben, ihn abzuschlachten.
Ein klagendes Weh versperrt ihr den Schlund. Nur das weiß sie, nur das begreift sie: ihr Cäsar, der Erwecker ihres Körpers und ihres Geistes, der Vater ihres Kindes ist tot – atmet nicht mehr, sieht nicht mehr die strahlende Märzsonne dort draußen. Wird nie mehr zu ihr kommen mit dem ironischen Lächeln auf dem klugen durchgeistigten Gesicht, nie mehr zu ihr sprechen – nie mehr sie küssen – nie wieder – nie wieder, und wenn sie hundert Jahre alt wird – und wenn sie tausend Jahre hier säße und auf ihn wartete – nie wieder wird er kommen.
Aber langsam, wühlend, schürfend steigt ihr Bewußtsein in die Tiefe. Da schreit sie auf, grell, grausig, wie ein Tier, das den Stahl in die Weichteile eindringen fühlt. Jetzt ist sie zu den Niederungen ihres Schmerzes und Verlustes herabgesunken. Jetzt erst sieht sie alles, übersieht sie alle Folgen. Jetzt erst weiß sie, daß alles dahin ist mit seinem Leben. Der Traum der Weltherrschaft – vorbei – zerronnen – alles zerstoben, als wäre es nie ausgedacht, ersonnen mit Herzblut, geistig erschaffen worden bis in alle Einzelheiten. Dreiundzwanzig Stilette haben den erhabensten, kühnsten Königstraum aller Zeiten erdolcht. Nicht nur den größten Mann seiner Tage haben sie hingemeuchelt – ihren Mann – es scheint ihr plötzlich, als seien alle ihre Lebensfäden in seinem Dasein zusammengelaufen, in seinem Dasein verankert gewesen – gestern hat er noch dort auf dem Stuhl gesessen –, die Brust umkrallt ein Schmerz, der die Lungen so eisern einengt, daß sie ächzen muß nach Luft und Atem. Doch das Lot ihrer Gedanken sinkt wieder tiefer – hinab unter persönliches Leid.
Sie haben nicht nur den größten Staatsmann und Feldherrn heute morgen im Senat erschlagen – auch seinen Traum vom Weltkönigstum, ihren Traum, ihren Rausch, seinen Ehrgeiz, ihren Ehrgeiz, seinen Willen zur höchsten und letzten Macht, ihren Willen zur höchsten und letzten Macht der Erde.
Das Kaiserreich der Welt ist verblutet unter den Mörderhänden. Dieses Reich, das heute Wirklichkeit werden sollte, haben sie in seinem Hirn erstochen. Diese Idee, die unsterblich schien wie ihr Träger, ist sterblich gewesen wie sein Leib.
Sie sinnt, die Wangen in beiden Händen. An einem, an dreiundzwanzig Dolchen hängt das höchste Wollen und Streben! Viel, alles hat sie erwogen. Seinen Tod nie.
Langsam, dann aber bis ins Mark vernichtend, begreift sie, daß ihr heute mehr gemordet worden ist als der Geliebte, der Vater ihres Kindes, der einzige Freund, der Mann, der sie heiraten und zur Kaiserin der Erde machen wollte. Ihr Schicksal, ihre Berufung, die große politische Idee – ihre Idee, ihr Gedanke –, Ost und West der Welt zu verbinden in ihm und in sich, ist erwürgt worden. Ihr Leben ist ein Unsinn geworden, ein Widersinn. Witwe ist sie des Leibes, des Geistes, der Macht. Heute morgen Anwärterin auf die Krone der Erde. Jetzt Königin eines kleinen, schwachen, nichtigen Landes, gefährdet, bedroht von den Feinden im Innern, eine leichte Beute des Römerrachens, der alles verschlingt. Plötzlich steht diese unhemmbare Gewalt feindlich und böse vor ihr auf. Der Freund, der Träger dieses Römertums, ihr Geliebter, Mann, Verbündeter des Körpers, des Geistes, der Tat, liegt tot im Hause der Calpurnia, die er nie geliebt, die ihn nie verstanden hat. Nur sie – oft hat er es gesagt –, nur sie allein war die ebenbürtige geistige Frau, die einzige.
Sie zwingt ihre Gedanken zurück. Rom steht jäh gegen sie, bedroht sie, wie es die Welt stets bedroht und unterjocht hat.
Sie hebt witternd die schöne, klare Stirn. Mitten in ihrem rasenden Schmerz, mitten in der grausamen Verlorenheit dieser Stunde erkennt sie ihre und ihres Landes Zukunft ungeschminkt, unbarmherzig ehrlich. Ihr genialer politischer Instinkt läßt sich nicht täuschen. Alle Sicherungen der großen letzten vier Jahre sind wie Seifenblasen zerplatzt, alle Chancen verpufft. Wie vor vier Jahren, als Cäsar nach Alexandrien kam, wankt wieder die Erde, wankt wieder ihr Thron, ihr Heimatsthron. Kein Weltreich mehr, Kampf um ihr kleines Reich gilt es nun, Kampf um ihr nacktes Dasein und Leben.
Ein Abgrund klafft vor ihr auf. Sie springt empor. Kann nicht untätig in dieses Unheil hinabstarren. Die Knie sind weich, tragen sie nicht. Sie lehnt gegen die Mauer, schaukelt mit dem Rücken hin und her. Und ballt die Fäuste und preßt die Knöchel zwischen die Zähne, daß das Blut aus der Haut spritzt. Es ist nicht möglich! Es ist nicht denkbar. Vor wenigen Stunden noch Möglichkeit, fast Wirklichkeit, schlimmsten Falles auf kurze Zeit vertagte Wirklichkeit – und jetzt alle Pläne, Erwartungen, Hoffnungen lächerliche Phantome, Chimären, Phantastereien müßiger Trödelstunden. Jetzt verwehende alberne Hirngespinste. Und doch vor Stunden noch greifbare Wirklichkeiten! Jetzt verblutet mit dem größten Manne seiner Zeit zu kalten Leichen, zerstochen, zerfetzt – –
Da packt sie wieder das Unbegreifen. Es ist nicht. Es kann nicht sein. All dieses gigantische Leben und Wollen kann nicht ausgelöscht sein, spurlos vergangen, als wäre es nie gewesen. Es kann jetzt nicht bleiche, wesenlose Geschichte sein, die durch die Jahrtausende geht, kalt, faßlich, sachlich. »An den Iden des März des Jahres 709 nach Gründung Roms wurde Julius Cäsar von seinen Freunden ermordet.« Nein. Nein. Sie träumt. Sie ist wahnsinnig geworden. Canidia, die Hexe, hat sie behext.
Sie klatscht besessen in panischem Entsetzen in die Hände, schreit. Man läuft zusammen. Es bleibt Wahrheit. Sie träumt nicht, sie ist nicht wahnsinnig geworden. Kein böser Geist verwirrt ihre Sinne. Draußen ist heller Frühling. Ist Sonne, Licht, Wärme. Die Blumen duften wie immer. Und Er ist nicht mehr. Sie faßt es nicht. Die Sonne strahlt und wärmt, die Lämmerwölkchen ziehen am Himmel, leicht und beflügelt, der Himmel ist blau, Lerchen steigen trillernd zu seinen Höhen, alles geht weiter, nichts stockt, nichts hört auf, alles ist wie gestern, wie heute morgen, nur Er ist nicht mehr. Alles lebt weiter, freut sich weiter, lacht und lebt weiter. Nur Cäsar ist tot.
Da beginnt sie zu rasen aus Unverstehen, aus Nichtbegreifenkönnen. Sie schlägt die Fäuste gegen die Wand des Zimmers, empört sich, revoltiert gegen das sinnlose Geschick, dem eine geniale Königin unterliegt wie der armseligste Bettler. Dann kommen wieder letzte hoffende, kaum noch hoffende Zweifel. Alle täuschen sich, alle sind irre geworden. Sie will es mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren hören. Umhüllt sich mit einem weiten Mantel, stülpt die Kapuze über den Kopf. Nur Charmion begleitet sie.
Hier drüben auf dem Janikulum ist noch wenig zu merken. Diese Villenvorstadt liegt still und verträumt wie immer. Doch schon auf der Brücke gähnt ihnen die Leere des Entsetzens entgegen. Das Forum starrt verlassen. Wer sich hinauswagt, jagt angstvoll dahin. Grauen lastet über der Stadt. Alles hält sich bebend in den Häusern. Keiner weiß, was der Tag des Todes noch bringen, wer Herr der Lage werden wird. Doch dort, im Schatten der Basilika Sempronia brodelt eine Menschengruppe. Sie tritt hinzu, hört vom Morde. Nur vom Morde des Herrn von Rom stammeln fassungslose Lippen.
Sie muß es glauben, es muß in ihrem Blute Leben und Begreifen werden. Da überkommt sie majestätischer Zorn. Sie ist keine Natur, die ergeben trägt. Sie schreit nach Rache. Nach Strafe. Schreit laut heraus, auf dem Heimwege. Voll Bangen zieht Charmion sie durch die menschenleeren Gassen.
»Das hätte in Alexandrien geschehen sollen! Längst hätte ich die Mordbuben gefaßt. Martern hätte ich ausgesonnen, wie sie nie erdacht worden sind.« Ihre Verzweiflung schwelgt in der Qual und dem Blute der Mörder Cäsars. Doch sie weiß, daß Ohnmacht und Zähneknirschen ihr Los ist.
VI.
Tagelang sitzt sie im verdunkelten Schlafzimmer, unbeweglich und starrt in die Leere, die Cäsars Tod gelassen hat. Denkt, trauert, grübelt, verzweifelt. Alt sieht sie aus, uralt wie das Rätsel des Lebens. Zerzaust, ungepflegt, vergangen. Sie hört Worte um sich. Charmions sorgende griechische Stimme. Eiras’ sanfte pflegende Hand fühlt sie – und hört und fühlt nichts. Man bringt ihr sein Kind. Sie sieht Cäsarion und sieht und sieht durch ihn hindurch ins Leere. Man erzählt von dem Leichenbegängnis auf dem Forum, der Wut des Volkes gegen die Mörder – sie hört, versteht und versteht nichts. Tage und Nächte sitzt sie und starrt in die Kluft, die Cäsars Tod in der Welt und ihrer Welt gelassen hat. Und dann bricht der Boden des Zimmers auf, und wie weiße Dämpfe qualmt es hervor; betäubendes Schuldbewußtsein. Sie hat ihn vorwärtsgetrieben, gegen seine Klugheit, gegen sein besseres Wissen. Sie hat ihn in den Tod gejagt. Sie hat den Tod auf ihn gehetzt in ihrer leidenschaftlichen Ungeduld. Sie weiß es und starrt auf ihre untilgbare Schuld.
Der Königsgedanke der Welt hat sein erstes Opfer gefordert.
Man dringt in sie. Die Herren ihres Gefolges, der Eunuch Mardion, der Hausminister Potheinus verschaffen sich Zutritt. Sie ist in Gefahr. Die neue Regierung, Senat und Konsuln, haben sich mit den Verschwörern geeinigt. Ihr Leben ist in Gefahr. Auch das des Kindes.
Da rafft sie sich auf. Das Wort Gefahr erweckt sie, wie eine Fanfare den Schläfer. Sie kennt Furcht nicht. Hat nie Furcht gekannt. Gefahr ist für sie ein Stählungstrank. Gefahr spürt jede Tatkraft in ihr auf. Sie hat überwunden. Sie wird handeln. Die Krise ist überstanden. Die Lähmung des Schmerzes, die Ohnmacht fällender Enttäuschung gleitet von ihr ab. Sie ist nicht die Frau, die der Gefahr weicht. Sie nicht! Im Gegenteil.
Ein leidgereiftes Weib ersteht aus dem Niederbruch seines Lebens. Sie stellt Cäsarion, seinen Sohn, vor sich auf den Tisch. Der Knirps, der des Vaters Züge trägt, tanzt vergnügt vor ihr – ihm ist es ein lustiges Spiel, auf dem Tische zu tanzen. Er ist für ihre hastenden Gedanken Sammelbecken, Kristallisierungspunkt.
Sein Sohn. Sein Erbe. Für ihn wird sie kämpfen und für sich. Für ihn wird sie das Weltreich bauen – und für sich. Cäsar war ein Mensch. Ihn konnten Dolche töten. Sein – ihr Traum vom Reich dieser Erde ist unsterblich. Ist Vermächtnis. Sie wird für dieses Erbe leben und es verwirklichen. Kein Jauchzen ist mehr in diesem Gedanken, kein Brausen und Sturm der Liebe und Einigkeit. Als kalte, heilige Pflicht ist er erstanden aus den Trümmern ihrer Liebe und ihres Daseins.
Marc Anton ist der Herr Roms geworden. Er ist einer der Konsuln dieses Jahres. Der Konsul. Er war Cäsars Intimus, seine rechte Hand, obwohl er ihm nie recht traute. Er hat den Staatsschatz, alle Schriften und Papiere Cäsars an sich gerafft, in sein Haus geschafft. Er hat sich zu Cäsars Willensvollstrecker aufgeschwungen. Er muß Cäsars einzigem Sohne das Erbe aushändigen, ihr, der Mutter, überantworten. Es muß ein Testament vorhanden sein. Oft hat sie mit Cäsar darüber gesprochen. Es muß ein Testament vorhanden sein, das Cäsarion zum Alleinerben aller Macht Cäsars bestimmt. In ihm wird sie den Gedanken des Weltreichs lebendig erhalten, bis er erwachsen ist. Cäsars Erbe wird ihr Reich Ägypten gegen Rom schützen und schirmen.
Sie läßt anspannen. Kleidet sich voll Sorgfalt. Sie kennt Marc Anton, doch nur sehr flüchtig. Wer galt ihr als Mann neben Cäsar! Nur in kurzen Räuschen der Schwäche war sie ihm im Begehren untreu. Sie will Eindruck machen auf den neuen Herrn Roms. Voll Kummer sieht sie im Spiegel, wie elend, wie schmal und unscheinbar sie geworden ist. Sie wird keinen Eindruck auf diesen Mann machen.
Dann nicht! Sie hat etwas, das fast so stark ist wie Frauenschönheit und Verführung. Sie hat das Recht in ihrer Hand. Das Recht, das Cäsars Sohn gebührt. Sie fährt dicht verschleiert und schwarz umflort zu Marc Anton.
VII.
Vor dem Hause Marc Antons ist Hochbetrieb.
Eigentlich ist es nicht das Haus des Marcus Antonius. Es gehört den Erben des großen Pompejus, den sie in Ägypten hinterrücks ermordet haben, der Bruder der Kleopatra und seine Eunuchen. Er hat den feigen Mord mit dem Leben gebüßt.