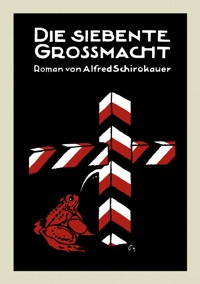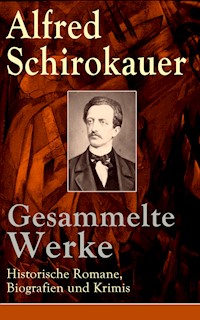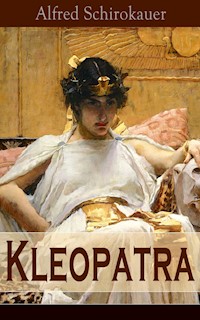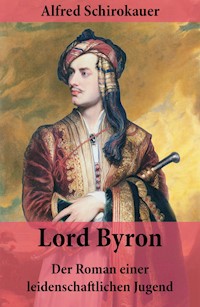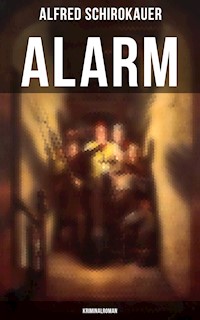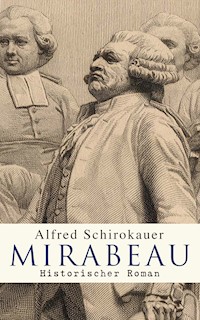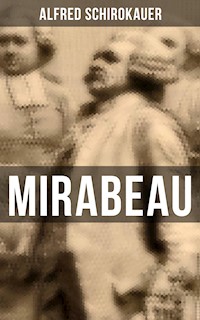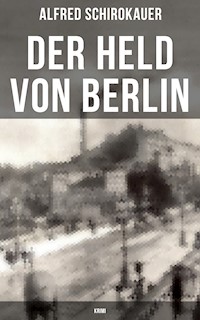
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In 'Der Held von Berlin: Krimi' von Alfred Schirokauer taucht der Leser ein in die düstere Welt des Berliner Verbrechens. Der Autor präsentiert einen fesselnden Krimi, der von mysteriösen Geheimnissen, unerwarteten Wendungen und einer packenden Handlung geprägt ist. Schirokauers Schreibstil ist präzise und detailreich, er schafft es, die Spannung von Anfang bis Ende aufrechtzuerhalten. Das Buch ist in der Kriminalliteratur einzigartig und hebt sich durch seine meisterhafte Erzählweise von anderen Werken des Genres ab. Er entwirft ein Bild von Berlin, das nicht nur als Hintergrund, sondern als integraler Bestandteil der Handlung dient. Der Kampf zwischen Gut und Böse wird in diesem Buch auf eine ganz neue Ebene gebracht, und der Leser wird bis zur letzten Seite in seinen Bann gezogen. Alfred Schirokauer, ein angesehener Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, komplexe Charaktere und packende Plots zu entwickeln. Seine Liebe zur Kriminalliteratur und sein tiefgreifendes Verständnis für die menschliche Natur spiegeln sich in 'Der Held von Berlin' wider. Schirokauer wurde inspiriert, dieses Buch zu schreiben, um die Leser mit einem packenden Thriller zu unterhalten und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen. Als Meister seines Fachs versteht er es, den Leser mit unerwarteten Wendungen zu überraschen und eine Atmosphäre der Spannung aufzubauen. 'Der Held von Berlin: Krimi' ist ein Muss für alle Liebhaber von spannender und intelligenter Kriminalliteratur. Dieses Buch bietet nicht nur eine mitreißende Geschichte, sondern auch tiefgründige Einblicke in die Abgründe der menschlichen Seele. Schirokauer hat ein Werk geschaffen, das sowohl unterhaltsam als auch anspruchsvoll ist und den Leser von der ersten bis zur letzten Seite fesselt. Tauchen Sie ein in die Welt von Alfred Schirokauer und erleben Sie einen atemberaubenden Kriminalroman, der Sie nicht mehr loslassen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Held von Berlin: Krimi
Books
Inhaltsverzeichnis
1
Die Probe des »Columbus« floss heute fehlerlos dahin. Die Soli, die Chöre, die Tänze, alles sass. Majestätisch strömte die prunkhafte, in leidenschaftlichen Szenen oft zu echt menschlichem Geschehen gestaltete Opernrevue dahin. Das Finale des zweiten Aktes setzte ein.
Der beglückende Sopran der Königin Isabella stieg wie eine weisse funkelnde Rakete empor. Der weiche Alt der Donna Felipa, des klagenden Weibes des Columbus, fing die niederrieselnden Silbersterne dieser Stimme auf und schwebte tragisch umflort über dem Abschiedsbilde. Dann strahlte der Tenor des Columbus auf.
Alles lauschte ergriffen. Zum ersten Mal entfaltete Henry Bara auf der Probe voll diese schönste Stimme, die auf Opernbühnen erklang, seit Caruso schwieg. Sofort riss er alle in die Gewalt dieses Brio. Bis zum letzten Bühnenarbeiter empfand jeder die Heiligkeit dieser begnadeten Töne.
Da – mitten hinein in die letzte Strophe des Liedes von Triumph und Ausfahrt, brüllte eine Reibeisenstimme aus der dunklen Tiefe des Zuschauerraumes: »Halt! Aufhören!«
Bara brach jäh ab und blickte verdutzt und empört auf den Störer. Der Kapellmeister, der Komponist der Opernrevue, – es war sein geniales Erstlingswerk – klopfte ab. Die Instrumente schwiegen abrupt. Eine Flöte tönte quiekend nach.
Im Zuschauerraum schlug ein gepolsterter Sitz wattig gedämpft empor. Die kleine, gedrungene Gestalt des Direktors polterte aus dem Parkett, hastete durch die schummrige Düsternis und eilte über den Holzsteg, der Zuschauerraum und Proszenium verkettete, hinauf zur Bühne. Jetzt stand Fritz Buchner, der Direktor, zwischen den Probenden.
»Das Abschiedslied ist viel zu lang! Viel zu lang!« stiess er hervor. »Das Publikum wird unruhig.«
Dann wandte er sich an den Kapellmeister, dessen junge vergeistigte Züge in dem matten Widerschein der abgeblendeten Pultlampe gespenstig scharf hervortraten, und rief: »Die zwei letzten Strophen werden gestrichen!«
Der Komponist hob das Gesicht zur Bühne empor, nickte traurig und ergeben und griff zu dem langen Blaustift, der schon viele klaffende schmerzvolle Wunden in seine Schöpfung gerissen hatte.
Da erklang wieder die Stimme des grossen Sängers. Aber sie hatte jetzt nichts von ihrem metallisch bezaubernden Schmelz. Sie klang wie eine gewöhnliche irdische, böse Stimme.
»Die beiden Strophen werden nicht gestrichen,« widersprach Bara sehr bestimmt. »Es ist die einzige Stelle in der ganzen Revue, in der ich meine stimmlichen Mittel endlich mal entfalten kann.«
Der Direktor blickte steil zu der hohen Gestalt Baras empor. Er hatte schon manches während der Proben von diesem verwöhnten Tenor erduldet. Das Mass war voll. Mühsam beherrschte er noch sein cholerisches Temperament.
»Aber liebster Herr Bara,« plädierte er und räkelte nervös die Schultern, »das Lied ist zu lang, sage ich Ihnen. Das Publikum wird kribbelig.«
»Das Publikum pflegt nicht kribbelig zu werden, wenn ich singe,« entgegnete Bara arrogant.
Da kochte Buchner über.
»In diesem Theater bestimme ich,« barst er los. »Ich führe die Regie. Ich muss Sie dringend ersuchen, sich meiner Anordnung zu fügen.«
»Und ich muss Sie dringend ersuchen, mit mir in einem angemessenen Ton zu reden,« brauste auch jetzt Bara auf.
Da trat Fatma Nansen, die Altistin, zu dem Sänger. Das Licht auf der Bühne war gedämpft und mild. Nur hoch oben am Schnürboden brannte eine Lampe. Dieses Halbdunkel hüllte gütig einen Schleier über die Jahre und tiefen bösen Runen in Fatma Nansens Gesicht. In dieser gnädigen Beleuchtung war sie rührend schön, und die Zerstörung schwand, die eine lange Bühnenlaufbahn und viel Leid ihrer Leidenschaft in ihre Züge gegraben hatte.
Leise flüsterte sie Bara zu: »Mach keine Szene, Liebster. Der Mann hat recht.«
Dabei legte sie begütigend und beschwörend die Hand auf seinen Arm.
Brüsk schüttelte Bara sie ab und schrie brutal: »Lass mich in Ruh! Ich weiss allein, was ich zu tun hab.«
Es war, als hätte er die Frau ins Gesicht geschlagen. Jeder Chorist und jeder Beleuchter wusste, dass sie Baras Geliebte, wusste, dass sie ihm von Amerika nach Berlin gefolgt war, dass sie für eine, an ihrem Ruhm gemessene, lächerliche Gage die Rolle der Donna Felipa übernommen hatte, um in seiner Nähe zu sein. Alles dies wusste der Kulissenklatsch. Und sie wusste, dass alle ihre Stellung zu Bara kannten. Darum fällte sie diese rohe öffentliche Zurückweisung. Trotz der fahlen Beleuchtung sah jeder, wie sie erbleichte und ihre Gestalt zusammensank. Ihre Schultern sanken wie gebrochene Flügel. Sie wich zurück. Da trat Jo Ternitz, die Sopranistin, zu ihr.
Jo war nicht schön. Aber selbst in diesem Dämmer der Bühne schien es, als würde sie von einem Scheinwerfer bestrahlt. So sah sie immer aus. So hell. So von innen beleuchtet. So in den Mittelpunkt gerückt. So kontrastreich hell und dunkel war ihr rassiges Gesicht.
Es waren eigentlich nur wenige Linien: feine Brauen – echte, grosse längliche blaue Augen, eine starke charaktervolle Nase, ein grosser Mund mit prachtvollen Zähnen, ein festes, energisches Kinn. Braune Haare als Rahmen.
Sie trat dicht hinter Fatma Nansen und strich mit einer scheuen kindlichen Bewegung über den Rücken der Kollegin. Sie fühlte, wie das Fleisch unter dem Kleid zitterte. Sie wollte ihr nur zeigen, dass sie bei ihr stand, wollte sie trösten und kameradschaftlich besänftigen.
Doch ihre Zärtlichkeit nahm Fatma die letzte Beherrschung. Sie litt im Geheimen schon lange. Jetzt hatte Bara den letzten Schein zertrümmert. Unter vier Augen behandelte er sie seit Tagen mit der Rücksichtslosigkeit, die er heute vor allen offenbart hatte. Seitdem sie in Berlin waren, hatte er sich geändert. Sie ahnte und witterte die fremde Frau.
Inzwischen hatte der Disput zwischen Buchner und Bara weitergebrannt.
»Ich bin nicht von Amerika nach Berlin gekommen, um mich in einer lächerlichen Rolle zu blamieren,« schnaubte der Tenor.
Noch ein Mal versuchte Buchner einzulenken. »Aber lieber Herr Bara, auf die zwei Strophen kommt’s doch nicht an. Sie haben die ganze Revue. Sie kommen überhaupt nicht von der Bühne.«
»Ich bestehe auf den drei Strophen meines Abschiedsliedes,« beharrte der Sänger mit unverschämter Heftigkeit.
Sensationsgierig verfolgte alles den Streit der beiden Männer. Buchner fühlte, dass seine Autorität auf dem Spiel stand. Er riss sich so weit empor, als sein kleiner drahtiger Körper es gestattete, und schäumte: »In diesem Hause befehle ich. Sonst keiner. Verstanden! Sie haben zu singen und die Gage einzustreichen. Weiter nichts.«
Da spielte Bara grosses Theater. Er machte es kläglich. Seine schauspielerische Begabung war gleich null. Er war ein miserabler Mime. Doch man vergass seine darstellerischen Mängel über dem Zauber seiner Stimme.
Er packte die Rolle und warf sie mit einer gewaltigen Geste dem Direktor vor die Füsse. Dabei rief er: »Sie scheinen nicht zu wissen, wie man mit Künstlern meines Ranges umgeht, Herr. Lassen Sie Ihre kastrierte Rolle von Herrn Müller oder Herrn Schulze singen. Ich bin solche Anremplung Gott sei Dank nicht gewöhnt und lasse sie mir nicht bieten.«
Dann wandte er sich grossartig auf dem Absatz um und schritt in einer Haltung, die er für imponierend hielt, in die Kulisse.
Im Bühnen- und Zuschauerraum vereiste alles Leben. Eine Erstarrung folgte dem turbulenten Abgang. Buchner stierte mehr perplex als ergrimmt dem Enteilenden nach.
Da geschah es. Da geschah etwas unerwartetes. Peter Heise stürmte aus der Rotte des Chores hervor, platzte auf den verblüfften Buchner los und keuchte zwischen Zähnen, die vor Erregung klirrten:
»Herr Direktor, geben Sie mir die Rolle! Ich kann sie Wort für Wort, Ton für Ton. Ich hab sie studiert, die Nächte hindurch. Ich will es Ihnen beweisen. Kapellmeister, spielen Sie das Abschiedslied.«
Und ohne auf die Begleitung zu warten, begann Peter Heise, das unscheinbare, kaum je beachtete Mitglied des Chores, das Abschiedslied des Columbus zu singen, das für Henry Bara, den grossen Tenor der Metropolitan Opera, komponiert worden war.
Es war nicht die kultivierte, vornehm geschulte und liebevoll gepflegte Stimme Baras. Aber es war ein Tenor, durchzittert von einem erquickenden Hauch von Natürlichkeit, durchpulst von Leben und warmem Blut. Aus Baras Kehle hatte dieses Abschiedslied des grossen Genuesen geklungen wie ein altspanisches Chanson. In Peter Heises Mund wurde es zu einem deutschen Volkslied.
Doch keiner hörte und empfand dieses Gottesgnadentum, das wie ein reiner, fortreissender Gebirgsbach diesem Mann aus dem Herzen drang. Die taufrische Stimme drang nicht hindurch durch die dicken Nebelschwaden der Voreingenommenheit, der Gewöhnung, der Abwehr und der Lächerlichkeit. Die Stimme zerschellte an der stählernen Umpanzerung des Vorurteils, schlug nicht hindurch bis in die Sinne dieser verblüfften Theatermenschen.
Was? dieser kleine Chorist wagte nach der Solorolle der Opernrevue zu greifen! Er hatte den unverfrorenen Wahnwitz, für Bara einzuspringen, für den berühmtesten lebenden Tenor, den Empfänger einer sagenhaften Gage, über deren Höhe sich die Zeitungen in phantastischen Vermutungen stritten! Der Kerl war ja vollständig übergeschnappt.
Alles bog sich vor Lachen. Buchner lachte, der Chor lachte, das Orchester lachte, der letzte Beleuchter lachte, Fatma lächelte, trotz ihres Kummers, nur Jo Ternitz lachte nicht. Sie liebte fast schon den kleinen Choristen.
Die Bühne war plötzlich von einer höhnenden Heiterkeit überflutet. Die vielen Gänge der Hinterbühne spieen die Spötter aus. Alles strömte herbei, diesen vermessenen Komiker wider Willen zu hören. In diesem Orkan des Gelächters ertrank die Stimme Peter Heises.
Doch den Sänger traf der ätzende Hohn der Kollegen nicht. Er hörte und sah ihn nicht. Er war nicht mehr von dieser Welt. Er war entrückt zu den Höhen seiner Lebenssehnsucht.
Er wollte hinauf. Endlich. Er wollte die Rolle erobern. Er wollte beweisen, dass er sie zu tragen vermochte. Seit Wochen, seit Monaten, ja, seit Jahren hatte er auf diesen Augenblick gewartet, für ihn gelitten und gedarbt und ihn mit einer monomanen Inbrunst und Gewissheit erharrt. Er wusste seit dem Tage, an dem er aus dem Fischerboot, aus dem kleinen friesischen Dorf auf Sylt durchgebrannt war und sich mit der unhemmbaren Verve des Genies der Bühne entgegengeschleudert hatte, dass er zum Sänger grössten Formats, zu höchstem Opernruhm vom Schicksal erkoren war. Wusste es, wie jeder es glaubte, der geblendet der Fata Morgana der Bühnenlaufbahn zujagt. Nur verbissener, besessener, phantastischer und berechtigter wusste er es, war von seiner Berufung durchglüht in der Esse seiner niederdeutschen starrnackigen Zähigkeit.
Nie in all den Jahren des erbitterten Kampfes um Bildung und Schulung der Stimme, nie in dieser harten Zeit der Erfolglosigkeit, der kläglichen Arbeit um das tägliche Brot, hatte er den Mut verloren, nie den Glauben an sich und seine titanische Zukunft. Er hatte das verwunschene Leben im Chor, in der Erniedrigung, in der Verpuppung ertragen in der steten, nie beirrten Zuversicht, dass eines Tages, urplötzlich, vom Himmel her seine Gelegenheit, seine grosse Chance, die Entzauberung auf ihn niederstürzen würde.
Daher überraschte sie ihn heute nicht. Er war auf sie vorbereitet, immer, zu jeder Stunde. Immer studierte er mit schonungsloser Energie die männliche Hauptrolle jeder Revue, jeder Operette, jeder Oper, in der neu er an seinem bescheidenen Schattenplatz mitwirkte. Seine Lebensdevise lautete: bereit sein für den gewaltigen Augenblick, der ihn emportragen würde.
Und darum berührte ihn der gassenbübische Hohn und Spott der Kollegen, der Bühnenarbeiter, aller dieser Leute vom Bau nicht, durchstach nicht die schirmende Rüstung seiner naiven nachtwandlerischen Selbsteinschätzung. Nur ein Ziel sah er in diesem kritischsten aller Momente: den Direktor zu packen, zu überzeugen, zu bezwingen.
Und das Wunder aller Wunder geschah. Zwar nur als perfide List. Doch davon wusste Peter Heises ehrliches Fischergemüt nichts. Er durchschaute die Tücke des Direktors nicht. Er sah nur die Tatsache, dass der Direktor ihm ein Zeichen gab, innezuhalten, ihn gedankenvoll ansah – Buchner war einst ein berückender Schauspieler gewesen und hatte, trotz seiner kleinen Gestalt, die grössten Rollen gespielt zum Ruhme des Brahmschen Ensembles – und dann laut und eindringlich die Worte sprach, die Heise aus einem Nichts zu einem König der Bretter, zu einem Gott erhoben:
»Garnicht übel, mein Gutester, famos, mein Lieber. Ihre Stimme ist sehr passabel – !«
Der Direktor hatte Heise kaum beachtet. In ihm zitterte angstvolle Sorge. Was sollte aus der Revue werden, wenn Bara wirklich die Rolle hinschmiss? Er sah und hörte den kleinen Gernegross und überspannten Rollenmarder da vor sich ohne Verwunderung. Er hatte zu lange Kulissendunst geatmet, um über eine Schauspielermanie zu staunen. Er dachte nur voll Bangen an die Gewaltreklame, die er mit Baras Namen gemacht hatte, an die verlorenen Kosten und an seine gefährdete Revue. Und sah sehr deutlich, dass der grosse Sänger auf seinem heroischen Rückzug in der Seitensoffitte Halt gemacht hatte, als dieser stupide Chorist ihn mit seiner Irrsinnsbitte ansprang und argwöhnisch lauschte, als er zu singen begann.
Da durchblitzte den mit allen Wassern gewaschene Berliner Bühnenleiter ein kühner Gedanke. Hier half nur ein verwegener Coup. Diesen hochnäsigen Gesellen, den Bara, bei seiner stärksten Begabung packen, bei seiner Eitelkeit. Er riskierte es. Er strich sich das glattrasierte Kinn, dass es kratzig schabte in die erwartungsheisse Stille, und sagte nachdenklich:
»Haben eine ausgezeichnete Stimme, mein Lieber. Sind mir schon lange im Chor aufgefallen.«
In Wahrheit sah er den Friesen heute zum ersten Mal bewusst auf seiner Bühne. »Kommen Sie mit ins Büro. Wir wollen die Sache besprechen.«
Und zur Allgemeinheit gewandt, rief er: »Die Probe ist auf fünf Minuten unterbrochen. Keiner rührt sich von seinem Platz.«
Da griff das Wunder auf die andern über. Der feixende Hohn wandelte sich in bestürzten Neid, in fassungslose Achtung. Sollte dieser Chorist, dieser Mensch der Masse, dem nie die kleinste Solopartie anvertraut worden war, wirklich mit einem Riesen-Saltomortale die tragende Rolle, die Rolle des Prominentesten unter den Prominenten, die Bombenrolle Baras erobern?!
Jo Ternitz strahlte jetzt, als wäre sie selbst ein Scheinwerfer. Heise hatte das Gefühl, ihn hebe eine Hiesenfaust von den Brettern und trage ihn durch die Luft. Die Bühne, die Kollegen, die Sänger, die Arbeiter, alles wirbelte in einem Schneeflockengemengsel vor seinen Augen. In diesem Chaos gab es nur einen ruhenden Pol, an dem sein schwindelndes Bewusstsein sich festsaugte: die kleine gedrungene Gestalt des Direktors, die vor ihm herschritt, wie die leitende Feuersäule vor den aus Ägypten ziehenden Hebräern. Die Kniekehlen waren weich und drohten unter ihm fortzusacken. Er wagte nicht, nach rechts noch links zu blicken, hielt die Augen starr gebannt auf den Rücken Buchners, aus Furcht, von der Gewalt seines Glückes, von der Macht des sausenden Überschwanges in seiner Brust, von seinem unbegreiflichen Erfolg hingemäht zu werden.
Da zerstob der Hexensabbat. Da geschah etwas Furchtbares.
Langsam schritt der grosse Tenor über die Bühne.
»Buchner!« rief diese vergötterte, hochgebenedeite Stimme.
Der Direktor blieb kurz vor der Bühnenwand stehen. Das Herz setzte dem gerissenen Va-banque Spieler aus vor Entspannung. Schon hatte er seinen gewagten Coup verloren gegeben. Doch keine Linie zuckte in dem ledernen, mageren Schauspielergesicht. So hart bändigte er die Freude, die ihm die Brust auseinandersprengt.
Der Sänger versuchte ein schalkhaftes Lächeln. Es misslang, wie ihm fast jedes Mienenspiel verunglückte.
»Sie haben für einen Revue-Direktor verdammt wenig Humor,« suchte Bara zu scherzen. »Ich habe doch nur Spass gemacht, Natürlich singe ich die Rolle.«
Bara war unter Alltagsverhältnissen kein rascher Denker. Doch er hatte sofort erkannt, dass hier aussergewöhnliche Dinge geschahen. Kopfüber war er in Buchners List hineingepurzelt. In törichtem Entsetzen hatte er gesehen, wie rasch und gleichmütig der Direktor über seine Absage zur Tagesordnung überging. Er hatte den naturnahen, echten Klang in der Stimme des kleinen Choristen sehr wohl vernommen. Er hatte mit den tausend Ohren des eifersüchtigen Nebenbuhlers gelauscht. Selbstverständlich stand diese Stimme klaftertief unter seinem illustren Organ. Kein Adel. Keine souveräne Tonbildung. Aber diese Direktoren! Er wusste längst, dass sie von Stimme so viel verstehen, wie der Ochs vom Seiltanzen. Wer konnte wissen! Durfte er einen Kontraktbruch, einen Skandal riskieren? Ein sensationeller Krach schadete auch dem berühmtesten Namen. Und morgen war Gagentag! Natürlich würde Buchner für die verflossene Zeit nicht einen roten Heller bluten. Nein, nein, lieber klein beigeben. Den Zorn vertagen. Der Tag der Heimzahlung und Rache würde schon noch kommen, ein ander Mal, wenn er alle Trümpfe in der Hand hatte. Er würde sie ausspielen! Aber heute? Sich von diesem Nichts da ausstechen lassen. Das hiess, seine Karriere einfältig gefährden. Wenn der Kerl Erfolg hatte! Dem Publikum war alles zuzutrauen. Es wiehert oft der notorischen Impotenz zu. Dann war er eledigt. Dann hiess es unausweichlich: den Bara kann jeder Chorist ersetzen. Nein, nein. Heute klein beigeben. Die Revanche für eine günstigere Gelegenheit aufsparen. Und darum versuchte er mit seinen unzulänglichen Mimischen Mitteln das überlegen schelmische Lächeln.
»Ich habe gewusst, dass Sie nur scherzen, mein lieber Bara,« log Buchner dreist, »und bin auf Ihren Scherz eingegangen, um Ihnen die Laune nicht zu verderben. Also weiter!« rief er in das Orchester hinab. »Zwei Strophen streichen. Dann nochmal das Finale von Anfang!«
Damit kletterte er wieder in den Zuschauerraum hinab. Das Intermezzo war vorüber.
Peter Heise sank zurück in die dunkle Anonymität des Chores.
2
Das Ensemble des »Columbus« war, wie alle Spielgemeinschaften Berlins, nur zur Aufführung dieser Opernrevue zusammengestellt worden. Aus allen Ecken und Enden der Berliner Theaterwelt waren die Mitglieder herangezogen worden, waren einander bis auf die wenigen Solodarsteller, die schon früher miteinander gespielt hatten, unbekannt und fremd und ein wenig verdächtig.
Jetzt aber kannten plötzlich alle Peter Heise. Er war in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Er war zur komischen Figur dieser Theatergemeinde geworden. Hätte er Erfolg gehabt, wäre er mit seiner verwegenen Tat durchgedrungen, so wäre er der Held des Tages und dieses Theaters gewesen. Alle hätten sich in Staunen und Neid vor ihm gebeugt, und neue verführerisch lockende Mythen über die sagenhaften Möglichkeiten der Bühnenlaufbahn wären aufgesprungen. Neue Schwärme von Gläubigen und Betörten wären dem Sirenengesang von dem märchenhaften Glück gefolgt, das in dieser Flitterweit blühe.
Doch Märchen geschehen nicht in dieser realsten aller Welten. Und Peter Heise wurde nicht der Held dieser Bühne, sondern ihr Clown.
In den Pausen der Probe wurde er von den Kollegen weidlich verhöhnt und gehänselt. Doch der Spott prallte wirkungslos an ihn ab. Er war eine völlig in sich verkapselte Natur, die nach aussen geringe Angriffsflächen bot. Auch war er heute viel zu sehr mit seinem Erfolg beschäftigt.
Ja, er glaubte an einen Erfolg. Er, wie Bara, waren die einzigen, die von der argen List Buchners dupiert worden waren. Anfangs hatten wohl auch die Andern minutenlang an den Ernst des Direktors geglaubt. Doch als der grosse Tenor prompt auf die schlaue Finte hereingefallen war, begriffen alle – ausser den beiden Hauptbeteiligten – den Schauspielertrick Buchners.
Heise war heilig davon durchglüht, dass sein Gesang dem Direktor gefallen hatte und dass er die Rolle erhalten hätte, wenn Bara nicht im letzten Augenblick zu Kreuz gekrochen wäre. Es war für ihn eine niederschmetternde Enttäuschung, aber zugleich doch auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass er alle diese Jahre nicht einem phantastischen Ziele zugestrebt hatte. Er hätte doch die Rolle erhalten, wenn – –, ja, wenn – – –!
Er hegte gegen Bara keinen Groll und keinen Hass. Er war ein grosser und neidloser Mensch und viel zu sehr Künstler, um die Kunst Baras nicht demütig zu verehren und sein Recht auf die Rolle des »Columbus« nicht zu achten. Aber der Auftritt hatte ihm, bei aller Enttäuschung, doch neuen Mut und neue Kraft zum Durchhalten gegeben. Und darum prallte jeder Hohn und jeder Spott wirkungslos an ihm ab.
Die Probe war zu Ende. Am Bühnenausgang sprach Jo Ternitz Heise an. Es fiel ihm nicht auf. Sie hatte auf ihn gewartet. Er hatte – vom ersten Tage an – ihre Teilnahme gewonnen. Sein schmales, klares, kantiges Gesicht hatte etwas ihrem Wesen Verwandtes. Es gefiel ihr. Es lockte sie zu weiterer Entdeckung.
Seine stämmige, schlaksige Gestalt entsprach irgendwie dem Urbild des Männlichen, das sie in ihrem Gemüt trug. Seine Stimme, die aus dem Chaos des Chors herausdrang, war ihr schon bei der ersten Probe aufgefallen. Sie hatte gerade vor Heise gestanden, zufällig. Da brach dieser starke volkstümliche Tenor hinterrücks über sie her wie eine Woge. Sie wandte sich überrascht um und sah ihn zum ersten Mal. Von da an sah und hörte sie ihn immer wieder. Seine Stimme, sein Gesicht, seine Figur, seine Persönlichkeit, sein Wesen, von dem sie so gut wie nichts wusste, übten auf sie eine bannende Gewalt. Alles sprach in einer neuen, nie erlebten Art zu ihren Sinnen. Dieser grosse kleine Chorist mit dem sandfarbenen wüsten Haarschopf und dem schäbigen Anzug war der erste Mann, der Jo Ternitz erregte und in seinen mystischen Lebenskreis sog.
Sie war ein verwöhntes Kind des Glücks, stammte aus sehr gutem Hause, – ihr Vater war ein bayrischer General – und hatte fast mühelos ihren steilen Weg gemacht. Aus dem Unterricht einer abgedankten berühmten Sängerin war sie ins Engagement nach Stuttgart gekommen. Nach zwei Jahren bewarb sich Dresden um ihren berückenden Sopran. Von dort hatte Buchner sie für die Rolle der »Isabella« nach Berlin geholt.
Es war alles von selbst, ohne Anstrengung, ohne Enttäuschung, scheinbar ganz selbstverständlich verlaufen. Nicht ohne angestrengteste Arbeit an sich und ihrer Stimme. Nicht ohne unermüdlichen Fleiss. Aber doch ohne Demütigung, ohne verzagtes demütigendes Warten, ohne Herz und Nerven zermürbendes Hoffen.
Viele Männer waren Jo Ternitz begegnet. Kollegen und sogenannte Mäzene und Verehrer ihrer Kunst. Keiner hatte Eindruck auf sie gemacht. Mit ihrer liebenswürdigen Sicherheit hatte sie jede Bewerbung um ihre Liebe oder ihre Hand abgewiesen. An diesem unbedeutenden, abgerissenen Choristen Peter Heise erfüllte sich, ihr noch unbewusst, ihr Geschick. An seiner in sich gekehrten, knorrigen Männlichkeit erwachte ihr Frauengemüt.
Nie zuvor hatten sie miteinander gesprochen. Er war zu erfüllt von sich und seinem Ehrgeiz, um sie zu bemerken. Zu besessen von seinem Drange hinauf, um seine Augen auf eine Frau zu richten. Zu beschäftigt, sich fortzubilden und zu vervollkommnen, musikalisch und wissenschaftlich, um Zeit für Abenteuer zu erübrigen.
Heute wartete sie auf ihn. Als er herauskam, sprach sie ihn an:
»Ich hätte gern einmal mit Ihnen gesprochen, Herr – – wie heissen Sie eingentlich?«
Er blickte sie überrascht an.
»Heise,« sagte er zurückhaltend und blieb stehen.
Aus dem Bühnenausgang schwärmte das Personal hervor. Neugierig erstaunte Blicke umtasteten die bekannte Sängerin und den komischen Choristen.
»Wir wollen gehen,« schlug sie vor.
Sie gingen an der Spree entlang auf das Reichstagsgebäude zu. Ein ungleiches Paar. Sie war gross, aber sie reichte ihm nur bis an die Schultern. Sie war elegant, er armselig und dürftig. Sie war modern und schick, trug einen Tigerpelz mit einem weichen braunen Waschbärkragen und ein kleines braunes Hütchen, sah forsch und sportlich aus. Er trug, trotz der Kälte, einen fadenscheinigen, dünnen Sommerrnantel, – ein wenig ausgewachsen schien er ihrem mitleidigen Blick – und einen überalterten, zerschundenen, weichen Hut. Er war nicht der passende Begleiter für eine mondäne junge Dame.
Aber das sah sie nicht. Sie sah nur traurigen Gemütes, dass er fror. Stumm gingen sie eine Weile nebeneinander her. Das von einem Eishauch übersponnen gefrorne Wasser der Spree dampfte. Dann eröffnete sie das Gespräch.
»Das war ja ein tollkühner Streich von Ihnen! Aber er hat irgendwie zu Ihnen gehört.«
»Wieso?« fragte er misstrauisch. Was wollte das Mädchen von ihm.
»So,« entgegnete sie munter. »Ich hatte den Eindruck, dass –« sie suchte das Wort und fand es, »dass Kühnheit zu Ihnen passt.«
Er antwortete nicht. Plötzlich schoss aus ihm die Frage hervor:
»Wie hat Ihnen meine Stimme gefallen? Aber ganz ehrlich! Sie verstehen etwas davon. Wer seine Kehle beherrscht wie Sie – Sie singen wie – – wie man sich im Traum vorstellt, dass eine Frau singen muss.«
»Sie sind sehr liebenswürdig,« lächelte sie mit einer ganz leisen Ironie.
»Nein, garnicht, ich sage immer nur, was ich meine.«
»Ich auch.«
»Also, durfte ich mich nach Bara hören lassen?«
Sie sah zu ihm auf, sah seine hellen, grauen Augen mit einer brennenden Erwartung auf sich gerichtet.
»So gut wie Bara war es nicht,« bekannte sie dann ehrlich.
»Das weiss ich,« erwiderte er tapfer. Doch seine Stimme war heiser und belegt. Sein Kinn vergrub sich in dem hochgeschlagenen Mantelkragen. Da fuhr sie hastig fort:
»Aber lieber Kollege, bedenken Sie, Bara ist der grösste lebende Sänger.«
»Weiss ich.«
Es klang so mutlos, dass sie heftig erwiderte:
»Erlauben Sie mal, man muss sein Ziel nicht gleich in die Wolken stecken.«
»Doch,« beharrte er, »ganz hoch muss man es sich stecken. Zu den höchsten Möglichkeiten. – – Es hat Ihnen also nicht gefallen?«
»Fallen Sie nicht von einem Extrem ins andere,« mahnte sie vorwurfsvoll. »Sehr hat es mir gefallen. Ganz hervorragend hat es mir gefallen. Deshalb habe ich Sie doch angesprochen. Ist es Ihnen noch garnicht aufgefallen, dass ich Sie angesprochen habe? Oder glauben Sie, es ist meine Gewohnheit, jungen Männern aufzulauern?«
Er blickte unsicher von seiner Höhe zu ihr nieder. Sie sprach fort:
»Ihre Stimme ist anders – urwüchsiger, weniger parfümiert, wenn ich so sagen soll, als Baras. Sie haben ein wunderbares Material.«
Er blieb stehen.
»Ist das Ihre ehrliche Überzeugung?« Er ballte vor Erregung die Hände, dass die Knöchel weiss aus der blaugefrorenen Haut hervortraten.
»Ja,« sagte sie überlaut. Ihre blauen Augen brannten zu ihm empor. Wie St. Elmsfeuer, dachte er.
»Danke,« sagte er mit einem tiefen Seufzer der Beglückung. »Mehr wollte ich nicht wissen.«
»Aber ich möchte gern mehr wissen,« lachte sie, fasste ihn formlos am Arm und ging weiter.
»Was,« fragte er und folgte gefügig.
»Wie sind Sie zu diesem – sagen wir, etwas ungewöhnlichen Schritt gekommen?«
»Mich für die Rolle anzubieten?«
»Ja.«
»Erscheint Ihnen das so ungewöhnlich?«
»Ja. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Mann – einer, der – –«
»Sagen Sie es doch frei heraus, dass ein nichtiger Mensch aus dem Chor sich erdreistet, nach der ersten Rolle einer Oper zu greifen.«
»Ja, wenn Sie es so wollen.«
Da brach er aus: »Aber Fräulein Ternitz, darauf warte ich doch tagaus, tagein, seit Jahren.«
»Worauf?«
»Auf diese Gelegenheit.« Er sagte es so verbissen und zugleich so selbstverständlich, dass sie durch diese Worte tief in ihn hineinsah wie durch offene Fenster seiner Seele.
»Ach so,« nickte sie begreifend und kannte den ganzen Mann.
Er schwieg eine Weile, ehe er mit einer Leidenschaftlichkeit fortfuhr, die das Feuer verriet, das in ihm glomm.
»Ja, mein Gott, wie soll man denn hinaufkommen? Glauben Sie, ich will als Chorist enden? Sie verstehen das nicht. Sie sind in jungen Jahren hinaufgelangt. Sie sind eine der Wenigen, denen es leicht gelungen ist. Aber ich! Soll das alles umsonst sein, was hier drinnen an Können und Wollen lodert?« Er schlug sich heftig mit der Faust gegen die Brust. »Immer nur im Chor. Nie die kleinste Rolle. Immer nur die dicken Namen, immer nur die Prominenten werden dazu engagiert. Aber sagen Sie mir um alles in der Welt, wie soll man sich einen Namen schaffen, wenn man nie dran kommt?! Es ist, als wenn man gegen Mauern anrennt. Die Agenten lächeln und zucken die Achseln. Die Direktoren zucken die Achseln und lächeln, – wenn sie grade in guter Stimmung sind und einem nicht die Tür weisen. Wie soll man hinaufgelangen?«
Ein Schrei der Verzweiflung stieg in die kalte graue Februarluft. Jo schwieg beklommen. Sie wusste keinen Rat. Auch sie kannte die Künstlermisere, die sie nie persönlich erfahren hatte. Aber sie sah und hörte genug rings um sich herum, denn sie ging mit offenen Augen und hellhörigen Ohren und weit erschlossenem mitfühlenden Gemüt ihren leichten Weg empor.
Sie kamen zum Reichstag.
»Wollen wir noch ein Stück gehen?« fragte sie.
»Gern, ich habe Zeit.«