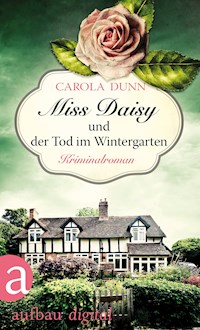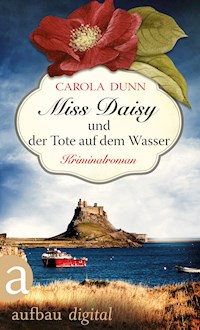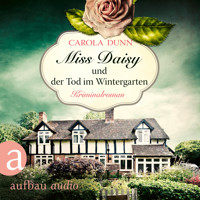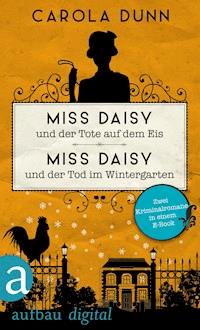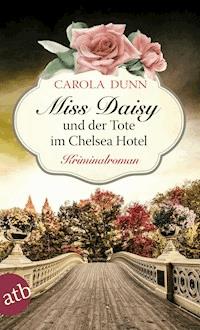
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miss Daisy ermittelt
- Sprache: Deutsch
Miss Daisy in New York. Daisy Dalrymple reist mit ihrem frischgebackenen Ehemann Alec Fletcher von Scotland Yard nach Amerika. Im berühmten Chelsea Hotel in New York freundet Daisy sich mit einigen skurrilen Hotelgästen an. Bei einem Treffen mit dem Herausgeber des Magazins, für das sie schreibt, hört sie plötzlich einen Schuss – ein Reporter ist tot, doch der Täter kann entkommen. Mit ihren neuen Freunden mischt Daisy sich in die Ermittlungen ein. Eine Spur zum Mörder führt sie quer durch das Amerika der Roaring Twenties. Ein Kriminalfall aus den Goldenen Zwanzigern voll skurriler Figuren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Über Carola Dunn
Carola Dunn wurde in England geboren und lebt heute in Eugene, Oregon. Sie veröffentlichte in den USA mehrere historische Romane, bevor sie die »Miss Daisy«-Serie zu schreiben begann.
Informationen zum Buch
Miss Daisy in New York.
Daisy Dalrymple reist mit ihrem frischgebackenen Ehemann Alec Fletcher von Scotland Yard nach Amerika. Im berühmten Chelsea Hotel in New York freundet Daisy sich mit einigen skurrilen Hotelgästen an. Bei einem Treffen mit dem Herausgeber des Magazins, für das sie schreibt, hört sie plötzlich einen Schuss – ein Reporter ist tot, doch der Täter kann entkommen. Mit ihren neuen Freunden mischt Daisy sich in die Ermittlungen ein. Eine Spur zum Mörder führt sie quer durch das Amerika der Roaring Twenties.
Ein Kriminalfall aus den Goldenen Zwanzigern voll skurriler Figuren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Carola Dunn
Miss Daisy und der Tote im Chelsea Hotel
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Eva Riekert
Inhaltsübersicht
Über Carola Dunn
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Impressum
Für alle Leser in Eugene, die mich seit Jahren fragen:
»Wann spielt denn mal ein Buch hier bei uns?«
Kapitel 1
Ärgerlich erhobene Stimmen: Als Daisy das Ende der Seite erreichte und das Klappern der Tasten ihrer Schreibmaschine aufhörte, drangen sie als undeutliches Geräusch in die plötzliche Stille durch die Wand aus dem Zimmer nebenan.
Es war nicht das erste Mal. Offensichtlich war ihr Zimmernachbar kein versöhnlicher Mensch. Diesmal waren es zwei Männer und eine Frau, da war sich Daisy ziemlich sicher, aber sosehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nichts verstehen. Ging sie ja auch nichts an, ermahnte sie sich und wendete sich wieder ihrer Arbeit zu.
Quietschend und unwillig gab die Remington zwei Bögen samt Kohlepapier frei. Daisy fächelte sich damit Luft zu. Da sie sich noch nicht an die Innentemperaturen gewöhnt hatte, die die New Yorker bevorzugten, und sie selbst mit prasselnden Kaminfeuern aufgewachsen war, durchmischt mit eisiger Zugluft, fand sie das Hotelzimmer erstickend heiß. Ihr Kampf mit dem störrischen Heizkörper war erfolgloser gewesen als der mit der Schreibmaschine, die sie vom Hotelmanagement zur Verfügung gestellt bekommen hatte.
Sehnsüchtig blickte sie zu den Balkonfenstern mit ihren verzierten Rosenholzrahmen, dann starrte sie ihre Schreibmaschine finster an. Das Chelsea Hotel war ein beliebter Zufluchtsort für Schriftsteller und auf ihre Bedürfnisse eingerichtet, doch die Remington pfiff auf dem letzten Loch. Daisy hatte den Verdacht, dass sie schon seit vierzig Jahren auf diesem Schreibtisch stand, nämlich seit 1883, als das Hotel erbaut worden war, und dass sie seitdem tagtäglich von mehr oder weniger geübten Fingern bearbeitet worden war. Sie knarrte und ächzte bei jeder Berührung und sperrte sich vehement gegen Großbuchstaben. Die Aussicht, den Kampf mit der garstigen Maschine erneut aufnehmen zu müssen, ließ sie in Schweiß ausbrechen.
Die Papierstapel neben der Schreibmaschine wurden immer höher. Mr. Thorwald hatte nur wenige Änderungen in ihrem Artikel über die Atlantiküberquerung gewünscht. Der Text war fertig getippt und konnte morgen abgeliefert werden. Mit dem Artikel über ihre ersten Eindrücke von Amerika kam sie gut voran. Sie hatte noch etwas Zeit.
Sie trat auf den Balkon. Die scharfe Kälte einer winterlichen Brise ließ sie frösteln. Der gelblich graue Himmel drohte Regen oder gar Schnee an, obwohl es noch nicht einmal ganz November war. Benzinschwaden, vermischt mit Staub, stiegen aus der West 23rd Street herauf, allerdings war der scharfe Geruch nach rußigem Kohlenrauch nicht so übermächtig wie im fernen London.
Daisy lehnte sich an das verschnörkelte gusseiserne Geländer und beobachtete eine Tram, die sieben Etagen unter ihr vorbeiratterte. Nicht eine Tram, eine Straßenbahn. Warum behaupteten die Amerikaner immer, sie würden Englisch sprechen, wo sie ihre Sprache doch genauso gut Amerikanisch hätten nennen können. Am seltsamsten war, dass ihr, einer Engländerin, die reinstes Oxfordenglisch sprach, immer gesagt wurde, sie habe einen drolligen Akzent!
Eine unmissverständlich amerikanische Stimme mischte sich in Daisys Überlegungen. Das Fenster des angrenzenden Zimmers stand einen Spalt offen. Die Stimme der Frau, die Daisy vorhin schon undeutlich gehört hatte, war jetzt glockenklar – nicht weich wie eine Kirchenglocke, nicht klingelnd wie die eines Pferdegeschirrs, sondern schriller als eine elektrische Hausklingel.
»Du Mistkerl!«, schrie sie giftig. »Nicht für eine Million Dollar würde ich zu dir zurückkommen.«
»Selbst wenn ich eine Million Dollar hätte«, erwiderte eine bissige männliche Stimme, eher sarkastisch als erzürnt, »würdest du keinen einzigen roten Heller aus mir herausquetschen.«
Ein anderer Mann sagte mit beruhigender, ziemlich nervöser Stimme etwas Unverständliches. Einen Augenblick später wurde eine Tür zugeschlagen.
Schuldbewusst gestand sich Daisy ein, dass nicht nur die überheizte Luft, sondern auch die Neugier sie nach draußen getrieben hatte. Rasch verschwand sie wieder in ihrem Zimmer. Hoffentlich hatte man nicht gesehen, wie sie vom Balkon aus gelauscht hatte. Da sie nicht herumsitzen und auf ein empörtes Klopfen an ihrer Tür warten wollte, beschloss sie, sich auf die Suche nach einer Tasse Tee zu machen. Schließlich war es schon nach vier Uhr. Die Prohibition hatte es mit sich gebracht, dass einige Amerikaner die Boston Tea Party inzwischen in anderem Licht sahen und fanden, dass sie die britische Sitte des Nachmittagstees durchaus übernehmen könnten. Es stimmte zwar, dass einige Amerikaner ohne die geringsten Schwierigkeiten an alkoholische Getränke kamen. Doch trotz seiner bohemehaften Gäste war das Chelsea ein respektables Etablissement, nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Speakeasys, wie man die illegalen Lokale hier nannte, in denen heimlich Alkohol ausgeschenkt wurde. Mit ein wenig Glück waren unten eine Kanne Tee und vielleicht sogar ein paar Kekse – Cookies, wie es hier hieß – zu haben.
Als sie bei den Fahrstühlen ankam, ging das äußere Gitter der übernächsten Kabine gerade rasselnd zu. Sie beeilte sich, doch als sie ankam, war das innere Gitter ebenfalls geschlossen, und die Kabine fuhr bereits den Schacht hinunter, unter lautem Rattern und Jammern des betagten Motors. Ein Hauch von Haarwasserduft, teurem Zigarrenrauch und noch teurerem Parfüm blieb zurück. Daisy sah die Oberseite der Livreemütze des Fahrstuhlführers und hinter ihm den Kopf eines Mannes mit schütterem Haar sowie einen scharlachroten Glockenhut mit weißen Reiherfedern.
»Zu spät!«, rief sie. »Mist!« Andererseits, wenn das das Paar gewesen war, das sich im Zimmer nebenan gestritten hatte, war sie ganz froh, nicht mit ihnen eingesperrt zu sein.
Sie ging zu dem anderen Fahrstuhl zurück und drückte auf den Knopf, um ihn anzufordern.
Ein junges Zimmermädchen kam mit einem Arm voller Handtücher aus der Wäschekammer am Ende des Ganges. »Da müssen Sie ganz schön lange warten, denke ich mal, Miss«, bemerkte sie mit starkem irischen Akzent. Ihr karottenfarbenes Haar und ihre Sommersprossen erinnerten Daisy an ihre Stieftochter Belinda. Unerwartet heftig überfiel sie eine Welle Heimweh.
Sie lächelte dem Mädchen zu, das wahrscheinlich genauso großes Heimweh hatte, aus weit verständlicherem Grund. »Ist dieser hier denn außer Betrieb?«, fragte sie.
»Der Liftboy ist so ein kleiner, wilder Teufelskerl, Miss. Um diese Zeit scharwenzelt er wahrscheinlich herum, statt seinen Pflichten nachzukommen.«
»Na ja, ich nehme an, dass gerade nicht viel los ist und dass es schrecklich langweilig ist, den ganzen Tag in diesem Käfig rauf- und runterzufahren.«
Das Mädchen strahlte sie an. »Es ist mein kleiner Bruder, Miss. Er hat seit sechs Uhr früh Dienst. Ja, das ist hart für so einen quicklebendigen Jungen, aber er muss ja seinen Unterhalt verdienen und hat Glück, ’ne Arbeit zu haben.«
»Ich verrate nichts«, versprach ihr Daisy. »Ich hab’s ja nicht direkt eilig. Vielleicht könnte ich auch die Treppe nehmen.«
»Lieber nicht, Miss, der Weg nach unten ist elend lang. Der zweite Lift kommt sicher gleich zurück, falls unser Kevin nicht doch noch auftaucht.«
Und tatsächlich, das Ächzen und Klappern von Seilen und Zahnrädern kündigte die bevorstehende Ankunft des geschmähten Kevin an. Daisy musste nur noch warten, bis sich die Kabine nach oben gekämpft hatte. Ein Mann kam den Gang entlang, um ebenfalls zu warten.
Das Zimmermädchen errötete, als es ihn sah, und verschwand eilig in der Wäschekammer.
Er wirkte kein bisschen wie ein Künstler. Er war so um die vierzig, trug einen hellgrauen Tweedanzug, einen schwarzen Homburg, in der einen Hand braune Lederhandschuhe und ein Aktenköfferchen in der anderen. Er war untersetzt, leicht o-beinig, und sein Gang war wichtigtuerisch. Er hatte das Kinn entschlossen vorgeschoben, und über seinem schmalen Schnurrbart saß eine lange Nase. Er sah Daisy so herausfordernd an, fast unverschämt, ja, zynisch abschätzig, dass sich ihr die Nackenhaare sträubten.
Sie fragte sich, ob er wohl der Mann von nebenan war, ob er sie auf dem Balkon gesehen hatte und ob sie womöglich rot wurde wie das irische Mädchen. Hoffentlich nicht. Erröten war so schrecklich viktorianisch. Sie warf ihm einen hochmütigen und vernichtenden Blick zu, der ihrer Mutter, der Dowager Viscountess Dalrymple alle Ehre gemacht hätte, aber da hatte sich der unverschämte Kerl bereits abgewandt.
Er drückte auf die Ruftaste, unnötigerweise, denn das lärmende Nahen der Kabine war nicht zu überhören. Ungeduldig schob er das Gitter zum leeren Schacht auf, in dem lange Kabelschlaufen ihren trigonometrischen Aufgaben nachkamen. Oder anderen Aufgaben – auf Daisys Mädchenschule waren derlei mathematische Feinheiten nicht ernst genommen worden, aber sie erinnerte sich, Gervaise über die Schulter geschaut zu haben, wenn er stöhnend an seinen Hausaufgaben saß.
Das ganze Lernen war vergebens gewesen, dachte sie traurig. Ihr Bruder war in den Krieg gezogen statt auf die Universität, und die ganze Mathematik hatte ihn nicht vor dem Tod in den Schützengräben Flanderns bewahren können.
Mathematik würde auch diesem Hotelgast nichts nützen, wenn er in die Tiefe des Liftschachts stürzte, was nicht ganz unwahrscheinlich schien. Doch da zog er schnell den Kopf zurück. Der Lift kam an, geführt von einem Jungen, der vielleicht vierzehn Jahre alt war. Seine karottenfarbenen Haare und seine Sommersprossen ließen darauf schließen, dass es sich um Kevin handelte, seine tränenden Augen und ein rotes Ohr hingegen darauf, dass sein Fehlverhalten bestraft worden war.
Ungeachtet dessen sah er Daisy mit einem übermütigen Grinsen, das unregelmäßige Zähne entblößte, an und fragte: »Runter, Ma’am?«
Möglich, dass seine Worte den ungeduldigen Herrn an seine Manieren erinnerten. Er war schon losgestürmt, trat dann jedoch zurück und ließ Daisy mit einer ironisch angedeuteten Verbeugung den Vortritt.
»Wo kann ich einen Tee bekommen?«, fragte sie den Jungen, als sich der Fahrstuhl in Bewegung setzte.
»In der Lobby, Mylady.« Er salutierte mit übertriebener Höflichkeit. Sein irischer Akzent war schon leicht vom New Yorker Näseln überlagert. »Stanley – das ist der Hotelpage, Mylady – nimmt Ihre Bestellung auf und lässt Ihnen den Tee bringen, Mylady.«
Er wirkte gleichzeitig naseweis und gutmütig. Daisy lachte. »Ich bin Engländerin«, gab sie zu, »aber nicht ›Mylady‹.«
»Können ja nicht alle was Besonderes sein«, sagte er mitfühlend. »Wollen Sie richtigen Tee? Richten Sie Stanley aus, dass Kevin gesagt habe, man solle den Tee schön stark machen, nicht so ein Spülwasser, das die Yankees Tee nennen.«
Der Mann hinter Daisy schnaubte abfällig. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er einen Flachmann aus der Tasche zog, aufschraubte und einen tiefen Zug nahm. Sie vermutete, dass es sich weder um Tee noch um Spülwasser handelte, denn sein Gesicht lief unkleidsam rot an.
Nicht, dass sie ihn eines Blickes würdigte. Die Genugtuung wollte sie ihm nicht geben. »Ich werde mir deinen Rat merken«, sagte sie lächelnd zu Kevin.
Er zwinkerte ihr zu. »Ich kann Ihnen auch das andere besorgen«, flüsterte er. »Nicht das schwarz gebrannte Zeug, sondern echten irischen Whiskey, direkt von der Grünen Insel.«
»Danke, nein.«
»Kein Risiko. Alle entscheidenden Leute wurden geschmiert.«
»Geschmiert?« Der Mann steckte seine lange Nase plötzlich zwischen Daisy und Kevin.
Der Liftboy sah ihn mit aufgerissenen Augen und unschuldsvoller Miene an. »Ham Se sich wohl verhört, Mister. Hab der Lady gerade erzählt, dass mein Bruder seinen Job verliert. Hat nämlich unten in den Docks gearbeitet.«
Es war offensichtlich, dass der Mann ihm nicht glaubte. Bestimmt hätte er sich den Jungen vorgenommen, wenn Daisy nicht dabei gewesen wäre. Sie tat ihr Bestes, um durch und durch seriös zu wirken, und sie erreichten das Erdgeschoss ohne weiteren Wortwechsel. Der Mann stiefelte ohne einen Blick zurück davon.
Daisy trat aus dem Lift und ging, vorbei an dem unbesetzten Empfangspult, in die Lobby. Der Boden war mit einem Muster aus weißen, grauen, schwarzen und dunkelroten Marmorfliesen ausgelegt, die Wände rundum hüfthoch grau verkleidet. In jeder Ecke standen armselige Palmen in Töpfen, was wohl hier genauso dazugehörte wie in London. In dieser ungemütlichen Oase flackerte unter einem dunklen Kaminsims mit aufwendigem Schnitzwerk ein Feuer. Zu beiden Seiten davon standen steife, nicht sehr einladende Bänke aus dem gleichen geschnitzten Holz mit rot-beige gestreiften Polstern.
Zwei Sessel und ein kleines Sofa, ebenso gestreift, standen vor dem Kamin um einen niedrigen Glastisch. Drum herum gruppierten sich mehrere wackelig wirkende Tische mit ebenso wackeligen Stühlen. Um zwei dieser Tische, die zusammengeschoben waren, saß eine Gruppe ernst dreinblickender Frauen und Männer mit ziemlich langen Haaren in eher ungewöhnlicher Garderobe: Die Männer hatten statt der üblichen Krawatten weiche, knallbunte Halstücher umgebunden, und einige der Frauen trugen Cordsamthosen. In ihrem taubenblauen Kostüm kam sich Daisy eindeutig bieder vor.
Ähnlich aussehenden Menschen war Daisy schon in Chelsea begegnet – in dem Londoner Stadtteil, nicht dem Hotel –, wo sie vor ihrer Hochzeit gelebt hatte. Entweder diskutierten sie über die Zukunft großer Literatur oder über die Niedertracht von Verlegern.
In Chelsea hätte so eine Gruppe den Nachmittagstee als absolut bourgeois abgelehnt (sie zogen Getränke wie Bier oder billigen Sherry vor, je nachdem, wer zu sein sie vorgaben), hier jedoch hielten sich alle an Teetassen fest. Tatsächlich entdeckte Daisy überall in der Lobby Teekannen auf den Tischen, die alle besetzt waren.
Ein junger Mann saß allein an einem Tisch auf einer der steifen Bänke an den Wänden. Seine Teekanne stand auf einem Beistelltisch, etwas zu hoch und nicht in greifbarer Nähe. Tasse und Untertasse balancierte er ungeschickt in einer Hand, als sei er sich nicht ganz sicher, was er damit sollte. Er war unauffällig gekleidet und trug einen dunklen geschäftsmäßig wirkenden Anzug. Sein Haar über der intellektuell wirkenden Hornbrille war kurz geschnitten. Er mochte so etwa drei oder vier Jahre jünger sein als Daisy mit ihren sechsundzwanzig Jahren und vermied es offensichtlich, sie anzusehen.
Natürlich hätte sie sich nicht zu ihm gesetzt, selbst wenn er sie dazu aufgefordert hätte, obwohl sie sich zu gerne irgendwo niedergelassen hätte.
Sie war doch eine moderne, unabhängige junge Frau, sagte sie sich. Schon seit Jahren war sie auf sich selbst gestellt, nachdem sie beschlossen hatte, dass alles besser wäre, als bei ihrer Mutter im Dower House zu leben, nachdem ihr Vater an der Grippeepidemie Anfang 1900 gestorben war. Nur weil sie inzwischen im Stand der Ehe war, schon vor einem ganzen Monat geheiratet hatte und ihr geliebter Alec Hunderte Kilometer entfernt war, bedeutete das noch lange nicht, dass sie nicht mehr auf sich selbst aufpassen konnte.
Der einzige freie Platz war auf der anderen Bank, doch gerade als sie sich dazu entschloss, sich dorthin zu setzen, erhob sich ein Paar und verließ einen Tisch auf der gegenüberliegenden Seite der Lobby, neben der Tür zu dem wenig benutzten Salon für Damen. Daisy steuerte darauf zu, als eine kleine gedrungene Frau mit unordentlichen grauen Haaren auf sie zugeeilt kam.
»Ach herrje«, sagte sie, »ich hoffe, es stört Sie nicht?« Sie sah Daisy flehentlich über die Gläser ihrer Halbbrille an.
»Was soll mich stören?«, fragte Daisy verblüfft.
Die kleine Dame wedelte mit dem Strickzeug, das sie bei sich hatte, einem Babyjäckchen mit entzückendem Muster aus hellgelber und weißer Wolle, die sich hinter ihr, wie Daisy jetzt bemerkte, bis zu dem niedrigen Tisch am Kamin verfolgen ließ, wo die kleine Dame ihren Strickbeutel deponiert hatte.
»Es geht um meine Schwester«, vertraute sie Daisy an. »Ach herrje, wie unangenehm, aber sie möchte es so gerne wissen.«
»Was möchte sie wissen?«, fragte Daisy zurückhaltend.
»Ach herrje, wie immer vermassle ich alles. Meine Schwester, Genevieve, besteht darauf, jeden kennenzulernen, der im Hotel wohnt. Wären Sie so freundlich?«
Sie wirkte etwas konsterniert, als Daisy lachte, wurde jedoch zuversichtlicher, als diese sagte: »Ich würde mich freuen. Darf ich Ihren Namen wissen?«
»Ach herrje, ich dachte, ich hätte mich gleich vorgestellt! Ich bin Miss Cabot, Ernestine Cabot – aus Boston, Sie wissen schon – allerdings eine ganz unbedeutende Linie.«
Miss Cabot drehte sich um und verhedderte sich mit den Füßen in ihrem eigenen Wollgarn. Sie wäre womöglich gestürzt, wenn nicht Kevin, der sich von seinem Posten am Lift entfernt hatte, herbeigestürzt wäre, um sie zu stützen.
»Passiert immer wieder, einmal pro Woche, immer wie am Schnürchen«, murmelte er Daisy zu.
Kaum einer schien auf das unbedeutende Missgeschick zu achten, mit Ausnahme des jungen Mannes, der ebenfalls zu Hilfe eilte. Er bückte sich, um die Wolle zu entwirren, doch Miss Cabot drehte sich pikiert um.
»Ach herrje … sehr zuvorkommend, Mr. … äh …«
»Lambert.«
»Mr. … Oje … ziemlich peinlich…«
Daisy vermutete, dass ihr weibliche Hilfe lieber wäre. Sie befreite die von schwarzen Baumwollstrümpfen umhüllten Fesseln der kleinen Dame, während Miss Cabot ein ums andere Mal »Ach herrje!» ausstieß.
Mr. Lambert bot Daisy die Hand, um ihr aufzuhelfen. Dabei sah er sie prüfend an, als ob er ihr Gesicht mit einem inneren Bild abgleichen würde. Daisy, die sich fragte, ob sie seiner Prüfung wohl standgehalten hatte, bedankte sich und lächelte.
»Sehr gerne, Ma’am.« Mit den Worten wehte ihr eine leichte Whiskeyfahne entgegen. Kevins Geschäfte liefen anscheinend gut, und nicht alle Teekannen enthielten tatsächlich Tee.
Daisy ergriff das Wollgarn, das von Miss Cabots Stricknadeln baumelte, um den Faden aufzuwickeln, während sie die alte Dame zu ihrer Schwester begleitete. Der Wollfaden spannte sich ungefähr einen halben Meter über dem Boden, als der ungeduldige Mitpassagier aus dem Fahrstuhl entschlossen angelaufen kam. Der Faden wickelte sich um seine Beine.
Ohne etwas zu merken, stürmte er weiter. Das Strickzeug flog Miss Cabot aus den Händen, und der Strickbeutel, der am anderen Ende des Fadens hing, fiel zu Boden.
Lambert hielt den Mann am Ärmel fest. »Hallo, Vorsicht, warten Sie mal kurz!«
»Sie können etwas dazu sagen?« Der Mann drehte sich begierig um. Daisy hätte schwören können, dass seine lange Nase zuckte. »Sie sind bereit zu reden?«
Verwirrt blinzelte Lambert ihn an. »Zu reden? Wüsste nicht, worüber ich reden sollte, Kumpel, außer, dass Sie achtgeben sollten, wohin Sie treten.«
»Achtgeben …?« Jetzt sah der andere verständnislos aus. Dann folgte er Lamberts Geste zu den gelben und weißen Fäden um seine Beine. Er machte sich daran, aus dem Fadengewirr zu steigen, und trat zurück. Die Wolle klebte an seiner Tweedhose. Er bückte sich und riss beide Fäden durch. »Lassen Sie sich nicht von Frauen einwickeln, Junge«, riet er Lambert. »Der einzige Ausweg daraus ist ein klarer Schnitt.« Dann eilte er davon.
Lambert hob das Strickzeug auf, das wie durch ein Wunder nicht von den Nadeln gerutscht war. »Tut mir leid, Ma’am«, sagte er betreten und reichte es Miss Cabot. »Himmel, mit so einem Kerl ist nicht gut Kirschen essen.«
»Ach herrje, ich fürchte, es handelt sich um einen traurigen Verfall der Sitten«, stimmte ihm Miss Cabot zu.
Lambert bückte sich erneut und hob die abgerissenen Enden der Wolle auf. Da er offensichtlich keine Ahnung hatte, was er damit anfangen sollte, nahm Daisy sie ihm ab. Sie begleitete Miss Cabot und wickelte dabei die Wolle weiter auf.
Lambert ging voraus, hob den Strickbeutel auf und legte ihn auf den Tisch zurück. Sein Versuch, bei ihnen zu verweilen, wurde nachdrücklich von Miss Genevieve Cabot unterbunden.
»Danke, junger Mann«, sagte sie und deutete mit einem unmissverständlichen Nicken an, dass er entlassen sei. Und während er sich etwas verunsichert abwandte, setzte sie noch hinzu: »Keine interessante Person.«
Mr. Lambert bekam rote Ohren.
»Guillotiniert«, dachte Daisy bei sich und hoffte, nicht vom selben Schicksal ereilt zu werden.
Kapitel 2
Miss Genevieve Cabot konnte von dem Sessel, in dem sie saß, sowohl den Haupteingang als auch die Lobby und den Zugang zu den Aufzügen kontrollieren. Kontrollieren war das richtige Wort. Während Miss Cabot weich und mollig war, war Miss Genevieve robust und legte ein Wesen an den Tag, das einen harten Gegensatz zu der zaudernden Art ihrer älteren Schwester bildete. Als Daisy sich näherte, blieb sie sitzen, neigte kurz den Kopf und deutete auf den Gehstock, der an ihrem Sessel lehnte, wohl als Entschuldigung, warum sie sich nicht erhob. Vielleicht eher als Erklärung, denn sie sah nicht so aus, als wäre es ihre Art, sich bei jemandem zu entschuldigen. Obwohl ihr Teint kränklich und bleich wirkte, war ihr Ton alles andere als angegriffen.
»Nun, Schwester?«
»Ach herrje, Schwester, leider habe ich ganz vergessen, die junge Dame nach ihrem Namen zu fragen!«
»Mrs. Fletcher«, sagte Daisy und nahm auf dem Sofa Platz, ohne abzuwarten, ob sie dazu aufgefordert würde. Sie war ja schließlich herbeizitiert worden. »Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Britisch«, bemerkte Miss Genevieve Cabot mit leicht skeptischem Unterton.
Ehe Daisy darauf reagieren konnte, kam ein kleiner Junge in Hoteluniform angerannt – Stanley, der Hotelpage. Miss Genevieve Cabot bestellte frischen Tee und weitere belegte Brote, Kleingebäck und Kuchen. Was immer sie von den Briten hielt, es minderte ihre Begeisterung für einen anständigen Nachmittagstee in keiner Weise, stellte Daisy erfreut fest.
Während Stanley Miss Genevieves Bestellung entgegennahm, musterte Daisy ihre beiden Gastgeberinnen. Beide trugen Strickkleider mit Krägen und Manschetten aus Spitze, schön gestrickt (von Miss Cabot?), aber nicht sehr schmeichelhaft für ihre stattlichen Figuren. Miss Cabots Kleid war rosa, das von Miss Genevieve dunkelblau. Strähnen von Miss Cabots Haar, zu einem Knoten zurückgerafft, rutschten überall aus den Haarnadeln und dem Haarnetz heraus. Miss Genevieves ebenfalls graues Haar war zu einem kurzen, strengen Bubikopf geschnitten.
Daisy fragte sich, ob sie rein zufällig hier wohnten oder ob sie zur Literatur- oder Künstlerszene gehörten. Dann entdeckte sie auf Miss Genevieves Schoß ein liniertes Notizbuch. Ein Bleistift steckte in der Spiralbindung. Die oberste Seite war halb gefüllt mit etwas, das nach Stenografie aussah.
»Sind Sie Schriftstellerin, Miss Genevieve?«, erkundigte sich Daisy.
»Ja, in der Tat!« Die Überraschung der alten Dame und ihr offensichtliches Missfallen ließen darauf schließen, dass sie es eher gewohnt war, andere zu befragen, statt selbst ausgefragt zu werden.
Daisy nutzte ihren Vorteil. »Darf man fragen, was Sie schreiben?«
Miss Genevieve runzelte die Stirn, während Miss Cabot eifrig einwarf: »Wirklich schöne Strickkolumnen. Für Frauenzeitschriften, wissen Sie. Ich nehme an, dass es so etwas in England auch gibt? Ich erfinde neue Muster, und Genevieve schreibt darüber. Dann schmückt sie die Strickanleitungen mit ein bisschen Plauderei aus, Sie wissen schon, was ich meine, sehr geistreich. Ich könnte das niemals.«
»Unsinn!«, sagte Miss Genevieve Cabot.
»Ach herrje! Die Muster sind doch wirklich ganz hübsch, Schwester. Wir bekommen so viele Zuschriften, so nette Briefe, aus dem ganzen Land. Aber leider hält Genevieve ihre Artikel nicht für schriftstellerische Arbeit«, vertraute sie Daisy an. »Selbst Klatschspalten zieht sie vor.«
»Klatschspalten?« Daisy konnte sich nicht so recht vorstellen, dass die Schwestern mit jener Art von Gesellschaft Umgang hatten, die den Klatschkolumnisten Futter lieferte.
»Literaturklatsch«, knurrte Miss Genevieve widerwillig.
»Für die Zeitschrift Writers’ World,« erläuterte Miss Cabot.
»Und hier ist der perfekte Ort, um Informationen zu sammeln«, sagte Daisy.
»Viele Autoren, die New York besuchen, halten sich im Chelsea Hotel auf. Es gelingt mir, mich mit einem Großteil von ihnen zu unterhalten. Wie ich festgestellt habe, brennen die meisten Schriftsteller darauf, von sich zu reden, selbst dieser unausstehliche Typ, der sich gerade in Ernestines Strickzeug verfangen hat.«
»Ach herrje, nichts Schlimmes passiert, keine Maschen fallengelassen, und die abgerissenen Enden kann ich so vernähen, dass man es nicht sieht, Schwester.«
»Das glaube ich gern.«
»Wer ist er?«, fragte Daisy. ›Unausstehlicher Typ‹ fand sie eine sehr angemessene Beschreibung.
»Sein Name ist Otis Carmody, und er ist Skandalreporter. Zweifellos eine notwendige Zunft, die auch Dreistigkeit benötigt, aber ich hätte doch gedacht, dass er mit einer etwas gewinnenderen Art weiterkommen würde.«
»Ich nehme mal an, dass er seine Manieren zügelt, wenn es nötig ist.«
»Kann sein. Ich schreibe jedoch auch über literarischere Personen«, verteidigte sich Miss Genevieve. »Ich lasse mich im Algonquin sehen, wenn ich es einrichten kann, aber ich komme inzwischen nicht mehr so viel herum. Außerdem schreibt ja Franklin Adams in der World über den Literarischen Zirkel. Abgesehen davon sind Dorothy Parker und Benchley und Konsorten Wichtigtuer, zwar geistreich, das mag sein, aber lange nicht so klug, wie sie sich einbilden. Nicht einer von ihnen könnte die Tätigkeit bewältigen, die ich geleistet habe.«
Daisy schätzte, dass eine Frage zum Algonquin und dem Literarischen Zirkel nicht gut ankommen würde. »Was war das für eine Tätigkeit?«, fragte sie stattdessen.
»Ich war Kriminalreporterin.« Miss Genevieve schien erfreut über Daisys Interesse – oder sie war dem erlegen, was Alec beharrlich Daisys Blick aus ›unschuldigen blauen Augen‹ nannte. »Die erste Kriminalreporterin in New York, und bisher die einzige, soweit ich weiß. Eugene Cannon war mein Pseudonym. Natürlich kam es zu der Zeit nicht in Frage, meinen eigenen Namen zu benutzen. Ich durfte nicht mal einen weiblichen Namen nehmen, wie es Lizzie Seaman kurze Zeit später tat.«
»Lizzie Seaman?«
»Sie nannte sich Nellie Bly. Sie war ein Mädchen mit großem Talent zur Selbstdarstellung. Um die Erde in achtzig Tagen, meine Güte! Ich selbst hingegen war nicht hinter dem Scheinwerferlicht her, wohlgemerkt. Ich wollte nur die Gelegenheit bekommen, gute Arbeit zu leisten.«
Miss Cabot seufzte. Ihre Stricknadeln klapperten eifrig weiter. »Wenigstens ist es dir gelungen, von daheim wegzukommen, Schwester.«
»Ja«, sagte Miss Genevieve mit grimmigem Ton, »aber für dich wäre diese Art Leben nicht in Frage gekommen, Schwester.«
In dem Augenblick kam ein Kellner. Während er sein Tablett entlud und die leere Teekanne und die gebrauchten Teller abräumte, sah sich Daisy um und bemerkte, dass Mr. Lambert sie beobachtete. Schnell wandte er den Blick ab. Etwas an dem jungen Mann war seltsam, fand sie.
Die Unterbrechung gab Miss Genevieve die Gelegenheit, das Gespräch von sich abzuwenden. »Und Sie, Mrs. Fletcher«, sagte sie, während ihre Schwester den Tee einschenkte, »ist Ihr Mann Schriftsteller?«
Es überraschte Daisy, dass ›Eugene Cannon‹ sie als bloßes Anhängsel eines Ehemannes einschätzte.
»Nein«, sagte sie, »er ist Polizist.« Sie bereute die Worte, kaum dass sie sie ausgesprochen hatte. Ein Monat Ehe hatte genügt, um ihr klarzumachen, dass die Frau eines Polizisten von den meisten fast genauso schief angesehen wurde wie ein Polizist selbst.
Miss Genevieve jedoch zeigte sich äußerst neugierig. »Ein englischer Polizist? Ich habe zwar noch nie einen kennengelernt, aber ich habe gehört, dass sie ganz anders sind als unsere New Yorker ›Bullen‹. Ist er auch hier?«
»Er ist in Washington und berät dort ein Ressort Ihrer Regierung.«
»Aha, also eine wichtige Persönlichkeit. Doch nicht … zufällig von Scotland Yard?«
»Doch, in der Tat, er ist Detective Chief Inspector beim Yard.« Daisy beschloss, jetzt von sich zu erzählen. »Ich bin Schriftstellerin.«
Miss Genevieve machte jetzt immerhin ein etwas verlegenes Gesicht. Mit betonter Aufmerksamkeit nahm sie ihr Notizbuch zur Hand.
»Und was schreiben Sie, Mrs. Fletcher?«
»Artikel für Zeitschriften. Einige habe ich für ein amerikanisches Magazin namens Abroad verfasst.«
»Abroad lese ich immer«, sagte Miss Cabot eifrig. »Es ist fast so gut wie selbst zu reisen. Ich wäre ja so gerne gereist, aber Papa …«
»Ich erinnere mich gar nicht, dass unter den Autoren eine Fletcher erwähnt wird«, fiel ihr Miss Genevieve mit gerunzelter Stirn ins Wort.
»Ich schreibe unter meinem Mädchennamen, Dalrymple.«
»Oh!« Miss Cabot ließ ihr Strickzeug fallen – zum Glück hielt sie nicht gerade eine Teetasse – und schlug die Hände zusammen. »Meine Liebe, etwa die Honourable Daisy Dalrymple?«
Miss Genevieve war nicht so beeindruckt von einem Adelstitel, doch sie äußerte sich immerhin einigermaßen schmeichelnd über Daisys Artikelserie über die Museen von London, von denen bereits zwei erschienen waren. Sie wollte wissen, was Daisy nach New York geführt hatte. Daisy berichtete, dass ihr Verleger ihr für einen Bericht über die Überfahrt die Reise nach Amerika spendiert hätte.
Miss Genevieve machte in ihrer Kurzschrift umfangreiche Notizen. »Und was sind Ihre Pläne, solange Sie hier sind?«, fragte sie.
»Mr. Thorwald möchte meine ersten Eindrücke von Amerika erfahren. Wir haben uns einige Tage bei Freunden in Connecticut aufgehalten, und jetzt bin ich ein paar Tage hier.«
Das führte zu einem Gespräch darüber, was sie in New York bereits gesehen hatte, was sie noch sehen wollte und was die Damen Cabot ihr zu sehen rieten.
»Wird Detective Chief Inspector Fletcher auch herkommen?«, fragte Miss Genevieve schließlich fast schüchtern. »Ich würde ihn zu gerne kennenlernen.«
Daisy schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht. Ich habe morgen einen Termin bei Mr. Thorwald, und übermorgen nehme ich den Zug nach Washington.«
»Ist vielleicht ganz gut so«, sagte Miss Genevieve seufzend. »Ich nehme an, britische Polizisten mögen Kriminalreporter ebenso wenig wie unsere. Schwester, reiche Mrs. Fletcher doch mal den Früchtekuchen.«
Der bleischwere Früchtekuchen war alles, was von der Vielfalt an Süßspeisen übriggeblieben war. Daisy lehnte dankend ab und hoffte, dass sie nicht allein verantwortlich war für das Verschwinden eines Großteils des restlichen Gebäcks. Auch in New York waren »Flach gebaut, vorne wie hinten« und eine auf die Hüften gerutschte Taille so in Mode wie zu Hause. Obwohl Daisy dieses Ideal niemals erreichen würde, wollte sie keinesfalls an die Silhouette eines Zeppelins erinnern.
»Vielen Dank für die Teestunde«, sagte sie. »Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu plaudern. Ich glaube, ich mache noch einen kleinen Spaziergang, ehe es zu dunkel wird.«
»Ja, sehen Sie zu, dass Sie vor Einbruch der Dunkelheit zurück sind«, sagte Miss Genevieve. »Wir haben Halloween. Das bedeutet, dass heute Abend aller möglicher Unfug getrieben wird.«
»Ich sehe mir nur mal das General Post Office und die Pennsylvania Station an, wie Sie vorgeschlagen haben.«
Was sie auch tat. Der Bahnhof war den Caracalla-Thermen nachempfunden worden, wie sie gehört hatte, auch wenn man ihr nicht genau gesagt hatte, was die Caracalla-Thermen waren. Sie klangen irgendwie römisch. Der Bahnhof war auf jeden Fall beeindruckend und übertraf das Postgebäude auf der anderen Seite der 8th Avenue. Beide wiesen jedoch zahlreiche klassisch anmutende Säulen auf. Pflichtschuldig umrundete Daisy das Postgebäude und notierte sich die Inschrift oberhalb der Säulenkolonnade: Weder Schnee noch Regen noch Hitze noch trübe Nacht halten diese Kuriere von der raschen Vollendung ihrer vorgeschriebenen Runden ab.
Dann schlenderte sie über eine andere Route zum Hotel zurück. Auf der 28th Street stieß sie auf eine kleine Parkanlage. Die meisten Bäume waren schon kahl, trotzdem war es hier nach den staubigen Straßen erfrischend. Kinder spielten im Dämmerlicht, und sie blieb stehen und sah ihnen zu. Die Spiele schienen denen in England zu gleichen – Himmel und Hölle, Murmelnwerfen, Fangen.
Die Kinder, die Fangen spielten, rannten um Daisy herum. Als sie sich umdrehte, um ihnen zuzusehen, entdeckte sie einen Mann, der hinter einem Baum verschwand, als wollte er nicht gesehen werden.
Er sah dem jungen Mr. Lambert verblüffend ähnlich, aber sie täuschte sich doch sicherlich. Warum hätte ihr Lambert folgen sollen?
*
Am nächsten Morgen machte sie sich zu ihrer Verabredung auf. Die Büros der Zeitschrift Abroad und weiterer dazugehöriger Publikationen befanden sich im Flatiron Building. Bei ihrem ersten Besuch war Daisy zu aufgeregt gewesen, um sich das ungewöhnliche Bauwerk richtig anzusehen.
An diesem Morgen hatte sie noch ein paar Minuten Zeit. Sie schlenderte durch den Madison Square Park, wo ihr die verkohlten Haufen von Halloweenfeuern und die ausgebrannten Reste von Feuerwerkskörpern auffielen. An der Kreuzung zwischen der 23rd Street und der 5th Avenue blieb sie stehen und blickte hinüber zu ihrem Ziel. Das Fuller Building, wie es ursprünglich genannt worden war, war einem dreieckigen Grundstück mit sehr spitzem Winkel angepasst worden, wo der Broadway auf die beiden anderen Straßen stieß. Daisy fand, dass das Gebäude weniger wie ein Bügeleisen aussah, was der englische Name bedeutete, als vielmehr dem Bug eines großen Schiffes glich, das in nördliche Richtung durch Manhattan pflügte.
Der kalte Wind, der hier pfiff, verstärkte diesen Eindruck. Als Daisy zusammen mit vielen anderen Fußgängern die breite, belebte Kreuzung unter dem Blick eines gestressten Verkehrspolizisten überquerte, hielt sie ihren Hut fest.
Während sie sich nach Süden wandte und auf den Eingang zuging, starrte sie zu den verschnörkelten Steinskulpturen der Fassade hinauf. Und immer höher. Sie hatte angenommen, sich an die New Yorker Wolkenkratzer gewöhnt zu haben, doch jetzt wurde ihr etwas schwindelig. Das Gebäude schien zu wanken und sich bedrohlich über sie zu neigen.
Schnell senkte sie den Blick wieder auf Straßenhöhe, da fiel ihr ein Mann auf, der eilig um eine abgelegene Ecke des Gebäudes verschwand – ein Mann, der dem jungen Lambert ziemlich ähnlich sah.
Das bildete sie sich sicher nur ein, wie auch das Wanken des Gebäudes. Sie musste sich wohl im Nacken die Blutzufuhr abgequetscht haben, das hatte ihr einmal ihre Freundin Madge sehr plastisch beschrieben, eine Krankenschwester der Freiwilligen Hilfsorganisation in dem Lazarett, in dem Daisy während des Krieges in der Verwaltung gearbeitet hatte. (Anatomie war natürlich in Daisys Schule nicht als passendes Fach für junge Damen angesehen worden.)
Sie blinzelte und schüttelte sich, um einen klaren Kopf zu bekommen. Als sie in die Eingangshalle trat, sah sie keine Trugbilder mehr, nur den Portier mit seinen Messingknöpfen.
Er erkannte sie von ihrem letzten Besuch am Vortag wieder. »Die Lady aus England, Mrs. Fletcher, habe ich recht?«, begrüßte er sie lächelnd. »Zu Thorwald von Abroad? Achtzehnter Stock, Ma’am. Fahren Sie nur hinauf. Ich rufe Mr. Thorwald an und sage Bescheid, dass Sie unterwegs sind, damit er Sie am Lift abholen kann.«
»Danke. Sie haben anscheinend gehört, dass ich mich gestern verirrt habe, als ich sein Büro gesucht habe.«
»Das passiert vielen, wette ich. Liegt an der Form des Gebäudes, dass die Leute verwirrt sind. Der Lift rechts von Ihnen, Ma’am.«
Ob auf Geheiß des Portiers oder auf eigene Faust, Thorwald wartete jedenfalls schon auf Daisy, als der Fahrstuhl den achtzehnten Stock erreichte. Er war ein birnenförmiger Herr mit einem Kinnbart, über dem seine glattrasierte Oberlippe merkwürdig nackt wirkte. Ebenso seine blassblauen Augen, wenn er den goldgeränderten Kneifer abnahm und damit herumfuchtelte oder sich die Augen rieb, wie er es häufig tat.
Er ging voraus und führte sie durch ein Vorzimmer in sein winziges Büro, das vollgestopft war mit Stapeln von Manuskripten und Druckfahnen. Er verfrachtete einen Stapel von Abroad von einem Stuhl auf den Boden, bat Daisy, Platz zu nehmen, und schob sich hinter seinen Schreibtisch.
»Ich hoffe, Sie sind angemessen untergebracht, Mrs. Fletcher?«, sagte er.
Er redete hochtrabend und volltönend, fand Daisy. »Ganz vorzüglich.« Wie jedes Mal, wenn sie mit Mr. Thorwald sprach, merkte sie, dass sie sich seinem geschwollenen Stil anpasste, als wäre er eine ansteckende Krankheit. Zum Glück breitete sich dieser Stil nicht in ihre Artikel aus, sonst würde sie wohl keiner mehr lesen.
»Ich habe einige ungewöhnlich faszinierende Leute kennengelernt«, fuhr sie fort. Sie berichtete ihm von Miss Genevieve Cabot und den verschiedenen Hotelgästen, mit denen Miss Genevieve sie am Vorabend bekannt gemacht hatte. Die Cabots mussten eine renommierte Bostoner Familie gewesen sein. »Sollte ich mir Boston vor dem zweiten Artikel ansehen?«
»Wenn ich auch zögere, Boston eines Besuches als unwürdig zu erklären, so ist eine Pilgerfahrt dorthin doch unnötig, liebe Mrs. Fletcher. Es gibt in dieser großartigen Nation so viel zu bewundern, dass Sie nicht annähernd alles abdecken können. Ihre Aufenthalte in Connecticut, New York und Washington werden genügen. Ich bin nicht um eine umfassende Darstellung bemüht, sondern um den neuen Blick. Aber wie unser weitsichtiger Benjamin Franklin bemerkte: ›Bedenket, dass Zeit Geld ist.‹ Erlauben Sie mir, die Früchte Ihrer Anstrengungen durchzusehen.«
Während er den fertigen Artikel sowie den Anfang des zweiten las, blickte Daisy durch das schmale Fenster hinaus. Vor sich sah sie nicht die Wipfel der Bäume vom Madison Square weit unter ihr oder den East River, sondern den großen Kontinent insgesamt. Im Süden die Karibik und Mexiko, im Norden Kanada, die fast fünftausend Kilometer bis zum Pazifik – sie seufzte und beneidete ihre Freunde von der Schiffsreise, die geplant hatten, so viel wie nur menschenmöglich anzusehen.
»Ausgezeichnet.« Mr. Thorwald war mit Daisys Arbeit zufrieden. Er machte ein paar Vorschläge für den Rest des unvollendeten Artikels; dann sprachen sie über ihre Ideen für Artikel, die sie schreiben könnte, wenn sie wieder in England war.
»Und nun, meine Liebe«, sagte er und zog seine Uhr heraus, »ist es bereits längst nach zwölf Uhr. Erlauben Sie mir, Sie zum Lunch ins Algonquin einzuladen?«
Daisy war nicht nur begierig darauf, das Algonquin kennenzulernen, sie war nur zu bereit, etwas zu essen, da sie ja kein zweites Frühstück gehabt hatte. Alle anderen schienen schon gegangen zu sein. Die Verlagsbüros, an denen sie vorüberkamen, waren praktisch verlassen.
Als sie sich den Fahrstühlen näherten, erkannte Daisy sofort den Mann wieder, der dort wartete, falls warten das richtige Wort war. Sie erkannte ihn nicht nur an seinem Äußeren, sondern auch an seiner Art – Otis Carmody hatte eine der Gittertüren geöffnet und blickte ungeduldig in den Liftschacht.
Vermutlich hatte er an den geheimnisvollen Bewegungen der Kabel längst erkannt, welcher Lift unterwegs war. Obwohl die Fahrstühle des Flatiron zwanzig Jahre jünger waren als die des Chelsea Hotel, bewegten sich die Kabinen mit fast dem gleichen Ächzen, Stöhnen, Scheppern und Rasseln.
Daisy vermutete zuerst, dass der laute Knall einfach nur Teil des allgemeinen Getöses war, bis ein eindeutig menschlicher Laut folgte, ein Schmerzensschrei. Ein Feuerwerkskörper? Am Vorabend hatte sie ständig Explosionen gehört. Vielleicht hatte ein Laufbursche leichtsinnigerweise noch einen in der Tasche gehabt.
Doch keine zehn Schritte von ihr entfernt wankte Carmody einen Augenblick lang am Abgrund des Fahrstuhlschachtes, dann kippte er um.
Kapitel 3
Teufelskerl!«, rief Mr. Thorwald aus.
»Er ist nicht gesprungen«, sagte Daisy grimmig. Ein paar Schritte von dem Verleger entfernt sah sie einen Mann durch den Gang vor den Fahrstühlen laufen und auf das Treppenhaus zustürzen. »Halt!«, rief sie.
Der Mann drehte ihr mit wildem Blick sein bleiches Gesicht zu, dann senkte er den Kopf und lief weiter. Seine genagelten Stiefel hallten über den Marmor, als er im Treppenhaus verschwand. Daisy rannte hinter ihm her.
»He, stehen bleiben!«, rief jemand hinter ihr.
»Halt!«, krächzte Mr. Thorwald.
Daisy zögerte und sah sich um. Zu ihrer Verwunderung bemerkte sie, wie Lambert ihr nachlief, eine gezückte Pistole in der Hand. Ihr blieb gar keine Zeit zu erschrecken, denn schon stürzte sich Mr. Thorwald auf Lamberts Beine und warf ihn mit einem geübten Rugbyangriff zu Boden. Lamberts Pistole flog auf Daisy zu, während seine Hornbrille und Thorwalds Kneifer über den Boden schlitterten.
Zu Daisys noch größerer Verwunderung fing sie die Waffe auf. Das gefürchtete Crickettraining an der Schule war also doch nicht ganz umsonst gewesen!
Aber was zum Kuckuck ging hier eigentlich vor sich? Hatte Lambert auf Carmody geschossen? Und wenn ja, hatte er eigentlich Daisy treffen wollen?
Sie hatte angenommen, dass der Flüchtende der Bösewicht war. War er stattdessen ein Verschwörer oder, was wahrscheinlicher schien, einfach nur ein erschrockener Augenzeuge? Wie auch immer, während sie noch gezögert hatte, war er entkommen. Auch falls er nur ein Zeuge war, musste man ihn aufhalten, damit er eine Aussage machen konnte.
Daisy lief in die Richtung, in die er verschwunden war. Sie hielt Lamberts Pistole am Lauf, um nicht versehentlich einen Schuss auszulösen. Hoffte sie.
»Kommen Sie zurück!«, rief ihr Lambert nach.
»Uff!«, stieß Thorwald außer Atem hervor.
Vom oberen Ende der Treppe sah Daisy, die sich über das Geländer beugte, wie der Flüchtige gämsenartig hinuntersprang und schon zwei Stockwerke tiefer war.
»Kommen Sie zurück!«, rief sie und lief die erste Treppe hinunter.
»Anhalten!« Lambert, der zerzaust und ohne seine Brille jünger denn je aussah, tauchte über ihr auf. »Ich hole ihn ein, Mrs. Fletcher. Halten Sie sich lieber raus. Bitte!«
Daisy erstarrte, als er die Treppe herunterkam und auf sie zurannte. Im letzten Moment erinnerte sie sich an die Pistole in ihrer Hand. Sie verbarg sie hinter ihrem Rücken, damit er sie ihr nicht entreißen konnte. Das Ding entglitt ihr jedoch und rutschte zwischen den Geländerstäben durch. Einen Moment später tönte ein fernes Scheppern vom Ende des Treppenhauses herauf.
Inzwischen war Lambert an Daisy vorbeigelaufen, während sie beschlossen hatte, dass es wohl angebrachter wäre, sich zurückzuhalten, und wieder nach oben eilte.
Mr. Thorwald kam wankend auf die Füße und rief klagend: »Mein Kneifer, mein Kneifer! Könnte vielleicht jemand nach meinem Kneifer suchen?«
Zwei Männer, die wohl Büroangestellte waren, sowie eine Frau, möglicherweise eine Sekretärin, waren aus den umliegenden Büros aufgetaucht, hatten sich um ihn geschart und gaben besorgte und mitfühlende Laute von sich. Daisy entdeckte den Kneifer und reichte ihn dem Verleger. Er setzte ihn auf die Nase, als endlich die Liftkabine herangerattert kam.
Ausgestreckt auf ihrem flachen Dach lag Otis Carmody. Es war offensichtlich, dass er sich das Genick gebrochen hatte.