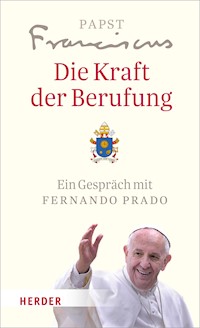Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Welt befindet sich im Umbruch. Immer mehr Menschen haben Sorgen und Ängste. Im Gespräch mit dem französischen Soziologen Dominique Wolton analysiert Papst Franziskus die Veränderungen, spricht über Chancen und Risiken. Deutlich zeigt der Papst auf, was zu tun ist, entwirft Skizzen für eine gemeinsame Zukunft. Wie noch in keinem Buch zuvor geht er in die Tiefe, diskutiert leidenschaftlich und richtet konkrete Appelle an die Welt, herausgefordert vom scharfsinnigen Denker Wolton. Fesselnd, überraschend und eine große intellektuelle Bereicherung. Die Gespräche fanden bei insgesamt zwölf Begegnungen in sehr privatem Rahmen statt. Dominique Wolton stellt fest: "In sozialer Hinsicht ist er ein bisschen franziskanisch, in intellektueller Hinsicht ein bisschen dominikanisch, in politischer Hinsicht ein bisschen jesuitisch … Und in jedem Fall sehr menschlich. Wahrscheinlich brauchte es noch sehr viel mehr, um seine Persönlichkeit zu begreifen …" Die angesprochenen Themen betreffen die politischen, kulturellen und religiösen Fragen, die die Welt und ihre Gewalt umtreiben: den Frieden und den Krieg; die Kirche in der Globalisierung und angesichts der kulturellen Vielfalt; die Religionen und die Politik; die Fundamentalismen und den Laizismus; die Beziehungen zwischen Kultur und Kommunikation; Europa als Schauplatz eines kulturellen Miteinanders; die Beziehungen zwischen Tradition und Moderne; den interreligiösen Dialog; den Status des Individuums, der Familie, der Sitten und der Gesellschaft; die universalistischen Ansätze; die Rolle der Christen in einer von der Rückkehr der Religionen geprägten laizistischen Welt; die Fehlkommunikation und die Besonderheit des religiösen Diskurses. "Politik machen heißt akzeptieren, dass es eine Spannung gibt, die wir nicht lösen können. Es kann nur eine Lösung nach oben, zum Höheren hin geben, bei der beide Seiten ihr Bestes einbringen und das Ergebnis keine Synthese, sondern ein gemeinsames Unterwegssein, ein "Miteinandergehen" ist. (…) Es gibt die große Politik und es gibt die kleine Parteienpolitik. Die Kirche darf sich nicht in die Parteienpolitik einmischen. Paul VI. und Pius XI. haben gesagt, dass die Politik, die große Politik, eine der erhabensten Formen der Nächstenliebe ist. Warum? Weil sie auf das Wohl aller, das Gemeinwohl ausgerichtet ist." (Papst Franziskus)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Papst Franziskus
»Mit Frieden gewinnt man alles«
Im Gespräch mit Dominique Wolton über Politik und Gesellschaft
Aus dem Französischen von Gabriele Stein
Titel der Originalausgabe:
Politique et société. Rencontres avec Dominique Wolton
© Editions de l’Observatoire / Humensis, 2017
© Libreria Editrice Vaticana
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, 2019
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Die Bibeltexte sind entnommen aus:
Die Bibel. Die Heilige Schrift
des Alten und Neuen Bundes
Vollständige deutsche Ausgabe
© Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005
Umschlaggestaltung: Stefan Weigand, wunderlichundweigand
Umschlagmotiv: © Servizio Fotografico - Vatican Media
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN (E-Book) 978-3-451-81444-0
ISBN (Buch) 978-3-451-38182-9
»Vor Kurzem habe ich gesagt, und ich wiederhole es, dass wir den Dritten Weltkrieg erleben, aber stückchenweise. Es gibt Wirtschaftssysteme, die nur dann überleben können, wenn Krieg geführt wird. So stellt man Waffen her und verkauft sie, und so können die Bilanzen der Wirtschaftssysteme, die den Menschen dem Götzen Geld opfern, natürlich saniert werden. Aber dabei denkt man nicht an die hungrigen Kinder in den Flüchtlingslagern, man denkt nicht an die Zwangsumsiedlungen, man denkt nicht an die zerstörten Häuser, ja, man denkt auch nicht an die vielen Leben, die zerbrochen sind. Wie viel Leid, wie viel Zerstörung, wie viel Schmerz! Heute, liebe Brüder und Schwestern, erhebt sich in allen Teilen der Welt, in jedem Volk, aus jedem Herzen und in den Volksbewegungen der Friedensruf: Nie wieder Krieg!«
Aus der Ansprache an die Teilnehmer des Internationalen Treffens der Volksbewegungen, 28. Oktober 2014
»Ich träume von einem jungen Europa, das fähig ist, noch Mutter zu sein: eine Mutter, die Leben hat, weil sie das Leben achtet und Hoffnung für das Leben bietet. Ich träume von einem Europa, das sich um das Kind kümmert, das dem Armen brüderlich beisteht und ebenso dem, der Aufnahme suchend kommt, weil er nichts mehr hat und um Hilfe bittet. Ich träume von einem Europa, das die Kranken und die alten Menschen anhört und ihnen Wertschätzung entgegenbringt, auf dass sie nicht zu unproduktiven Abfallsgegenständen herabgesetzt werden. Ich träume von einem Europa, in dem das Migrantsein kein Verbrechen ist, sondern vielmehr eine Einladung zu einem größeren Einsatz mit der Würde der ganzen menschlichen Person. Ich träume von einem Europa, wo die jungen Menschen die reine Luft der Ehrlichkeit atmen, wo sie die Schönheit der Kultur und eines einfachen Lebens lieben, die nicht von den endlosen Bedürfnissen des Konsumismus beschmutzt ist; wo das Heiraten und der Kinderwunsch eine Verantwortung wie eine große Freude sind und kein Problem darstellen, weil es an einer hinreichend stabilen Arbeit fehlt. Ich träume von einem Europa der Familien mit einer echt wirksamen Politik, die mehr in die Gesichter als auf die Zahlen blickt und mehr auf die Geburt von Kindern als auf die Vermehrung der Güter achtet. Ich träume von einem Europa, das die Rechte des Einzelnen fördert und schützt, ohne die Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft außer Acht zu lassen. Ich träume von einem Europa, von dem man nicht sagen kann, dass sein Einsatz für die Menschenrechte an letzter Stelle seiner Visionen stand.«
Aus der Ansprache bei der Verleihung des Karlspreises, 6. Mai 2016
Inhalt
Einleitung
1 Frieden und Krieg
»Wir alle sind Flüchtlinge.«
Eine politische Kirche?
»Mit Frieden gewinnt man alles«
2 Religion und Politik
Globale Kirche – Globale Politik?
Europa und die kulturelle Vielfalt
Stumme Kirche?
3 »Europa geht es schlecht«
Mehr Initiative!
Kehrt Marx zurück?
Kirche und Moderne
4 Der Schlüssel zur Kommunikation
Zwischen Einsamkeit und Berührung
Begegnung aus der Stille
Technik oder Kommunikation?
5 Die Andersheit, die Zeit und die Freude
Dialog mit der Realität
Die Freude macht den Unterschied
»So nah, so fern«
6 »Die Barmherzigkeit ist eine Reise vom Herzen zur Hand«
Heimat und Identität
Gott ist größer als kleine Zeichen
Welche Wurzeln hat Europa?
7 »Die Tradition ist eine Bewegung«
Wachsen durch Verstehen
Der gesunde Laizismus
Vitalität statt Verbote
8 »Manchmal muss man radikal sein«
»Da ist diese Tendenz …«
Freundschaft mit einem Papst?
»Dieser Friede hat mich bis heute nicht verlassen«
Ansprachen von Papst Franziskus
Einige Sätze von Papst Franziskus
Auswahlbibliographie von Papst Franziskus
Bibliographie von Dominique Wolton
Danksagungen
Über die Autoren
Einleitung
»Nicht leicht, nicht leicht …«
Das Projekt
Es gibt individuelle Schicksale, die mit der Geschichte zusammentreffen. Das ist bei Papst Franziskus der Fall, der mit seiner lateinamerikanischen Herkunft eine neue Identität in die katholische Kirche hineinbringt. Mit seiner Persönlichkeit, seiner Vorgehensweise, seinen Taten fordert er eine Epoche heraus, die von der Wirtschaft, aber auch von der Suche nach Sinn, Authentizität und oft nach spirituellen Werten geprägt ist. Dieses Zusammentreffen zwischen einem Menschen und einer Geschichte bildet den Kern unserer Gespräche: Gespräche zwischen einem Kirchenmann und einem französischen Intellektuellen, Laizisten und Experten für Kommunikation, der sich seit vielen Jahren mit der Globalisierung, der kulturellen Vielfalt und der Andersheit beschäftigt.
Warum ein Zwiegespräch? Weil es eine Öffnung zum anderen hin, einen Austausch von Argumenten und die Präsenz des Lesers zulässt. Das Zwiegespräch – der Dialog – verleiht der menschlichen Kommunikation einen Sinn, der über die Performance und über die Grenzen der Technologie hinausgeht.
Der Blickwinkel, den ich für dieses Buch gewählt habe, bezieht sich auf eine jener Fragen, die in der Geschichte der Kirche immer wiederkehren: Worin besteht die Eigenart ihres sozialen und politischen Engagements? Was unterscheidet sie von einem politischen Akteur? Fragen, die sich immer dann stellen, wenn die Lektüre des Evangeliums, die neuerliche Lektüre der Kirchenväter und der Enzykliken ein kritisches Engagement und ein Handeln zugunsten der Armen befürworten, der Unterdrückten, der Ausgegrenzten … Diejenigen, die im Lauf der Jahrhunderte aufgestanden sind, um Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten anzuprangern, haben oft eine direkte Verbindung zwischen politischer Botschaft und Spiritualität hergestellt.
Eines der letzten großen Beispiele hierfür ist die Debatte und sind die Konflikte im Kontext der Befreiungstheologie. Wie kann man sich die spirituelle Dimension des politischen Handelns der Kirche vorstellen, wie sie erkennen? Wie weit darf man gehen und wie weit nicht? Es soll – so die Idee – zum Nachdenken darüber angeregt werden, was Spiritualität und politisches Handeln verbindet und trennt. Dieses Nachdenken ist zwingend notwendig, zumal in einer Zeit, in der eine Rückkehr der spirituellen Suche zu verzeichnen ist und die Globalisierung der Information überdies die Ungleichheiten deutlicher zutage treten lässt, wodurch nicht nur das Engagement dringlicher, sondern auch die Argumente einfacher werden und nicht selten die Tendenz besteht, alles auf einen politischen Ansatz zu reduzieren. Wie lässt sich verhindern, dass die Kirche mit ihrem kritischen Engagement im Namen der »Modernität« auf einen globalen politischen Akteur ‒ so etwas wie eine entfernte Cousine der UNO ‒ reduziert wird? Die Jesuiten sind durch ihre Geschichte und Lateinamerika ist durch die Geschichte des Papstes ein eklatantes Beispiel für diese Debatte, für die Notwendigkeit und für die Schwierigkeit, einen Unterschied zwischen diesen beiden Logiken aufrechtzuerhalten.
Die Begegnung
Eine Begegnung kann man nicht kontrollieren, sie folgt ihren eigenen Gesetzen. Diese hier war frei, nonkonformistisch, vertrauensvoll, humorvoll. Sympathie auf beiden Seiten. Der Papst ist präsent, aufmerksam, bescheiden, durchdrungen von der Geschichte und, was die Menschen angeht, illusionslos. Ich treffe ihn außerhalb jedweden institutionellen Rahmens, bei ihm zu Hause, aber das allein genügt nicht, um seine Fähigkeit des Zuhörens zu erklären, seine Freiheit, sein Entgegenkommen. Floskeln sind ganz, ganz selten.
Manchmal wird mir schwindelig, wenn ich an die erdrückende Last der Verantwortung denke, die auf seinen Schultern ruht. Wie kann er inmitten so vieler Zwänge und Erwartungen entscheiden, denken, zuhören, handeln, und das nicht nur für die Kirche, sondern auch für eine ganze Anzahl anderer Belange der Welt? Wie macht er das? Ja, er ist vielleicht wirklich der erste Papst der Globalisierung, ein Papst zwischen Lateinamerika und Europa. Menschlich, bescheiden, und doch zugleich so entschlossen: einer, der mit beiden Beinen auf dem Boden der Geschichte steht. Obwohl seine Rolle nichts mit der der großen politischen Leader der Welt zu tun hat, wird er ständig damit konfrontiert.
Der vielleicht stärkste Satz, der ihm mitten im Gespräch wie selbstverständlich über die Lippen kam, war: »Mich kann nichts erschrecken.« Und dann, eines Abends, beim Abschied, zwischen Tür und Angel und ganz leise, hat er noch etwas anderes gesagt, das ich nie vergessen werde, weil es seine Menschlichkeit, sein Apostolat so gut zum Ausdruck bringt: »Nicht leicht, nicht leicht …« Was ist dem noch hinzuzufügen, dieser Bescheidenheit, Einsamkeit, Hellsichtigkeit und Intelligenz?
Die Schwierigkeit bestand darin, eine mögliche Ebene für diesen Dialog zu finden, weil wir einerseits so verschieden und doch andererseits auch so entschlossen waren, einander zu verstehen oder es wenigstens zu versuchen, »Mauern einzureißen« und Fehlkommunikationen zuzugeben. Es war »nicht leicht«, jemanden zum Sprechen zu bringen, der ohnehin schon so oft das Wort ergreift und dies sehr gut und mit großer Einfachheit tut, zumal der religiöse Diskurs immer auf alles eine Antwort hat und alles bereits gesagt worden ist … Wiederholungen zu vermeiden im Hinblick auf das, was von seinen Stellungnahmen bereits bekannt ist, sich abzuheben vom religiösen und offiziellen Vokabular. Die Wahrheit zu suchen, die unvermeidliche Fehlkommunikation anzunehmen, wann immer sie aufkam. Wir haben uns häufiger auf der Ebene der Geschichte, der Politik, als im Spektrum der spirituellen Dimensionen bewegt.
Im Übrigen ließe sich dieser an Übereinstimmungen wie auch an Verschiedenheiten gleichermaßen reiche Dialog zwischen dem Ordensmann und dem Laien beliebig fortsetzen. Ich war weder Claqueur noch Kritiker, sondern einfach ein Wissenschaftler, ein Mann, der in gutem Glauben versuchte, ein Gespräch mit einer der herausragendsten intellektuellen und religiösen Persönlichkeiten der Welt zu führen. Diese Freiheit, die ich im Lauf der Unterhaltungen gespürt habe, gehört ganz und gar zu ihm. Er ist weder konventionell noch konformistisch. Übrigens muss man, um das zu begreifen, nur sehen, wie er in Argentinien und Lateinamerika gelebt, geredet und agiert hat. Der Unterschied zu Europa ist grundlegend.
Empirisch betrachtet habe ich – nicht immer bewusst ‒ dieselbe Vorgehensweise angewandt wie in meinen Gesprächen mit dem Philosophen Raymond Aron (1981), dem Kardinal Jean-Marie Lustiger (1987) und dem Präsidenten der europäischen Gemeinschaft Jacques Delors (1994). Die Philosophie, die Religion, die Politik. Drei Dimensionen, die sich letztlich auch hier wiederfinden. Sicherlich eine Position, die die Haltung des Suchenden trefflich veranschaulicht, der, unsichtbar, aber für das Nachdenken über die Geschichte und die Welt unentbehrlich, gleichsam für den Weltbürger spricht. Sprechen, einen Dialog führen, um die unüberwindlichen Entfernungen zu verringern und zu ermöglichen, dass man einander ein Stück weit versteht. Berührungspunkte gab es paradoxerweise häufig auf dem Feld einer gemeinsamen Kommunikationsphilosophie. Dem Menschen Vorrang geben vor der Technologie. Die Fehlkommunikation akzeptieren, den Dialog begünstigen, die Kommunikation enttechnologisieren, um die humanistischen Werte wiederzuentdecken. Akzeptieren, dass die Kommunikation mindestens ebenso sehr im Verhandeln und im Miteinander (Anm. d. Lektorats: Der soziologische Fachbegriff cohabitation wird in diesem Buch mit Miteinander wiedergegeben) wie im Teilen besteht. Die Kommunikation als politische Diplomatietätigkeit.
Die großen Themen
Unsere Gespräche fanden zwischen Februar 2016 und Februar 2017 bei insgesamt zwölf Begegnungen statt. Das ist, wenn man die vatikanischen Gepflogenheiten bedenkt, immerhin bemerkenswert. So gut wie nichts war im Vorfeld festgelegt worden. Oft gingen die Gespräche über den engeren Rahmen des Buches hinaus, und nicht alles ist direkt in den Text eingeflossen, der gleichwohl einen guten Eindruck vom Ton, von der Atmosphäre und von der Freiheit unseres Austauschs vermittelt. Der Papst hat das Manuskript natürlich gelesen, und wir sind uns mühelos einig geworden.
Die angesprochenen Themen betreffen die politischen, kulturellen und religiösen Fragen, die die Welt und ihre Gewalt umtreiben: den Frieden und den Krieg; die Kirche in der Globalisierung und angesichts der kulturellen Vielfalt; die Religionen und die Politik; die Fundamentalismen und den Laizismus; die Beziehungen zwischen Kultur und Kommunikation; Europa als Schauplatz eines kulturellen Miteinanders; die Beziehungen zwischen Tradition und Moderne; den interreligiösen Dialog; den Status des Individuums, der Familie, der Sitten und der Gesellschaft; die universalistischen Ansätze; die Rolle der Christen in einer von der Rückkehr der Religionen geprägten laizistischen Welt; die Fehlkommunikation und die Besonderheit des religiösen Diskurses.
Diese Themen sind in acht Kapiteln angeordnet. In jedem dieser Kapitel habe ich unsere Gespräche mit Auszügen aus 16 großen Ansprachen ergänzt, die Papst Franziskus seit seiner Wahl am 13. März 2013 in aller Welt gehalten hat. Jeweils zwei dieser Ansprachen, die unsere Zwiegespräche veranschaulichen, finden sich am Ende eines jeden Kapitels.
Bewusst nicht eingegangen wird dagegen auf die politischen und institutionellen Konflikte im Herzen der Kirche. Abgesehen davon, dass andere in dieser Frage kompetenter sind als ich und Informationsmaterial in reichlicher Menge vorliegt, entsprach dies nicht meinem eigentlichen Interesse, nämlich den Platz der Kirche in der Welt und in der Politik von der Erfahrung und Analyse des ersten jesuitischen und nicht-europäischen Papstes der katholischen Kirche her in den Blick zu nehmen.
Eine Hypothese über ihn? In sozialer Hinsicht ist er ein bisschen franziskanisch, in intellektueller Hinsicht ein bisschen dominikanisch, in politischer Hinsicht ein bisschen jesuitisch … Und in jedem Fall sehr menschlich. Wahrscheinlich bräuchte es noch sehr viel mehr, um seine Persönlichkeit zu begreifen …
Kleine Fehlkommunikationen …
Beim Heiligen Vater erwächst alles, auch die Beschäftigung mit explizit politischen Fragen, aus der Religion und aus dem Glauben. Die Barmherzigkeit spielt eine wesentliche Rolle, übrigens ebenso sehr wie die Tiefe einer Geschichte und einer Eschatologie, deren Wurzeln über 4000 Jahre alt sind. Meine Bezugsgrößen sind eher anthropologisch, auch wenn sich die spirituellen Dimensionen im Handeln der Menschen natürlich niemals komplett ausblenden lassen. Nicht der Blickwinkel, wohl aber die Blicke auf die Welt sind oft dieselben. Die Rationalitäten und die Logiken sind nicht immer deckungsgleich. Gerade darin besteht ja die Größe der Kommunikation: dass man versucht, einander zu verstehen und die Unterschiede zu akzeptieren. Etwa im Hinblick auf das Rätsel der gegenwärtigen Welt mit ihrer Sichtbarkeit und Interaktivität, wo die Performance und die Schnelligkeit der Information ein nie dagewesenes Maß an Unverständnis und Fehlkommunikation hervorbringen. Eine Herausforderung: in dieser offenen Welt die Andersheit zu denken, das Monopol eines einzigen politischen oder religiösen Diskurses zu vermeiden, dem wechselseitigen Verständnis den Vorzug zu geben.
»Annehmen, begleiten, unterscheiden, eingliedern.« In letzter Konsequenz besitzen die vier Schlüsselbegriffe des apostolischen Schreibens Amoris laetitia (Die Freude der Liebe, März 2016) eine gewisse allgemeine Tragweite. Insbesondere, wenn es darum geht, die wesentlichen Fragen der heutigen Welt ‒ Arbeit, Bildung, die Beziehungen zwischen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft, Globalisierung, Andersheit und kulturelle Vielfalt, Medien und öffentliche Meinung, die politische Kommunikation, das Urbane – neu zu überdenken. Es gibt so viele Themenbereiche, in denen die Arbeit der Kirche oder sogar Enzykliken zu einem vertieften Weiterdenken beitragen könnten.
Es war nicht leicht, diese Gespräche zu führen. Der Papst antwortet nicht immer auf die Fragen, die man ihm stellt, jedenfalls nicht so, wie man es erwartet, wenn man an die modernen Rationalitäten gewöhnt ist. Man bekommt es sehr leicht mit Bezugssystemen zu tun, die mehrere hundert Jahre alt sind, oder mit Metaphern, oder mit den Evangelien … Nicht immer gibt es eine »Folgerichtigkeit« im klassischen Sinne. Man bewegt sich in unterschiedlichen symbolischen Räumen. Kurz, es entstehen »kleine Fehlkommunikationen«, wie ich es nenne, die aber das eigentlich Interessante an dieser Begegnung ausmachen. Zumal da ja auch noch der dritte Partner ist: der Leser, von dem niemand weiß, wie er diese Äußerungen auffassen wird. Kurz, es ist ein Dialog ohne die »klassische Rationalität« des gewohnten intellektuellen und politischen Austauschs. Und das ist gut, auch wenn es für einige Überraschungen sorgt. Denn damit ist man schon mittendrin in einer Kommunikationsphilosophie, die die Andersheit respektiert.
Das Interessante an der Kirche ist, dass sie praktisch nie modern ist. Sie ist nie ganz und gar in der Gegenwart, auch wenn sie sich in zahlreichen Kämpfen für diese engagiert. Und diese Haltung, so ärgerlich oder ungewöhnlich man sie auch finden mag, macht ihre Weltanschauung natürlich so interessant. Nicht auf Modernität bedacht sein heißt, sich nach Werten und Zeitrechnungen zu richten, die nicht mit unserer von Schnelligkeit, Dringlichkeit und Globalisierung beherrschten Epoche übereinstimmen. In der Vergangenheit gab es oft eine gewisse Deckungsgleichheit zwischen Religion und Politik, zwischen dem Geistlichen und dem Zeitlichen, und die Resultate waren in vielen Fällen fragwürdig … Heute sind das Geistliche und das Zeitliche zumindest im Christentum nicht mehr deckungsgleich, und diese Distanzierung von der Moderne in all ihren Formen ist in Wirklichkeit eine Chance – so schwierig es auch immer sein wird, die Distanz, die zwischen beiden gewahrt werden sollte, genau zu bestimmen. Die Moderne, die binnen vier Jahrhunderten über die Tradition triumphiert hat, ist zu einer Ideologie geworden. Die Wiederaufwertung der Tradition ist sicherlich ein Weg, die herrschende Moderne zu retten. Hier kann die katholische Kirche – wie übrigens auch alle anderen religiösen, künstlerischen und wissenschaftlichen Ressourcen – eine Hilfe sein. Auf jeden Fall zwingen alle diese Dimensionen zum Dialog, zur Toleranz und zum wechselseitigen Verständnis. Und umgekehrt kann die herrschende Tradition, der sich die Moderne im Lauf der Jahrhunderte zu Recht entgegengestellt hat, heute durch Logiken befruchtet werden, die nicht die ihren sind. Solange man nicht in die Eindimensionalität verfällt, die immer eine Bedrohung darstellt, und in die Verdinglichung der Welt, wie es die Frankfurter Schule in den 1920er-Jahren vorhergesagt hatte.
Die Arbeit an diesem Buch hat zweieinhalb Jahre in Anspruch genommen. Sie hat einige Erschütterungen in mir hervorgerufen, einen tiefen Respekt und eine echte Bescheidenheit gegenüber diesem Mann und seiner unermesslichen Verantwortung.
Zugleich war diese Begegnung, bei der eine echte Freiheit herrschte, eine Gelegenheit, viele Dinge zu sagen. Ein Moment in zeitlicher Schwebe. Mit der stets allgegenwärtigen Globalisierung, die alle Skalen, alle Werte erschüttert und die durchdacht werden muss, um neue Kriege zu verhindern. Mit der wachsenden Bedeutung der Kommunikation und der Fehlkommunikation. Kurz gesagt: »Informieren heißt nicht Kommunizieren« und: »Kommunizieren heißt Verhandeln und im besten Fall Zusammenleben«. Vorstellungen, die im Zentrum meiner Forschungen zur Möglichkeit eines friedlichen Miteinanders oft unterschiedlicher und zuweilen gegensätzlicher Weltanschauungen stehen. Übrigens lassen einige Berührungspunkte zwischen dem laizistischen und dem religiösen Diskurs dort, wo es um die Herausforderungen der Globalisierung geht, einen gewissen Optimismus zu. Um es auf den Punkt zu bringen: Es muss alles getan werden, um den Hass auf den anderen zu verhindern. Die christliche Religion mit ihrer universalistischen Ausrichtung ist heute darauf bedacht, mit so wesentlichen Wörtern wie »Respekt«, »Würde«, »Anerkennung«, »Vertrauen« auch im Zentrum des demokratischen Modells den Dialog aufrechtzuerhalten …
Dominique Wolton
1Frieden und Krieg
Februar 2016. Erstes Interview. Ich bin Papst Franziskus noch nie begegnet. Mit dem Dolmetscher, Pater Louis de Romanet, einem Freund, betrete ich das bescheidene Gästehaus Santa Marta1 gleich neben dem Petersdom. Man bittet uns, in einem kleinen, recht kühlen Raum zu warten. Schweigen. Eine gewisse Anspannung. Dann tritt er ein, warmherzig. Sofort dieser Blick, tief und sanft. Wir machen uns bekannt. Die Unterhaltung beginnt. Alles wird zunehmend natürlich, unmittelbar. Etwas passiert. Er antwortet ernsthaft, der Dialog entspinnt sich, unterbrochen von Gelächter, was bei unseren zwölf Begegnungen sehr häufig vorkommen wird.
Der Humor, das Einvernehmen, die Anspielungen und diese ganze natürliche Kommunikation jenseits der Worte, durch Blicke, durch Gesten. Es gibt keine zeitliche Begrenzung. Nach eineinhalb Stunden bittet er darum, dass wir aufhören, weil er seinen Beichtvater aufsuchen müsse. Das sei »auch dringend nötig«, antworte ich ihm. Wir lachen. Dann vereinbaren wir den nächsten Termin. Er öffnet die Tür und geht genauso einfach, wie er gekommen ist. Tief bewegt sehe ich, wie die weiße Silhouette sich entfernt. Unübersehbare Zerbrechlichkeit und unermessliche Kraft der Symbole. Wir haben über ernste Dinge gesprochen, den Frieden und den Krieg, den Platz der Kirche in der Globalisierung und in der Geschichte.
Anmerkung: In den Gesprächen zwischen Papst Franziskus und Dominique Wolton finden sich einige Anspielungen auf Ansprachen des Papstes. Zum besseren Verständnis werden die entsprechenden Passagen aus diesen Ansprachen in diesem Buch abgedruckt.
»Wir alle sind Flüchtlinge.«
À vous la parole. (Sie haben das Wort.)
Sie haben im Januar 2016 auf Lesbos etwas Schönes und Ungewöhnliches gesagt: »Wir alle sind Migranten, und wir alle sind Flüchtlinge.« Die europäischen und westlichen Mächte schotten sich ab. Was kann man, von diesem grandiosen Satz einmal abgesehen, noch dazu sagen? Und was kann man tun?
Es gibt einen Satz, den ich gesagt habe – und einige der Migrantenkinder trugen T-Shirts, die damit bedruckt waren: »Ich bin keine Gefahr, ich bin in Gefahr.« Unsere Theologie ist eine Theologie von Migranten. Denn das sind wir, seit der Ruf an Abraham erging, mit all den Migrationen des Volkes Israel. Jesus selbst war ein Flüchtling, ein Einwanderer. Und außerdem sind wir von unserem Glauben her auf existenzielle Weise Migranten. Das »Unterwegssein« ist ein notwendiger Bestandteil der Menschenwürde. Wenn ein Mann oder eine Frau nicht unterwegs ist, dann ist er oder sie eine Mumie. Ein Museumsstück. Ein solcher Mensch ist nicht lebendig.
Es geht nicht nur darum, auf dem Weg zu »sein«, sondern den Weg zu »machen«. Man macht den Weg. In einem spanischen Gedicht heißt es: »Der Weg entsteht im Gehen«. Und gehen heißt, mit den anderen zu kommunizieren. Wenn man geht, hat man Begegnungen. Gehen ist vielleicht die Grundlage der Kultur der Begegnung. Die Menschen begegnen einander, sie kommunizieren. Im Guten, freundschaftlich, oder im Schlechten und im Extremfall mit Krieg. Die große Freundschaft, aber auch der Krieg ist eine Form der Kommunikation. Eine Kommunikation der Aggressivität, zu der der Mensch imstande ist. Wenn ich »Mensch« sage, meine ich den Mann und die Frau. Wenn eine menschliche Person beschließt, nicht weiterzugehen, dann scheitert sie. Sie scheitert in ihrer menschlichen Berufung. Gehen, immer unterwegs sein, heißt immer auch kommunizieren. Man kann den falschen Weg einschlagen, man kann hinfallen … Man kann in ein Labyrinth geraten wie in der Geschichte vom Faden der Ariadne, wie Ariadne und Theseus … Aber man geht. Man geht in die Irre, aber man geht. Man kommuniziert. Man tut sich schwer mit der Kommunikation, aber man kommuniziert trotz alledem. Ich sage das, weil man die Menschen, die unterwegs sind, nicht ablehnen darf. Weil das hieße, die Kommunikation abzulehnen.
Aber die Migranten, die in Europa abgelehnt werden?
Wenn die Europäer unter sich bleiben wollen, dann sollen sie Kinder zur Welt bringen! Ich glaube, die französische Regierung hat richtige Pläne herausgebracht, Gesetze, um den kinderreichen Familien zu helfen. Die anderen Länder dagegen haben das nicht gemacht: Dort steht man besser da, wenn man keine Kinder hat. Aus verschiedenen Gründen, in verschiedener Hinsicht.
Europa hat im Frühling 2016 einen irrsinnigen Vertrag über die Schließung der Grenze zwischen Europa und der Türkei unterzeichnet.2
Deshalb verweise ich auf den Menschen, der unterwegs ist. Der Mensch ist ein grundsätzlich kommunikatives Wesen. Der stumme Mensch – stumm in dem Sinne, dass er nicht kommunizieren kann – ist ein Mensch, dem das »Unterwegssein« fehlt, das »Gehen« …
Eineinhalb Jahre, nachdem sie auf Lesbos diesen Satz gesagt haben, hat sich die Situation verschlimmert. Viele Menschen haben Sie für das bewundert, was Sie gesagt haben, aber danach ist nichts weiter geschehen. Was könnten Sie heute sagen?
Das Problem beginnt in den Ländern, aus denen die Migranten kommen. Warum verlassen sie ihr Land? Aus Arbeitsmangel oder wegen des Krieges. Das sind die beiden Hauptgründe. Der Arbeitsmangel, weil sie ausgebeutet worden sind – ich meine die Afrikaner. Europa hat Afrika ausgebeutet … Ich weiß nicht, ob man das sagen darf! Aber gewisse europäische Kolonisationen … Ja, sie haben es ausgebeutet. Ich habe gelesen, dass ein afrikanischer Staatschef, der kürzlich gewählt worden ist, dem Parlament ein Gesetz über die Wiederaufforstung seines Landes vorgelegt hat, das war seine erste Regierungshandlung. Es ist übrigens verabschiedet worden. Die ökonomischen Weltmächte hatten alle Bäume gefällt. Wiederaufforsten. Das Land ist trocken, weil es zu sehr ausgebeutet worden ist, und es gibt keine Arbeit mehr. Das Erste, was getan werden muss, und das habe ich auch bei den Vereinten Nationen gesagt, beim Europarat, überall, ist, dass man vor Ort Möglichkeiten der Arbeitsbeschaffung findet und darein investiert. Allerdings muss Europa auch bei sich zu Hause investieren. Denn auch hier gibt es ein Problem mit der Arbeitslosigkeit. Der andere Grund für die Migrationen sind die Kriege. Man kann investieren, dann haben die Menschen die Möglichkeit zu arbeiten und müssen nicht mehr fortgehen, aber wenn Krieg herrscht, müssen sie trotzdem fliehen. Und wer macht den Krieg? Wer liefert die Waffen? Wir.
Und insbesondere die Franzosen …
Ach ja? Andere Länder auch, ich weiß, dass sie mehr oder weniger mit Waffen in Verbindung stehen. Wir liefern sie ihnen, damit sie sich letztlich zerstören. Man beklagt sich, dass die Migranten kommen und uns zerstören. Aber wir sind diejenigen, die Raketen dorthin schicken! Sehen Sie sich den Nahen Osten an. Da ist es genauso. Wer liefert die Waffen? Dem Daesch, Assads Anhängern in Syrien, den Anti-Assad-Rebellen? Wer liefert die Waffen? Wenn ich »wir« sage, dann meine ich den Westen. Ich klage kein einzelnes Land an – außerdem verkaufen auch einige nichtwestliche Länder Waffen. Wir sind es, die die Waffen liefern. Wir verursachen das Chaos, die Menschen fliehen, und wir, was machen wir? Wir sagen: »Oh nein, ihr müsst sehen, wie ihr klarkommt!« Ich möchte keine zu harten Worte verwenden, aber wir haben nicht das Recht, den Leuten, die kommen, nicht zu helfen. Das sind Menschen. Ein Politiker hat zu mir gesagt: »Wichtiger als alle diese Verträge sind die Menschenrechte.« Das war ein europäischer Staatsmann mit einer sehr klaren Vorstellung von der Problematik.
Diese ablehnende Haltung kann sogar zu einem Hassbeschleuniger werden, denn mit der heutigen Globalisierung der Bilder sieht die ganze Welt im Internet oder im Fernsehen zu, wie die Europäer die Menschenrechte verraten und die Einwanderer ablehnen, sich egoistisch abschotten, obwohl wir den Migranten natürlich in ökonomischer Hinsicht, aber auch sozial und kulturell seit 50 Jahren so vieles zu verdanken haben. Das wird wie ein Bumerangeffekt auf Europa zurückwirken. Die Europäer behaupten, sie seien die größten Demokraten? Aber sie verraten ihre humanistischen und demokratischen Werte! Die Globalisierung der Information macht daraus einen Bumerang … Aber die Europäer sehen das nicht. Aus Egoismus. Aus Dummheit.
Europa ist die Wiege des Humanismus.
Um auf die Politik zurückzukommen …
Jeder Mensch und jede Institution auf der ganzen Welt hat immer eine politische Dimension. Der große Pius XI.3 hat gesagt, die POLITIK, großgeschrieben, sei eine der höchsten Formen der Nächstenliebe. Für eine »gute« Politik zu arbeiten heißt, ein Land und seine Kultur voranzubringen: Das ist Politik. Und das ist ein Beruf. Auf dem Rückflug aus Mexiko, Mitte Februar 2016,4 haben mir Journalisten erzählt, dass Donald Trump vor seiner Wahl zum Präsidenten über mich gesagt hat, ich sei ein Politiker, und dann hat er angekündigt, dass er, wenn er gewählt werden würde, Tausende Kilometer von Mauern bauen lassen würde … Ich habe ihm dafür gedankt, dass er mich einen Politiker genannt hat, denn Aristoteles definiert die menschliche Person als ein Animal politicum, und das ist eine Ehre für mich. Ich bin also immerhin eine Person! Was die Mauern angeht … Das Mittel der Politik ist die Nähe. Dass man sich mit den Problemen auseinandersetzt, sie versteht. Da ist noch eine Sache, bei der wir aus der Übung gekommen sind: die Überzeugung. Sie ist vielleicht die subtilste, die raffinierteste Methode der Politik. Ich höre mir die Argumente des anderen an, ich analysiere sie, und ich lege ihm meine Argumente vor … Der andere versucht mich zu überzeugen, ich versuche ihn zu überzeugen, und auf diese Weise sind wir gemeinsam unterwegs. Vielleicht gelangen wir nicht zu einer hegelianischen oder idealistischen Synthese ‒ Gott sei Dank, denn das kann man, das darf man nicht machen, weil dabei immer etwas kaputtgeht.
Ihre Definition von der Politik – überzeugen, argumentieren und vor allem miteinander verhandeln – geht völlig konform mit der Definition von Kommunikation, die ich vertrete und die in einem Kontext der Fehlkommunikation auf Verhandlung setzt! Die Kommunikation ist ein Konzept, das untrennbar mit der Demokratie verbunden ist, denn sie setzt die Freiheit und Gleichheit der Partner voraus. Kommunizieren heißt manchmal teilen, aber häufiger verhandeln und miteinander leben …
Politik machen heißt akzeptieren, dass es eine Spannung gibt, die wir nicht lösen können. Denn etwas im Sinne einer Synthese zu lösen bedeutet, eine Seite zugunsten der anderen aufzugeben. Es kann nur eine Lösung nach oben, zum Höheren hin geben, bei der beide Seiten ihr Bestes einbringen und das Ergebnis keine Synthese, sondern ein gemeinsames Unterwegssein, ein »Miteinandergehen« ist. Nehmen wir zum Beispiel die Globalisierung. Das ist ein abstraktes Wort. Vergleichen wir diesen Begriff mit einem geometrischen Körper: Man kann die Globalisierung, die ein politisches Phänomen ist, als eine »Blase« sehen, bei der jeder Punkt gleich weit von der Mitte entfernt ist. Alle Punkte sind identisch, und die Einheitlichkeit steht an erster Stelle: Man sieht genau, dass diese Art von Globalisierung die Vielfalt zerstört.
Man kann sie sich aber auch als Polyeder vorstellen,5 in dem alle Punkte verbunden sind und dennoch jeder Punkt, ob es sich nun um ein Volk oder um eine Person handelt, seine eigene Identität bewahrt. Politik machen heißt, diese Spannung zwischen der Einheit und den Eigenidentitäten zu suchen.
Gehen wir über zum religiösen Bereich. Als ich noch klein war, hieß es, alle Protestanten kämen in die Hölle, alle, absolut alle. (Lacht.) Ja nun, das war eine Todsünde. In Argentinien gab es sogar einen Priester, der die Zelte der evangelischen Missionare verbrannte. Ich spreche hier von den Jahren zwischen 1940 und 1942. Als ich vier oder fünf Jahre alt war, bin ich einmal mit meiner Großmutter auf der Straße spazieren gegangen, und auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig gingen zwei Frauen von der Heilsarmee mit ihren Abzeichen auf den Mützen. Ich fragte: »Sag mal, Oma, wer sind diese Damen, sind das Nonnen?«, und sie antwortete: »Nein, das sind Protestanten. Aber es sind gute Menschen.« Meine erste ökumenische Lektion kam also von einer älteren Person. Auf diese Weise hat meine Großmutter mir die Türen zur ökumenischen Vielfalt aufgestoßen. Diese Erfahrung müssen wir an alle weitergeben. Bei der Erziehung der Kinder, der Jugendlichen … Jeder hat seine Identität … Was den interreligiösen Dialog betrifft: Den muss es geben, aber man kann keinen aufrichtigen Dialog zwischen den Religionen etablieren, wenn man nicht von seiner eigenen Identität ausgeht! Ich habe meine Identität und spreche mit meiner Identität. Man nähert sich an, man findet Gemeinsamkeiten, Punkte, in denen man nicht übereinstimmt, aber in den Gemeinsamkeiten kommt man weiter, und zwar zum Wohl aller. Gemeinsam bringt man karitative Werke auf den Weg, Bildungsaktivitäten, viele Dinge. Was meine Großmutter an mir, dem fünfjährigen Kind, getan hat, war ein politischer Akt. Sie hat mich gelehrt, die Tür zu öffnen.
Bei einer Spannung darf man also nicht nach der Synthese suchen, denn die Synthese kann zerstören. Man muss zum Polyeder hinstreben, zur Einheit, die alle Unterschiede, alle Identitäten bewahrt. Der Meister auf diesem Gebiet ‒ denn ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken – ist Romano Guardini.6 Guardini ist meiner Meinung nach derjenige, der das alles begriffen hat, und er erklärt es insbesondere in seinem Buch Der Gegensatz7 – ich weiß nicht, wie die französische Übersetzung heißt, die italienische trägt den Titel L’opposizione polare. Dieses erste Buch, das er 1923 über die Metaphysik geschrieben hat, ist meiner Meinung nach sein Meisterwerk. Was er darin erläutert, könnte man als die »Philosophie der Politik« bezeichnen, aber die Grundlage jeder Politik sind Überzeugung und Nähe. Die Kirche muss also die Türen öffnen. Wenn die Kirche eine Haltung einnimmt, die nicht gerecht ist, dann wird sie proselytisch. Der Proselytismus aber – ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf – ist nicht sehr katholisch! (Lacht.)
Sie müssen aber zugeben, dass der Dialogbegriff, den die Kirche lange Zeit vertreten hat, alles andere als egalitär gewesen ist. Welches Verhältnis besteht zwischen dem Proselytismus und dem interreligiösen Dialog?
Der Proselytismus zerstört die Einheit. Und deshalb heißt interreligiöser Dialog nicht, dass alle sich einigen, nein, sondern dass man gemeinsam unterwegs ist: jeder mit seiner eigenen Identität. Das ist, wie wenn man auf Mission geht, wenn die Schwestern oder die Priester in die Welt hinausgehen, um Zeugnis abzulegen. Genau das ist die Politik der Kirche: ihr Zeugnis. Aus sich herausgehen. Zeugnis ablegen. Erlauben Sie mir, noch einmal kurz auf den Meister Guardini zurückzukommen. Es gibt da auch noch ein ganz kleines Buch über Europa von Przywara, einem der Denker, die ihn inspiriert haben. Aber der Meister der Gegensätze, der bipolaren Spannungen, wie wir sagen, ist Guardini, der uns diesen Weg der Einheit in der Vielfalt lehrt. Was passiert heutzutage mit den Fundamentalisten? Die Fundamentalisten verschließen sich in ihrer eigenen Identität und wollen nichts anderes hören. Auch in der Weltpolitik gibt es einen heimlichen Fundamentalismus. Denn Ideologien können keine Politik machen. Sie helfen beim Denken – man muss die Ideologien übrigens kennen ‒, aber sie können keine Politik machen. Wir haben im letzten Jahrhundert viele gesehen: Ideologien, die politische Systeme hervorgebracht haben. Und die funktionieren nicht.
Was also soll die Kirche tun? Sich mit dem einen oder dem anderen einigen? Das hieße, einer Versuchung nachzugeben, das würde den Eindruck einer imperialistischen Kirche entstehen lassen, die nicht die Kirche Jesu Christi, die nicht die Kirche des Dienens ist.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das nichts mit mir zu tun hat, das Beispiel zweier großer Männer, die ich sehr schätze: Schimon Peres8 und Mahmud Abbas.9 Die beiden waren befreundet, und sie haben oft miteinander telefoniert. Als ich dorthin gereist bin, wollten sie ein Zeichen setzen, aber sie fanden keinen geeigneten Ort für eine entsprechende Geste, denn Abbas konnte nicht in die Nuntiatur nach Jerusalem kommen; und Peres sagte: »Ich würde ja gerne auf palästinensisches Territorium kommen, aber die Regierung wird mich nur mit einer umfangreichen Eskorte dorthin reisen lassen, und das wird als Aggression verstanden werden.« Also haben beide gefragt, ob sie nicht herkommen könnten. Ich überlegte mir, dass ich dieses Treffen nicht gut mit den beiden allein veranstalten konnte, und deshalb habe ich Bartholomaios I. angerufen, den orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel. Und so sind vier Konfessionen zusammengekommen, die bei aller Unterschiedlichkeit doch alle dasselbe wollten, nämlich Frieden und Einheit. Jeder ist mit seinen eigenen Vorstellungen wieder abgereist, aber ein Baum ist geblieben. Wir haben ihn zusammen gepflanzt. Und geblieben ist außerdem die Erinnerung an eine Freundschaft, an eine Umarmung unter Brüdern. In der Politik besteht der Dienst der Kirche darin, Brücken zu bauen: Das ist ihre diplomatische Rolle. »Die Arbeit der Nuntien besteht darin, Brücken zu bauen.«
Und das ist durchaus etwas, das im Zentrum unseres Glaubens steht. Gott Vater hat seinen Sohn gesandt, und er ist die Brücke. »Pontifex«, dieses Wort fasst die Handlungsweise Gottes gegenüber der Menschheit zusammen, und das muss auch die politische Handlungsweise der Kirche und der Christen sein. Bauen wir Brücken. Arbeiten wir. Lassen wir uns nicht dazu hinreißen, zu sagen: »Aber wer bist du denn schon?« Machen wir alles gemeinsam und reden wir miteinander. Auf diese Weise können die Dinge besser werden. Ich habe mich zum Beispiel verpflichtet gefühlt, nach Caserta10 zu reisen und die Charismatiker, die Pfingstler, um Vergebung zu bitten. Dann, als ich in Turin war, habe ich die Notwendigkeit verspürt, mich an die Waldenserkirche zu wenden. Man hat den Waldensern viele schreckliche Dinge angetan, es hat auch Tote gegeben. Um Vergebung bitten: Manchmal entstehen Brücken, wenn man um Vergebung bittet. Oder wenn man die anderen zu Hause besucht. Man muss Brücken bauen wie Jesus Christus, unser Vorbild, der vom Vater gesandt ist, um der »Pontifex« zu sein, der Brückenbauer. Meiner Meinung nach ist das die Grundlage des politischen Handelns der Kirche. Wenn die Kirche sich in die niedere Politik einmischt, macht sie keine Politik mehr.
Eine politische Kirche?
Alle sagen: »Die Kirche macht keine Politik.« Aber die Kirche interveniert, in Ihrer Person und auch vorher in der Person von Johannes Paul II. und Benedikt XVI., und das in allen möglichen Themen: Migranten, Kriege, Grenzen, Klima, Atomkraft, Terrorismus, Korruption, Ökologie … Ist das denn keine Politik? Bis zu welchem Punkt beteiligt sich die Kirche an der Politik, und ab wann handelt es sich um etwas anderes?
Die französischen Bischöfe haben im Herbst 2016 ein pastorales Schreiben veröffentlicht, Retrouver le sens du politique.11 Es knüpft an ein anderes Schreiben an, das sie 15 Jahre zuvor verfasst hatten. Es gibt die große Politik und es gibt die kleine Parteienpolitik. Die Kirche darf sich nicht in die Parteienpolitik einmischen. Paul VI. und Pius XI. haben gesagt, dass die Politik, die große Politik, eine der erhabensten Formen der Nächstenliebe ist. Warum? Weil sie auf das Wohl aller, das Gemeinwohl ausgerichtet ist.
Ja, darin besteht ganz offensichtlich die Größe der Politik.
Aber was die Vielfalt der politischen Parteien betrifft, da darf die Kirche nicht hineinreden. Das ist die Freiheit der Gläubigen.
Ist das der Grund dafür, dass Sie nicht wirklich viel von der Existenz christlicher Parteien halten?
Das ist eine schwierige Frage, ich scheue mich, darauf zu antworten. Ich halte es für gut, dass es Parteien gibt, die die großen christlichen Werte vertreten: Diese Werte dienen dem Wohl der Menschheit. Das ja. Aber eine Partei nur für Christen oder nur für Katholiken, nein. Das ist immer zum Scheitern verurteilt.
Ich glaube, da haben Sie recht. Denn es hat 150 Jahre lang christliche Parteien gegeben, und das Resultat …
Das ist eine Form von »Cäsaropapismus«, da sind wir uns völlig einig. Und das bringt mich auf ein Thema, dass euch Franzosen sehr am Herzen liegt: der Laizismus.
Die Frage des Laizismus stellt sich heute wieder verstärkt, weil der Fundamentalismus eine neuerliche Zusammenführung von politischer Macht und religiöser Macht anstrebt.
Der laizistische Staat ist eine vernünftige Sache. Es gibt einen gesunden Laizismus. Jesus hat gesagt, man soll dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Vor Gott sind wir alle gleich. Aber ich glaube, dass dieser Laizismus in bestimmten Ländern wie zum Beispiel in Frankreich viel zu sehr vom Erbe der Aufklärung geprägt ist. Deshalb konstruiert sie ein kollektives Bild, das die Religionen als Subkultur darstellt. Ich glaube, dass Frankreich – das ist meine persönliche Meinung, nicht die offizielle Position der Kirche ‒ das Niveau des Laizismus ein wenig »anheben« sollte, in dem Sinne, dass es anerkennt, dass auch die Religionen ein Teil der Kultur sind. Was heißt das, laizistisch gesprochen? Dass es sich für die Transzendenz öffnet. Jeder kann seine eigene Art finden, sich zu öffnen. Im französischen Erbe hat die Aufklärung ein zu großes Gewicht. Ich habe Verständnis für dieses historische Erbe, aber es muss erweitert werden, daran muss man arbeiten. Es gibt christliche und nichtchristliche Regierungen, die den Laizismus nicht dulden.
Was heißt das, ein laizistischer Staat, der sich »der Transzendenz öffnet«? Dass die Religionen keine Subkulturen, sondern Teil der Kultur sind. Wenn es heißt, man dürfe kein Kreuz sichtbar um den Hals tragen oder die Frauen dürften dieses oder jenes nicht tragen, dann ist das eine Dummheit. Denn das eine wie das andere steht für eine Kultur. Der eine trägt ein Kreuz, der andere etwas anderes, der Rabbiner trägt die Kippa, der Papst das Scheitelkäppchen! (Lacht.) … Das ist gesunder Laizismus! Das II. Vatikanische Konzil hat sich sehr gut, sehr deutlich dazu geäußert. Ich glaube, dass in diesen Fragen übertrieben wird, vor allem dann, wenn der Laizismus über die Religionen gestellt wird. Gehören denn die Religionen nicht zur Kultur? Sind sie etwa Subkulturen?
Was könnte die Kirche mit all ihrer Erfahrung, ihren Irrtümern und ihren Errungenschaften als Element des Dialogs oder des Miteinanders beitragen? Was kann sie tun, um die zunehmend gewaltsamen Konflikte, die Kriege und den Hass zu überwinden?
Ich kann mich nur auf meine Erfahrung beziehen, auf das, was ich schon gesagt habe: über den Juden, den Orthodoxen und den Palästinenser. Und auch auf das, was ich im November 2015 in der Zentralafrikanischen Republik erlebt habe. Ich bin vor dieser Reise auf so viele Widerstände gestoßen! Aber die Leute dort, auch die Übergangspräsidentin, haben mich gebeten zu kommen. Die Übergangspräsidentin ist praktizierende Katholikin, aber bei den Muslimen sehr beliebt. Sehr beliebt. Ich wollte dorthin, trotz der Sicherheitsprobleme, um zu sagen, was die Kirche zum Beispiel tun kann. In Bangui, im muslimischen Viertel, bin ich in die Moschee gegangen, ich habe in der Moschee gebetet, ich habe den Imam ins Papamobil steigen lassen, um eine Runde zu drehen … Ich sage nicht, dass ich Frieden gestiftet habe, aber ich sage, dass die Kirche solche Dinge tun muss. Es gibt dort einen guten Erzbischof, es gibt einen guten Imam und es gibt einen guten evangelischen Vorsitzenden. Und sie alle drei arbeiten gemeinsam für den Frieden. Alle drei. Sie streiten nicht miteinander.
Was kann man tun, damit das Volk in Frieden lebt? Man muss sagen, dass die Heimat, die Nation und das Volk über den Parteiinteressen stehen. Und für mich ist das ein geopolitisches Prinzip: Das Ganze ist mehr als seine Teile.
Aber was ist der Zweck Ihrer Reisen? Geht es um Frieden, um Kommunikation oder um Verhandlung? Warum machen Sie so viele Reisen und sprechen dabei unablässig von Gewalt, Frieden, Verhandlung?
Ich sage immer, dass ich als Pilger dorthin reise, um zu lernen – als Pilger des Friedens. Sie haben ein Wort verwendet, das ich früher nicht verwendet habe: Verhandlung. Verhandeln. Ich habe es neulich gebraucht, bei einem Treffen zwischen Unternehmern und Arbeitern in Ciudad Juárez: Wenn wir uns an den Verhandlungstisch setzen, tun wir das in dem Bewusstsein, in der Gewissheit, dass man bei einer Verhandlung immer etwas verliert, aber dass alle gewinnen.12 Das Verhandeln ist ein Instrument des Friedens, und man nimmt mit dem Ziel daran teil, so wenig wie möglich zu verlieren … Man verliert immer etwas, wenn man verhandelt, aber alle gewinnen, und das ist etwas sehr Gutes. Man gibt, christlich gesprochen, ein kleines Stück seines eigenen Lebens für das Leben der Gesellschaft hin, das Leben aller. Verhandeln, das ist wichtig.
Wie sehen Sie in diesem Kontext das, was Sie die »Neuevangelisierung« nennen? Was für ein Verhältnis besteht zwischen dem einen und dem anderen?
Ich greife noch einmal auf, was ich vorhin schon gesagt habe: Evangelisieren heißt nicht, Proselytismus zu betreiben. Und das ist ein Satz von Benedikt XVI. Benedikt XVI. hat gesagt – zuerst in Brasilien, in Aparecida, und auch danach noch des Öfteren ‒, dass die Kirche nicht durch Proselytismus, sondern durch Anziehung wächst.13 Mit der Politik ist es genauso. Einer ist Katholik, einer Protestant, einer Muslim, der andere Jude, aber sie wächst durch Anziehung, durch Freundschaft … Brücken, Brücken und wieder Brücken … In bestimmten Situationen muss man verhandeln, weil es kein anderes Mittel gibt. Aber das ist auch eine Frage der politischen Demut. Tun wir, was wir können, und gehen wir so weit, wie wir dürfen …
Meiner Meinung nach sind die größten politischen Gefahren derzeit die Vereinheitlichung und die Globalisierung. Und dann ist da noch etwas Schreckliches, das gerade geschieht: die ideologischen Kolonialisierungen. Es gibt Ideologien, die um sich greifen … Die afrikanischen Bischöfe haben es mir mehrmals gesagt: »Unser Land hat einen Kredit bekommen, aber die Konditionen, die uns aufgezwungen worden sind, stehen im Gegensatz zu unserer Kultur.« Hier ist eine verheerende Ideologie am Werk, und das erkläre ich sowohl in Evangelii gaudium14 als auch in Laudato si’.15 Im Zentrum von alledem steht die Ideologie des Idols, des »Götzen Geld«, der alles beherrscht. Stattdessen müssen der Mann und die Frau wieder ins Zentrum und das Geld muss in den Dienst ihrer Entwicklung gestellt werden. Afrika, das schon immer ein ausgebeuteter Kontinent gewesen ist, wird nun von Ideologien erneut kolonialisiert! Als wäre es Afrikas Schicksal, ausgebeutet zu werden!
Wenn ein Teil der Priester oder sogar der Episkopate sich gegen schädliche Auswirkungen der Globalisierung wendet, dann läuft ihr politisches Handeln Gefahr, den Boden des Evangeliums zu verlassen und sich Seite an Seite mit dem politischen Handeln des Sozialismus oder des Marxismus wiederzufinden. Wie zum Beispiel die von Rom kritisierte Befreiungstheologie. Wie lässt sich die Distanz zwischen politischem Handeln und spiritueller Dimension wahren?
Die Befreiungstheologie ist eine Art und Weise, die Theologie zu denken, die wiederholt Anleihen bei nichtchristlichen Ideologien wie dem Hegelianismus oder dem Marxismus gemacht hat. In den 1980er-Jahren hatte man einen Hang zur marxistischen Wirklichkeitsanalyse, und die hat man dann einfach umbenannt in »Volkstheologie«. Ich mag diesen Namen nicht so sehr, aber unter diesem Namen habe ich sie kennengelernt. Mit dem Volk Gottes gehen und die Theologie der Kultur betreiben.
Es gibt einen Denker, den Sie lesen sollten: Rodolfo Kusch,16 einen Deutschen, der im Nordwesten von Argentinien gelebt hat, ein sehr guter anthropologischer Philosoph. Er hat mich eines verstehen lassen: Das Wort »Volk« ist kein logisches Wort. Es ist ein mythisches Wort. Sie können nicht im logischen Sinne von Volk sprechen, denn das wäre nicht mehr als eine Beschreibung. Um ein Volk zu verstehen, um die Werte dieses Volkes zu verstehen, muss man sich auf den Geist, das Herz, die Arbeit, die Geschichte und den Mythos seiner Tradition einlassen. Dieser Punkt ist das eigentliche Fundament der sogenannten »Volkstheologie«. Das heißt, mit dem Volk zu gehen, zu sehen, wie es sich ausdrückt. Diese Unterscheidung ist wichtig. Und es wäre gut, wenn Sie als Intellektueller diese Idee von einer mythischen Kategorie weiterentwickeln würden! Das Volk ist keine logische Kategorie, es ist eine mythische Kategorie.
»Mit Frieden gewinnt man alles«
Inwiefern hilft Ihnen Ihre Erfahrung aus Lateinamerika, die Widersprüche der Globalisierung besser zu verstehen? Hat Lateinamerika in dieser Hinsicht ein besonderes historisches, politisches oder kulturelles Potenzial? Und wenn ja, wie beeinflusst das Ihren Blick auf die Globalisierung und die wirtschaftliche Globalität, die Ausbeutung, die Zerstörung kultureller Identitäten usw.?
Seit dem »Dokument von Aparecida«17 ist es Lateinamerika sehr deutlich bewusst geworden, dass man die Erde schützen muss. Nehmen wir zum Beispiel die Entwaldung. Das Amazonasgebiet – das ganze Amazonasgebiet, nicht nur der brasilianische Teil – ist einer der beiden Lungenflügel der Menschheit. Der andere ist der Kongo. Sie reagieren allmählich. Die Minen sind ebenfalls eine Gefahr, mit dem Arsen, dem Zyanid. Und das alles verschmutzt die Gewässer. Da ist etwas, das meiner Ansicht nach sehr schwerwiegend ist … Ich treffe hier jeden Dienstag mit Kindern zusammen, die an seltenen Krankheiten leiden. Aber woher kommen diese seltenen Krankheiten? Von atomaren Abfällen, von Altbatterien … Man spricht auch von elektromagnetischen Wellen.