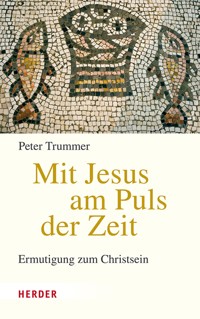
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Kirchenkrise ist nicht nur besorgniserregend, sie bietet auch die Chance einer Neubesinnung auf das Christliche, grundlegend Jesuanische. Denn am Prüfstand steht die Deutung des Kreuzes als Sühneopfer, welche den Glauben Jesu verdunkelt, während seine Symposien und Gastmähler mit den Outsidern die bedingungslose, opferfreie Liebe Gottes für alle bezeugen. Deswegen wird in der frühen Kirche das "Brotbrechen" (und nicht das Abendmahl) zur sich selbst erklärenden, authentisch-jesuanischen Geste, an der sein Geist und seine Gegenwart erkannt werden (Lk 24,35). Die dazu ermutigenden 16 Essays führen "Den Herzschlag Jesu erspüren. Seinen Glauben leben" (Freiburg 2021) weiter; sind ursprünglich im Zeitungsformat konzipiert, können aber auch als Buch kreuz und quer gelesen werden. So ernst die Sache ist: Der Ton macht die Musik, auch im Glauben. Ihn wollte der Autor möglichst wortgetreu am biblischen Original liebevoll und freimütig zur Sprache bringen .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Abbildung auf dem Umschlag
Ausschnitt aus einem Mosaik (frühes 5. Jahrhundert) in der Brotvermehrungskirche in Tabgha („Siebenquell“) nahe Kafarnaum am See Gennesaret (dazu u. S. 55, 107 und 117).
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2024
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder, Freiburg i. Br.
Umschlagmotiv: © LiorFil/GettyImages
Satz: B. Herrmann, Freiburg i. Br.
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN (Print) 978-3-451-39790-5
ISBN E-Book (EPub) 978-3-451-83790-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83490-5
FürDora Ruth,Ivo und Damaris,Naomi, Simon und Noah,die mir ein Segensind
Inhalt
Vorwort
1. Éffata – öffne dich! Ein jesuanisches Lebensprogramm
2. Weihnachten – interkulturell
3. Erlöster müsstet ihr aussehen!
4. Wenn Jesus Abba sagt
5. Der Jude Jesus, sein Land, seine Zeit
6. Wer war Jesus? Ein Zwischenruf
7. Wer kann Sünden vergeben?
8. Liebe will ich, nicht Opfer
9. Gastfreundschaft oder Messopfer?
10. Was bedeutet „Wandlung“?
11. Sorge um die Kirche – paulinisch betrachtet
12. Angst. Sorgen. Loslassen
13. An Jesus glauben oder mit Jesus glauben?
14. Liturgie im Wandel
15. Wie Hauskirchen feiern
16. Am Puls der Zeit
Nachweis der Erstveröffentlichung
Bibelstellenregister
Zu den verwendeten Bibelübersetzungen
In den folgenden 16 Kapiteln gebe ich Bibeltexte in möglichst wortgetreuer eigener Übersetzung wieder. Daneben zitiere ich (1) die katholische Bibelübersetzung in ihrer revidierten, aktuellen Fassung (Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständige durchgesehene und überarbeitete Ausgabe, 2016) sowie in ihrer ursprünglichen (ersten) Fassung 1980 (abgekürzt: EÜ 1980 bzw. 2016) und (2) die evangelische Lutherbibel, aktuell in der revidierten Fassung von 2017 (abgekürzt: Luther).
Vorwort
Die Kirchenkrise ist nicht nur besorgniserregend, sie bietet auch die Chance einer Neubesinnung auf das Christliche, grundlegend Jesuanische. Denn am Prüfstand steht die Deutung des Kreuzes als Sühneopfer, welche den Glauben Jesu verdunkelt, während seine Symposien und Gastmähler mit den Outsidern die bedingungslose, opferfreie Liebe Gottes für alle bezeugen. Deswegen wird in der frühen Kirche das „Brotbrechen“ (und nicht das Abendmahl) zur sich selbsterklärenden, authentisch-jesuanischen Geste, an der sein Geist und seine Gegenwart erkannt werden (Lk 24,35).
Die dazu ermutigenden Essays führen „Den Herzschlag Jesu erspüren. Seinen Glauben leben“* weiter; sind ursprünglich im Zeitungsformat konzipiert, können aber auch als Buch kreuz und quer gelesen werden.
So ernst die Sache ist: Der Ton macht die Musik, auch im Glauben. Ihn wollte ich, liebe Leserinnen und Leser, möglichst wortgetreu am biblischen Original, liebevoll und freimütig zur Sprache bringen und Sie zum Mitschwingen einladen.
Graz, Ostern 2024
Peter Trummer
* Freiburg (Herder) 2021, 4. Auflage 2023.
1 Éffata – öffne dich! Ein jesuanisches Lebensprogramm
Es ist eines der seltenen aramäischen Worte im Neuen Testament (Mk 7,34): Da wird ein Tauber und mühsam Redender zur Handauflegung zu Jesus gebracht, doch dieser separiert ihn von der Menge, sucht einen intimen Ort, „‚warf‘ ihm seine Finger in die Ohren, und berührte spuckend seine Zunge, schaute zum Himmel auf, seufzte und sagt ihm: Éffata“. Die archaische Szene spielt an der Ostseite des Sees Gennesaret, wo kaum aramäisch gesprochen oder verstanden wird, und dasselbe gilt für die Adressatinnen und Adressaten des Evangeliums. Also fügt es die griechische Erklärung des fremden Wortes an und deutet es als: „öffne dich“, eigentlich genauer: öffne dich durch und durch bzw. lass dich öffnen, und zwar nach oben hin (di-an-oíchthēti). Es geht nicht nur um ein aktives Tun, sondern um ein Geschehen, das die gesamte Kommunikation betrifft: Nicht nur „seine Ohren (eigentlich: „Hörfähigkeiten“) öffneten sich ganz, auch die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig“ (Mk 7,35).
Der Mund (hebräisch: peh) ist in der Bibel die (Körper-)Öffnung schlechthin: Aus ihm ertönt die Sprache, und soll eine Rede bedeutungsvoll sein, beginnt sie feierlich: „er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach“ (Mt 5,2). Diese offene Rede (griechisch: parrhēsía, die eigentlich „jedes Wort“ meint) ist Kennzeichen der jesuanischen Verkündigung, nicht nur der Bergpredigt. Sie ist wirkmächtig, weil authentisch („aus dem Sein heraus“: ex-ousía), bedarf nicht unbedingt einer Schriftgelehrsamkeit oder besonderen „göttlichen“ Vollmacht (wie die Einheitsübersetzung bis zur Revision 2016 zu Mt 7,29 meinte), und sie macht frei.
Diese Sprache kennt keine Tabus: „Alles, was durch den Mund eingeht und im Leib Raum findet, wird in den Abort ‚hinausgeworfen‘“ (Mt 15,17). Dass alles funktioniert, ist nicht selbstverständlich. Deswegen dankt das jüdische Morgengebet für die vielen Öffnungen und Körperhöhlungen und bedenkt, „wenn eine von ihnen offen oder eine von ihnen verschlossen bliebe“, wäre es mit dem Leben vorbei: „Gelobt seist du, Ewiger, der alles Fleisch heilt und wunderbar wirkt“.
Unmittelbar über dem Mund sitzen die Nasenlöcher und eröffnen einen ganzen Kosmos an Düften und Gefühlen. Es macht viel aus, ob wir jemand „riechen“ können oder nicht. Woraus auch der Glaube entstand, dass man den vermeintlichen Zorn der Götter, der in ihren Nasen sitzt, durch Rauch- und Brandopfer besänftigen könne. Es war ein falscher Riecher: Gott hat keine Opfer nötig. Wir müssen nicht seine Nase kitzeln, um ihn aufzuheitern oder bei Laune zu halten.
Keine typische Heilungsgeschichte, sondern eher spätere Legendenbildung ist die Schwertattacke bei der Verhaftung Jesu, wonach Petrus (Joh 18,10f) bzw. ein unbekannter Jünger (Lk 22,50f) einem Knecht des Hohepriesters (bei Johannes heißt er Malchus, eigentlich „König“) das rechte Ohr abschlägt. Was Jesus entschieden zurückweist und das Ohr nach Lukas durch eine Berührung heilt. Für Johannes, der dem treulosen Petrus nachträglich wohl noch etwas Tapferkeit bescheinigen möchte, ist dies kein erzählenswertes „Zeichen“ Jesu (wovon er sieben auswählt). Heilungswunder gehen anders, besonders bei Johannes. Sein Jesus schlägt sich auch nicht mit Dämonen herum.
Das eingangs erwähnte Éffata begleitet die Heilgeste der ins Ohr gelegten Finger und weist so dem Hören eine neue Richtung. Ansonsten gleichen die synoptischen Heilungen von Tauben eher Dämonenaustreibungen (Mt 9,32f; 12,22; Mk 9,25f; Lk 11,14), ein Hinweis, dass es sich mehr um Geisteshaltungen als um körperliche Behinderungen handelt. Häufig findet sich die Mahnung: „Wer Ohren hat, höre“ (Mt 11,15 u. a.) bzw. bringt ein Prophetenzitat Jesu Frustration zum Ausdruck, dass er nicht verstanden wird, weil das Herz der Hörerinnen und Hörer wohlgenährt/undurchlässig ist und folgedessen schwer hört (Jes 6,9f/Mt 13,14f).
Die Augen stehen nicht nur im Körper, sondern auch im Wirken Jesu ganz zuoberst. Das Sehen ist unser am weitesten reichender Sinn, aber auch seine Fehleinschätzungen sind äußerst weitläufig und nachhaltig, denn sie gehen in beide Richtungen: Im Hebräischen bedeutet das Auge auch die Quelle (’áyin, neuhebräisch en), ist also nicht bloß Rezeptor des Außen, sondern Projektor der Innenwelt, während wir eher an der Objektivität dessen festhalten wollen, was wir „mit eigenen Augen“ gesehen haben.
Womit wir uns dem zentralen Motiv des „Augen-Öffnens“ nähern. Doch in der Bibel ist „blind“ nicht gleich blind, sondern meint Menschen ohne wirkliche Erkenntnis und Einsicht. Schon der Prophet Jesaja nennt das Volk blind, spricht von „Augen, die wie blind sind, und von Tauben, die Ohren haben“ (Jes 43,8 griechisch) oder: „Unwissend sind sie und ohne Verstand; / denn ihre Augen sind verklebt, / sie sehen nichts / und ihr Herz hat keine Einsicht“ (Jes 44,18 EÜ 2016). Auch Jesus bezieht sich auf solch geistige Blindheit (Jes 6,10; Jer 5,21; Mt 13,14f; Mk 8,18; Joh 9,41). Außerdem würde ein Semite organisch Blinde nie als solche ansprechen, sondern eher blumig als besonders scharf- oder einsichtig umschreiben. Mit gutem Grund. Denn Menschen, die durch die Augenlust oder den Augenschein nicht mehr verführbar sind, müssen sich tiefere Erkenntnisquellen erschließen. Zudem ist Blindheit im Neuen Testament kein gelegentliches Einzelschicksal, sondern eher ein kollektives, gesellschaftliches Phänomen. Der Blindgeborene (Joh 9) ist kein „Mann“ (EÜ), sondern der Mensch (ánthrōpos) schlechthin (richtig: Luther): Alle, die auf (in) die Welt kommen, sind mehr oder weniger blind, bis sie dem „Licht der Welt“ begegnen, das sie erleuchtet (Joh 1,9; 8,12).
Diese Erleuchtung wird mit ‚aufschauen‘ (ana-blépō) oder als ‚auföffnen‘ (an-oígō) beschrieben. Ersteres hatte die Einheitsübersetzung zuerst als „wieder sehend werden“ interpretiert, nicht nur innerhalb der Synopse (Mt 20,34; Mk 10,53), sondern versehentlich auch beim Blindgeborenen (Joh 9,11). Die Revision von 2016 hat das „wieder“ überall getilgt, vernachlässigt aber (außer in Mk 8,24) die Vorsilbe aná, welche die Übersetzung „aufschauen“ nahelegt. Es ist mehr als nur „sehend werden“, denn es geht um den Blick nach oben, den auch Jesus selbst teilt (Mk 6,41; 7,34). Also reicht das klassische Verb ‚öffnen‘ (oígō) nicht mehr aus, sondern wird zum „Auf-öffnen“ (an-oígō). Erst dieser Blick nach oben führt zu einem aufrichtenden Gottesbild, macht jenes Auf(er)-stehen möglich, das zum Aufstand wird, der selbst gegen den Tod angeht.
Das meint auch das zweite aramäisch überlieferte Heilungswort Jesu: Talíta kum (Mk 5,41), welches griechisch als: „Mädchen wach auf/richte dich auf“ (égeire) gedeutet wird. Es wird keiner Toten in unserem Sinn gesagt, sondern der 12-jährigen Jaΐrustochter, die (angesichts der religiösen Autorität ihres Vaters?) nicht auf die eigenen Füße kommt, handelt also von Tod und Stillstand mitten im Leben, und nicht von seinem definitiven Ende.
Das Neue Testament beschränkt sich nicht auf die Blindenheilungen von Betsaída (Mk 8,22), Bartimäus (Mk 10,46; bei Mt 9,27; 20,30 jeweils verdoppelt) bzw. den Blindgeborenen (Joh 9), es bietet auch eine reflektierte Erkenntnislehre an. Dabei spricht die Bergpredigt vom „einfachen“ (haploús) bzw. vom „bösen“ (ponērós) Auge (Mt 6,22f). Die Einheitsübersetzung hat daraus unverständlicherweise ein „gesundes“ bzw. „krankes“ Auge gemacht (richtig Luther). Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg spricht dagegen (Mt 20,15): Es ist der von den Orientalen gefürchtete „böse (neidische) Blick“, der nicht nur den ganzen Leib, sondern die Weltsicht verfinstert (mit evidenten Folgen auch für die eigene Gesundheit).
Das einfache Auge ist das Gegenteil des bösen und meint so etwas wie ‚schlicht, geradlinig‘, eine Sichtweise ohne Hintergedanken. Bezeichnenderweise spricht die Bergpredigt vom Auge immer in der Einzahl, wohl darum, weil wir die unterschiedlichen Bilder, welche unsere beiden Augen liefern, zu einem dreidimensionalen Bild zusammenfügen müssen. Auch müssen wir uns von den oft verwirrenden Vorurteilen und Eindrücken immer wieder lösen, um entscheidungs- und handlungsfähig zu werden, was die Hermeneutik die „zweite Naivität“ (erstmals Peter Wust 1925 bzw. Paul Ricoeur [† 2005]) nennt.
Lange vor jeder Tiefenpsychologie hat Jesus die Projektion mit dem Paradox von „Splitter und Balken“ (Mt 7,1–5) auf den Punkt gebracht. Dabei werden die eigenen unliebsamen Persönlichkeitsanteile (der „Schatten“) den anderen (besonders Gleichgeschlechtlichen) angelastet und Feindbilder geschaffen, die nicht nur schweres Unrecht tun, sondern auch die eigenen und eigentlichen Probleme unerledigt lassen. Nicht ohne Ironie lässt Jesus im Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ (besser: vom gütigen Vater) den älteren Bruder sich über die Huren des Jüngeren alterieren, von denen doch überhaupt nicht die Rede war (Lk 15,30).
Die Feindbilder stehen der von Jesus geforderten Feindesliebe diametral entgegen. Doch erst sie macht uns, wie auch das Friedenstiften, Gott ähnlich, „der seine Sonne aufstrahlen lässt über Böse und Gute“ (Mt 5,9.43–48). Beide Tugenden gehören eng zusammen, denn indem wir unsere Feindbilder abarbeiten und auflösen, werden wir konflikt- und friedensfähig, werden wir nichts weniger als „Töchter und Söhne Gottes“, was die Einheitsübersetzung jedoch als „Kinder Gottes“ verharmlost. Es ist ebenso ernst gemeint wie bei Jesus selbst, der sich seit der Taufe als „geliebter Sohn“ (Mt 3,17) versteht.
Aber die Bösen zuerst? Ja. Sie sind Gottes besondere „Sorgenkinder“ (vgl. Lk 15,7). Denn wenn sein Wesen wirklich Güte und Barmherzigkeit ist (was die semitischen Sprachen mit dem Plural des Mutterleibes bzw. der Mutterliebe als rachamím beschreiben), dann kann er seine (oder genauer: unsere) Feinde nicht wirklich hassen, auch wenn er unter deren Bosheit am meisten leidet und mit den Opfern der Gewalt mitleidet (was Sympathie wörtlich bedeutet). Deswegen ist es absurd, Jesus eine ewige Hölle zuschreiben zu wollen, auch wenn er öfters bildhaft auf den rauchenden Müllplatz Jerusalems Bezug nimmt (Mt 5,22.29 u. a.). Doch neben seinem guten Ábba-Gott (sprich ‚Papa‘: Mk 14,36) hat ein Teufel als bleibender Gegenspieler keinen Platz. Es war eine perfide Idee Kaiser Justinians, seine Macht per Dekret im Jahr 543 gleichsam auf jenseitige Höllenqualen auszuweiten und durch das gleichzeitig tagende Konzil bestätigen zu lassen. Dass er damit einen Ort definierte, von dem er Gott auf ewig ausschloss, störte ihn nicht.
Die Ewigkeit der Hölle ist damit freilich noch lange nicht ausgemacht. Zwar geistert sie seit Dante Alighieris (1265–1321) „Divína commédia“ (Göttliche Komödie) durch die europäische Malerei und Literatur, aber es ist übergriffig zu behaupten, dass irgendjemand wirklich drinnen sei. Die ominöse „Vorhölle“ (der límbus puerórum) für ungetaufte Kinder wurde 2007 als „nicht mehr sinnvoll“ lehramtlich entsorgt (vgl. Kap. 16). Die Hölle sollte ihr alsbald folgen. Denn wenn uns etwas „auf ewig“ schmerzen sollte, dann ist es kein physikalisches Höllenfeuer, sondern unsere Einsicht angesichts der Liebe Gottes, dass wir zu wenig geliebt haben.
Es gibt also noch genug blinde bzw. dunkle Flecken des Glaubens aufzuhellen. Dabei setzt der Epheserbrief auf „erleuchtete Augen des Herzens, um den Reichtum unserer Hoffnung zu erkennen“ (Eph 1,18f). Öffnen ist angesagt, und zwar in vielerlei Hinsicht:
– in Bezug auf den Mund, um „Gesicht zu zeigen“, Freundlichkeit zu vermitteln, das rechte Wort zur rechten Zeit zu sagen
– die Ohren, um auch die leisen Stimmen wahrzunehmen, immer beide Seiten zu hören, um gerecht urteilen und in Beziehung bleiben zu können
– die Hände, die zur Faust geballt oder verkrampft sind, zu lösen, gewaltfrei und freigebig zu werden in jeder Hinsicht und Beziehung
– mit den Augen das Wesentliche suchen, das Unsichtbare nicht verleugnen, Projektionen zurücknehmen
– die Grenzen, die oft nur in unseren Köpfen existieren, auszuweiten bzw. ganz still zu legen
– die Arme auszubreiten und unser Gegenüber „von Herzen“ zu umarmen
– alle Körperöffnungen (einschließlich der Poren als „Wege“ durch die Haut) durchlässig zu halten und abzugeben, was nicht mehr (auch geistig) nährt
– das Herz nicht zu verhärten oder einzuengen, um zu lieben, Schuld zu vergeben, Kränkungen und Sorgen loszulassen
– die Gräber zu ‚öffnen‘, um die Toten aus unseren steinbeschwerten Gedankengrüften herauszurufen und ins himmlische Vaterhaus ‚weggehen‘ zu lassen (Joh 11,44)
– die Hölle als schlechten Kinderschreck verlachen, weil das Böse keinen Bestand mehr haben kann, wenn „Gott alles in allem“ ist (1 Kor 15,28)
In Summe: Wir müssen unser Gottesbild ‚total verändern‘ (kat-allássein: 2 Kor 5,18ff), unser hochgerechnetes Über-Ich entthronen. Jesus hat am Kreuz nichts für uns „gesühnt“, sondern – wie schon mit den anstößigen Tafelrunden – seinen Glauben an Gottes bedingungslose Güte und Gastfreundschaft bezeugt. Das verlangt eine behutsamere Rede von Gott als bisher, wo vor allem das schlechte Gewissen der Gläubigen am Köcheln gehalten werden sollte. Dabei kommt der Glaubensvermittlung eine unersetzliche Bedeutung zu. Denn alles, was wir von Gott denken, hat Auswirkungen auf die Menschen, egal ob sie daran glauben können oder nicht. Religion ist also nie nur Privatsache, sondern von öffentlichem Interesse. Auch eine wissenschaftlich redliche Theologie ist und bleibt notwendig, wenn wir an den Übergängen des Lebens nicht schweigend und hilflos nebeneinander stehen, sondern zu einer solidarischen, mitfühlenden Gemeinschaft zusammenfinden wollen, während religiöser Fanatismus nur Trennung und Gewaltbereitschaft nach sich zieht.
Das bedeutet: Nur durch eine offene, dialogische, ökumenische, interkulturelle und (im Sinne einer theología negatíva) a-theistische Verkündigung lassen sich die unseligen Ausgrenzungen und Feindseligkeiten im Namen Gottes und der vermeintlich einzig wahren Religion abbauen und auch der staatliche Religionsunterricht als unverzichtbare öffentliche Erziehungsleistung rechtfertigen.
Schon die Weihnachtsbotschaft gilt nicht nur den Christen und Christinnen, sondern allen Menschen, und zwar unterschiedslos: Jedes Kind ist ein Geschenk des Himmels mit allen Menschenrechten und göttlicher Würde, nicht nur das Krippenkind Jesus! Konsequent heißt es im Refrain meines Weihnachtsliedes „Hirtenweise – Weise Hirten“*:
„Ehre sei Gott in den Menschen auf Erden,
Friede und Glück soll heut’ allen werden!“
Es geht darum, dass wir die „Menschwerdung Gottes“ nicht mit Christi Himmelfahrt für beendet erklären, sondern in jedem Menschenkind erkennen und daraus die Konsequenz ziehen, dass wir Gott nur in den Menschen, und zwar in allen und jedem einzelnen, verehren können und müssen (vgl. Kap. 2). Das „Ehre sei Gott in der Höhe“ war da viel zu unverbindlich. Statt des vorbehaltlosen göttlichen Wohlwollens (eu-dokía) für die Menschen (Lk 2,14) haben wir nur denjenigen, die unserer Meinung nach „guten Willens“ (bónae voluntátis) waren, den Frieden zugesprochen. Da ist der Friede Gottes immer noch viel großzügiger als wir. Wir können noch eine ganze Menge von ihm lernen.
* „Hirtenweise – Weise Hirten“ Text und Komposition: Peter Trummer (Kultum Graz), s. Youtube.
2 Weihnachten – interkulturell
Die Jahreszählung vor bzw. nach Christi Geburt ist oft noch das Einzige, was die Welt heute an Jesus erinnert. In Wirklichkeit liegt sie etliche Jahre davor. Paradox, aber verzeihlich, denn es war schwierig genug, die diversen Kalender der Antike zu synchronisieren, und es dauerte noch Jahrhunderte, bis das Ergebnis sich allgemein durchsetzte, ohne die alten Chronologien nach der Bibel, den Olympiaden oder „seit der römischen Stadtgründung“ (ab úrbe cóndita) ganz zu verdrängen. Das genaue Lebensalter zu kennen war noch lange nicht selbstverständlich, auch die Steuerlisten nennen es oft nur „ungefähr“ (wie in Lk 3,23 für Jesus). Und obwohl Geburtstagspartys zumindest in höheren Kreisen durchaus üblich sind (Mk 7,21), bekunden die Kindheitsgeschichten der Evangelien keinerlei Interesse am Geburtstag Jesu.
Schwieriger gestaltet sich die Frage, womit die christliche Zählung ihre Allgemeingültigkeit begründen kann. Ende des 4. Jahrhunderts wurde der altrömische Tag der unbesiegten Sonne so gedeutet, dass mit Jesus „das Licht in die Welt kam“ (Joh 1,9). Das war argumentierbar, weil das Christentum, obwohl noch eine Minderheit, von seiner Umwelt als innovativ wahrgenommen wurde. Der Sonntag als Tag der Auferstehung wurde bereits im Jahr 321 per Gesetz arbeitsfrei gestellt, eine Errungenschaft der Menschheit, die wir nicht leichtfertig über Bord werfen sollten, am allerwenigsten vor Weihnachten.
Auch das Dogma bildet weniger die Wahrheit ab als die Herrschaftsverhältnisse. Das kündigt sich bereits im Weihnachtsevangelium an, wo der (historisch umstrittene) weltweite Steuerzensus des Augustus um Jesu Geburt herum ein dógma genannt wird (Lk 2,1). An sich ist ein schlichtes: ‚Es scheint mir‘ (dokeí moi) im Griechischen Ausdruck der persönlichen Meinung, aber die des „Kaisers“ (wie das Evangelium den selbsternannten prímus ínter páres outet) ist Befehl und Gesetz, egal ob es sich um Steuern oder um den Glauben handelt.
Zum historischen Kontext: Einen Diktator sah die römische Verfassung nur für Notzeiten vor. Daher war der Umsturz von der (aristokratischen) Demokratie zur absoluten Monarchie seit Cäsar hoch riskant und blieb es noch ein gutes Jahrhundert lang: Tyrannen sind zu ermorden. Oktavian suchte sich und seine monarchischen Bestrebungen mit dem religiösen Titel ‚Erhabener‘ (augústus) zu schützen, die Münzprägung feiert ihn als „Sohn“ der (neben Jupiter) höchsten römischen Staatsgottheit Divus, zu der Cäsar bald nach seiner Ermordung erhoben wurde: DIVI F(ílius) steht auf seinem Denar, geprägt um die Zeitenwende, gefolgt vom „Vater des Vaterlandes“.
Betlehem ist das reine Gegenprogramm: Ein „in Windel gewickelter Säugling“ (bréphos) – die spätere Verehrung hat sie zum Glück nicht weggemacht – wird „in eine Futterkrippe“ gelegt, „weil für sie kein Ort in der Herberge war“ (Lk 2,7). Verachtete Hirten sind seine ersten Fans, bei Matthäus „Magier von (Sonnen)Aufgängen“, die ihn anbeten (Mt 2,11). Und das zu einer Zeit, wo der römische Paterfamilias noch über Leben und Tod der Neugeborenen entscheidet, ein Gewohnheits- ,recht‘, das erst ab der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts zurückgedrängt wird. Erstmals in der Weltgeschichte wird ein Kind als ‚göttlich‘ erkannt und angebetet.
Drei Jahrhunderte später bestellt ein römischer (noch ungetaufter) Kaiser die christlichen Bischöfe in seinen Sommerpalast in Nizäa ein und lässt Jesus mit Gott für „wesensgleich“ erklären. Eine Win-win-Strategie, ein Upgrade seiner eigenen Würde, denn gleich nach Jesus kommt er (vgl. Kap. 13). Doch der Duft des Palastes infiltriert auch das Gottesbild. Jesus nimmt als ‚Allherrscher‘ (pantokrátōr) die Züge des Kaisers an. Und bis heute beginnen unsere Gebete mit: Allmächtiger ewiger Gott. Aber wo bleibt die Menschwerdung?
Die christliche Theologie hat sich lange redlich bemüht, Jesu Gottesbeziehung näher zu beschreiben und kam auf das herrschaftsfreie Beziehungsmodell einer Dreifaltigkeit auf Augenhöhe. Das war nicht reines Wolkenschieben, sondern hat maßgeblich dazu beigetragen, auch Frauen und Kinder allmählich als Personen (und nicht als Eigentum und Befehlsempfänger/-innen) wahrzunehmen (die Sklaven und Sklavinnen fielen noch länger unter das Sachenrecht). An der praktischen Durchsetzung jedoch mangelt es allerorten, bis heute. Auch die Allgemeinen Menschenrechte stehen erst seit 1948 auf dem Papier (das ausgerechnet der Vatikan nicht unterzeichnet), sind aber rechtlich nicht bindend. Die Mächtigen haben zu viele Ausreden und Verkleidungen.
Eine relativ harmlose Verkleidung bedient sich auch der Kindheitsgeschichte bei Matthäus, der Jesu Geburt nur in einem Nebensatz erwähnt: Die anbetenden „Magier“ mutieren zu unseren „Drei Königen“ (für deren Reliquien der Kölner Dom erbaut wurde), ihre Zahl wird aus den „Geschenken: Gold, Weihrauch und Myrrhe“ (Mt 2,11) gefolgert, die Namen werden nachgereicht. Im christlichen Mittelalter signalisieren sie den Herrschern, dass sie vor Jesus knien sollen (bzw. von seinem „Stellvertreter auf Erden“ ihre Macht empfangen), seit den 1950er Jahren gehen sie von Haus zu Haus und sammeln Geschenke für Menschen, die wir zuvor arm gemacht haben.
Auch der hochgestochene Streit um den Gottessohn ist im Grunde ein Streit um sehr handfeste irdische Macht (auch innerhalb der Kirche). In der Bibel klingt alles noch ganz anders. Für sie ist eine Weltbeschreibung ohne Familienbegriffe undenkbar (vgl. Kap. 9), aber sie weiß auch, dass die geistige Welt Gottes sich unserem Begreifen entzieht. Adám z. B. ist kein Eigenname, sondern ‚der Mensch‘ (als Gattung, männlich und weiblich), ein einzelner Mensch ist ein Menschensohn (ben-adám), ein Sternensohn (wie Bar Kochba, der Führer des zweiten jüdischen Aufstandes von 132 bis 135 n. Chr. sich nannte) ist ein Star, ein Sohn des Lichts nicht aus Licht gezeugt/geboren, sondern im Charakter freundlich, hell, ein Sohn/eine Tochter der Weisung (bar/bat mitzwá) orientiert sich an der göttlichen Weisheit (die wir als Gebot bzw. Gesetz missdeuten).
Jesus hat Gott mit dem kleinkindlichen aramäischen Ábba (Papa) angesprochen und wollte, dass wir es ihm gleichtun (Mt 6,9; vgl. Kap. 4). Doch das Dogma blockte ab. Einzig Jesus ist der wirkliche Gottessohn, „gezeugt, nicht geschaffen“. Er entstammt einer (biologisch immerwährenden) „Jungfrau“ + Heiligem Geist (obwohl Gal 4,4 bekennt: „geworden aus einer Frau“; vgl. Kap. 6





























