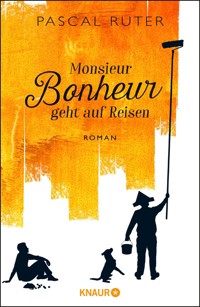
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein bewegender und dabei leichtfüßig daherkommender Roman von Pascal Ruter aus Frankreich Die rührende Geschichte eines Enkels und seines an Demenz erkrankten Großvaters, deren Rollen sich langsam umkehren - "Honig im Kopf" in Romanform! Léonard vergöttert seinen Großvater Napoléon, den er »General« nennt, weil »Opa« so alt klingt. Daran ändert sich auch nichts, als Napoléon sich überraschend von seiner Frau Joséphine trennt, zum Entsetzen und Erstaunen der ganzen Familie. Léonard und Napoléon werden ein eingeschworenes Team, das so manches verrückte Abenteuer erlebt, das die übrige Familie vor den Kopf stößt. Doch dann muss der Enkel ganz langsam erkennen, was mit seinem Großvater wirklich los ist. Aus dem »General« wird nun doch der »Opa«, aber Léonard steht treu an Napoléons Seite und hilft ihm schließlich auch, Joséphine doch noch die Wahrheit zu sagen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Pascal Ruter
Monsieur Bonheur geht auf Reisen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die rührende Geschichte eines Enkels und seines an Demenz erkrankten Großvaters, deren Rollen sich langsam umkehren – »Honig im Kopf« in Romanform!
Léonard vergöttert seinen Großvater Napoléon, den er »General« nennt, weil »Opa« so alt klingt. Daran ändert sich auch nichts, als Napoléon sich überraschend von seiner Frau Joséphine trennt, zum Entsetzen und Erstaunen der ganzen Familie. Léonard und Napoléon werden ein eingeschworenes Team, das so manches verrückte Abenteuer erlebt, das die übrige Familie vor den Kopf stößt. Doch dann muss der Enkel ganz langsam erkennen, was mit seinem Großvater wirklich los ist. Aus dem »General« wird nun doch der »Opa«, aber Léonard steht treu an Napoléons Seite und hilft ihm schließlich auch, Joséphine doch noch die Wahrheit zu sagen…
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Epilog
Danksagung
Für Michèle Moreau, ohne die aus diesen Seiten niemals ein Roman geworden wäre
In unendlicher Dankbarkeit
1
Im Alter von fünfundachtzig Jahren beschloss mein Großvater Napoléon, dass er sich unbedingt erneuern müsse. Also schleppte er meine Großmutter Joséphine vors Gericht. Und da sie ihm noch nie etwas hatte ausschlagen können, ließ sie das einfach mit sich machen.
Die Scheidung fand am ersten Herbsttag statt.
»Ich will in meinem Leben noch mal ganz neu durchstarten«, hatte er dem Richter mitgeteilt, der mit dieser Angelegenheit betraut war.
»Das ist Ihr gutes Recht«, hatte der ihm geantwortet.
Wir, meine Eltern und ich, hatten sie bis zum Gerichtsgebäude begleitet. Mein Vater in der Hoffnung, dass Napoléon im letzten Moment einen Rückzieher machen würde, auch wenn ich sehr wohl wusste, dass er sich da täuschte: Mein Großvater änderte seine Meinung niemals.
Meine Großmutter Joséphine war untröstlich und weinte die ganze Zeit. Ich hatte sie untergehakt und reichte ihr Taschentücher, die innerhalb weniger Sekunden tränennass waren.
»Danke, Léonard, mein Liebling«, sagte sie. »Was für ein Trampel aber auch, dieser Napoléon!«
Sie schnäuzte sich, seufzte, dann umspielte ein sehr weiches, sehr nachsichtiges Lächeln ihre Lippen.
»Nun denn«, fuhr sie fort, »wenn er das so will, dieser Trampel.«
Mein Großvater trug seinen Namen zu Recht. Wie er so auf den Stufen des Gerichtsgebäudes stand, die Hände in den Hosentaschen seiner nigelnagelneuen weißen Hose, wirkte er so stolz und gebieterisch wie jemand, der soeben ein Königreich erobert hatte. Zufrieden schweifte sein majestätischer Blick über die Straße und die Passanten.
Ich bewunderte ihn. Und ich war der Überzeugung, dass das Leben allerhand Geheimnisse barg und mein Großvater sie alle kannte.
Es war Herbstanfang, die Luft weich und feucht. Joséphine schauderte und klappte den Kragen ihres Mantels nach oben.
»Das feiern wir jetzt!«, bestimmte Napoléon.
Papa und Mama waren damit nicht einverstanden, Joséphine noch viel weniger, also machten wir uns einfach nur auf den Weg zur Metro.
»Hast du vielleicht Lust auf ein Vanilleeis?«, fragte mich Napoléon vor einem Eiswagen.
Er reichte dem jungen Verkäufer einen Schein.
»Zwei Mal bitte, eins für mich und eins für meinen Coco. Mit Sahne? Ja. Oder, Coco, wir wollen doch Sahne?«
Er zwinkerte mir zu, ich nickte. Mama zuckte mit den Schultern. Papa stierte mit leerem Blick vor sich hin.
»Aber natürlich will mein Coco Sahne!«
Coco … So nannte er mich schon immer. Keine Ahnung, warum, aber ich stellte mir gern vor, dass die Leute in den Boxklubs und Ringen, in denen er früher regelmäßig verkehrte, einander auch immer Coco genannt hatten.
Das hatte so gar nichts mit Léonard gemein. Léonard Bonheur. Ich war zehn Jahre alt, die Welt schien mir noch unverständlich, rätselhaft, leicht feindlich, und häufig überkam mich das Gefühl, dass mein Umriss auf der Netzhaut derer, denen ich begegnete, keinen bleibenden Abdruck hinterließ. Napoléon versicherte mir, ein Boxer müsse nicht breitschultrig sein, außerdem zeige sich die wahre Größe der meisten Champions in ihrem Können und ihrem Talent; aber ich war eben kein Boxer. Ich war der Unsichtbare.
Ich hatte mich an einem Gewitterabend angekündigt; die Glühbirnen im Kreißsaal waren durchgebrannt, und meine ersten Schreie in dieser Welt brachen im Dunkeln hervor. Der kleine Bonheur war also in die Finsternis hineingeboren, und zehn Jahre hatten nicht ganz ausgereicht, diese zu tilgen.
»Schmeckt’s, Coco?«, fragte mich Napoléon.
»Lecker, danke!«, antwortete ich.
Großmutter hatte sich etwas beruhigt. Ich fing ihren blassen Blick auf. Sie lächelte und flüsterte mir zu: »Genieß es.«
Der Verkäufer hielt Napoléon das Wechselgeld hin und wurde von diesem gefragt: »Wie alt sind Sie denn?«
»Dreiundzwanzig. Warum?«
»Ach, einfach nur so. Behalten Sie alles. Doch, doch, ganz sicher. Heute ist ein Festtag!«
»Das ist ja wohl die Höhe«, murmelte meine Großmutter.
Auf der Heimfahrt im Zug, umgeben von Leuten, die von der Arbeit nach Hause fuhren, saßen wir alle schweigend da. Meine Großmutter hatte ihre Fassung einigermaßen wiedergewonnen und sich inzwischen auch die Wangen frisch gepudert. Ich kuschelte mich an sie, als spürte ich, dass ich mich bald von ihr verabschieden würde. Sie hatte die Stirn an die Scheibe gelehnt und betrachtete die vorbeiziehende Landschaft. Die Traurigkeit verlieh ihr eine sehr würdevolle Schönheit. Ab und an warf sie einen Blick auf den, mit dem sie ihr Leben geteilt hatte. Ihre Augen hatten die Farbe von welken Blättern, die durch den Himmel wirbelten. Ich fragte mich, durch welche Gedanken dieses flüchtige Lächeln hervorgerufen wurde, das immer wieder ihre Lippen umspielte.
Und ich sagte mir, dass sie alles verstehen konnte.
Vom Vanilleeis hatte mein Großvater einen weißen Schnurrbart. Die Füße hatte er auf der Sitzbank gegenüber abgelegt. Außerdem pfiff er.
»Was haben wir doch für einen schönen Tag gehabt!«, rief er aus.
»Genau nach dem Ausdruck habe ich gesucht«, murmelte meine Großmutter.
2
In der darauffolgenden Woche begleiteten wir alle Joséphine zur Gare de Lyon, sogar Napoléon.
Sie hatte beschlossen, in den Süden von Frankreich zurückzukehren, in die Nähe von Aix-en-Provence, wo sie geboren und ihre Nichte gerade aus einem kleinen Häuschen ausgezogen war, das jetzt auf sie wartete. Sie müsse versuchen, die positive Seite der Dinge zu sehen, sagte sie. Sie würde wieder mit Freundinnen von einst Kontakt knüpfen und auf den Pfaden ihrer Kindheit wandeln. Vor allen Dingen aber habe sie dort Sonne und Licht.
»Bei mir wird es wärmer sein als bei euch!«
Wie um ihr recht zu geben, prasselten feine Tropfen auf das Glasdach des Bahnhofs.
Auf dem Bahnsteig, umgeben von einem Berg Koffer, warteten wir auf den Zug. Nervös schritt mein Großvater auf und ab, als hätte er Angst, der Zug könnte niemals eintreffen.
»Léonard, mein Schatz, du kommst mich doch besuchen?«, fragte mich meine Großmutter.
Meine Mutter antwortete an meiner Stelle: »Aber natürlich, wir werden dich oft besuchen. Es ist ja gar nicht so weit.«
»Und du wirst uns auch besuchen«, fügte mein Vater hinzu.
»Ich komme, wenn Napoléon mich anruft. Das könnt ihr ihm sagen. Ich kenne ihn, diesen Trampel, besser als sonst jemand, und ich weiß ganz genau, was er …«
Sie schien kurz nachzudenken, dann verbesserte sie sich: »Ach nein, sagt ihm besser nichts. Wenn er reif genug ist, dann wird er mich von selbst darum bitten. Ganz reif wie ein alter, fauliger Apfel …«
Mit hastigen Schritten kam da mein Großvater zurück und unterbrach sie: »Der Zug kommt! Macht euch bereit! Den dürfen wir nicht verpassen!«
»Du hast wirklich ein ganz besonderes Geschick dafür, genau das zu sagen, was man gern hören möchte«, sagte mein Vater.
Napoléon schnappte sich den größten Koffer, wandte sich dann zu Joséphine um und murmelte ihr sanft zu: »Ich hab in der Ersten für dich reserviert.«
»Wie aufmerksam!«
Wir brachten Joséphine zu ihrem Sitzplatz. Napoléon und mein Vater verstauten die Koffer um sie herum, und ich hörte, wie mein Großvater einer Mitreisenden zuflüsterte: »Passen Sie gut auf sie auf. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist von sehr schwacher Konstitution.«
»Was erzählst du der Dame da?«, fragte meine Großmutter ihn.
»Nichts, nichts, nur dass die Züge immer Verspätung haben.«
Wir traten wieder hinaus auf den Bahnsteig. Eine Stimme verkündete, der Zug nach Aix-en-Provence fahre gleich ab. Hinter der Scheibe lächelte Joséphine uns zu, als würde sie nur verreisen.
Der Zug schob sich an uns vorbei, wir winkten, dann verschwanden die roten Lichter des letzten Waggons im Nebel.
Es war vorbei. Die Stimme kündigte einen anderen Zug an. Andere Reisende strömten auf den Bahnsteig.
»Lasst uns was trinken gehen!«, schlug Napoléon vor. »Die Runde geht auf mich.«
Trauben von Reisenden drängelten sich im Café, aber Napoléon ergatterte eine Sitzbank, auf die wir vier uns quetschten. Er hatte sich unglaublich viel vorgenommen.
»Erst mal das Haus renovieren«, sagte er. »Neu tapezieren, malern, überall ein bisschen flicken und ausbessern. Eben alles ein bisschen verjüngen.«
»Ich werde jemanden dafür kommen lassen«, sagte mein Vater.
»Jemanden kommen lassen, nichts da! Das mache ich selbst. Und mein Coco hilft mir dabei.«
Er unterstrich seine Worte, indem er mir mit der Faust gegen die Schulter boxte.
»Das ist nicht sehr vernünftig«, wandte meine Mutter ein. »Sie sollten auf Ihren Sohn hören.«
Mein Vater nickte zustimmend und bekräftigte: »Das stimmt, Papa, denk doch mal nach, es wäre am einfachsten, wenn das jemand übernehmen würde! Der kümmert sich dann um die großen Arbeiten.«
»So weit kommt’s noch«, tobte mein Großvater. »Und ich soll mich mit den übrig gebliebenen Krümeln zufriedengeben? Wie ein Spatz?! Nie und nimmer! Ich mache alles selbst. Ich habe euch um nichts gebeten, vergesst das nicht. Wenn ihr hier seid, um mich zu kränken, dann hättet ihr auch zu Hause bleiben können. Ich werde sehr gut allein klarkommen. Allein oder mit meinem Coco. Und zusammen richten wir auch einen Trainingsraum ein.«
»Einen Trainingsraum?«, ereiferte sich mein Vater. »Warum nicht gleich auch noch eine Hantelbank?«
»Eine Hantelbank, gar nicht dumm die Idee. Daran hatte ich nicht gedacht, das muss ich mir merken.«
Mein Vater seufzte, tauschte einen Blick mit meiner Mutter, ehe er sich räusperte und verkündete: »Ehrlich, Papa, wenn du meine Meinung dazu …«
»Mach dir nicht die Mühe«, unterbrach ihn Napoléon und schlürfte die restliche Cola mit dem Strohhalm, »ich weiß sehr wohl, was du von dieser Geschichte hältst.«
Nein, sie hießen es nicht für gut. Vor allen Dingen mein Vater. Mit fünfundachtzig, fast schon sechsundachtzig Jahren ließ man sich nicht scheiden. Man richtete auch keinen Trainingsraum ein, und man ließ sich helfen, wenn man renovieren wollte. Mal ganz abgesehen davon, dass man in diesem Alter eigentlich überhaupt nicht mehr renovierte. Weder innen noch außen. Rein gar nichts. Man wartete. Man wartete auf das Ende.
»Tatsächlich«, fuhr Napoléon fort, »ist es mir aber völlig schnurz, was du denkst. Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Capito?«
Mein Vater lief knallrot an; sein Gesicht verzog sich augenblicklich zu einer wütenden Grimasse, doch dann legte sich die Hand meiner Mutter beschwichtigend auf seinen Arm, und seine Wut verrauchte.
»Ich denke, ich kann das verstehen«, murrte er nur noch vor sich hin.
Napoléon zwinkerte mir zu und sagte: »Laǔ vi, ĉu mi estis sufiĉe klara, Bubo?«
Auf Esperanto, dieser Sprache, die mein Großvater fließend sprach und deren Grundkenntnisse er mir beigebracht hatte, hieß das: Glaubst du, dass ich mich klar genug ausgedrückt habe, mein Coco?
Ich nickte.
Esperanto war zu unserer Geheimsprache geworden, und wir verwendeten sie, wann immer wir uns über etwas austauschten, das nicht für fremde Ohren bestimmt war. Ich mochte die Klänge dieser Sprache, diese aus fernen Regionen stammenden, zugleich fremdartigen und vertrauten Laute; ich mochte diese Sprache, die einem den Eindruck vermittelte, man habe die ganze Welt im Mund. Er hatte sie während seines ersten Lebens erlernt, als er die Fausthagel in den Boxringen niederregnen ließ, einfach um sich mit den ausländischen Boxern unterhalten zu können, um sich unter Sportkameraden auszutauschen und so alle anderen, Trainer, Manager und Journalisten, an der Nase herumzuführen.
»Was hat er gesagt?«, fragte mein Vater.
»Ach nichts«, sagte ich. »Nur dass es nett von euch ist, euch so um ihn zu sorgen.«
Wir verließen den Bahnhof. Eine endlose Taxischlange wartete auf Reisende.
»He!«, rief mein Großvater einem Fahrer zu. »Sind Sie frei?«
»Ja, ich bin frei.«
»Das ist gut«, erwiderte Napoléon. »Ich auch.«
Dann lachte er schallend.
3
Napoléon hatte bereits zwei Leben gelebt, und bestimmt hatte er noch einen ganzen Haufen in Reserve, wie das bei Katzen der Fall war. Während seines ersten Lebens war er in den Boxringen der ganzen Welt unterwegs gewesen und hatte es auf die Titelseiten von etlichen Zeitungen geschafft. Er hatte den dunklen Ruhm der Säle von Boxmeisterschaften kennengelernt, das Knistern der Blitzlichtgewitter, die kurz anhaltende Freude der Siege und die unendliche Einsamkeit in den Umkleiden nach einer Niederlage. Und dann hatte er dieser Karriere aus Gründen, die sich uns entzogen, knallhart ein Ende gesetzt.
Als Nächstes war er Taxifahrer geworden. Taximan, wie er so gern mit amerikanischem Akzent sagte. Er hatte das Taxischild nie von seinem Autodach entfernt. Wenn er mich von der Schule abholte, schaltete er es ein, und im Winter leuchteten die drei Buchstaben T, A, I im Dunkeln auf, während das X sich beharrlich widersetzte. Dann öffnete er die Tür zum Rücksitz seines Peugeot und fragte mich feierlich: »Wohin soll es gehen, der Herr?«
Doch an diesem Freitag, eine Woche nach Joséphines Abreise, sagte er einfach nur: »Ich nehme dich mit.«
»Zum Bowlen?«
»Nein, nicht zum Bowlen. Du wirst schon sehen.«
Napoléon erklärte mir, er habe viel nachgedacht und der Beginn dieses dritten Lebens müsse von einem wichtigen Ereignis markiert werden.
»Von einem glücklichen Ereignis!«, rief er, während er einem anderen die Vorfahrt nahm.
»Einverstanden, aber du fährst auf der linken Spur, Opa.«
»Das ist nicht weiter schlimm, in England fahren sie alle links!«
»Wir sind aber nicht in England!«
»Warum hupen die seit vorhin alle nur so? Weißt du vielleicht, weshalb?«
»Sag mal, in welchem Jahr hast du deinen Führerschein bekommen, Opa?«
»Erstens: Ab heute hörst du gefälligst auf, mich Opa zu nennen. Und zweitens: Von welchem Schein redest du da?«
Langsam wanderte die Sonne im Himmel abwärts.
An jeder Kreuzung streckte er ganz automatisch den Arm vor mir aus, damit ich nicht durch die Windschutzscheibe flog, sollte er stark bremsen müssen, als hätte sein Auto noch immer keine Sicherheitsgurte. Wir waren seit einer halben Stunde unterwegs, als wir die Straße verließen und auf einen Feldweg abbogen.
»Da ist es. Das glaube ich zumindest.«
Ich las die drei Buchstaben, die an der Einfahrt standen.
»TSV.«
»Sehr gut, du kennst drei Buchstaben. Das reicht. Du weißt genug, um damit zurechtzukommen. Na dann, los, go, raus mit uns.«
»Willst du etwa einen Hund adoptieren?«, fragte ich, während wir die betonierten Wege zwischen den Zwingern abschritten.
»Aber nein, du siehst doch, dass ich auf der Suche nach einer Sekretärin bin! Junge, Junge, du stellst vielleicht Fragen!«
Aus den Zwingern ertönte raues Gekläff, vermischt mit spitzem Gebell. Hier waren wirklich alle möglichen Hunde mit allen erdenklichen Fellarten vertreten: lang, fein, kurz, dicht, glatt oder kraus. Die meisten lagen niedergeschlagen und matt hinten in ihrem Zwinger und fingen an mit dem Schwanz zu wedeln, sobald ein Besucher an ihnen vorbeilief.
Ein paar Hunde litten an irgendwelchen Hautkrankheiten und kratzten sich ganz verzweifelt, andere hatten tränende Augen, und wieder andere drehten sich auf der Jagd nach dem eigenen Schwanz wild im Kreis.
Hier ein gut gebauter Spaniel, da ein massiver Beauceron, dort ein ungestümer Jack Russell, weiter hinten ein verlässlicher Labrador, ein eleganter Collie oder ein anmutiger und aristokratischer Windhund. Da hatte man die Qual der Wahl. Und genau das war das Problem.
»Gar nicht einfach, sich was auszusuchen!«, sagte Napoléon. »Alle können wir nicht mitnehmen! Und wir werden ja wohl keinen auslosen …«
Eine Frau kam auf uns zu und verkündete angesichts der Unschlüssigkeit meines Großvaters: »Es kommt darauf an, was Sie mit ihm machen wollen.«
»Aber genau das wissen wir doch nicht«, erwiderte Napoléon. »Was für eine Frage! Wir wollen einfach nur einen Hund haben und ihn als Hund behandeln, das ist alles.«
Er zeigte auf einen Zwinger, auf dessen Schild kein weiterer Hinweis stand: »Und das da, was ist das?«
»Das?«, sagte die Angestellte. »Ein Drahthaarterrier, glaube ich zumindest.«
Der Hund schaute uns aus trüben Augen an, hob seine Schnauze kurz, stieß dann einen tiefen Seufzer aus und legte sie wieder zwischen seinen parallel ausgestreckten Pfoten ab.
»Sind Sie sich sicher?«, fragte Napoléon.
»Ehrlich gesagt, nein. Vielleicht eher ein Setter … Warten Sie, ich sehe mal nach.«
Die Dame fand sich in ihren Unterlagen nicht zurecht, deren lose Blätter im Wind davonflatterten.
»Mir fehlt es etwas an Ordnung.«
»Die Rasse ist egal. Die Rasse ist uns doch schnurz, oder, Coco?«
»Ja, völlig schnurz.«
»Und wie alt ist er?«
Die Dame war um eine gewissenhafte Miene und ein kompetentes Auftreten bemüht.
»Ähm … etwa ein Jahr. Nein, zwei. Ja, das ist es.«
Ein verlegenes Lächeln machte sich auf ihrem Gesicht breit.
»Vielleicht ist er auch ein bisschen jünger. Oder sehr viel älter.«
Wieder durchforstete sie ihre Blattsammlung, bis diese ihr schließlich ganz entglitt und sich über das eingezäunte Grundstück verteilte.
»Ach, vergessen Sie es!«, meinte Napoléon. »Das Alter ist uns auch schnurz. Wie alt wird diese Art Hund denn so?«
»Das sind sehr widerstandsfähige Hunde«, antwortete die Dame, »so an die zwanzig Jahre! Sie wirken besorgt. Ist das ein Problem?«
»Natürlich ist das ein Problem!«, ereiferte sich Napoléon.
»O ja, ich verstehe. Ich glaube, ich kann folgen …«
»Das ist das Problem bei Tieren«, sagte Napoléon, »sie verschwinden immer vor einem, und dann sitzt man mit seinem Kummer allein da!«
»Wie lustig!«, befand Napoléon. »Ist dir auch aufgefallen, dass wir zu zweit gekommen sind und zu dritt gehen?«
Wir grinsten einander an. Gerne hätten wir mit ihm geredet, mit dem Hund, aber wir trauten uns nicht, weil uns das ein bisschen lächerlich vorkam.
Napoléon zog eine brandneue Leine aus der Hosentasche, die sich wie eine Schlange entrollte. Das Preisschild hing noch daran.
»Du hast alles geplant, Op… – Napoléon!«
»Alles. Selbst das. Schau mal!«
Der Kofferraum des Peugeot war randvoll mit Trockenfutter für Hunde. Napoléon öffnete die hintere Autotür und sagte feierlich: »Jetzt beginnt ein neues Leben! Wohin möchte der Herr gebracht werden?«
Der Hund hüpfte auf die Rückbank, schnüffelte daran und schien sie für gut zu befinden, denn er ließ sich gemütlich darauf nieder.
Das kaputte Taxameter zeigte 0000 an, und für mich war das, als würde es wirklich den Anfang von etwas Neuem markieren.
»Das stimmt ja wohl«, sagte Napoléon und legte den ersten Gang ein, »wir brauchen keinen Hund mit einer ganz bestimmten Rasse. Nur einen Hund. Eine Kreuzung aus Hund mit Hund, basta!«
Jetzt kam natürlich die Frage nach einem Namen auf. Leo, Rex, Rin Tin Tin, Balu, nichts von all dem begeisterte uns so richtig. An einer roten Ampel drehten wir uns zu ihm um. Der Hund hob den Kopf und schaute uns aus sanften, wie mit Kajal umrandeten Augen fragend an.
»Einen originellen Namen«, sagte mein Großvater, »genau das brauchen wir. Was Neues! Den ganzen alten Mist wollen wir nicht mehr! Aus. Punkt. Ding Dong. Nächste Runde!«
»Punkt-Ding-Dong«, rief ich, »das ist doch ein schöner Name!«
»Na dann, bingo für: Punkt-Ding-Dong!«
Damit drehte er sich nach hinten um und fragte: »Na, Punkt-Ding-Dong, bist du zufrieden, dass du endlich einen Namen hast?«
»Wuff.«
»Er scheint damit einverstanden zu sein!«, sagte ich. »Es ist grün, du kannst weiterfahren.«
»Das ist ein hübscher Name«, sagte mein Großvater beim Anfahren. »Zumindest für einen Hund. Außergewöhnlich. Distinguiert. Hat eben Klasse. Sehr viel besser als ›Strichpunkt‹ oder ›Klammer zu‹! Du hast den Hundeinstinkt, das merkt man gleich.«
Sobald wir bei ihm angekommen waren, holten wir die Säcke mit dem Trockenfutter aus dem Kofferraum und stopften sie in die Schränke.
»Wir haben ordentlich was geschafft«, sagte Napoléon. »Ich hab da was für dich.«
Er zog eine Schublade auf und holte ein prall gefülltes Leinensäckchen heraus.
»Keine Angst, das sind keine Hundeleckerli. Mach auf.«
Seine Augen blitzten schelmisch.
Murmeln. Hunderte von Murmeln. Alte Murmeln aus Ton, andere aus Glas, Achat oder Stahl, große und kleine … Napoléons gesamte Kindheit.
»Die sind nicht mehr ganz neu«, sagte er. »Es hat Jahre gedauert, bis ich sie gewonnen hatte. Dir nützen sie mehr als mir. Ich hab nicht mehr so viele, mit denen ich klickern könnte, weißt du? Für gewöhnlich gibt man eher eine Briefmarkensammlung weiter, aber mich haben Briefmarken immer nur genervt. Erst mal habe ich nicht so rasend viele bekommen, Briefe meine ich. Und ich muss zugeben, dass ich mir auch nicht gerade ein Bein ausgerissen habe, um welche zu schreiben.«
Ich hatte weiche Knie, mein Herz pochte, und die Kiefer hatte ich fest aufeinandergepresst.
»Du fängst jetzt aber nicht an zu flennen!«, warf er mir an den Kopf.
4
So trat Punkt-Ding-Dong in unsere Familie und wurde gleich am nächsten Tag meinen Eltern vorgestellt. Er war ein sehr umgänglicher Hund, folgsam und sanft, der sich über die kleinste Aufmerksamkeit freute. Mein Vater wollte nur wissen: »Was ist das denn für eine Rasse?«
»Das ist ein Hund«, antwortete Napoléon, »das ist alles. Ich weiß nicht, weshalb, aber mir war klar, dass du diese Frage stellen würdest.«
»Jetzt sei doch nicht gleich sauer«, brummte mein Vater. »Ich wollte es nur wissen. Man sagt doch häufig: Das ist ein Pudel, ein Labrador, ein …«
»Aber hier eben nicht, da sagt man nur ›Es ist ein Hund‹. Ein Hund gekreuzt mit einem Hund. Punkt-Ding-Dong!«
»Ist ja schon gut, wegen einer einfachen Frage brauchst du nicht so aus der Haut zu fahren.«
»Ich fahre nicht aus der Haut. Er heißt Punkt-Ding-Dong. Und ja, doch, eigentlich bin ich sauer. Diese Macke, ständig alles einordnen zu müssen, das nervt einfach. Schon als Kind hast du immer alles eingeordnet. Erinnerst du dich noch an deine Briefmarken? Du hast die Leute – und die Hunde – schon immer gern in Schubladen gepackt. Damit sie sich nicht mehr bewegen, so eingezwängt, wie in …«
Mein Vater zuckte mit den Schultern und fragte: »Kannst du mir vielleicht mal sagen, weshalb du jetzt mit einem Hund daherkommst? Jetzt, wo …«
»Wo was?«
»Ach, nichts.«
Wild gestikulierend erklärte Napoléon, dass er sich schon immer einen Hund gewünscht habe. Schon als er klein war, aber da habe er in einer winzigen Wohnung bei Belleville gewohnt, und danach, als Boxer, habe sich die Frage gar nicht mehr gestellt. Welcher Hund, selbst wenn er so umgänglich und sympathisch war wie Punkt-Ding-Dong, hätte sich mit dem Leben eines herumtingelnden Boxers zufriedengegeben?
»Und deine Mutter war allergisch auf Hundehaare. Da hatte ich echt kein Glück! Aber jetzt habe ich vor, mich bis zum Schluss um ihn zu kümmern.«
Erstaunt zog mein Vater eine Augenbraue hoch.
»Bis zu seinem Schluss«, stellte Napoléon das Offensichtliche klar.
Meine Mutter hatte einen Skizzenblock hervorgeholt und ließ bereits ihre Stifte über das Papier wandern. Punkt-Ding-Dong schien das zu verstehen und zeigte sich ihr stolz in seinem vornehmsten Profil. Er war dafür geschaffen, auf den Seiten meiner Mutter festgehalten zu werden.
Ich sah ihr gern beim Arbeiten zu. Sie zeichnete alles, was sie umgab, und ließ sich von ihrem Modell ganz vereinnahmen; dann existierte nichts anderes mehr um sie herum. Sie hatte erst mit sechs Jahren angefangen zu sprechen, und seitdem machte es ganz den Eindruck, als würde sie sich vor Worten in Acht nehmen. Sie ging sparsam damit um, als hätte sie nur wenige vorrätig, aber alles, was sie nicht sagte, zeichnete sie. Mit drei Strichen erweckte sie die Wesen auf dem Papier zum Leben. Im Handumdrehen fing sie das Funkeln in einem Auge ein oder hielt mit ihren Pinseln eine unscheinbare – und vermeintlich unbedeutende – Geste fest, die tatsächlich aber sehr viel verriet. Hunderte dieser kleinen, aus dem Stegreif entstandenen Zeichnungen füllten ganze Schubladen; als Album gebunden erzählten sie manchmal eine zusammenhanglose und leicht poetische Geschichte. Häufig stellte sie sie in einer Bibliothek oder in Schulen vor.
Mein Vater ging um den Hund herum, und nachdem er eine Enzyklopädie zurate gezogen hatte, bestimmte er, dass Punkt-Ding-Dong eine Mischung aus Foxterrier, Windhund, Spaniel und sogar Malteser sein müsse. Ein regelrechtes Hundepuzzle. Sein langer buschiger Schwanz war jedoch nicht klassifizierbar. Man hätte meinen können, er wäre dem Körper erst nachträglich angefügt worden.
»Ach, übrigens«, sagte Napoléon und wandte sich an meinen Vater, »wo wir gerade zwei Minuten Ruhe haben, ich müsste dich um etwas bitten.«
Er zog ein ganzes Bündel beschriebener Blätter aus einem großen Umschlag.
»Sieh mal, der Richter hat mir geschrieben. Könntest du das mal eben für mich lesen? Ich würde es ja selbst lesen, aber ich habe meine Brille vergessen.«
Mein Vater nahm die Unterlagen an sich und überflog sie rasch.
»Mal sehen, mal sehen … ›Grund der Scheidung: Erneuerung des Lebens‹. Also ehrlich, Papa, das ist ganz schön dreist von dir!«
Napoléon lächelte stolz, und Punkt-Ding-Dong schien ihn bewundernd anzusehen.
»Im Wesentlichen steht hier, dass alle einverstanden waren und es keine Konflikte gab.«
»Ganz genau«, sagte Napoléon. »Alle sind zufrieden, es ist supergut gelaufen.«
»Für dich vielleicht«, meinte mein Vater. »Bei Joséphine bin ich mir da nicht so sicher …«
»Tststs! Was weißt du schon? Gut, und der Rest?«
»Alles scheint geregelt zu sein, danach stehen nur noch ein paar formelle Dinge drauf …«
»Komm schon zum Punkt!«, verlangte Napoléon.
Der Blick meines Vaters fiel auf den unteren Teil des Dokuments.
»Weißt du, was der Richter da mit Bleistift hingeschrieben hat? Halte dich gut fest: ›Viel Glück!‹«
»Er war nett, dieser Richter«, sagte mein Großvater. »Ich habe gemerkt, dass wir dieselbe Wellenlänge hatten. Fast hätte ich ihm vorgeschlagen, mal zusammen ein Bierchen trinken zu gehen.«
Napoléon entriss meinem Vater die Unterlagen.
»Das lasse ich rahmen und hänge es aufs stille Örtchen. Um den Beginn meines neuen Lebens zu markieren.«
Er hielt mir das Bündel Unterlagen unter die Nase.
»Hast du gesehen, Coco, was für ein tolles Diplom! Mein erstes Diplom. Das kommt neben Rocky!«
Er lächelte. Seine blauen Augen strahlten regelrecht unter seinem dichten schneeweißen Haar, dessen Strähnen ihm häufig ins Gesicht fielen. Ich bestaunte seine Unbeschwertheit und seinen jung gebliebenen Blick inmitten dieser kleinen Falten. Seine Hände waren immer zu Fäusten geballt, selbst wenn ihn gerade nichts verärgerte.
»Wenn du zufrieden bist, dann ist ja alles gut«, sagte mein Vater. »Ich weiß, dass du es nicht magst, wenn man sich in deine Angelegenheiten mischt, und dass dir meine Meinung egal ist, aber ich finde, das mit Mama hast du etwas übertrieben. So, jetzt ist es ein für alle Mal raus.«
»Da hast du absolut recht«, entgegnete Napoléon.
Zufrieden leuchteten die Augen meines Vaters, bis Napoléon weiter ausführte: »Sogar in zwei Punkten: Ich mag es nicht, wenn man sich in meine Angelegenheiten mischt, und es ist mir völlig schnuppe, was du denkst.«
Dann wandte sich Napoléon zu mir um und fragte mich: »Ĉu vi ne taksas lin cimcerba?« (Denkst du nicht auch, dass er ein Schwachkopf ist?)
Ich lächelte daraufhin nur.
»Was hat er gesagt, Léonard, hm?«, fragte mich mein Vater.
»Ach nichts«, antwortete ich. »Nur wie nett es doch von dir ist, dir Sorgen zu machen. Und er bedankt sich dafür.«
Das Lächeln, das daraufhin das Gesicht meines Vaters zum Strahlen brachte, erfüllte mich unwillkürlich mit einer düsteren, zärtlichen Traurigkeit. Meine Mutter legte ihm einen Arm um die Schultern.
»Das stimmt ja wohl auch!«, brummelte mein Großvater schulterzuckend.
Am nächsten Tag lernte ich Alexandre Rawcziik kennen. Mit zwei i, wie er sofort klarstellte. Ihm waren diese zwei i so wichtig wie mir die Murmeln von Napoléon, die ich in meinem Schulranzen aufbewahrte. Er trug eine merkwürdige Mütze, ein Puzzle aus Fell, Samt und sogar Federn, und er hängte sie sehr sorgfältig an der Garderobe im Gang auf wie einen Helm; dieser merkwürdige Gegenstand hypnotisierte mich.
Alexandre wirkte schüchtern, etwas traurig und einsam, was ihn sofort von den anderen Schülern in der Klasse absetzte und ihm meine Sympathie einbrachte. Und nach wenigen Stunden stellte ich überrascht fest, dass ich ihn als meinen besten Freund erachtete. Lag es an der Freude darüber, endlich jemanden gefunden zu haben, der mir ähnelte und mit dem ich alles teilen könnte? Lag es an der Magie von Napoléons Murmeln? Das bleibt ein Rätsel. Es ist jedenfalls so, dass ich, berauscht von einem neuerlichen Gefühl der Unbesiegbarkeit, nicht zögerte, Alexandre zu einer Partie Murmeln aufzufordern. Und in der Gewissheit, den Schatz zu vergrößern, der mir anvertraut worden war, brachte ich Napoléons Murmeln zum Einsatz.
Ich sah zu, wie eine Murmel nach der anderen in der Hosentasche meines neuen Freundes verschwand. Ich hoffte beständig, doch noch zu gewinnen, also holte ich unablässig eine neue aus dem alten Säckchen. Das Blatt würde sich wenden, ganz sicher. Aber da war nichts zu machen, ein böser Geist war mit allen Mitteln darauf bedacht, den Lauf meiner Murmel umzuleiten, sodass sie im letzten Moment immer am Ziel vorbeischoss.
Alexandre steckte seine Beute geistesabwesend ein, ohne mich überhaupt anzusehen. Die Murmeln klickerten leise, während sie seine Hosentasche zusehends ausbeulten. Ich sagte mir, dass ich aufhören müsse, sonst würde ich noch alle verlieren, doch immer wieder griff meine Hand in das Säckchen und brachte eine weitere Murmel ins Spiel. Alexandre besaß ein teuflisches Geschick, und seine Gesten hatten die Präzision eines Scharfschützen.
Als Erstes verschwanden die hässlichsten, dann die glänzendsten, und zum Schluss kamen die wertvollsten an die Reihe. An einem einzigen Tag hatte ich meinen ganzen Schatz verspielt.
»Das war's, ich habe keine mehr«, sagte ich.
Merkwürdigerweise war ich nicht sauer auf Alexandre. Ohne irgendjemandes Zutun hatte ich etwas Heiliges verschleudert.
Mein Herz war ebenso leer wie mein Säckchen, als ich mit einem Kloß im Hals nach Hause ging. Was war nur in mich gefahren? Warum hatte ich auch bis zum Äußersten gehen müssen? Jetzt war es zu spät.
5
Am Tag nach der Murmeltragödie verkündete mir mein Großvater: »Coco, ich ernenne dich zu meinem Adjutanten. Hiermit erkläre ich Léonard Bonheur zu meinem Adjutanten. So, jetzt ist es offiziell.«
»Stets zu Diensten, mein Kaiser!«, sagte ich und ahmte einen Soldaten in Habachtstellung nach.
»Knöpfen wir uns die durchgebrannten Glühbirnen vor. Dann sieht die Zukunft gleich viel rosiger aus, was, Coco?«
»So viel ist sicher.«
Ich hielt den Hocker fest, auf den er kletterte, um die Glühbirne herauszudrehen.
»Hast du den Strom auch ganz sicher abgestellt, Opa?«
»Keine Sorge, Coco. Und nenn mich nicht Opa.«
»Okay, Opa. Ich mache mir keine Sorgen, ich will nur nicht, dass es dir so ergeht wie Cloclo.«
»Ach, der arme Cloclo, unser lieber Claude François, immer wenn ich an ihn denke, versetzt mir das einen Schlag. Einen Stromschlag … Ha, ha!«
Er lachte so sehr, dass er sich nur mit Mühe auf dem Hocker halten konnte.
»Jetzt aber mal ernsthaft, gib mir die neue Glühbirne.«
Funken stoben unter seiner Hand hervor. Dann war es stockdunkel.
»Autsch! Verdammt!«, fluchte er und wedelte mit seiner Hand herum, um sie irgendwie abzukühlen. »Da muss ich wohl was vergessen haben! Dabei habe doch ich in diesem Haus die Leitungen verlegt, das verstehe ich jetzt nicht. Bestimmt hat deine Großmutter mal jemanden kommen lassen, der alles durcheinandergebracht hat, und jetzt haben wir den Salat. Man muss sich wirklich vor den Frauen in Acht nehmen.«
Er sprang vom Hocker und federte gekonnt mit den Beinen ab. Dann stöberte er eine Kerze auf und zündete sie an.
»Und es ward Licht!«, sagte er stolz.
Punkt-Ding-Dong schien das Ganze zu gefallen. Er saß da, wedelte mit dem Schwanz und wartete anscheinend auf eine Fortsetzung der belustigenden Darbietung.
»Sag mal, Coco?«
»Ja.«
»Findest du nicht, dass es uns hier gut geht, uns beiden?«, fragte Napoléon, als er sich auf das alte Sofa setzte.
»Uns dreien!«, korrigierte ich und streichelte Punkt-Ding-Dong.
Er hatte recht. In diesem von dunklen Schatten erfüllten Haus ähnelten wir zwei Einbrechern, die gemeinsame Sache machten. Zwei Einbrecher mit ihrem Hund.
»Ich frage mich, ob er wohl ein guter Wachhund ist«, überlegte Napoléon laut.
Als Antwort legte sich Punkt-Ding-Dong auf den Rücken und streckte uns seinen Bauch zum Kraulen hin.
»Setz dich mal zu mir her«, sagte mein Großvater zu mir und klopfte neben sich auf das Sofa. »Ich muss dir was sagen.«
Seine Stimme war sanft, ein wenig zittrig. Für den Bruchteil einer Sekunde überkam mich ein Gefühl von Zerbrechlichkeit. Joséphines Abwesenheit erfüllte den Raum, und ich war mir sicher, dass Napoléon dieselbe Leere empfand wie ich.
»Mein lieber Coco«, sagte er mit einem Seufzer, »manche Menschen sind auch dann noch da, wenn man sie nicht mehr sieht.«
Trotz der katastrophalen Lage war er sehr entspannt. Mir fiel auf, dass seine großen, knorrigen Hände wie zwei große Blätter auf seinen Knien lagen. Die Kerze verbreitete ein sanftes Licht.
»Was brennt das schnell runter, so eine Kerze!«, murmelte mein Großvater.
Und dann, ganz erstaunt über seinen eigenen Ausspruch, berappelte er sich wieder: »Genug Trübsal geblasen, genug philosophiert. Armdrücken.«
Feierlich nehmen wir einander gegenüber Platz. Unsere Hände verschränken sich. Handfläche gegen Handfläche. Unsere Muskeln spannen sich an. Unsere Arme schwanken von links nach rechts. Furchterregende Grimassen, wie Piraten. Er tut so, als würde er die Zähne zusammenbeißen, als würde er leiden, dieses Mal werde ich ihn schlagen. Aber genau in dem Moment, in dem mir der Sieg sicher scheint, wenn sein Handrücken nur noch einen Zentimeter vom Tisch entfernt ist, strahlt und pfeift er plötzlich, betrachtet die Nägel seiner freien Hand, und dann, ganz mühelos und unbekümmert, kehrt er die Situation behutsam um. Und schließlich beschreibt meine Hand einen Bogen und landet mit dem Handrücken auf dem Tisch.
Genau da klopfte es an der Tür.
»Erwartest du jemanden?«, fragte ich.
»Nein, niemanden. Geh aufmachen. Solange drehe ich die Sicherung wieder rein. Man hat ja wirklich keine zwei Minuten seine Ruhe.«
Sie waren zu zweit, trugen den gleichen Anzug und hatten identische Koffer dabei.
»Bist du denn ganz allein?«, fragte mich einer der beiden.
In dem Moment war der Strom zurück, und mein Großvater tauchte hinter mir auf. Zu meiner großen Überraschung ließ er sie ohne Weiteres eintreten und bat sie, am Tisch Platz zu nehmen. Mir fiel auf, dass seine Hände erneut zu Fäusten geballt waren.
»Ni amuziĝos, Bubo! Ili ne eltenos tri raŭndojn!« (Das wird ein Spaß, Coco! Die halten keine drei Runden durch!)
Die beiden Besucher holten Faltblätter und Kataloge aus ihren Koffern. Mit aufmerksamer Miene und neugierigem Blick schaute Großvater ihnen zu. Vor allem die Bilder schienen ihn zu interessieren.
»Also das hier, sehen Sie«, fing der eine Vertreter an, »das ist eine verzahnte Laufstange, die man entlang eines Treppengeländers installieren kann, damit man ohne sich zu ermüden in den oberen Stock gelangt … wie ein kleiner persönlicher Aufzug. Vom Allerfeinsten.«
»Nicht schlecht. Und das da?«
»Ein Hörgerät für Menschen mit verminderter Hörleistung.«
»Ein was?«, hakte Napoléon nach und beugte sich vor.
»Ein Hörgerät für …«
»Ein Störgerät meinen Sie? Kein Bedarf, hier gibt es keine Störe. Mal abgesehen von ein paar Störenfrieden ab und an.«
Die beiden Männer tauschten diskret einen Blick und rangen sich ein Lächeln ab.
»Und das, was ist das?«, fragte mein Großvater und presste seinen Finger auf ein anderes Bild.
»Lupen, für Menschen mit verminderter Sehkraft.«





























