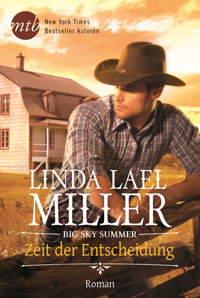7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Montana Creeds
- Sprache: Deutsch
Wie ein Sturm bricht die Vergangenheit über die zurückhaltende Bibliothekarin Kristy Madison hinein, als Dylan Creed nach Stillwater Springs zurückkehrt: Erinnerungen an Küsse voller Sehnsucht, an Nächte voller Leidenschaft - und an ein Ende voller Tränen. Doch Dylan kommt nicht allein die staubige Hauptstraße entlang: Er hat seine zweijährige Tochter Bonnie bei sich. Dass die Kleine eine Mutter braucht, ist Kristy klar. Ist das der Grund, warum Dylan ihre Nähe sucht? Oder treibt auch ihn die Sehnsucht? Und bei aller banger Hoffnung gibt es in Kristys Leben noch etwas anderes, dass sie mit tiefer Unruhe erfüllt: Ein Skandal um ihren Vater zieht weite Kreise und droht, auch sie in einen dunklen Strudel zu reißen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alle Rechte, einschließlich das der vollständigen oder auszugsweisen Vervielfältigung, des Ab- oder Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten und bedürfen in jedem Fall der Zustimmung des Verlages.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Linda Lael Miller
Soweit die Sehnsucht trägt
Roman
MIRA® TASCHENBUCH
MIRA® TASCHENBÜCHER
erscheinen in der Harlequin Enterprises GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2012 by MIRA Taschenbuch in der Harlequin Enterprises GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
Montana Creeds: Dylan
Copyright © 2009 by Linda Lael Miller
erschienen bei: Harlequin Enterprises Ltd., Toronto
Übersetzt von Ralph Sander
Published by arrangement with
HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln
Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln
Titelabbildung: Getty Images, München / pecher und soiron, Köln
Autorenfoto: © by John Hall Photography
/ Harlequin Enterprises S.A., Schweiz
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN eBook 978-3-95576-218-6
www.mira-taschenbuch.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
Für Sam und Janet Smith,
meine lieben und witzigen Freunde.
Danke für alle eure guten Ratschläge!
1. KAPITEL
Las Vegas, Nevada
Er spürte schon den ganzen Tag, dass etwas noch nie dagewesenes geschehen würde – etwas, das sein Leben für immer verändern würde. Dieses Gefühl bescherte ihm ein Kribbeln im Bauch und sorgte dafür, dass sich die feinen Härchen in seinem Nacken aufrichteten. Dylan Creed saß in einem zwielichtigen Spielclub, seinem Lieblingsladen, und bestritt einen Poker-Marathon. Er hatte die leise Stimme in seinem Kopf die ganze Zeit über ignoriert; sie warnte ihn schließlich nicht vor einer realen Gefahr. Doch jetzt, da er nach einer Glückssträhne ein ganzes Bündel Geldscheine in seinen linken Stiefel steckte, da wusste Dylan: Er sollte besser auf diese Stimme hören.
Unten in Downtown tummelten sich entlang der Fremont Street Scharen von Besuchern. Sie waren umgeben von Sicherheitsleuten, die im Auftrag der riesigen Casinos auf sie achteten. Schließlich sollten die Gäste nicht von irgendwelchen Kriminellen ausgeraubt werden, bevor sie ihr Geld an den Spieltischen zurücklassen konnten. Cops waren dort ebenfalls unterwegs, und jeder Winkel wurde von Kameras überwacht. Hier dagegen, in der Black Rose Cowboy Bar, versammelten sich die hartgesottenen Pokerspieler, die den Glamour verabscheuten. Sie wurden in der schummrigen Gasse hinter der Bar von einer defekten Straßenlaterne, einem übervollen Müllcontainer, einer Handvoll rostiger alter Karren und einer Ratte von der Größe eines Waschbären empfangen.
Zwar ging Dylan einer gepflegten Prügelei nicht aus dem Weg – immerhin war er ein Creed. Dennoch musste sein Hinterkopf nicht unbedingt Bekanntschaft mit einem Stemmeisen machen, nur um dann um seinen Gewinn erleichtert zu werden. Der betrug heute Abend rund fünfzigtausend Dollar.
Er ging anscheinend lässig zu seinem Pick-up, einem Ford. Auf jemanden, der sich hinter dem Müllcontainer oder irgendwo in den Schatten versteckt hielt, musste er völlig arglos wirken. Jemand beobachtete ihn, dessen war Dylan sich jetzt ganz sicher, aber es ärgerte ihn mehr, als dass es ihn beunruhigte. Als mittlerer Sohn von Jake Creed wusste er bereits seit jungen Jahren, dass die Anwesenheit anderer Personen für eine aufgeladene Atmosphäre sorgte.
Vorsichtshalber griff er in seine alte Jeansjacke und legte die Finger um den Griff seiner 45er, die mit ihrem kurzen Lauf gut in die Innentasche passte. Bei seinen häufigen Ausflügen in die diversen Spielhöllen trug er sie immer bei sich. In Schuppen wie dem Black Rose tummelten sich schließlich nur Verlierer, Betrüger und Kartenhaie – und Dylan Creed fiel in die letztgenannte Kategorie.
Er war noch gut zwei Meter von seinem Truck entfernt, als er jemanden auf dem Beifahrersitz bemerkte. Einen Moment lang überlegte er, ob er seine Waffe oder lieber sein Handy aus der Jacke holen sollte. Und dann erkannte er Bonnie.
Bonnie. Seine zweijährige Tochter stand auf dem Sitz und grinste ihn durch die Scheibe an.
Dylan machte einen Satz auf den Wagen zu und stieg ein, woraufhin ihm das Mädchen so schwungvoll um den Hals fiel, dass ihm der Hut vom Kopf rutschte.
Mit dem Ellbogen drückte er auf den Schalter für die Zentralverriegelung.
“Daddy!”, rief Bonnie. Zumindest hieß sie für ihn Bonnie. Ihre Mutter Sharlene hatte sie dagegen je nach Laune ein Dutzend Mal umgetauft.
“Hey, Süße”, erwiderte Dylan und lockerte seinen Griff um die Kleine, da er fürchtete, er könnte sie erdrücken. “Wo ist deine Mom?”
Bonnie sah ihn mit ihren riesigen blauen Augen an. Ihr kurzes blondes Haar lockte sich um ihre Ohren, und sie trug einen abgewetzten Overall und Flipflops.
Ich bin erst zwei, schien ihre Miene zu sagen. Woher soll ich wissen, wo meine Mom ist?
Dylan drehte sich um und öffnete das Seitenfenster, wobei er einen Arm um Bonnie gelegt hielt. “Sharlene!”, rief er über den dunklen Parkplatz.
Natürlich bekam er keine Antwort. Die erneute Veränderung in der Atmosphäre verriet ihm, dass seine Exfreundin längst das Weite gesucht hatte. Wieder einmal.
Nur dass sie diesmal Bonnie zurückgelassen hatte.
Er wollte fluchen, mit der Faust das Lenkrad traktieren, doch solche Dinge tat man nicht in der Gegenwart eines Kindes. Nicht, wenn man wie er und seine Brüder Logan und Tyler im Haushalt eines Alkoholikers aufgewachsen war und bei jedem lauten Geräusch erschrocken zusammenzuckte. Aber das war nicht der einzige Grund. Denn er verspürte zugleich eine seltsame, unterschwellige Begeisterung.
Dank Sharlenes Nomadenleben – das sie dennoch nie davon abhielt, seine Unterhaltsschecks einzulösen – bekam er seine Tochter nur selten zu sehen, und es tat ihm in der Seele weh, dass er meistens nicht wusste, was sie gerade tat.
Bonnie setzte sich auf seinen Schoß, legte den Kopf an seine Brust und stieß einen leisen Seufzer aus, vielleicht aus Erleichterung, vielleicht auch aus Resignation. Vermutlich hatte sie einen schlimmen, anstrengenden Tag hinter sich.
Für einen Moment ließ Dylan das Kinn auf den Kopf seiner Tochter sinken. Seine Augen brannten, und seine Kehle glühte, als hätte er versucht, ein Brandeisen zu schlucken. Er beugte sich vor, steckte den Schlüssel ins Zündschloss und legte den Gang ein.
Logan. Das war sein nächster Gedanke. Er musste zu Logan fahren. Schließlich war sein Bruder Anwalt. Auch wenn Dylan genug Geld besaß, um jeden Rechtsverdreher im Land zu engagieren, und auch wenn er und Logan sich nicht so ganz grün waren, wusste er, er konnte keinem anderen etwas so Wichtiges anvertrauen.
Bonnie war auch seine Tochter, nicht nur Sharlenes. Und sie verdiente es, in geordneten Verhältnissen zu leben, anständige Kleidung zu tragen – ihr Overall sah aus, als hätte die letzten Jahre jede Nacht ein Hund darauf geschlafen – und wenigstens einen verantwortungsbewussten Elternteil stets um sich zu haben.
Okay, ganz so verantwortungsbewusst war er vielleicht auch nicht. Immerhin hatte er jahrelang sein Geld mit Rodeos verdient, an deren Stelle nun seine Pokerpartien getreten waren. Und neben einer gewissen guten Investition und einer fast schon beängstigenden Tendenz, an praktisch jedem Pokerabend einen Royal Flush hinzulegen, hatte er für einige Filme diverse hoch bezahlte Stunts erledigt.
Dennoch war er im Vergleich zur unsteten Sharlene ein aussichtsreicher Anwärter auf den Titel Vater des Jahres.
Erst als er sein Lieblingshotel South Point erreichte, entdeckte er den Brief, der in einer schmuddeligen Reisetasche auf dem Rücksitz steckte. Er nahm die schlafende Bonnie auf den Arm, und während er darauf wartete, dass ein Hotelangestellter zu ihm kam, um den Truck ins Parkhaus zu fahren, las er den Brief durch.
Ich habe einige Probleme, hatte Sharlene in ihrer kindlichen Handschrift mit extremem Linksdrall auf einem billigen Notizzettel hingekritzelt. Darum kann ich mich nicht länger um Aurora kümmern. Jetzt nannte sie sie Aurora? Lieber Himmel, warum nicht gleich Oprah? Ich glaube, es ist besser, wenn ich sie zu dir bringe, anstatt sie in eine Pflegefamilie zu geben. Das habe ich selbst mitgemacht, und das war Mist. Versuch nicht, mich zu finden. Ich habe einen Freund, und wir machen uns auf den Weg. Sharlene.
Dylan atmete tief durch. Er nahm den Parkschein entgegen und griff nach der Reisetasche. Seine eigenen Sachen würde er sich von Madelines Wohnung herschicken lassen, wo er normalerweise übernachtete, wenn er einen Abstecher nach Vegas machte. Das würde Madeline zwar nicht gefallen, doch er beabsichtigte nicht, mit seiner zweijährigen Tochter bei ihr aufzutauchen.
Im South Point stieg Dylan beim National Finals Rodeo ab oder wenn Madeline durch ihren Job als Flugbegleiterin nicht in der Stadt war. Oder wenn sie gerade einen anderen Freund hatte.
Das Hotel war familienfreundlich, und er und Bonnie waren Familie.
Nachdem er sich ein Zimmer mit zwei riesigen Betten genommen hatte, bestellte er beim Zimmerservice Hamburger, Fritten und Milchshakes. Während sie auf ihr Essen warteten, rollte sich Bonnie schläfrig auf ihrem Bett zusammen, steckte den Daumen in den Mund und verfolgte jede seiner Bewegungen.
“Wir kriegen das schon hin, Kleine”, sagte er zu ihr.
Sie wirkte so klein und verwundbar, wie sie in ihrer schäbigen Kleidung dalag. “Daddy”, erwiderte sie, gähnte von Herzen und schob den Daumen wieder in den Mund, um eifrig daran zu nuckeln.
“Ganz richtig”, antwortete Dylan und widmete sich der Tasche, die Sharlene mit seiner Tochter zurückgelassen hatte. Darin befand sich weitere Kleidung im gleichen erbärmlichen Zustand wie das, was das Mädchen gerade trug, außerdem eine abgenutzte Kinderzahnbürste und eine nackte Babypuppe mit Kugelschreiberflecken im Gesicht. “Ich bin dein Daddy. Und wie es aussieht, werden wir beide morgen früh erst mal einkaufen gehen.”
Es gab keinen Schlafanzug, keine Strümpfe, nicht mal Schuhe. Nur zwei weitere Overalls und zwei armselige T-Shirts.
Wut kochte in Dylan hoch. Verdammt noch mal, wofür gab Sharlene eigentlich das Geld aus, das er ihr jeden Monat per Scheck an eine Postfachadresse in Topeka schickte? Er wusste, ihre Großmutter löste den Scheck ein, noch bevor die Tinte trocken war, mit der er unterschrieben hatte. Gleich danach schickte sie das Geld per Kurier dorthin, wo sich Sharlene gerade aufhielt.
Natürlich hatte er so seine Vermutungen; schließlich kannte er Sharlene. Vermutlich investierte sie den Unterhalt in Kokain, hautenge Klamotten und Tattoos für den aktuellen Freund, vielleicht auch für sie selbst. Bonnie war unterdessen vermutlich mit Fast Food und Tiefkühlpizza ernährt worden.
Er zwang sich zur Ruhe. Nichts davon war Bonnies Werk. Im Gegensatz zu ihm und Sharlene war sie völlig unschuldig. Und trotzdem musste sie die Fehler ausbaden, die andere Menschen begingen.
Das hat jetzt ein Ende, schwor er sich.
So gern er auch Sharlene die alleinige Schuld an dieser Misere gegeben hätte – das wäre nicht fair gewesen. Er hatte gewusst, wer und was sie war, als er vor fast drei Jahren nach einem Rodeo mit ihr geschlafen hatte; an den Namen der Stadt konnte er sich nicht mehr erinnern. Sie hatten sich in einem billigen Motelzimmer einquartiert, und nach einer Woche voller Sex trennten sich ihre Wege wieder. Ein paar Monate später tauchte Sharlene wie aus dem Nichts auf und verkündete, sie sei von ihm schwanger.
Noch bevor er Bonnie gesehen hatte und sich von der Ähnlichkeit zwischen ihnen beiden überzeugen konnte, wusste er, Sharlene sagte die Wahrheit. Es war für ihn so klar gewesen wie die Erkenntnis, dass sich jemand auf dem Parkplatz aufhielt, als er das Black Rose verließ.
Müde und wohl auch etwas verwirrt aß Bonnie nur kleine Happen von dem Essen, das der Zimmerservice brachte, dann legte sie sich wieder aufs Bett und schlief in ihrem Overall ein. Bekam sie noch immer Fertigmilch? Sollte er jemanden vom Hotel in die Stadt schicken, damit er Fläschchen und Milchpulver besorgte?
Seufzend und ratlos fuhr er sich durchs Haar.
Gleich morgen früh würde er mit ihr einen Kinderarzt aufsuchen. Allerdings würde er sie erst vernünftig einkleiden – nicht dass der Arzt das Jugendamt verständigte, sobald Dylan die Praxis betrat. Dann jedoch wollte er die Kleine gründlich untersuchen und sich erklären lassen, was um alles in der Welt Zweijährige eigentlich zu essen bekamen.
Als er überzeugt war, dass Bonnie tatsächlich fest schlief, deckte er sie behutsam zu und rief Madeline an. Sicher erwartete sie ihn bereits; sie wusste allerdings auch, dass sie erst zu nachtschlafender Zeit mit ihm rechnen konnte.
Er brauchte seine Kleidung, sein Rasierzeug und seinen Laptop.
“Dylan hier”, sagte er, als Madeline sich meldete.
“Na, gewinnst du wieder mal, Süßer?”, fragte sie mit ihrem leichten skandinavischen Akzent.
“Tu ich doch immer”, murmelte Dylan, während er seine schlafende Tochter betrachtete.
“Dann sollten wir das feiern”, säuselte sie. “Ich suche uns einen sexy Film im Kabelfernsehen aus, und dann …”
“Hör zu, Madeline, ich schaffe es heute Abend nicht mehr zu dir. Mir ist … ähm … was dazwischengekommen.”
“Wo bist du?” Ihr Tonfall hatte etwas Forderndes. Sie war nicht besitzergreifend, ansonsten hätte Dylan auch einen großen Bogen um sie gemacht. Aber sie hatte für die Dauer seines Aufenthalts in Vegas andere Angebote ausgeschlagen, und es gefiel ihr gar nicht, von ihm nun unverhofft versetzt zu werden.
“Ich bin im South Point …”, begann er.
“Zum Teufel mit dir!”, unterbrach sie ihn unüberhörbar verärgert. “Du hast irgendeine Frau abgeschleppt, wie?”
“Nicht so ganz.”
“Was soll denn das heißen?”
“Das soll heißen, dass ich mit meiner Tochter hier bin, Madeline”, erklärte er und bemühte sich, ruhig zu bleiben. Schließlich wollte er Bonnie nicht aufwecken. “Sie ist zwei.”
Prompt kehrte das zuckersüße Säuseln zurück: “Oh, komm mit ihr her! Ich liebe Babys!”
Für einen Sekundenbruchteil dachte er über Madelines Angebot nach. Dann jedoch erinnerte er sich an ihre Vorliebe für spontanen Sex, an den abgestandenen Geruch nach Joints in ihrem Apartment und an die Schale mit farbenfroh verpackten Kondomen mitten auf dem Wohnzimmertisch.
“Ähm … nein”, sagte er. “Sie ist zu müde.”
Er merkte Madeline an, dass sie wieder wütend wurde. “Und warum rufst du mich dann überhaupt an?”, knurrte sie. Jeden Moment würde sie die Krallen ausfahren und ihn in Stücke reißen.
“Ich brauche meine Sachen”, erwiderte er und zog unwillkürlich den Kopf ein, so wie er es als Kind gemacht hatte, wenn er damit rechnete, geschlagen zu werden. “Wenn du alles zusammenpackst und von einem Taxi herbringen lässt, wäre ich dir sehr dankbar.”
“Das würde mir nicht mal im Traum einfallen”, konterte Madeline. “Auf dem Weg zum Club werde ich dir die Sachen vorbeibringen.” Was wie ein freundliches Angebot klang, war zugleich eine ganz klare Ansage: Sie dachte nicht daran, den Abend allein vor dem Fernseher zu verbringen, wenn er nicht zu ihr kam.
“Madeline, du musst nicht extra …”
“Sagtest du South Point?”
“Ja, aber …”
Sie legte auf, noch bevor er etwas einwenden konnte.
Dylan setzte sich gegenüber von Bonnie auf die Bettkante und stützte die Ellbogen auf seine Oberschenkel. Madeline würde nach oben in sein Zimmer kommen wollen, allein schon um nachzusehen, ob er die Wahrheit gesagt hatte. Er wollte nicht, dass sie Bonnie aufweckte. Aber falls er Madeline nicht dazu überreden konnte, sein Gepäck von einem Pagen nach oben bringen zu lassen – und davon war auszugehen –, würde sich das wohl nicht vermeiden lassen.
Es sei denn, er ging selbst nach unten ins Foyer, um seine Sachen abzuholen. Doch er wollte Bonnie auf keinen Fall allein lassen.
Zwanzig Minuten später klingelte das Telefon. Bonnie bewegte sich prompt unruhig, wachte aber nicht auf. Dylan nahm den Hörer sofort ab. “Hallo?”, flüsterte er.
“Ich bin im Foyer”, verkündete Madeline. “Welche Zimmernummer hast du, Süßer?”
Dylan unterdrückte einen Seufzer. Gott, wie er es hasste, “Süßer” genannt zu werden. “Zwölf-zweiundvierzig.”
Madeline, eine Rothaarige mit endlosen Beinen, die mit gut eins achtzig fast so groß war wie er selbst, tauchte nur Augenblicke später im Flur auf. Beim Blick durch den Spion sah er, dass sie von einem Pagen mit beladenem Gepäckwagen begleitet wurde. Die Lippen hatte sie fest zusammengepresst, die Augen waren leicht zusammengekniffen.
Widerstrebend ließ er sie eintreten.
Sofort schaute sie sich suchend um, bis ihr Blick bei Bonnie angekommen war. Unterdessen wartete der Page geduldig mit dem Entladen seines Gepäckwagens. Dylan drückte ihm ein Trinkgeld in die Hand und brachte seine Sachen selbst ins Zimmer.
“Sie ist hinreißend!”, begeisterte sich Madeline, als sie sich über Bonnies Bett beugte.
“Sei leise”, sagte Dylan. “Sie hat einen anstrengenden Tag hinter sich.” Ein anstrengendes Leben hätte es allerdings wohl besser getroffen. Wenn Madeline erst einmal gegangen war, würde er in den sauren Apfel beißen und Logan anrufen. In der letzten Zeit kamen er und sein älterer Bruder wieder etwas besser miteinander aus, aber das konnte sich jederzeit aufs Neue verschlechtern. Außerdem würde es für ihn schon schwierig genug werden, Logan um Hilfe zu bitten.
Madeline legte einen Finger auf ihre vollen Lippen und senkte den Blick. Hätte sie die typische Vegas-Aufmachung getragen – riesigen Federschmuck auf dem Kopf, ein knappes Kostüm, hohe Absätze und Netzstrümpfe – und wäre Bonnie in diesem Moment aufgewacht, dann hätte sie der Kleinen wohl für den Rest ihres Lebens Albträume von Showgirls beschert.
Er fasste Madeline am Ellbogen und bugsierte sie Richtung Tür. “Gute Nacht und vielen Dank. Was schulde ich dir?”
“Das regeln wir, wenn du das nächste Mal in Vegas bist”, meinte sie und tätschelte dabei seine Wange. Dann kam ihr eine Idee. “Hör mal, das Hotel dürfte doch wohl einen Babysitter zur Hand haben, oder nicht? Dann könnten wir beide …”
“Nein”, unterbrach er sie knapp.
Dann endlich war Madeline gegangen.
Er duschte und rasierte sich, putzte sich die Zähne und ging in Boxershorts zum Bett. Seit der Grundschule hatte er keine Pyjamas mehr getragen.
Aber jetzt musste er auch an Bonnie denken. Und er konnte doch nicht in Boxershorts vor einer Zweijährigen umherstolzieren – auch wenn sie tief und fest schlief.
Vater zu sein wurde mit jeder Minute noch etwas komplizierter, vor allem, weil er absolut nichts darüber wusste. Seine bisherige Erfahrung mit Kindern beschränkte sich auf einige kurze Besuche bei Bonnie, wenn Sharlene sich ausnahmsweise mal dazu herabgelassen hatte, für ein paar Wochen am selben Ort zu bleiben, statt ständig weiterzuziehen.
Er holte eine Jeans und ein T-Shirt aus seiner Tasche, zog beides an und legte sich dann ins Bett.
Morgen würde er Logan anrufen, das nahm er sich fest vor. Oder übermorgen. Oder am Tag danach …
Kristy Madison wirbelte durch ihre große Küche, öffnete eine Dose Katzenfutter für ihren Perserkater Winston, nahm ihre Notizen für das heutige Treffen des Leseclubs in der Bibliothek an sich und griff nach dem Handy auf dem Tresen, das sie dort während ihrer kurzen Mittagspause aufgeladen hatte.
Sie wünschte, sie könnte heute Abend zu Hause bleiben, ein ausgiebiges Bad nehmen und ein Buch lesen. Aber der Leseclub war schließlich ihre eigene Idee gewesen, und er hatte sich als ausgesprochen beliebt erwiesen. Bislang hatten sich schon sechsundzwanzig Teilnehmer eingetragen.
Insgeheim fragte sie sich, wie viele von ihnen eigentlich nichts anderes wollten, als die Frau genauer unter die Lupe zu nehmen, der Logan Creed sein Herz geschenkt hatte. Bevor Briana mit ihm zusammengekommen war, war sie nur eine alleinerziehende Mutter gewesen, die im Council Fire Casino am Stadtrand von Stillwater Springs arbeitete, ihre beiden Söhne Josh und Alec zu Hause unterrichtete und sich mehr oder weniger um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerte.
Kristy biss sich auf die Unterlippe. Der Name Logan lenkte ihre Gedanken automatisch auf Dylan. Und das tat immer noch viel zu weh, auch wenn sie ihn vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen hatte. Seit Kurzem war er zurück in der Stadt; die Klatschweiber hatten dafür gesorgt, dass sie auch ja davon erfuhr. Aber bislang war er nicht zu ihr gekommen. Und sie war ihrerseits zu stolz, hinter ihm herzulaufen.
Das Spiegelbild im Küchenfenster zeigte ihr eine schlanke Frau mit modisch geschnittenem, mittellangem Haar, kobaltblauen Augen und zierlichem Knochenbau. Doch sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, ihre Frisur geriet allmählich aus der Form, und was bitte brachte einem ein zierlicher Knochenbau? Auf dem Foto für ihren Führerschein sah sie ganz gut aus, aber das war auch der einzige Vorteil, den sie bislang hatte feststellen können.
Winston ignorierte seinen Fressnapf, miaute laut und jämmerlich, während er sich an Kristys schwarzer Jeans scheuerte und ein Meer aus schneeweißen Haaren am Stoff zurückließ.
Oh nein! Jetzt musste sie schon wieder zum Fusselroller greifen.
Andere Frauen trugen Pfefferminz und Lippenstift in ihrer Handtasche mit sich herum, Kristy dagegen hielt stets ein Ding von der Größe einer Haarbürste griffbereit, das mit klebrigem Band umwickelt war.
“Ich weiß”, sagte sie leise zu Winston. “Du willst kuscheln und dir im Fernsehen eine Tiersendung ansehen, aber ich muss arbeiten gehen.”
Als Antwort darauf miaute Winston abermals, jetzt sogar noch deutlich kläglicher als zuvor.
“Du bekommst eine Extraportion Fisch, wenn ich nach Hause komme”, versprach sie ihm. “So spät wird das nicht werden, maximal halb zehn.”
Der Kater ließ sich davon nicht umstimmen und kehrte in die Küche zurück, wo er sich seinen Weg zwischen Farbdosen und Tapetenmustern hindurch bahnte. Er schnippte einmal verächtlich mit seinem buschigen weißen Schwanz und verschwand ins Esszimmer.
Es kam Kristy so vor, als sei sie schon seit einer Ewigkeit mit der Renovierung ihres großen viktorianischen Hauses beschäftigt. Sie war bereits daran gewöhnt, über die Einkäufe aus dem Baumarkt zu stolpern, doch ganz plötzlich kam ihr diese Arbeit wie eine niemals endende Qual vor. Nichts war mehr von dem Gefühl geblieben, mit der Renovierung etwas Gutes und Wichtiges zu leisten, wie sie es noch geglaubt hatte, als sie seinerzeit den Kaufvertrag unterschrieb.
“Ich bin mein Leben leid”, sagte sie zu ihrem Spiegelbild. “Ich will ein anderes haben.”
“Pech gehabt”, erwiderte das Spiegelbild. “Du hast dir das ausgesucht, jetzt musst du auch damit zurechtkommen. Und zwar allein.”
Ohne Ehemann, ohne Kinder.
Noch ein paar Geburtstage und eine Handvoll Katzen mehr, dann würde sie als verrückte alte Jungfer durchgehen. Die Kinder würden sie als Hexe bezeichnen und an Halloween einen großen Bogen um ihr Haus machen.
Kristy wandte sich von ihrem Spiegelbild ab, hängte sich die Handtasche über die Schulter, steckte das Handy, ihre Notizen und das Buch ein, das sie für das erste Treffen des Leseclubs ausgewählt hatte, und ging zur Hintertür.
Ganz gleich, wie trüb ihre Gedanken auch sein mochten – sobald sie die öffentliche Bibliothek von Stillwater Springs sah, besserte sich ihre Laune sofort. Das war auch heute Abend nicht anders. Sie liebte dieses gedrungene Backsteingebäude mit den grünen Fensterläden und dem mit Schindeln gedeckten Dach. Und sie liebte es, von Büchern und von den Menschen umgeben zu sein, die diese Bücher lasen.
Sie und einige andere Leute, die in dieser Gegend von Montana aufgewachsen waren, hatten einen beharrlichen Kampf austragen müssen, um das Geld für eine neue Bibliothek und einen angemessenen Bestand an Büchern zusammenzubekommen, nachdem das alte Gebäude einem Feuer zum Opfer gefallen war.
Ihren dunkelgrünen Geländewagen, einen Chevrolet Blazer, stellte sie auf dem für sie reservierten Platz ab, dann eilte sie zum Seiteneingang. Der Haupttrakt der Bibliothek war bereits am Nachmittag geschlossen worden, da in einer der Toiletten Klempnerarbeiten durchgeführt werden mussten, aber die beiden kleinen Versammlungsräume standen dennoch zur Verfügung – einer für den Leseclub, der andere für die Anonymen Alkoholiker.
Sie hängte ihre Tasche an einen Haken, wusch sich die Hände in der Spüle der kleinen Kochnische zwischen den beiden Räumen und begann dann, sich mit der großen Kaffeekanne abzumühen.
Sheriff Floyd Book traf als Nächster ein. Er brachte aus seinem Privatwagen einen Karton mit Büchern und Flugblättern mit und begrüßte Kristy mit einem freundlichen Nicken. “Ich wusste doch, wenn ich nicht früh genug herkomme, würdest du den Kaffee aufschütten”, zog er sie auf.
“Alles bereit für deine Pensionierung?”, fragte sie lachend, während sie Pappbecher und Tütchen mit Zucker und Milchpulver verteilte.
“Ja, nur ich nicht”, rief er aus dem Nebenraum, wo er die Bücher und Flugblätter für das anstehende Treffen der Anonymen Alkoholiker auslegte. In Stillwater Springs war niemand anonym, aber damit das sogenannte Programm abgespult werden konnte, tat jeder so, als würde er nichts davon mitbekommen, wer am Dienstagabend den Seiteneingang der Bibliothek benutzte. “Ich kann die Wahl kaum erwarten. Dann drücke ich meine Dienstmarke Jim Huntinghorse oder Mike Danvers in die Hand, und dann lasse ich diese Stadt hinter mir – jedenfalls für ein paar Wochen. Dorothy und ich sitzen schon in den Startlöchern für unsere Kreuzfahrt nach Alaska.”
“Na, bald ist es ja so weit”, meinte sie aufmunternd. Bis ihr Name gefallen war, hatte Kristy gar nicht bemerkt, dass Floyd seine Frau nicht mitgebracht hatte. “Kommt Dorothy nicht zu unserem Treffen? Sie hatte sich doch angemeldet.”
Seit einem Verkehrsunfall vor ein paar Jahren saß Dorothy Book im Rollstuhl, und es gab den einen oder anderen, der behauptete, sie sei nicht ganz richtig im Kopf. Kristy hatte Dorothy immer gut leiden können, und selbst wenn sie tatsächlich etwas anders sein sollte, hatte sie sich darauf gefreut, die Frau des Sheriffs beim ersten Treffen dabeizuhaben.
Floyd schüttelte den Kopf. In letzter Zeit wirkte er müde und abgekämpft, fast so wie Kristys Mutter, kurz bevor sie starb. Vielleicht lag es am allgemeinen Interesse an seiner bevorstehenden Pensionierung, am Stress, den sein Job mit sich brachte, oder am ungewissen Ausgang der Wahl. Auf jeden Fall kam er ihr angespannter vor als üblich.
“Es fällt ihr schwer, in den Wagen ein- und wieder auszusteigen”, erklärte der Sheriff. “Und sie kann das Theater mit dem Rollstuhl nicht ausstehen. Ich hoffe, die Kreuzfahrt bewirkt, dass sie wieder Farbe ins Gesicht bekommt und das Funkeln in ihre Augen zurückkehrt.”
Kristy hielt inne. Floyd Book war Sheriff eines ausgedehnten County, seit Kristy in die zweite Klasse gegangen war. Niemand außer ihm hatte in all den Jahren dieses Amt bekleidet. Bis ihr Dad nur ein halbes Jahr nach ihrer Mom starb, war Floyd regelmäßiger Gast auf der Madison-Ranch gewesen. Er und Kristys Vater waren beste Freunde gewesen. Sie angelten beide mit Begeisterung, ritten gern und kümmerten sich um die bescheidene Herde, die Tim Madison sich hatte leisten können.
Ein Stich ging Kristy durchs Herz. Am liebsten hätte sie Floyd ohne Umschweife gefragt, ob etwas nicht stimme und ob sie ihm irgendwie helfen könne. Offenbar war das ein Abend, an dem nur schmerzhafte Erinnerungen nach oben kamen.
“Alles in Ordnung?”, fragte Floyd und kam zügig zu ihr, um seine große Hand auf ihre Schulter zu legen. “Du warst einen Moment lang kreidebleich. Ich dachte schon, du wirst ohnmächtig.”
“Mir geht’s gut”, wehrte sie ab. Sie war auf einer Ranch in Montana aufgewachsen, und da erwartete man von ihr, so zu antworten. Selbst, wenn das Gegenteil der Fall war.
Aber die Ranch war jetzt verlassen, die Scheune stand windschief da, und das robust gebaute alte Ranchhaus war seit Langem menschenleer. Als Kristy sich das letzte Mal gezwungen hatte, die Ranch aufzusuchen, und auf der Anhöhe stand, auf der sie mit ihrem geliebten Palomino-Wallach Sugarfoot geritten war, da hatte sie förmlich spüren können, wie ihr Herz in tausend Splitter zersprang.
Ihre Eltern waren beide tot, sie hatte keine Brüder oder Schwestern, keine Tanten – zuletzt war auch noch ihre Großtante Millie gestorben – oder Onkel und auch keine Cousins oder Cousinen.
Sugarfoot lebte gleichfalls nicht mehr, sondern lag in einem Grab inmitten einer Baumgruppe nahe der Grenze zur Creed-Ranch. Nach sechzehn Jahren, also mehr als der Hälfte ihres Lebens, musste Kristy immer noch weinen, wenn sie die letzte Ruhestätte ihres besten Freundes besuchte. Die Leute drängten sie, sich ein neues Pferd anzuschaffen, schließlich liebte sie es zu reiten und war darin außergewöhnlich gut. Aber sie brachte es einfach nicht übers Herz, ein anderes Tier oder einen anderen Menschen so sehr zu lieben und dabei einen weiteren Verlust zu riskieren.
Ihr war schon so viel genommen worden.
Ihre Eltern, Sugarfoot …
Und Dylan Creed.
“Kristy?” Der Sheriff sah sie besorgt an. “Vielleicht solltest du besser nach Hause gehen. Womöglich hast du dir irgendeinen Virus eingefangen. Ich kann den Damen vom Leseclub sagen, dass das Treffen verschoben werden muss.”
Sie brachte ein Lächeln zustande, straffte die Schultern und sah dem alten Freund ihres Vaters in die Augen. “Unsinn”, sagte sie. “Wir haben das schon einmal verschoben. Ich bin nur etwas müde, weiter nichts.”
Floyd war von ihren Beteuerungen nicht so ganz überzeugt, aber die ersten Teilnehmer seines Programms trafen soeben ein, also wandte er sich von Kristy ab und ging nach nebenan, um die Leute zu begrüßen. So machte er es seit Jahren an jedem Dienstagabend, seit Dorothy in diesen Unfall verwickelt worden war – und seit der Skandal die Runde gemacht hatte, dass er sich hinter dem Rücken seiner Frau mit Freida Turlow traf. Er hatte draußen auf der Ranch in der Küche von Kristys Vater gesessen und Tränen vergossen über den Schmerz, den Dorothy erlitten hatte – nicht nur bei jenem Unfall auf einer spiegelglatten Straße, sondern auch dadurch, dass er sie mit einer anderen Frau betrog.
Es war das erste und einzige Mal, dass Kristy, die sich im Flur versteckt hatte und lauschte, einen erwachsenen Mann hatte weinen sehen.
Ihr hilfsbereiter Vater hatte Floyd eine Hand auf die Schulter gelegt und gesagt: “Das ist der Alkohol, alter Freund. Der verwandelt dein Leben in einen solchen Scherbenhaufen. Meinst du, ich weiß nicht, dass du immer eine Flasche bei dir hast, wo du auch gehst und stehst? Du musst was dagegen tun.”
Und das hatte Floyd dann auch getan. Er schloss sich den Anonymen Alkoholikern an und sagte sich vom Alkohol los. Seitdem war er seiner Frau Dorothy treu gewesen, soweit Kristy das beurteilen konnte.
Kristy verließ die Kochnische und ging zurück in ihren Versammlungsraum, wo sich durch eine Laune des Schicksals ausgerechnet Freida Turlow als Erste eingefunden hatte.
Freida war eine athletische Frau, auf eine herbe Art attraktiv. Wie Kristy lebte auch sie schon ein Leben lang in Stillwater Springs. Vom College abgesehen hatte keine von ihnen für längere Zeit ihrer Heimatstadt den Rücken gekehrt.
Aber Kristy war auch ein heimatverbundener Typ. Sie hatte niemals woanders leben wollen, nicht einmal, nachdem ihre Eltern während ihres ersten Jahrs an der University of Montana innerhalb kurzer Zeit gestorben waren. Freida dagegen, die mindestens zehn Jahre älter war und sich an jenen wenigen Abenden als ihre Babysitterin um sie gekümmert hatte, wenn ihre Eltern tanzen gingen oder mit Freunden Karten spielten, wirkte in Stillwater Springs fehl am Platz. Sie war ehrgeizig und gebildet, und sie war praktisch die Chefin des örtlichen Maklerbüros. Ihr Bruder Brett war der klassische Verlierer, der auf ihrer Couch übernachtete und vor allem dadurch von sich reden machte, dass er ihr bei jeder Gelegenheit Bargeld klaute.
Heute Abend hatte Freida ihr dunkles, mittellanges Haar nach hinten gekämmt und zusammengebunden. Sie trug einen Jogginganzug und Laufschuhe, unter dem Arm hielt sie das Buch für diesen Abend geklemmt. So wie Kristy hatte auch Freida ihr Zuhause aus Kindheitstagen verloren – ausgerechnet jenes, an ein Lebkuchenhaus erinnernde Gebäude, das nun Kristy gehörte – und reagierte gereizt, wenn das Thema zur Sprache kam. Wiederholt hatte sie versucht, Kristy das Haus wieder abzukaufen. Sie hatte jedes Mal noch ein bisschen mehr geboten, und mit jeder freundlichen Ablehnung war sie noch schroffer und ungehaltener geworden.
Kristy konnte Freida verstehen; sie fühlte sogar mit ihr mit. Aber neben Winston und ihrem Job, den sie ausübte, seit sie ihren Abschluss gemacht hatte, war das Haus alles, was sie besaß.
Wohin sollte sie, wenn sie Freida das Haus verkaufte?
“Es gibt Neuigkeiten aus der Welt der Makler”, verkündete Freida mit sichtlicher Genugtuung. “Ich habe ein Angebot für die Madison-Ranch bekommen. Genauer gesagt: die Ankündigung eines Angebots.”
Einen Moment lang konnte Kristy sich nicht rühren. Die alte Ranch war heruntergekommen, aber das Grundstück war riesig und brachte es auf über zwölfhundert Hektar. Genau das Richtige für Filmstars und Firmenbosse, die sich in den letzten Jahrzehnten so manches Anwesen in Montana unter den Nagel gerissen hatten.
Nur das Durcheinander mit den Testamenten hatte dafür gesorgt, dass das Anwesen so lange Zeit nicht auf dem Markt angeboten worden war. Rechtlich gesehen gehörte die Ranch jetzt der örtlichen Bank, doch der Name Madison war nach wie vor damit verbunden. Die Madisons hatten dort seit der Besiedlung des Bundesstaats gelebt. Zwei Monate nach dem Tod von Kristys Dad hatte die Bank das Land gepfändet.
Freida gestattete sich ein überhebliches Lächeln.
Dann betrat Briana Grant den Raum. Es kursierten Gerüchte, dass sie und Logan Creed bereits heimlich geheiratet hatten oder dass es zumindest in Kürze dazu kommen sollte. Auf jeden Fall hieß es, dass die beiden miteinander schliefen. Briana, die ihr langes rotblondes Haar wie immer zu einem Zopf geflochten trug, hatte Kristy über ihre Beziehung bislang noch keine Einzelheiten anvertraut, obwohl sie beide sich gut verstanden.
Als sie Freida am Konferenztisch sitzen sah, blieb Briana in der Tür stehen und machte den Eindruck, als wolle sie auf dem Absatz kehrtmachen.
“Kommen Sie herein”, sagte Kristy hastig und lächelte sie an. Innerlich jedoch war sie immer noch tief davon getroffen, dass jemand die Madison-Ranch kaufen wollte. Da half es auch nichts, wenn sie sich wieder und wieder einredete, das sei bedeutungslos.
Briana zögerte noch. Dann bemerkte sie Freidas Blick, hob das Kinn ein wenig an und setzte sich an den Tisch.
“Sie haben ja vielleicht Nerven, hier einfach aufzukreuzen, nachdem Sie meinem Bruder Ärger ohne Ende gemacht haben”, zischte Freida ihr zu.
Briana errötete, ließ sich aber nicht einschüchtern. Sheriff Book hatte Brett Turlow einige Male festgenommen und verhört, nachdem bei Briana eingebrochen worden war. Mehr wusste Kristy nicht darüber; sie war für Klatsch und Tratsch nicht zu haben.
“Hier ist jeder willkommen, Freida”, erklärte Kristy mit Nachdruck. Die Bibliothek von Stillwater Springs war zwar nicht der Ort, an dem hitzige Diskussionen ausgetragen wurden, dennoch besaß sie einige Erfahrung darin, für Ordnung zu sorgen. Viele Bewohner der Stadt betrachteten die Bibliothek als einen Ort, an dem jeder bei freiem Eintritt den ganzen Tag zubringen konnte, und es ging durchaus schon mal lautstark zu, wenn zwei eifrige Leseratten sich um das einzige Exemplar eines aktuellen Bestsellers stritten.
Freida stand mit steifen, sparsamen Bewegungen auf, nahm ihre Handtasche und das Buch und meinte: “Ich weiß nicht, warum ich überhaupt noch in dieser Stadt bleibe, wo sich in letzter Zeit dieser ganze Pöbel hier ansammelt.” Dann verließ sie mit hoch erhobenem Kopf den Versammlungsraum.
Briana standen Tränen in den Augen.
Kristy setzte sich zu ihr und nahm ihre Hand. “Wenn sich hier jemand unpassend verhält, dann ist es Freida. Anderen Leuten etwas von Pöbel zu erzählen, wenn sie selbst so einen missratenen Bruder hat”, sagte sie sanft.
Briana schniefte, brachte ein Lächeln zustande und nickte dann. Dabei drückte sie das Buch so fest an sich, als handele es sich um einen kostbaren Schatz.
Dann trudelten nach und nach die anderen Teilnehmerinnen des Leseclubs ein, die meisten in Zweier- oder Dreiergruppen, die in angeregte Unterhaltungen vertieft waren. Einige von ihnen holten sich einen Kaffee, und obwohl sie fast alle Briana interessiert musterten und sicherlich insgeheim über ihr Verhältnis zu Logan Creed spekulierten, bezogen sie sie doch in ihre Diskussion mit ein.
Gut eine Stunde später schaltete Kristy das Licht aus und schloss die Tür ab. Sowohl ihr Treffen als auch das von Sheriff Book waren beendet. Es war ein durchaus lohnenswerter Abend gewesen, fand sie – auch wenn Winston das nicht so sehen würde.
Zurück in ihrem Wagen, der einsam auf dem Bibliotheksparkplatz stand, umfasste Kristy das Lenkrad mit beiden Händen und ließ den Kopf sinken. Sie war sonderbar nervös, als müsse jeden Moment etwas Bedeutsames geschehen. Aber das hier war Stillwater Springs, Montana, und hier ereignete sich nie etwas Bedeutsames. Jedenfalls nicht allzu oft.
Sie riss sich zusammen, zwang sich dazu, sich gerade hinzusetzen, dann ließ sie den Motor an und fuhr nach Hause. Winston wartete bereits auf sie, ebenso ihre altmodische Badewanne mit den Löwenfüßen sowie ein fesselnder Thriller, den sie seit einer Woche zu Ende zu lesen versuchte.
Vielleicht hatte Sheriff Book ja recht gehabt. Vielleicht hatte sie sich tatsächlich irgendeinen Virus eingefangen.
Und vielleicht würde die Erinnerung, die ihr ihr Unterbewusstsein schon so lange vorenthielt, endgültig an die Oberfläche durchbrechen – und ihr so sorgsam aufgebautes Leben ruinieren.
2. KAPITEL
Nachdem er am nächsten Morgen eine halbe Stunde lang versucht hatte, den vom Zimmerservice gelieferten Haferbrei an Bonnie zu verfüttern, die aber beharrlich den Mund zusammenkniff, gab Dylan auf. Er verließ das Hotel und fuhr zum nächsten Wal-Mart.
Bonnie brauchte einen Kindersitz für seinen Wagen und noch einen ganzen Berg anderer Dinge. Also setzte er sie in den Einkaufswagen und machte mit ihr eine Tour durch den Supermarkt. Ihre Kleidergröße schätzte er, und als sie ein paar Schuhe anprobieren sollte, wehrte sie sich mit Händen und Füßen dagegen. Nach einem kurzen Kampf stand er aber schließlich als Sieger da. In der Spielzeugabteilung suchte er eine Puppe aus, die fast so groß war wie Bonnie selbst und die zudem auf einem Plastikpferd saß, doch sie zeigte kein großes Interesse daran.
“Spielzeug”, flüsterte ihm eine ältere Frau ins Ohr, “muss altersgerecht sein.”
“Altersgerecht?” Dylan schob seinen Hut bis in den Nacken.
Die Frau zeigte auf den Karton mit der reitenden Puppe. “Die ist für Kinder ab fünf Jahren. Ihre Kleine dagegen kann kaum älter als zwei sein.”
“Sie ist klein für ihr Alter”, erwiderte Dylan trotzig. Er konnte es nicht ausstehen, wenn andere Leute ihm sagten, was er zu tun hatte – selbst wenn sie damit recht hatten. Aber nachdem die mitteilsame Kundin in den nächsten Gang entschwunden war, stellte er die Puppe zurück ins Regal und griff stattdessen nach einem rosa Plüsch-Einhorn, das laut Anhänger “altersgerecht” war.
Bonnie drückte das Tier sofort an sich.
Nachdem er alles Notwendige beisammen und bezahlt hatte, konnte es weitergehen. Zurück im Truck erledigte Dylan einige Telefonate, und er machte eine Kinderärztin am Stadtrand ausfindig.
Die Praxis von Dr. med. Jessica Welch befand sich in einer teuren Mall. Die Ärztin sah gut aus. Ihr langes, glänzendes, braunes Haar wurde im Nacken von einer silbernen Spange zusammengehalten. Es war zwar nicht von Bedeutung, doch wenn Dylan einer Frau begegnete – egal welcher Frau –, dann fielen ihm solche Kleinigkeiten auf.
“Und wen haben wir hier?”, fragte Dr. Welch und strich Bonnie übers Haar, während die Kleine sich mit beiden Armen an Dylans Hals festklammerte.
Bonnie warf abrupt den Kopf nach hinten und stieß einen Schrei aus. Seit er die Praxis vor einer geschlagenen Dreiviertelstunde betreten hatte, klammerte sie sich an ihn. Als einziger Vater im Wartezimmer bekam er von den Müttern mit ihren besser erzogenen Kindern Blicke zugeworfen, die er von Frauen nicht gewöhnt war.
Dr. Welch zeigte sich ungerührt, immerhin gehörten schreiende Kinder zu ihrem Alltag. “Hier entlang”, sagte sie.
Dylan folgte ihr durch einen kurzen Korridor in ein kleines Behandlungszimmer. Bonnie hörte nicht auf zu schreien, und nun begann sie auch noch, zu treten und sich in seinen Armen zu winden.
“Vermutlich denkt sie, sie bekommt jetzt eine Spritze oder so etwas”, überlegte Dylan, obwohl er eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Mittlerweile hatte Bonnie ihm den Hut vom Kopf geschlagen und zog mit beiden Händen an seinen Haaren.
Dr. Welch lächelte nur. “Dann wollen wir uns mal gründlicher mit dir befassen, Miss …”
“Bonnie”, antwortete Dylan. “Bonnie Creed.”
Bonnie Creed. Das hörte sich gut an!
Die Ärztin sah sich die Formulare an, die er im Wartezimmer ausgefüllt hatte. “Und Sie sind der Vater.” Es war keine Frage, nur eine Feststellung, dennoch fühlte er sich zu einer Reaktion veranlasst.
“Ja.”
“Die Ähnlichkeit ist auch nicht zu übersehen”, meinte Dr. Welch. Wie sich herausstellte, hatte sie einige gute Tricks und Kniffe auf Lager. Sie ließ Bonnie mit dem Stethoskop Dylans Herzschlag hören und brachte die Kleine damit tatsächlich zur Ruhe.
“Irgendwelche schwerwiegenden gesundheitlichen Probleme?”, fragte die Ärztin, als sie die Routineuntersuchung fortsetzte. Sie untersuchte Bonnies Ohren und ihren Hals.
“Nicht dass ich wüsste”, erwiderte er. “Sie hat … ähm … sie hat bislang bei der Mutter gelebt.”
“Verstehe”, kam Dr. Welchs ernste Antwort.
“Ich hatte gehofft, Sie könnten mir sagen, was sie zu essen bekommen muss und so weiter”, fuhr er fort und spürte, dass seine Ohren glühten. Womöglich überlegte die Ärztin, ob sie die Behörden verständigen sollte.
“Ich nehme an, Sie haben bislang nicht viel Zeit mit Bonnie verbracht”, sagte sie nachdenklich.
“Das kam alles sehr plötzlich. Sharlene hat beschlossen, sich nicht länger um ihre Tochter kümmern zu können, also hat sie sie mir aufs Auge gedrückt.” Er mochte gelassen klingen und vielleicht auch wirken. Aber sollte Dr. Welch im nächsten Moment zum Telefon greifen, dann würde er sofort die Flucht antreten und mit Bonnie davonfahren. Verdammt! Ein Anruf bei Logan, und der hätte ihn wenigstens in juristischer Hinsicht unterstützen können …
“Ich brauche eine Telefonnummer, unter der ich Sie erreichen kann, Mr. Creed.”
Er gab ihr seine Handynummer und nahm Bonnie vom Untersuchungstisch in seine Arme.
“Zweijährige”, redete Dr. Welch weiter und lächelte plötzlich wieder, “bevorzugen eine halbfeste Ernährung. Dazu gehört auch Babynahrung, aber nicht die, die für Säuglinge gedacht ist. Alles, was sich mühelos kauen lässt.”
“Keine Fläschchen?”, wunderte sich Dylan.
“Einen Lernbecher mit Deckel”, sagte die Ärztin. “Bonnie muss viel Milch trinken. Fruchtsäfte sind auch in Ordnung, allerdings müssen Sie auf den Zuckergehalt achten.”
Dylan wurde bewusst, dass er sich wohl besser Notizen machen sollte. Was sollte bitte ein Lernbecher sein? Und steckte nicht in jedem Fruchtsaft Zucker?
Er behielt seine Fragen für sich; er hatte sich schon genug zum Narren gemacht. Er würde sich jedenfalls nicht wundern, wenn die Ärztin ihn für einen Kidnapper hielt.
Dr. Welch gab Bonnie ein paar Spritzen, von denen die Kleine kaum Notiz nahm, versorgte ihn mit einer Liste gesunder Nahrungsmittel und ließ sie beide gehen. Er bezahlte die Rechnung, dann machte er sich auf den Weg zum Truck. Erst als sie sich fünfzig Meilen nördlich von Las Vegas befanden, hörte Dylan auf, im Rückspiegel nach Polizeiwagen Ausschau zu halten.
Dylan musste sich gar nicht dazu durchringen, Logan anzurufen – Logan meldete sich bei ihm. Wie gewohnt natürlich im unpassenden Moment.
Logan ließ ihn wissen, dass er Briana Grant heiraten würde. Und das ließ er sich auch nicht mehr ausreden, wie Dylan merkte, als er den Anruf seines Bruders in einer Raststätte am Rande des Highways annahm. Bonnie saß in einem Kinderstuhl und bewarf ihn immer wieder mit Spaghetti.
Seine Geduld war allmählich am Ende. “Pass auf, Logan, ich …” Er hielt inne, als Bonnie plötzlich ihr Gesichtchen in den Teller drückte und ihn dann, überall mit Nudeln beklebt, anstrahlte. “Verdammt, hör auf damit …”
Bonnie kicherte und zierte sich sogar ein wenig, als sei sie ein Model für Spaghettigesichter.
“Hast du eine Frau bei dir?”, hörte er Logan fragen. Er klang, als würde er grinsen.
“Schön wär’s”, erwiderte Dylan. “Ich muss jetzt Schluss machen … ich sagte, du sollst aufhören … Ich werde zusehen, dass ich es rechtzeitig schaffe. Wenn ich mich verspäte, dann macht ohne mich weiter.”
Von allem, was sein Bruder ihm danach noch erzählte, bekam er kaum etwas mit. Vielleicht würde Logan in Vegas heiraten. In erster Linie aber behielt er im Gedächtnis, dass sein Bruder ihn bat, mit Tyler Kontakt aufzunehmen. Logan wollte mit ihm reden, persönlich.
Von wegen. Tyler war sauer und hatte auf stur geschaltet, und damit war es unmöglich, zu ihm durchzudringen. Ganz egal, was Dylan auch sagte.
Dann warf Bonnie abermals mit Spaghetti um sich, und diesmal traf sie die Frau am Nebentisch genau am Hinterkopf. Dylan legte prompt auf, ohne dass er seinem Vorhaben, Logan um Hilfe zu bitten, auch nur ein Stückchen näher gekommen war. Er zog seinen kleinen Satansbraten vom Kinderstuhl, legte ein paar Geldscheine für das Essen auf den Tisch und verließ fluchtartig das Lokal.
Jetzt musste er nur noch eine Möglichkeit finden, um das Kind wieder sauber zu bekommen. Da er keinen Gartenschlauch zur Hand hatte, begnügte er sich mit den Babytüchern, die er gerade gekauft hatte – ebenso wie das Einhorn, eine Kindertoilette aus Plastik, die kleinen Tennisschuhe und die Kleidung, die Bonnie trug. Die hatte sie mit dem Teller Nudeln allerdings weitestgehend ruiniert.
“Töpfchen”, sagte sie, als sie von der Raststätte kommend auf den Highway zurückkehrten. “Daddy, Töpfchen.”
“Wir können uns auf keinen Fall noch mal da drinnen blicken lassen”, wehrte Dylan ab. “Vermutlich haben wir Hausverbot bis zum jüngsten Tag.”
“Töpfchen”, beharrte Bonnie. Außer Daddy schien es das einzige Wort zu sein, das sie beherrschte. Seit sie am Morgen das South Point verlassen hatten, war er mit ihr in vier verschiedene Herrentoiletten geschlichen, hatte sie auf die Brille gesetzt und festgehalten, damit sie nicht hineinfiel, und dann weggeschaut, bis sie fertig war.
Plötzlich begann ihre Unterlippe zu zittern. “Töpfchen”, wiederholte sie kläglich.
“Oh verdammt”, murmelte Dylan. Er fuhr rechts ran, holte die rosa Toilette aus der Plastiktüte und platzierte sie hinter ein paar Büschen am Straßenrand. Dann befreite er Bonnie aus dem Kindersitz und trug sie ebenfalls hinter die Büsche.
Er drehte ihr den Rücken zu.
Sie musste sich die Hose selbst ausgezogen haben, denn als er sich schließlich wieder zu Bonnie umdrehte, grinste die ihn mit ihrem mit getrockneter Tomatensoße verklebten Gesichtchen an und machte unheilvolle Presslaute.
Dylan hatte die wildesten Bullen im Rodeo bezwungen, und bis zu seiner Begegnung mit Cimarron, dem Paradebeispiel für einen Bullen, war er niemals abgeworfen worden. Er hatte sich bei Schlägereien in Kneipen und finsteren Gassen behauptet, wo Verlieren gleichbedeutend damit war, dass einem der Kopf gegen den Bordstein gedonnert wurde. Er hatte besser geblufft als die besten Pokerspieler von ganz Amerika.
Aber ein kleines Mädchen, das ein großes Geschäft verrichtet – nein, so etwas hatte er noch nie erlebt.
“Tuch!”, krähte sie.
“Das glaubst du doch selbst nicht”, kommentierte Dylan, holte trotzdem die Babytücher aus dem Wagen und reichte sie ihr.
Offenbar wusste sie, was damit zu tun war, denn auf einmal ging sie um ihn herum, war vollständig angezogen, und zog die Toilette hinter sich her. So unangenehm diese Erfahrung für ihn auch gewesen war, verspürte Dylan dennoch einen gewissen Stolz. Die Kleine war für eine Zweijährige ausgesprochen selbstständig. Sie hatte sogar daran gedacht, das belastende Beweisstück zu entsorgen.
“Wir brauchen eine Frau”, sagte er zu ihr, als sie wieder im Truck saßen und er mit einem Tuch ihre Hände abgewischt und sie im Kindersitz festgeschnallt hatte – was im Übrigen eine so komplizierte Aktion war, als hätte die NASA den Sitz entwickelt. “Irgendeine Frau.”
Aber es war nicht irgendeine Frau, die ihm in den Sinn kam.
Es war Kristy Madison.
Auf gar keinen Fall, dachte er sofort.
Danach waren sie noch einige Stunden unterwegs, und um kurz nach drei am Morgen erreichten sie die ersten Ausläufer von Stillwater Springs, Montana.
Dylan gehörte ein Haus auf der Ranch seiner Familie, in dem bis vor Kurzem Briana und ihre beiden Söhne gelebt hatten. Sie waren zu Logan gezogen, nachdem dort eingebrochen worden war. Er wusste nicht, ob sein Bruder die Verwüstungen bereits hatte beseitigen lassen.
Also fuhr er stattdessen zu Cassie.
Als er in die Auffahrt einbog, bemerkte er einen schwachen Lichtschein, der durch die dünnen Tierhäute ihres berühmten Tipis drang. Dylan hatte dort mit Logan und Tyler viele schöne Stunden verbracht. Oft hatten sie so getan, als wären sie Indianer, die einen Überfall auf eine Siedlung der Weißen planten.
Bonnie war in ihrem Kindersitz fest eingeschlafen. Sie hielt die nackte, verschmierte Puppe an sich gedrückt, als sei sie ihr einziger Freund auf der Welt; das rosa Einhorn lag unbeachtet neben ihr. Dylan stieg aus und ging zum Tipi.
Cassie war eine wunderschöne Frau mit langem, von silbernen Fäden durchzogenem Haar und blitzenden braunen Augen. Ihr Gewicht hatte sie nie interessiert; sie betrachtete ihre Pfunde schlicht als Teil ihrer Persönlichkeit. Für Dylan und seine Brüder war Cassie so etwas wie ihre Großmutter, obwohl sie streng genommen eigentlich gar nicht verwandt waren: Logans Mutter Teresa war Cassies Pflegetochter gewesen.
Cassie saß im Tipi und beobachtete die zuckenden Flammen in der Feuergrube. Das Ganze wäre sehr malerisch anzusehen gewesen, hätte sie indianische Stammeskleidung getragen. In ihrer ausgebeulten Hose, den neongrünen Sportschuhen und einem Sweatshirt mit einem Motiv von General Custer, dem man einen Pfeil durch den Kopf gejagt hatte, machte sie jedoch jede Illusion von Mokassins und Ledergewändern mit Fransen zunichte.
Das Custer-Motiv war dennoch ganz witzig anzusehen, zumal sein gütiger Gesichtsausdruck den Schluss nahelegte, dass ihn der Pfeil nicht sonderlich störte.
“Dylan”, sagte Cassie, als sie aufsah, klang jedoch in keiner Weise überrascht.
“Ich brauche Hilfe”, erwiderte er. Bei Cassie war es sinnlos, um den heißen Brei herumzureden. Sie durchschaute jeden auf Anhieb.
Sie nickte ihm lächelnd zu und stand auf. Dylan hielt ihr seine Hand hin, um ihr hochzuhelfen, dann führte er sie zum Truck.
Bei Bonnies Anblick, die immer noch tief und fest schlief, schnappte sie verblüfft nach Luft. “Dein Kind?”, flüsterte sie.
“Ja, meins”, bestätigte er und verspürte wieder unsagbaren Stolz.
“Wo ist die Mutter?”
“Weiß der Geier”, antwortete er und holte Bonnie aus dem Wagen, ohne sie aufzuwecken. “Ich werde das alleinige Sorgerecht beantragen, aber dafür benötige ich Logans Hilfe.”
“Es gibt Tausende von Anwälten”, betonte Cassie. “Warum Logan?”
“Weil das hier … na ja, wie soll ich sagen … das könnte ziemlich knifflig werden.”
“Dylan Creed, hast du das Kind seiner Mutter etwa weggenommen?” Sie waren am Gartenzaun angekommen, Cassie ging vor ihm her auf die Veranda und drehte den Türknauf.
Offenbar konnte sie ihn doch nicht durchschauen. Jedenfalls nicht immer.
“Nein”, sagte Dylan. Es war schon spät in der Nacht, und die lange Fahrt und die Sorge um seine zweijährige Tochter hatten ihn zu viel Kraft gekostet, sodass er jetzt nicht mehr ins Detail gehen wollte. “Was denkst du denn von mir? Ich bin doch kein Verbrecher.”
“Aber aus irgendeinem Grund benimmst du dich, als würde dich jemand verfolgen”, gab Cassie leise zurück und schaltete eine Lampe im vertrauten Wohnzimmer ihres kleinen, schlichten Hauses ein. Sie nahm ihm Bonnie aus den Armen und murmelte ihr etwas Besänftigendes zu, als sich das Mädchen im Schlaf bewegte.
“Ich habe nicht das Sorgerecht für sie”, erklärte er. “Bis dahin will ich mich etwas bedeckt halten, falls Sharlene erneut ihre Meinung ändert. Den Rest erzähle ich dir morgen.”
Cassie musterte ihn einen Moment lang, dann nickte sie wieder. “Alles klar”, meinte sie und ging zum Gästezimmer. “Ich bringe die Kleine ins Bett. Im Kühlschrank findest du noch etwas Brathähnchen, falls du Hunger hast.”
Dankbar ließ sich Dylan auf das Sofa fallen. Und ehe er sich’s versah, war bereits die Sonne aufgegangen, und Bonnie stand neben ihm und zog ihn zum Spaß an den Haaren.
Er grinste sie an. Er war froh darüber, sie zu sehen. Sie trug eines von Cassies riesigen T-Shirts, das überall mit Sicherheitsnadeln gerafft und hochgesteckt war, damit es ihr einigermaßen passte. Und sie war gewaschen.
Er dankte dem Himmel für Cassie. Trotz ihrer unübersehbaren Bedenken hatte sie Bonnie gebadet und ihr wahrscheinlich auch schon etwas zu essen gegeben.
“Daddy!”, sagte die Kleine mit Engelsstimme und strich mit ihrer kleinen Hand über die Bartstoppeln auf seiner Wange.
Hätte Dylan bis dahin nicht gewusst, dass er alles tun würde, um dieses Kind – sein Kind – zu behalten und großzuziehen: Spätestens in diesem Augenblick wäre es ihm klar geworden.
“Dylan ist bei Cassie”, bekam Kristy von ihrer Friseurin Mavis Bradley zu hören. Sie nutzte die Mittagspause, um ihre Haare schneiden zu lassen. “Als ich herkam, habe ich seinen Truck in der Auffahrt zu ihrem Haus gesehen.”
Eine Mischung aus Angst und Vorfreude überkam Kristy, aber sie wartete geduldig ab, bis sich beide Regungen gelegt hatten. Sollte Dylan tatsächlich in der Stadt sein, dann würde er sie auch bald wieder verlassen. Das war seine übliche Vorgehensweise: Er kam hereingestürmt und brach einer Frau das Herz, indem er mit seinem Stiefelabsatz darauf herumtrampelte, und dann verschwand er aufs Neue.
“Und keine Stunde später war Cassie im Supermarkt und hat Windeln und Kindernahrung gekauft, und zwar die unverschämt teuren Marken”, redete Mavis weiter, ehe Kristy etwas entgegnen konnte. “Das hat mir Julie Danvers erzählt, als sie vorbeikam, um sich die Fingernägel machen zu lassen.”
Dass sie Julie verpasst hatte, nahm Kristy erleichtert zur Kenntnis. Zwischen ihnen herrschte unterschwellige Feindseligkeit, zumindest von Julies Seite: Kristy war eine Weile mit ihrem Ehemann Mike verlobt gewesen, und der hatte die Trennung nicht gut verkraftet. Inzwischen hatten sie zwei Kinder, ein großes Haus und ein blühendes Geschäft, zudem kandidierte Mike für den Posten des Sheriffs. Es war für Kristy ein Rätsel, wieso Julie ihr die Vergangenheit noch immer nachtrug.
“Interessant”, sagte Julie. Sie kannte Mavis seit der ersten Grundschulklasse, und sie wusste, sie würde so lange auf sie einreden, bis eine Reaktion kam. Jeder in Stillwater Springs wusste, Kristy und Dylan waren einmal sehr verliebt gewesen. Mavis war keineswegs die Einzige in der Stadt, die ihr von Dylans Rückkehr berichten würde.
“Ich frage mich, warum Cassie solche Sachen für ein kleines Kind kauft, wenn sie nicht …”
“Mavis”, unterbrach Kristy sie. “Ich habe keine Ahnung.”
“Meinst du, du wirst dich mit ihm treffen?”
Kristy zuckte mit den Schultern. Es wäre albern gewesen, so zu tun, als wüsste sie nicht, von wem Mavis redete. “Vielleicht laufen wir uns in der Stadt mal über den Weg”, antwortete sie mit einer Gleichgültigkeit, die sie tief in ihrem Inneren allerdings nicht verspürte. “Das mit Dylan und mir gehört der Vergangenheit an.”
“Das mit Mike Danvers auch”, gab Mavis zurück. “Trotzdem springt Julie jedes Mal aus dem Hemd, wenn er nur deinen Namen erwähnt. Was offenbar ziemlich oft vorkommt.”
Eine Erwiderung darauf musste sich Kristy gut überlegen. Alles was sie sagte, wurde von Mavis über deren persönliches Netzwerk weiterverbreitet, kaum dass sie bezahlt und den Salon verlassen hatte. “Das ist doch albern! Mike und Julie sind schon so lange verheiratet. Die beiden haben zwei wundervolle Kinder und führen ein wunderbares Leben. Stillwater Springs ist eine Kleinstadt, und wahrscheinlich sagt er jeden Tag alle möglichen Namen.”
“Na ja”, meinte Mavis hartnäckig. “Ich dachte, du würdest dich wenigstens ein bisschen darüber wundern, wieso Cassie Windeln kauft und wieso Dylan Creeds Truck so früh am Morgen bei ihr vor dem Haus parkt, dass er mitten in der Nacht angekommen sein muss …”
“Ich wundere mich gar nicht”, widersprach Kristy energisch, auch wenn sie in Wahrheit ganz anders darüber dachte. Sollte Dylan ein Kind haben, wäre das der Gipfel der Ungerechtigkeit. Sie war diejenige, die sich nach einem Rudel Kinder sehnte. Dylan hatte nie sesshaft werden wollen, sondern nur so getan, weil das seinen Absichten dienlich war. “Was Dylan Creed macht oder auch nicht macht, interessiert mich kein bisschen.”
“Unsinn”, beharrte Mavis. “Deine Ohren sind schon ganz rot angelaufen.”
“Das liegt nur daran, dass du mich andauernd mit der Schere in meine Ohren stichst. Bist du jetzt eigentlich endlich fertig? Ich muss zurück zur Bibliothek.”
Mavis schnaubte mürrisch. “Zur Bibliothek! Mein Gott, Kristy! In der Highschool warst du Cheerleader. Du warst die Königin beim Abschlussball! Du warst Miss Rodeo Montana und die zweitplatzierte Miss Rodeo America! Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Kristy Madison sich einen Job aussucht, für den sich nur alte Jungfern interessieren?”
“Um Himmels willen, Mavis!” Kristy war kurz davor, von ihrem Stuhl zu springen, sich den Plastikumhang abzureißen und mit den Klammern im Haar auf die Straße zu laufen. “Einige von uns haben die Zeit an der Highschool inzwischen hinter sich gelassen. Und was ist denn so schlimm daran, als Bibliothekarin zu arbeiten?”
Im Spiegel konnte sie sehen, wie Mavis’ spitzes, schmales Gesicht einen traurigen Ausdruck annahm. “Gar nichts”, sagte sie leise.
“Tut mir leid”, murmelte Kristy, die ihren Wutausbruch sofort bereute. “Ich wollte dich nicht anbrüllen. Es ist nur so …”
“Es ist nur so”, führte Mavis den Satz für sie zu Ende, “dass du sofort aus der Haut fährst, wenn jemand Dylan Creed erwähnt.”
“Und warum erwähnst du ihn dann?”, fragte Kristy gereizt.
Mavis drückte ihre Schulter. “Ich wollte dir nichts Böses. Ich dachte nur, es könnte dich freuen, dass Dylan zurück ist. Ich weiß, du hast eine schwere Zeit hinter dir, Kristy. Der Tod deiner Eltern, der Verlust der Ranch und dann auch noch Sugarfoot. Das kam ja praktisch alles zusammen. Ich würde dich eben gern wieder glücklich sehen! Und das warst du mit Dylan ja auch, bis es bei der Beerdigung seines Dads zu diesem großen Zerwürfnis kam. Alle in Stillwater Springs würden das gern – dich wieder glücklich sehen, meine ich.”
Es kostete Kristy Mühe, ihre Tränen zurückzuhalten. Der Grund dafür waren nicht die traurigen Erinnerungen, sondern Mavis’ Worte, die sie tief berührten. Auf ihre eigene tollpatschige Art war Mavis um sie besorgt, und das galt auch für viele andere Leute in Stillwater Springs. “Ich bin glücklich”, beteuerte sie. “Ich habe meinen Job, mein Haus, meine Katze …”
“Ich habe einen Job, ein Haus und vier Katzen”, hielt Mavis gut gelaunt dagegen. “Aber es ist mein Bill, der dafür sorgt, dass mein Herz schneller schlägt.”
“Du kannst dich glücklich schätzen”, kommentierte Kristy und meinte es so, wie sie es sagte. Seit dem Tag nach dem Highschool-Abschluss war sie mit ein und demselben Mann verheiratet, und auch wenn sie und Bill nie Kinder bekommen hatten, waren sie immer noch so verliebt wie am ersten Tag.