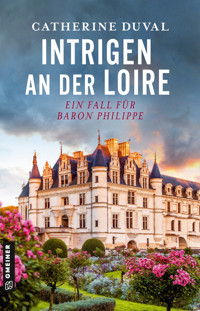Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: GMEINERHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Philippe du Pléssis
- Sprache: Deutsch
Eigentlich hätte Philippe du Pléssis mit der Suche nach einer uralten Schatulle aus Familienbesitz schon genug zu tun. Aber als im Château de Cotignac ein Gemälde gestohlen wird und im Schlossgraben eine Leiche treibt, findet er sich plötzlich in einem Mordfall wieder. Die zuständige Kommissarin Charlotte Maigret macht aus ihrer Abneigung gegen den adeligen Lebemann keinen Hehl. Doch bald taucht ein zweiter Toter auf und die Polizistin und der Dandy müssen gemeinsam ermitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Catherine Duval
Mord an der Loire
Ein Fall für Baron Philippe
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © JérémyElain / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7860-4
Prolog
»Ist es geschehen?«
»Wie Ihr es befohlen habt, Sire.«
»Wie viele Karren?«
»Achtzehn, Sire.«
»Unsere Brüder in Cotignac?«
»Alles ist bereitet, wie Ihr es befohlen habt, Sire.«
»So legen wir unser Schicksal in die Hände des Herrn. Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Nicht uns, sondern deinem Namen sei Ehre, oh Herr.«
Kapitel 1
Zu kalt. Er schlug den Kragen seines Tweedjacketts hoch. Zu hell. Philippe fummelte die Sonnenbrille aus der Brusttasche. Der Himmel über der Rue Colbert hatte sich noch nicht für eine Farbe entscheiden können. Und eindeutig zu früh. Der letzte Drink gestern im »Alexandra« war wohl einer zu viel gewesen. Mechanisch lenkten seine Schritte ihn in Richtung Place Plumereau. Das Telefon hatte ihn aus seinem ersten tiefen Schlaf gerissen. Nur Daniel konnte ihm helfen.
»So früh heute?«
Daniel stand hinter seinem Tresen und nahm eine Tasse von der fauchenden, beeindruckend großen Kaffeemaschine. Mit Schwung klopfte er den Siebträger auf die Holzkante der Bar, die an dieser Stelle bereits eine tiefe Einbuchtung hatte. Sekunden später klemmte frisches Kaffeepulver in dem chromblitzenden Gerät.
»Tante Aude«, seufzte Philippe und griff hinter den Plexiglasschutz. Er angelte nach einem goldgelben Croissant. »Von Robert?«
Daniel nickte.
»Von wem sonst, Chéri?« Butter. Eine schmeichelweiche Masse. Die Croissants au beurre aus Roberts Boulangerie waren legendär. Die langen Warteschlangen vor seinem Bäckerladen gehörten zu Recht zum Stadtbild. Das zarte Gebäck war innerhalb weniger Sekunden verschlungen. Philippe merkte, wie sich seine Mundwinkel zu einem Lächeln verzogen. Zum ersten Mal an diesem Morgen, der so unsanft begonnen hatte.
»Voilà, Monsieur. Nachschub. Mit dem Extraschuss Milch für die deutsch-französische Freundschaft. Hilft auch gegen alte Drachen wie deine Tante Aude.«
Mit einem Augenzwinkern hatte Daniel einen Grand Crème und eine Tartine vor ihm abgestellt. Dann entschwand er ans andere Ende des Tresens, um abzukassieren. Die beiden Bauarbeiter in Montur nickten Philippe zu, bevor sie das Café verließen. Stammkundschaft wie er.
Als er zurückkam, legte Daniel die Stirn in Falten. »Du siehst ein bisschen zerknittert aus, Herr Baron.«
Philippe winkte ab. »Willst du nicht wissen, glaub mir.«
»Hast du’s schon gelesen? Deine Landsmänner bringen uns zurück, was uns gehört. Nach über siebzig Jahren.« Daniel schob ihm mit einem breiten Grinsen einen Stapel Zeitungen zu. Die Ouest-France machte heute mit einem reißerischen Titel auf: »Besiegtes Deutschland. Rousseau-Gemälde an seinen rechtmäßigen Besitzer restituiert«.
Die Nouvelle République formulierte: »Französisches Kulturgut kehrt zurück: Während der Occupation gestohlenes Gemälde wird an seinen Besitzer zurückgegeben. Großes gesellschaftliches Event in Cotignac«.
Philippe lächelte zurück. »Ich sag ja: Tante Aude.«
Er schluckte den letzten Bissen des Croissants herunter und griff nach dem Baguette. Die herrlich rösche Kruste der Tartine krachte zwischen seinen Zähnen. Leicht salzige Butter und tröstlich süße Feigenkonfitüre. Es war ein Genuss. Dazu einen Schluck des bitteren Gebräus. Besiegtes Deutschland? Er ließ sich lieber auf diese Weise besiegen. Er spürte, wie die Lebensgeister in ihn zurückkehrten.
»Wenn sie dich wieder davon überzeugen will, dass du dein Junggesellenleben in Paris endgültig aufgeben und hierbleiben sollst, bin ich ganz ihrer Meinung. Aber vermutlich geht es um das Fest. Die Noblesse ist unter sich. Oder sind auch ein paar richtige französische Bürger dabei, echte Citoyens wie ich? Und seit wann zum Teufel treibst du dich gerne auf Adelsfesten herum?« Daniel sah ihn gespielt vorwurfsvoll an.
»Das ganze Who’s who der Touraine; die Familie und alle anderen Adeligen, die ihr Citoyens bei der Revolution nicht geköpft habt. Ein paar Politiker und so weiter. Hoffentlich ist wenigstens das Catering gut.« Philippe schnippte einige Baguette-Krumen von seinem Tweedjackett. »Und von gerne kann keine Rede sein. Ich bin dort rein beruflich. Ich gehe hin, mache meinen Job als Philippe Auguste Louis Vicomte du Pléssis, Baron de Beaumarchais. Und morgen bin ich wieder Philippe Pléssis und trinke bei meinem Freund Daniel und seinem Göttergatten Eric meinen ersten Kaffee.«
»Rein beruflich. Natürlich. Du haust dir rein beruflich ein paar Gläser roten Chinon hinter die Binde, ein bisschen Foie gras hier, ein paar Petits Fours da, nur aus Pflichtgefühl, versteht sich. Vermutlich gibt’s danach noch ein Dîner, man ist unter sich. Schwerstarbeit. Du erwartest jetzt aber nicht von mir, dass ich dich bedauere, Monsieur le Baron?«
»Doch, eigentlich schon. Aber beim Essen hört für euch Franzosen wohl die Freundschaft auf?« Sie lachten. Dieselben Neckereien wie schon vor über zwanzig Jahren im Collège. Daniel, der Sohn eines Arbeiters. Und er, Spross einer alten Adelsfamilie mit einem Stammbaum bis ins 12. Jahrhundert. So wie sich das im französischen »Tal der Könige« gehörte. Das Blut seiner Urgroßmutter, einer bayerischen Prinzessin, die seinem Urgroßvater seinerzeit bei der Weltausstellung in Paris den Kopf verdreht hatte, machte ihn für seinen Freund zum Deutschen. Damit unterschied er sich, obwohl Républicain, in nichts von Philippes Verwandtschaft. Von ihren Schlösschen links und rechts der Loire aus hatten sie aus ihrer Missbilligung die amourösen Eskapaden seines Uropas betreffend seinerzeit keinen Hehl gemacht. Bis heute blieb es ein Fleckchen auf der ansonsten prächtigen Adelsrobe der Familie derer von Cotignac und du Pléssis.
Daniel wollte antworten, als scheppernd der Torero-Marsch aus der Oper »Carmen« ertönte. Der Klingelton, den er an Tante Aude vergeben hatte. Schon wieder. Nicht genug, dass sie ihn aus dem Bett geworfen hatte. Sie gönnte ihm nun nicht einmal seinen dringend benötigten Kaffee. Wenn sie etwas wollte, ließ sie nicht locker, bis sie es hatte. Und sie gehörte zu der Sorte Frauen, die stets bekam, was sie wollte. Aber diesmal nicht. Er zog sein Handy aus der Tasche, drückte die Anruferin weg und stellte das Gerät auf lautlos. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Er war noch nicht völlig wiederhergestellt.
»Noch einen Petit Serré mit einem Schuss Zitronensaft, Daniel.«
Der zog die Augenbrauen hoch: »So schlimm heute?«, bevor er sich an die Arbeit machte.
Keine Minute später sah Philippe zu, wie der Zucker aus einem schmalen Tütchen langsam durch die Crema sackte, kippte den Zitronensaft dazu und rührte alles zu seiner Spezialmischung zusammen, die er bereits unzählige Male erfolgreich gegen einen dicken Brummschädel eingesetzt hatte. Sie verfehlte auch diesmal ihre Wirkung nicht.
Er tupfte sich die Lippen mit einer kleinen Papierserviette ab. Dann rutschte er von seinem Barhocker.
»Merci, Daniel. Das hat gutgetan.«
»Kommst du zum Mittagessen?«
Philippe schüttelte den Kopf: »Wird mir zu knapp. Ich habe heute noch einen anderen Termin. Eine charmante Dame braucht meine Unterstützung. Ich soll die Rede, die sie über das Bild halten will, mit der Rede von Onkel Jean-Baptiste abgleichen.«
Er kramte in seiner Jackentasche und hielt Daniel schließlich sein Handydisplay hin. Der pfiff durch die Zähne. Von einer deutschen Kunstversicherungs-Website strahlte ihn eine hübsche Blondine an.
»Rein beruflich, natürlich.«
»Selbstverständlich.«
»Wer’s glaubt.«
Philippe legte Daniel einige Münzen auf den Tresen. »Glaub es oder glaub es nicht. Ich muss jedenfalls los. Meine Göttin ist nicht die schnellste, wie du weißt.«
»Sie läuft wieder? Na dann. Viel Glück. Und viel Spaß bei der Schwerstarbeit, Baron. Wir sehen uns.« Daniel nickte ihm zu, während Philippe das Café verließ.
Die dunklen Fachwerkhäuser hoben sich vom inzwischen strahlend blauen Himmel ab. Die Place Plumereau im Zentrum der Altstadt von Tours lag im Schlummer. Die unzähligen Tische und Stühle der Café- und Restaurant-Terrassen, die sich um den fast quadratischen Platz reihten, waren in der Mitte zusammengeschoben. Sie würden sich erst zum Mittag mit Gästen füllen.
In seiner Jackentasche begann es erneut zu vibrieren. Eindeutig zu viele Anrufe angesichts der frühen Tageszeit.
Wenige Minuten später hatte er den Boulevard de Lattre de Tassigny erreicht. Die Loire lag gelangweilt und sich gemächlich rekelnd in ihrem Bett, wie es sich für eine französische Schönheit um diese Uhrzeit gehörte. Ein einsamer Schwan gründelte am Ufer neben einer vertäuten Langère. Das flache Boot gehörte einem der letzten Fischer von Tours, Lieferant von Daniel. Es dümpelte leicht in der Strömung.
Widerwillig riss sich Philippe von dem friedlichen Anblick los.
Auf in den Kampf, Torero, dachte er. Behände glitt er hinter das Steuer seines Oldtimers. Die Schiebermütze ließ er auf, der nächtliche Nebel des Flusses war durch die Ritzen gekrochen und machte den Innenraum klamm. Ob der Frühling in diesem Jahr noch in die Gänge kam? Dreimal musste Philippe starten, ehe seine Göttin ansprang. Dann wackelte die DS mit ihrem Hinterteil. Die Hydraulik ruckelte das Chassis in die Höhe. Er zündete sich einen Zigarillo an und blies die Luft durch das kleine Seitenfenster, das er nach außen gedreht hatte. Das kalte Lenkrad mit der Rechten greifend, in der Linken seinen Zigarillo, steuerte er den Wagen in Richtung Westen, aus der Stadt heraus. Die Straße führte an der Loire entlang, die sich nun breit ausgedehnt an die freie Landschaft der Touraine verschwendete. Philippe konnte Möwen sehen, die kreischend auf dem Wasser landeten. Ein leichter Wind streichelte die Äste der typischen Trauerweiden, die das Ufer säumten, und schüttelte die grünen Büsche und Sträucher der vielen lang gezogenen Inseln und Sandbänke in der Flussmitte.
Der Kies knirschte, als Philippe den alten Citroën vor Tante Audes Anwesen parkte, einem Manoir aus dem 19. Jahrhundert. Raschen Schrittes nahm er die Stufen der geschwungenen Treppe zum Haupteingang und stand nur Sekunden später unter dem riesigen Lüster in der großen Halle des Herrenhauses.
Kapitel 2
»Tante Aude? Bist du da?«, rief Philippe ins Haus hinein.
»Willkommen, Monsieur le Baron. Madame nimmt ihr Frühstück im Wintergarten ein, Monsieur le Baron. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.«
Jacques, das Faktotum von Tante Aude, hatte ihn begrüßt und führte ihn nun durch den Salon auf der anderen Seite des Gebäudes auf die verglaste Terrasse. Tante Aude saß in einem Korbsessel, ein Plaid über die Beine geschlagen und wie immer tadellos gekleidet. Ihre weißen Haare rahmten in adretten Wellen ihr Gesicht ein, dem die achtundsiebzig Jahre erst auf den zweiten Blick anzusehen waren. Das lag vor allem an ihrem regsamen Geist und den wachen blauen Augen. Gerade schenkte sie sich aus einer Champagnerflasche nach.
»Aber Tantchen, das hat dir der Arzt doch verboten!«, rügte Philippe sie und beugte sich zur Begrüßung zu ihr herunter.
»Papperlapapp«, schnaubte die alte Dame. Dabei forderte sie mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand drei Begrüßungsküsschen.
»Sei nicht so schrecklich bourgeois, Philippe«, beschwerte sie sich, während Philippe ihr die geforderten Wangenküsse gab.
»Du bist zu spät. Setz dich.«
Er wollte sich ihr gegenüber niederlassen. »Nein, nicht da! Dort! Du versperrst mir den Blick«, schmetterte sie ihm resolut entgegen und deutete auf den Platz zu ihrer Linken.
»Kommen wir gleich zur Sache«, begann sie ohne Umschweife und mit einer Stimme so rau wie Schleifpapier. Dabei blickte sie an ihm vorbei in den Park. Philippe saß kerzengerade an der Vorderkante seines Korbstuhls. Seine Tante strahlte die Autorität eines Generals aus. Sie befehligte die Familie. Und er war einer ihrer Söldner.
»Du bist nicht mehr der Jüngste, mein Lieber. Du musst endlich diese Juliette vergessen. Und alles, was damit zu tun hat. Schau nach vorne. Was also macht dein Liebesleben?«
Weil Philippe nicht reagierte, fuhr sie einfach fort.
»Hab ich’s mir doch gedacht. Nichts Ernstes. Da kommt das Event in Cotignac doch wie gerufen. Du bist jetzt in einer Lebensphase, da ist die erste Scheidungswelle durch. Frauen in deinem Alter sind wieder auf dem Markt. Das musst du nutzen!«
Sie trank ihr Champagnerglas in einem Zug aus. Dann gab Tante Aude Philippe ein Update aus der weitverzweigten Verwandtschaft und der restlichen Adelsgesellschaft der Region. Ob er wollte oder nicht. Vor allem bei den Ankündigungen bevorstehender Verlobungen, Hochzeiten und frisch erfolgter Trennungen blickte sie ihn vielsagend an. Noch einmal ergriff sie die Gelegenheit und redete auf ihn ein, er solle sich endlich dazu entschließen, Paris den Rücken zu kehren und endgültig zurück in die Touraine zu kommen. Und er solle sich mit seinem Vater und seinem Bruder Constant aussprechen. Es war die übliche Leier.
»Aber Tata, war es das, worüber du mit mir reden wolltest?«, fragte Philippe ungeduldig. Seit zwei Monaten war er jetzt in seiner alten Heimat, hatte es bisher aber vermieden, mit den beiden zu sprechen. Seinen Vater hatte er gar nicht erst kontaktiert. Und Constant war glücklicherweise verreist. Jedenfalls vor zwei Monaten noch. Inzwischen wäre sicherlich Gelegenheit für ein Gespräch mit Constant gewesen, denn er blieb nie länger als zwei, drei Wochen auf La Réunion, um sich um die Vanilleplantage zu kümmern. Die Besitzungen der Familie dort waren Constants Aufgabengebiet. Aber er ging seinem Bruder aus dem Weg, der unterschiedlicher als er nicht hätte sein können.
Außerdem wollte Philippe sich nicht festlegen. Er fühlte sich in der Touraine wohl. Und in einem Punkt hatte Tante Aude recht: In Paris erinnerte ihn jede Ecke an Juliette. Aber zum letzten Schritt, die Hauptstadt, das glitzernde Paris, ganz hinter sich zu lassen, fühlte er sich noch nicht bereit. Er war vierzig, kein Alter, um in der Provinz zu versauern. Und er hatte lange genug in Paris gelebt, um wie ein echter Parisien den gesamten Rest des Landes als Provinz zu bezeichnen. Sogar seine geliebte alte Heimat an der Loire.
Tante Audes Perlen-Armband klimperte gegen den Flaschenhals, als sie sich aus der Champagnerflasche nachschenkte. Philippe machte das Beste aus der Situation und hielt ihr auch sein Glas entgegen, als Jacques in den Wintergarten trat. Er trug ein Silbertablett vor sich her, auf dem das Mobilteil eines Telefongeräts lag.
»Madame, Ihr Bruder, Monsieur de Cotignac, ist am Apparat.«
»Sagen Sie ihm, ich rufe später zurück, Jacques.«
Jacques hüstelte vornehm in seine Glacéhandschuhe. »Es ist dringend, fürchte ich«, sagte er.
Tante Aude sah ihn erstaunt an, griff sich dann den Hörer.
»Hallo? Jean-Baptiste? Was gibt’s? Ich bereite gerade Philippe auf den Empfang vor«, schnarrte sie ungeduldig in den Apparat.
Wenige Augenblicke später wurde sie weiß wie die Wand. Philippe hörte die aufgeregte Stimme seines Onkels. Tante Aude nickte wortlos ein paarmal. Sie sah auf einmal uralt aus. Dann legte sie den Hörer zitternd auf das Tablett zurück und wartete, bis Jacques gegangen war. Ihre Stimmung hatte sich völlig verändert. Sie starrte ins Leere, schüttelte immer wieder ihren Kopf. Schließlich stammelte sie: »Dein Onkel. Was für eine Schande. Unser guter Name.«
»Ich verstehe nicht? Tante Aude, was ist passiert?«
Philippe beugte sich zu ihr und legte ihr seine Hand auf den Unterarm. Endlich richtete sie ihre Augen auf ihn, die aufgehört hatten zu strahlen.
»Das Kästchen. Jean-Baptiste hat es sich stehlen lassen. Es ist weg.«
Kapitel 3
Philippe war sofort losgefahren. Daniels Kaffee, Tante Audes Champagner. Erst das Adrenalin, das Onkel Jean-Baptistes Nachricht in ihm ausgeschüttet hatte, hatte ihn endgültig wach gemacht. Das Kästchen, das sich seit Jahrhunderten in Familienbesitz befand, war verschwunden. Für die Cotignacs war es mehr als eine alte Holzschatulle. In der Innenseite seines Deckels war der Stammbaum der Familie eingeschnitzt, der sich bis in die Zeit von Philipp dem Schönen und den Templern zurückverfolgen ließ. Es stellte die Legitimation derer von Cotignac und Pléssis dar. Der Nachweis ihrer adeligen Abstammung.
Wie ein Scherenschnitt hob sich die Silhouette des Château de Cotignac vor dem frühlingsgrünen Park ab, als Philippe durch die prächtige Platanenallee auf das elegante Renaissanceschloss zufuhr. Auch zweihundert Jahre, nachdem Napoléon diesen Baum in Frankreich populär gemacht hatte, noch mehr als eindrucksvoll. Im Wassergraben zog ein Entenpaar seine Bahnen. Man hatte im 19. Jahrhundert die nahe Vienne einfach umgeleitet, um damit den Graben zu füllen und aus Cotignac ein romantisches Wasserschloss zu machen. Der Mode entsprechend. Aus heutiger Sicht war das ökologischer Wahnsinn, aber Philippe musste zugeben, dass ihm der Anblick gefiel. Der Effekt war derselbe wie in Chambord. Nur war die Anlage nicht so größenwahnsinnig wie dort.
Außer einigen eifrig hin und her laufenden Angestellten eines Catering-Services war niemand zu sehen, als er seinen Oldtimer auf dem Schlosshof parkte. Anders als die Top Hundert Loireschlösser, die von Scharen von Touristen heimgesucht wurden, hatte das Château de Cotignac keinen Besucherparkplatz. Aufwendiger Blumenschmuck in riesigen Kübeln lenkte den Blick von dem etwas maroden Dach und den ebenfalls renovierungsbedürftigen Nebengebäuden ab.
Cotignac befand sich nach wie vor in Privatbesitz des Duc de Cotignac, seit Jahrhunderten bewohnt und vom Massentourismus des Loiretals unbehelligt geblieben. Philippe erinnerte es von der Größe her sehr an das Château du Pléssis, in dem er aufgewachsen war. Er hatte Cotignac zuletzt vor etlichen Jahren besucht. Damals war ein Familienfest der Anlass gewesen.
Philippe betrat die große Halle, in der ebenfalls geschäftiges Treiben herrschte. Alles wurde für den großen Abend vorbereitet. Einige junge Männer stellten Stuhlreihen auf. Im hinteren Bereich des Raumes stand ein langer Tisch, wahrscheinlich für das Buffet. An der Wand lehnten Stehtische, die noch zusammengeklappt waren. Die Angestellten nahmen keine Notiz von ihm, als er sich nach links wandte und das Treppenhaus in den Keller zur Küche hinabstieg. Die alte Madeleine, die den Haushalt seines Onkels führte, seit Philippe sich erinnern konnte, empfing ihn freundlich. Der Duc sei im Salon zu finden, ließ sie ihn wissen.
Philippe eilte die Treppe wieder hinauf und betrat den bewohnten Bereich des Schlosses.
Jean-Baptiste de Cotignac war von ausgesprochen massiger Gestalt, ein Hüne, fast zwei Meter groß und aufgrund einer Vorliebe für gutes Essen und noch besseren Chinon-Wein drohten die Knöpfe seines Hemds jeden Augenblick abzuspringen. Eine löchrige, gewachste Jacke mit Cordkragen und eine alte Reiterhose, die einmal beige gewesen sein musste und in riesigen, schief gelaufenen Stiefeln steckte, vermittelten nicht gerade den Eindruck, dass hier ein Vertreter alten französischen Adels aus dem Sessel quoll. In seinen großen Händen hielt er einen Whiskytumbler und forderte Philippe auf, sich auch zu bedienen.
Auch wenn er vom Alter gezeichnet war, strahlte er noch immer das Selbstverständnis seiner Familie aus: Er wusste um seine Herkunft.
»Philippe. Gut, dass du hier bist. Es ist etwas Schreckliches passiert!«
Während Philippe ihm gegenüber vor dem meterhohen Kamin Platz nahm, begann der Duc de Cotignac zu erzählen. Onkel Jean-Baptiste erklärte, dass er das Kästchen dem Museumsleiter in der Festung von Chinon für eine Ausstellung versprochen habe. Es sei einer der ältesten Gegenstände aus der Umgebung. Und der Museumsleiter sei schließlich ein Confrère. Daher sei er dem Wunsch gerne nachgekommen. Philippe erinnerte sich, dass sein Onkel ihm den Mann einmal vorgestellt hatte, bei irgendeiner Feierlichkeit der Weinbruderschaft, bei der außer den Weinbrüdern, den Confrères, auch die Öffentlichkeit eingeladen gewesen war. Er nippte am Whisky. Sein Magen rebellierte sofort. Das Croissant und die Tartine reichten nicht als Grundlage für Champagner und starken Alkohol nach einer durchfeierten Nacht.
»Eine Katastrophe! Mein Ruf ist ruiniert«, fuhr der Duc fort. Alle Fachzeitungen hatten die neu konzipierte Ausstellung »Chinon – patrimoine royal« angekündigt. Sie sollte den ganzen Sommer über zu sehen sein und zahlreiche Touristen aus dem In- und Ausland anlocken. In den historischen Räumen, in denen angeblich auch die berühmte Begegnung zwischen Jeanne d'Arc und dem französischen König im Hundertjährigen Krieg stattgefunden hatte.
»Ich bin erledigt«, seufzte Jean-Baptiste de Cotignac. In einem Zug trank er das Whiskyglas aus.
In der Tat hörte Philippe seinen Bruder Constant bereits feixen. Noch nie hatte er am Duc ein gutes Haar gelassen. So wie er, Philippe, gehörte auch Jean-Baptiste für Constant zu den schwarzen Schafen der Familie. Der Duc habe Spielschulden in Monaco. Sein Schloss sei in einem erbärmlichen Zustand. Statt in die Familienehre investiere er lieber in Wein.
»Ich verstehe nicht ganz«, begann Philippe mit einem Tröstungsversuch, »wenn es dem Schlossmuseum gestohlen wurde, dann waren die Verantwortlichen doch bestimmt versichert. Vor allem, wenn der Tresor aufgebrochen wurde. Und wenn noch mehr gestohlen wurde, dann schaltet sich der OCBC ein.«
Der Office central de lutte contre le trafic des biens culturels war eine Spezialeinheit der französischen Polizei, die in Verbrechen gegen Kulturgüter ermittelte. Insgeheim wunderte sich Philippe, dass er davon noch nichts in der Presse gelesen oder gehört hatte. Nicht einmal auf France Bleu Touraine bei der Herfahrt im Auto.
Sein Onkel durchbohrte ihn mit einem Blick. Dann sprach er: »Es geht mir hier nicht darum, ob der OCBC verhindert, dass Kunstschätze außer Landes gebracht werden oder nicht. Dieses Kästchen ist untrennbar mit unserer Familiengeschichte verbunden. Es ist keine x-beliebige Schatulle.«
»Die Polizei wird es finden, da bin ich mir sicher«, beruhigte Philippe weiter und fragte sich, weshalb sein Onkel das Stück dann überhaupt aus der Hand gegeben hatte.
Der Duc ließ das Whiskyglas, das er inzwischen wieder gefüllt hatte und gerade für einen erneuten Schluck ansetzte, sinken. Ganz offensichtlich rang er nach Worten, bevor er schließlich kraftlos herauspresste: »Wird sie nicht.«
Er schüttelte den Kopf und trank. Dann ergänzte er: »Das ist es ja gerade.«
»Na, na, etwas mehr Vertrauen in die französische Polizei, Onkel Jean-Baptiste. Die haben eine gute Aufklärungsquote. Weiß ich aus erster Hand. Claire arbeitet doch dort«, tröstete Philippe erneut.
»Claire? Eine deiner Eroberungen?«, schnaubte der Duc.
»Ausnahmsweise nicht«, grinste Philippe. »Claire ist Daniels Schwester. Warum glaubst du, dass die Polizei das Kästchen nicht finden wird?«
»Weil«, begann der Duc, bevor er einen weiteren Schluck Whisky nahm, »weil sie gar nicht danach suchen wird.«
Irritiert sah Philippe seinen Onkel an.
Der erklärte ihm, dass er zwar seinem alten Freund und Confrère versprochen hatte, ihm das Kästchen für die Ausstellung zu leihen, es sich aber schon seit einiger Zeit bei einem anderen Confrère, dem Antiquitätenhändler Laurent Delacour, in Chinon befinde. Den habe Jean-Baptiste de Cotignac beauftragt, anhand des Stammbaums ein wenig Genealogie zu betreiben und die Verknüpfung der Ahnen derer von Cotignac mit dem französischen und anderen europäischen Königshäusern zu untersuchen.
»Das Kästchen ist nicht bei den Kuratoren der Ausstellung angelangt – bei Delacour wurde eingebrochen! Nun ist es weg«, schloss der Duc.
Philippe rollte innerlich die Augen. Welch ein Leichtsinn seines Onkels, wegen derartiger Eitelkeiten die wertvolle Schatulle aus den Händen zu geben. Ständig ging es in den Familien darum, ob man zur »noblesse d’épée« gehörte, also zum alten, »echten« Schwertadel, oder zur »noblesse de robe«, denjenigen Adeligen, die von Amts wegen in den Adelsstand eingetreten waren. Um all diesen Staub der Geschichte hinter sich zu lassen, war er nach Paris gegangen. Die eindringliche Stimme des Duc holte ihn aus seinen Gedanken zurück.
»Du musst es wiederfinden, hörst du? Niemand außer Aude und dir weiß davon. Bis zur Ausstellungseröffnung muss das Kästchen wieder da sein. Ich komme sonst in Teufels Küche. Du kennst doch Constant. Und die anderen.«
Philippe nickte. Die adelige Gesellschaft in der Region war das reinste Haifischbecken. Tradition wurde großgeschrieben, sowohl beim Schwertadel als auch beim Amtsadel. Sogar noch mehr als zweihundert Jahre nach der Französischen Revolution.
»Was für eine Misere!«, jammerte der Duc weiter. »Und das ausgerechnet, wo die ganze Region auf das Château de Cotignac blickt. Der Empfang heute! Alles, was Rang und Namen hat, wird mir heute in meinem eigenen Haus auf die Nerven fallen. Ich baue auf dich, mein Junge! Irgendetwas Brauchbares wirst du in Melun ja wohl gelernt haben!« Er beugte sich nach vorne und fasste Philippe am Arm.
Die Ausbildung zum Privatdetektiv in Melun. Danach hatte Philippe eine kleine Detektei gegründet, die »Agence des Affaires Délicates«, Agentur für unangenehme Angelegenheiten. Die meisten seiner Aufträge hatten sich bisher darauf beschränkt, untreue Ehegatten zu beschatten. Ein weiterer Makel in den Augen seines Halbbruders Constant. Ein Job weit unterhalb der Würde eines du Pléssis. Aber für Philippe nach allem, was er in Paris erlebt hatte, eine willkommene zweite Karriere. Die Arbeit als Anwalt hatte ihm ohnehin nie Spaß bereitet. Das Jurastudium war bei den du Pléssis Pflicht. Philippe hatte lieber mit Claire Vorlesungen in Kunstgeschichte besucht.
»Eine Aufgabe für deine Agence. Zeig es Constant! Und rette mich! Du musst die Schatulle finden. Die Ausstellungseröffnung ist in zwei Wochen.«
Kapitel 4
Als er wenig später mit seinem Lederköfferchen vorbei an der hektischen Betriebsamkeit in der großen Halle die Treppe nach oben nahm, checkte er sein Handy. Den Termin mit dieser hübschen Deutschen hatte er kurzfristig abgesagt, nachdem Tante Aude den Anruf des Duc erhalten hatte. Etwas, was er aus Höflichkeit normalerweise vermied. Merkwürdigerweise hatte diese Frau Berger nicht reagiert. Er hoffte, dass sie die Nachricht noch rechtzeitig erreicht hatte. Hier auf Cotignac befand er sich in einem Funkloch.
Er hatte sich auch dagegen entschlossen, gleich nach Chinon zu fahren und sich bei Laurent Delacour umzusehen. Das konnte er auch noch in Ruhe machen, wenn die Comtessen und Comtes, Vicomtes und Barons wieder in ihren eigenen Schlössern hocken würden und der Trubel auf Cotignac vorbei war. So konnte er in der Nähe bleiben, für alle Fälle. So nervös hatte Philippe ihn noch nie gesehen. Als ob noch mehr hinter der Sache mit dem Kästchen stecken würde. Danach müsste er unbedingt nach Tours zurückfahren. Schließlich hatte er nur Sachen für eine Nacht dabei. Und seinen neuen Abendanzug.
Sein Zimmer lag in einem der Türme und war angesichts seiner Größe spartanisch eingerichtet. In der Mitte thronte ein antikes Bett mit Baldachin. Eine Kommode stand an der Wand gegenüber. Darauf ein Spiegel und eine Waschgarnitur. Daneben ein etwas ramponierter Stuhl mit Kunstlederbezug und Edelstahlbeinen, den Philippe auf die Siebzigerjahre datierte. Er wirkte in diesem Renaissance-Ambiente fehl am Platz. Philippe fröstelte. Feuchte Kälte kroch aus dem Gemäuer. Nordflügel. Der zaghafte Frühlingsbeginn draußen hatte viel zu wenig Kraft, um eine angenehme Temperatur in diesem Raum zu erzeugen. Philippe sah auf seine Taschenuhr. Es war noch genug Zeit, um ein wenig in Onkel Jean-Baptistes herrlicher Bibliothek zu schmökern.
Der Weg dorthin führte durch einen düsteren Gang, von dessen Wänden ihn einige seiner Verwandten in gepuderten Perücken, Pluderhosen und Strümpfen streng anblickten. Damen, die in starren Gewändern steckten, lächelten schmallippig aus ihren verstaubten Prunkrahmen ins Leere. Die wenigen elektrischen Kerzenleuchter, die man angebracht hatte, wirkten wie futuristische Fremdkörper. Ein abgetretener Läufer, von dessen ursprünglicher Farbe nicht viel geblieben war, schluckte das Geräusch seiner Schuhe. Die feuchte Kälte lauerte auch hier, hinter Truhen und Rüstungen.
Die Tür der Bibliothek war nur angelehnt. Philippe trat neugierig ein. Vor dem wuchtigen Schreibtisch stand neben seinem Onkel ein Mann und scannte Dokumente mit einem Tablet.
Philippe ging auf die beiden zu.
»Michel, darf ich dir meinen Neffen vorstellen? Philippe, komm her. Das ist Michel Bayol, ein lieber Confrère, der mir bei der Arbeit an der Familienchronik zur Hand geht. Gut, dass du da bist, Philippe. Dann gehe ich in die Halle und sehe nach, wie weit die Vorbereitungen sind.«
Als er an Philippe vorbeilief, flüsterte er ihm zu: »Kein Wort zu ihm von dem Kästchen, hörst du?«
»Bonjour, Monsieur le Baron. Ein herrliches Ambiente, in dem ich mit Ihrem Onkel arbeiten darf«, begrüßte ihn sein Gegenüber.
Er machte eine ausschweifende Geste durch den beeindruckenden Raum. Die Jahrhunderte hatten der Bibliothek nichts anhaben können, nicht einmal die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg. An jeder Wand prangten lederne Folianten und Buchrücken mit goldenen, geprägten Titeln in massiven, dunklen Holzregalen. Vom Boden bis zur Decke. Einige geschnitzte Stühle mit roter Seidenbespannung, wie sie typisch für die Renaissance waren, sowie ein Stehpult möblierten außerdem den Raum.
»Sie sind Historiker?«, wollte Philippe wissen. Er wunderte sich insgeheim, dass Tante Aude ihm nichts vom Angestellten des Duc erzählt hatte.
»Kein studierter, nein.« Michel Bayol lächelte. »Aber ich kenne mich mit der Geschichte der Region sehr gut aus. Schlösser und Burgen gehören zu meinen Leidenschaften. Daher kann ich Ihrem Onkel bei der Arbeit an seiner Chronik ein wenig behilflich sein. Diese Bibliothek ist ein wahres Archiv der ganzen Gegend.«
»Ja. Das Archiv von Chinon beneidet uns darum«, erklärte Philippe geschmeichelt.
Er schätzte Bayol auf Mitte fünfzig. Seine Haut war braungebrannt und wettergegerbt wie bei einem Segler. Sein südfranzösischer Akzent passte dazu. Er trug ein hellblaues Hemd und eine beige Chino, über die Schultern baumelte ein dunkelblauer Kaschmirpulli, der die Farbe seiner Augen betonte. Ein gepflegter Dreitagebart und ein herbes Rasierwasser unterstrichen den Eindruck, dass Bayol viel Wert auf sein Äußeres legte. Das machte ihn für Philippe noch sympathischer. Als Bayol die Unterlagen, die er eben noch gescannt hatte, in eine türkisfarbene Plastikmappe verstaute, war er bei seinem Durchzieher durch die Geschichte des Schlosses bei der Occupation angekommen.
»Wissen Sie, dass die Nazis damals nicht nur das Gemälde haben mitgehen lassen? Es fehlen noch viel mehr Kunstgegenstände. Was für ein Jammer! Und welch ein Verlust für die Region!«, beklagte sich Bayol.
»Und nicht nur das!«, trumpfte nun Philippe mit seinem Familienwissen auf. »Sicher hat Ihnen mein Onkel auch erzählt, woher die Unregelmäßigkeiten im unteren Mauerring stammen?«
Bayol zog fragend die Augenbrauen hoch. »Unregelmäßigkeiten? Wollten die Nazis etwa das Schloss abtragen und in Deutschland wieder aufbauen?« Er lachte.
»Die Idee ist gut. Aber der Grund ist noch besser: Sie haben die Fundamentmauern des Schlosses nach dem sagenumwobenen Schatz der schwarzen Gräfin durchsucht.«
»Schwarze Gräfin? Sie machen mich neugierig.«
»Sie sind wohl nicht von hier?«
»Marseille.«
»Das erklärt Ihr Unwissen«, lachte Philippe. »Hier in der Gegend kennt sie jeder. Die schwarze Gräfin besaß einen Schatz, den ihr Mann, ein notorischer Schürzenjäger, ihr hinterlassen hat. Jeder Mätresse, die er hatte, nahm er einen Ring ab. Mehr als vierhundert Ringe sollen auf diese Weise zusammengekommen sein. Ein interessantes Geschäftsmodell, nicht wahr?«
»Das mag die Comtesse anders gesehen haben«, schmunzelte Bayol.
»In der Tat«, griff Philippe den Faden auf, »ganz anders sogar. Ihr Mann verstarb plötzlich und unerwartet nach einem Abendessen mit der Gräfin. Kaum gehörte ihr der Schatz, bekam sie Angst, jemand könnte ihn stehlen. Sie ließ ihn kurzerhand im Schloss einmauern. Den Diener, den sie damit beauftragt hatte, erschlug sie eigenhändig. Ihre Zofe ertränkte sie im Burggraben. Damit wusste außer ihr niemand mehr, wo der Schatz verborgen war.«
»Dann beruht das Vermögen der Familie de Cotignac also auf den Juwelen von Mätressen!«, rief Bayol aus, dem die Geschichte sichtlich gefiel.
»Leider nein. Das Geheimnis um den Schatz nahm die schwarze Gräfin mit ins Grab. Sie starb bei einem Reitunfall; das hatte sie wohl so nicht geplant.«
Bayol lachte wieder. »Und sagen Sie jetzt nicht, dass es seitdem auf Cotignac spukt!«
»Nun, die schwarze Gräfin wird immer wieder gesichtet. Nachts, bei Vollmond, wenn sich der Tod ihrer Opfer jährt«, raunte Philippe theatralisch.
»Aber Monsieur du Pléssis, wir sind hier doch nicht in England! Sie sind ein wunderbarer Geschichtenerzähler, wahrhaftig. Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Aber ich fürchte, es wird Zeit für mich, wenn ich mich noch für den Abend umziehen will. Der Duc und ich haben sowieso erledigt, was wir heute schaffen wollten. Sie entschuldigen mich? Ich würde mich freuen, wenn wir unser Gespräch heute Abend fortsetzen.«
Nachdem er gegangen war, checkte Philippe sein Handy nach einer Lesebestätigung der Deutschen. Kein Empfang hinter den dicken Mauern von Cotignac. Er öffnete eines der Fenster mit den Butzenscheiben und hielt das Gerät hinaus. Für wenige Sekunden erschien ein Balken auf dem Display. Dann war er sofort wieder weg. Aber der Kontakt zur Funkzelle hatte immerhin lange genug gehalten, um ihm mehrere Anrufe in Abwesenheit anzuzeigen. Mit der Ländervorwahl 0049.
»Na also, klappt doch alles wie am Schnürchen«, sagte er laut in die leere Bibliothek hinein. »Noch genug Zeit für ein Kapitel im ›Pantagruel‹.« Und schlug vorsichtig die vergilbten Seiten einer wertvollen Originalausgabe auf.
Kapitel 5
Er würde das Beste aus der Situation machen und das Event gemeinsam mit seinem Onkel hinter sich bringen. Wie ein echter Cotignac. Philippe zupfte sein gelbes Seidentuch zurecht, das in der linken Brusttasche steckte und mit dem dunklen Violett des Anzugs korrespondierte wie Krokusse in einer Frühlingsrabatte. Seine ebenfalls neuen schwarzen Stiefeletten glänzten poliert. Die Kroko-Optik machte sich hervorragend unter den schmalen Anzughosen. No brown after six o’clock. Das galt für ein gepflegtes Auftreten nicht nur jenseits des Ärmelkanals.
Das laute Brouhaha – Philippe liebte dieses Wort –, also das laute Stimmengewirr verschluckte ihn, als er die Halle betrat und versuchte, sich einen Überblick über das Event, das ihm nun bevorstand, zu verschaffen. Der Raum war festlich geschmückt. Vor die alten Gobelins, die die Wände an den Flanken bedeckten, hatte man riesige Blumengebinde gerückt. Auch der Brunnen, der mitten in der Halle stand, war mit einem farbenprächtigen Arrangement geschmückt, das genauso in Schloss Chenonceau hätte stehen können. Der Erbauer von Cotignac hatte mit dem Brunnen dafür gesorgt, dass auch im Falle einer Belagerung des Châteaus Wasser zur Verfügung stand. Heute war er ein willkommenes Podest für den Blumenschmuck. Aus den großen goldenen Vasen strahlte der Frühling und verströmte seinen betörenden Duft. Philippe nahm einen Hauch von Maiglöckchen wahr. Oder war es sein eigenes Parfum?
An der rechten Querseite war ein Buffet aufgebaut. Einige junge Mädchen schenkten dort fleißig Champagner und Apéritifs an die eleganten Gäste aus. Das Gedränge war groß. Scheinwerfer leuchteten die Stirnseite des Saales aus. Philippe entdeckte ein Rednerpult neben dem mannshohen Kaminschlund und der wuchtigen Holztür mit dem großen, alten Kastenschloss. Die Tür wurde von zwei Gorillas im schwarzen Anzug flankiert. Security. Sollte sich darin etwa das restituierte Gemälde befinden? Einer der beiden sprach gerade nervös in das Revers seines Sakkos; er musste irgendwie verkabelt sein. Seinen Onkel konnte Philippe nirgends ausmachen. Auch die deutsche Blondine nicht.
Über Kamin und Rednerpult thronte das Wappen der Cotignacs, ein Helm auf rot-weiß gewürfeltem Grund, im linken oberen Feld ein Tatzenkreuz. Irgendein Vorfahr war Templer gewesen. Links und rechts des Rednerpultes die gleichen goldenen Vasen mit üppiger Blumenpracht wie auf dem Brunnen.
Philippe schlenderte Richtung Bar, nach allen Seiten nickend. Den Großteil der Gäste hätte man im Dictionnaire de la Noblesse de Touraine nachschlagen können. Man kannte sich. Philippe ordnete die Gesichter den Namen zu, die Tante Aude ihm eingetrichtert hatte. Auf Brautschau gehen wollte er nach wie vor nicht, obwohl einige der Damen sehr attraktiv waren.
Von einer hübschen brünetten Studentin ließ er sich einen Kir reichen und sicherte sich einige der Petits Fours, die allesamt wie kleine Kunstwerke aussahen.
So bewaffnet zog er sich an einen leeren Stehtisch zurück. Er hatte keine Lust auf adelige Interaktion und wollte lieber seinen Apéritif genießen. Unschlüssig kreisten seine Finger über dem Tellerchen, griffen schließlich eine winzige Apfel-Tartelette, auf der ein Stück Foie gras glänzte, und schoben sie in seinen Mund. Die Säure des Apfels und das deftige Fett der Leber waren ein Paar, das zusammengehörte wie Napoléon und Joséphine oder Paris und der Eiffelturm. Man sollte sie nie trennen, schwelgte Philippe. Er spülte mit einem Schluck prickelnden Kirs nach.
Was als Nächstes? Den mit Crevetten gefüllten Petit Chou oder lieber die Mini-Quiche? Während er noch überlegte, wurde das Stimmengewirr lauter und die Gäste drehten ihre Köpfe Richtung Eingang. Ein stattlicher Mann im blauen Anzug, quer über der Brust eine blau-weiß-rote Schärpe, betrat die Halle, gefolgt von einer Gruppe Anzugträgern und einer Dame im schwarzen Abendkleid. Daneben ein attraktiver, dunkelhaariger Mann, den Philippe noch nie gesehen hatte. Blitzlichter. Natürlich. Die Presse war auch da. Das Fernsehen. Ein Kameramann tauchte auf und eine Reporterin hielt den Neuankömmlingen ein rotes Mikrofon entgegen. Es wurde gelacht.
Philippe ließ sich gerade den Blätterteig auf der Zunge zergehen, als die Gruppe direkt auf ihn zusteuerte. Angeführt von Charles Trichet, der Bürgermeister, Spitzenkandidat der Action Nationale, AN. Er wollte bei den nächsten Regionalwahlen Sous-Préfet werden. Ein ambitionierter Politiker, der noch konservativer war als die ältesten Familien der Gegend. Er war bei den letzten Kommunalwahlen, den Municipales, bereits für die Rechten angetreten, hatte aber das Mandat an den Kandidaten der Républicains abtreten müssen. In der Zeitung war er trotzdem groß herausgekommen. Ein Foto, auf dem er Arm in Arm mit Marine Le Pen zu sehen war, hatte sämtliche Titelseiten geziert. Sie hatte das Auszählen im Parteibüro der AN Touraine persönlich verfolgt. Schließlich war Paris nur zwei Autostunden entfernt.
Philippe wandte sich einem herrlichen orientalischen Linsensalat zu, als die Dame im schwarzen Abendkleid sich mit Trichet und dem Unbekannten direkt an den Nebentisch stellte. Tante Audes Briefing sagte ihm, dass dies die Comtesse de Crécy sein musste. Er hatte sie zuletzt gesehen, als sie ihm den Laufpass gegeben hatte. Damals war er fünfzehn gewesen. Und sie sechsundzwanzig. Trotz der nicht gerade positiven Erinnerungen an sie musste Philippe zugeben, dass sie immer noch umwerfend aussah. Dennoch spürte er ein Unbehagen. Zu spät. Sie hatte ihn entdeckt und überschlug sich fast, als sie ihn ihrem Begleiter vorstellte. Also doch adelige Interaktion. Er hasste es.
»Philippe du Pléssis? Ist das möglich? Wie lange ist es her, dass wir uns zuletzt gesehen haben?«
Sie reichte ihm beide Hände. Dass er keine Lust auf ein Gespräch mit ihr hatte, verschluckte er ebenso wie die Reste des Linsensalats, der ein angenehmes Aroma von Kreuzkümmel und Curry in seinem Mund zurückließ. Er hauchte ihr gezwungenermaßen einen angedeuteten Kuss auf den Handrücken.
»Comtesse!«, hörte er sich charmant flöten. »Es muss gestern gewesen sein. Sie sind genauso bezaubernd wie in meiner Erinnerung.«
Und in der Tat schien sie kaum gealtert zu sein. Sie musste jetzt Anfang fünfzig sein, doch ihr Dekolleté war makellos, das Gesicht fast faltenfrei und dezent geschminkt. Die smaragdgrünen Augen funkelten mit ihrem juwelenbesetzten Schmuck um die Wette. Philippe fiel auf, dass der Dunkelhaarige jede ihrer Bewegungen genau beobachtete.
»Darf ich vorstellen? Charles Trichet, unser künftiger Sous-Préfet. Unter uns gesagt, der kommende Mann der AN. Und Charles: Das ist der Vicomte du Pléssis. Du weißt schon.«
Du weißt schon? War das hier eine abgekartete Sache, über die Tante Aude ihn nicht aufgeklärt hatte? Aus Trichets Gesicht triefte ein schmieriges Lächeln. Er hatte mausgraue Augen, die unablässig den Saal scannten. Vermutlich immer auf der Suche nach wichtigen Persönlichkeiten, denen er sich vorstellen wollte. Sein volles weißes Haar trug er in einer dramatischen Welle über der Stirn. Philippe schätzte ihn auf Mitte sechzig. Unter seiner blau-weiß-roten Schärpe zeichnete sich ein muskulöser Oberkörper ab. Sein Händedruck war schraubzwingenartig. Philippe musste sich beherrschen, um nicht laut aufzuschreien.
»Sehr erfreut«, quetschte Philippe floskelhaft heraus.
»Verzeihung, Monsieur le Baron. Ich wollte nicht zu fest drücken. Das macht der viele Sport.« Er lachte polternd und sah sich dabei Beifall heischend bei seiner Entourage um.
»Monsieur sind Sportler?«, tat ihm Philippe den Gefallen und fragte nach.
»Ich boxe. Hin und wieder etwas Radsport. Golf. Das Übliche eben.«
Das Übliche? Philippe hatte noch nie verstanden, warum sich Leute körperlich völlig verausgabten und dafür auch noch ihre Freizeit opferten.
»Und Sie?«, fragte Trichet, lächelte dabei aber der Comtesse zu.
»Wenn überhaupt Sport, dann Schach. Boxen überlasse ich den Pferden«, versuchte Philippe einen Witz. Niemand lachte. Den Dunkelhaarigen hatte die Comtesse ihm nicht vorgestellt. Er hielt sich im Hintergrund.
»Haben Sie schon die Petits Fours gekostet? Sie sind köstlich, eine gelungene Mischung aus traditionell französischer und orientalischer Küche.«
»Tatsächlich?« Trichet klang unbeeindruckt.
Einer der Anzugträger löste sich aus seinem Tross und fragte eifrig: »Soll ich Ihnen etwas holen, Chef?« Eine schmale blau-weiß-rote Schärpe blitzte auch unter seinem Jackett hervor.
»Etwas Französisches«, sagte er mit einem kurzen, aber verächtlichen Blick auf Philippes Teller, »und ein Glas Champagner, mein lieber Coligny. Für die Comtesse auch.«
Philippe überlegte fieberhaft, wie er der Situation entkommen könnte, und stürzte kurzerhand seinen Kir hinunter.
»Ich begleite Sie, Monsieur Coligny.« Entschuldigend lächelte er Trichet und der Comtesse zu. »In diese Gläser passt wirklich nichts hinein.«
Er folgte Coligny zur Bar. Schade um die restlichen Petits Fours. Er hatte sie aufgeben müssen, um dem Gespräch mit diesem Widerling zu entfliehen.
»Sie sind verwandt mit dem Duc de Cotignac?«