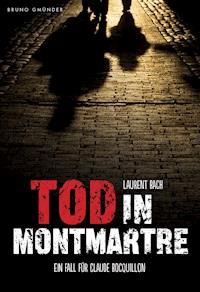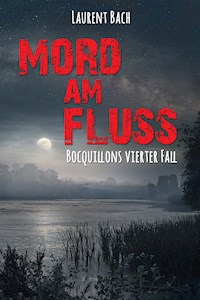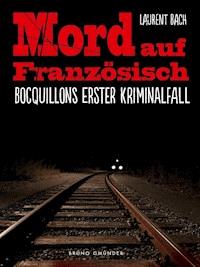
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruno Gmünder Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sommer in Südfrankreich: Während sich das beschauliche Städtchen Anduze von seiner schönsten Seite präsentiert, muss Privatdetektiv Claude Bocquillon einen Fall lösen, der es in sich hat. Pascal Melot, mit dem ihn mehr als nur eine Freundschaft verband, ist auf grausame Weise ums Leben gekommen. Die Polizei will den Fall als Selbstmord zu den Akten legen, doch Claude gibt sich damit nicht zufrieden ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
16. August
17. August
18. August
19. August
20. August
21. August
22. August
23. August
26. August
Über den Autor
Impressum
Prolog
Die Spiegelung des Wassers verzerrte die Umrisse der nackten Gestalten, ihre Haut wirkte aufgelöst, die Glieder schwebend. Auch ihre Gesichter waren hinter einer Gischt aus glitzernden Wassertröpfchen verborgen, die aus ihren Haaren spritzten. Das Einzige, was deutlich war: sie amüsierten sich köstlich. Das Lachen hallte von den Felswänden wider, abgehackte Worte überlagerten die Fließgeräusche des Gardon.
Der Ast dort störte, an die Seite mit ihm, um besser beobachten zu können. Ein Rundumblick, um sicherzugehen, nicht selbst entdeckt zu werden in dieser sonnendurchfluteten Wildnis. Nun war das Paar gut zu sehen: es lag an einer sandigen Uferstelle. Die beiden küssten sich, umschlangen sich mit Armen und Beinen, rollten übereinander hinweg, bis sie erneut im Wasser lagen und sich wie spielende Hunde balgten. Einer von ihnen lehnte sich entspannt an einen Felsen, das Wasser reichte ihm bis an die Brust. Sein Begleiter strich sich kokett die feuchten Strähnen aus der Stirn, ließ die Zunge über die Schulter des Anderen gleiten und glitt nach einem bedeutungsvollen Blick direkt vor ihm in die Tiefe, sodass er ganz unter der Oberfläche des Wassers verschwand. Anfangs Stille, keine Regung, doch dann begann der Stehende zu stöhnen, er zuckte mit dem Kopf, warf ihn in den Nacken, die Augen geschlossen. Da tauchte die eben noch verschwundene Gestalt wieder auf, küsste ihn und verschwand noch einmal unter Wasser, wo das Spiel weiter ging. Einige Mal wiederholte sich die Szene, bis endlich der Stehende keuchte und einen Schrei ausstieß. Er griff nach dem Körper vor ihm und zog ihn heraus, drückte sich eng gegen ihn. Sie fielen gemeinsam in die Fluten hinein, trieben fort, Hand in Hand. Nur schnell jetzt, der Fluss nahm sie mit, um eine Biegung herum, sie gerieten außer Sicht. Es gab keinen verborgenen Pfad am Ufer entlang, man musste über Felsbrocken und im Sichtschutz dorniger Sträucher stolpern, um sie nicht zu verlieren. Da waren sie. Sie ließen sich vom Fluss tragen, auf dem Rücken liegend, die Genitalien schaukelten auf den Wellen. Nie endender, schriller Zikadengesang löste die Zeit auf. Nach dieser Pause schwamm das Paar wieder zu seinem Liegeplatz. Die Tropfen perlten an ihrer Haut hinab. Sie balancierten über die spitzen Kieselsteine zu ihren Handtüchern. Ihnen nach, wieder zurück, nur nicht aus den Augen lassen. Die Zweige wippten, als der Beobachter erneut seinen Platz wechselte.
16. August
»Bitte, Monsieur Bocquillon, ich weiß sonst nicht weiter. Sie müssen mir einfach helfen!«
In diesem Moment nieste der Kater einen feinen Tröpfchenregen bis an die Fensterscheibe. Claude Bocquillon schrak auf und schüttelte den Kopf, bevor er das Gespräch fortsetzte.
»Ist das wirklich ernst gemeint?«
»Ja, natürlich. Sie machen doch solche Ermittlungen. Hier, ich habe nicht viel Geld, aber nächsten Monat und übernächsten, dann kriegen Sie noch mehr.«
Gegen die steinerweichenden Blicke seines neuen Kunden, der etwa zehn Jahre alt sein mochte, kam Claude nicht an. Er seufzte und betrachtete den zerknitterten 5-Euro-Schein, den der Kleine ihm entgegenstreckte. Einen Auftrag, der wenig Ehre und noch weniger Geld brachte, lehnte er eigentlich prinzipiell ab, doch dieser Junge setzte sein Vertrauen in ihn und damit lösten sich seine Prinzipien in Nichts auf.
»Du musst deinen Hund sehr gern haben, wenn du drei Monate auf dein Taschengeld verzichten willst.«
»Ja, das habe ich, Monsieur Bocquillon.« Der Junge nickte heftig.
»Hast du ein Foto?«
Der Junge zog ein portable aus seiner Hosentasche und zauberte ein Bild auf das Display: ein schwarz-weiß gefleckter Hund mit einem Stock im Maul.
»Das ist aber ein großer Jack-Russell.«
Sein Auftraggeber protestierte. »Quatsch, das ist ein Ratonero Bodeguero Andaluz.«
Claude hob beschwichtigend die Hände »Oh, pardon.«
Er erinnerte sich an den Hofhund seiner Kindheit. Nicht immer der gleiche, aber immer der gleiche Typ von struppiger Knurrigkeit. Er hätte für seinen Köter keinen Pfifferling gegeben. Da bemerkte er, dass sich Tränen in den Augen des Jungen festsetzten und – was schlimmer war – er ähnlich zu schnaufen begann wie der Kater. Claude fürchtete kein Handgemenge mit Ganoven in einer verlassenen Lagerhalle, doch die Gefühle des Jungen überforderten ihn. Er öffnete die Fensterläden und tröstete ihn unbeholfen:
»Na komm schon, erzähl mal, was passiert ist.«
Es gelang ihm tatsächlich, Geheule zu verhindern. Während der Junge nach Worten suchte, strömten mit der sommerlichen Morgenluft die Geräusche aus der Altstadt von Anduze ins erste Stockwerk hinauf: klappernde Absätze, Wortfetzen und Rufe, untermalt vom Plätschern des Brunnens auf dem Place Notre Dame, an dem das Mietshaus lag. Im Gebäude gegenüber lehnten sich zwei kleine Kinder gefährlich weit aus dem Fenster, um ihrer Mutter nachzusehen. Claude wandte schnell seinen Blick von den risikofreudigen Geschwistern ab. Sein neuer Kunde erzählte währenddessen, wie sein Hund ihm am vergangenen Nachmittag einfach in den Dampfzug gefolgt war. »Als ich in St. Jean du Gard ausstieg, war da ziemliches Gedrängel. Sie wissen ja, die Touristen.«
»Klar«, sagte Claude, der sich im Lauf der Jahre mit den sommerlichen Besucherströmen abgefunden hatte.
»Und da habe ich ihn nicht wieder gefunden. Vielleicht ist er mit zurückgefahren, aber zu Hause war er nicht. Und falls er in St. Jean oder am Bambuspark rausgesprungen ist, hat er sich jetzt bestimmt verlaufen.«
Nun liefen doch Tränen die Wangen des Jungen hinab und hinterließen helle Spuren auf der dreckigen Haut. Claudes portable auf dem Tisch vibrierte. Verwundert blickte er aufs Display und nahm das Gespräch entgegen.
»Hallo? ... Ich fass es ja nicht. Pascal, der erfolgreiche Makler? Was verschafft mir die Ehre? … Nein, ich bin nicht gereizt. … Nein, ich will die alten Geschichten nicht wieder aufwärmen. Was willst du denn jetzt? … Meinen Rat brauchst du? Das kostet aber. … Ja, erzähl es später, ich habe jetzt keine Zeit. … Also gut, ich warte dann auf deinen Anruf.« Er legte das Telefon fort. »Entschuldige, das war ein alter Freund.«
Claude klopfte seinem Kunden auf den Rücken. »Na, lass das Geld mal stecken.« Dafür kannst du dir ein anderes Haustier kaufen, dachte er, doch er sicherte zu: »Ich wollte heute ohnehin nach St. Jean. Und statt mit dem Rad fahre ich eben mit der Dampflok. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht.«
»Und dann?« Die Augen des Kleinen leuchteten hoffnungsvoll.
»Dann halte ich Ausschau nach deinem Ratero.«
»Ratonero«, berichtigte der Junge.
»Meinetwegen. Wie heißt er?«
»Jules.«
»Gut, nach deinem Jules.« Fürsorglich und kompetent, damit der Kleine kein Trauma fürs Leben erlitt, führte er ihn auf den Flur. Der Kater entwischte, doch Claude ließ ihn laufen. So konnte er wenigstens noch ein wenig warten, bis er das Katzenklo leeren musste.
»Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Deine Telefonnummer habe ich ja.«
Getröstet nickte der Junge und rannte die alte Holztreppe hinunter, während er am Geländer stand und ihm nachschaute. Die Sonnenstrahlen platzten in den Hausflur, als sein erster Kunde seit zwei Monaten gemeinsam mit der geflüchteten Samtpfote auf den Place Notre Dame hinaustrat.
»Dabei mag ich gar keine Hunde«, gestand Claude einen Augenblick später seinem Spiegelbild. Das Gesicht mit markantem Kinn und dunklen Augen machte keine Anstalten zu antworten. Als er prüfte, ob sich erste Fältchen blicken ließen, kam er zu dem Schluss, nicht mehr so oft Fahrrad in der prallen Sonne zu fahren – die Hitze schadete offensichtlich seinem Teint. Ein Grummeln in seinem Bauch erinnerte ihn an das Frühstück und unwillkürlich tastete er nach seiner Geldbörse, die leer an seinem Hintern klebte. Dann begutachtete er den Glanz seiner Schuhe und verließ das Haus mit leisem Bedauern, die fünf Euro nicht angenommen zu haben. Das Metallschild an der Wand war mit Taubendreck verunziert: »Claude Bocquillon, Ermittlungen aller Art«. War Vogelschiss nun ein böses oder gutes Omen? Aber Claude hatte noch nie etwas auf Omen gegeben und verspürte kein Interesse, nun, da seine Geschäfte praktisch am Boden lagen, damit anzufangen. Er seufzte, denn es kam ihm in den Sinn, dass seine Geschäfte so gut wie immer am Boden lagen. Trotzdem spuckte er in ein Papiertaschentuch und säuberte die Platte. Zuversichtlich und mit einer gewissen Lust glitten seine Finger über die eingravierten Buchstaben. Als das Metall endlich makellos im Licht blinkte, machte er sich auf den Weg in die Innenstadt. In seinem Stammcafé würde ihm schon jemand einen Kaffee und ein Croissant spendieren. Dort konnte er auch darüber nachdenken, mit welcher Art von Luxusproblemen sich sein Kumpel Pascal Melot herumschlug. Ein seltsames Telefonat war das gewesen, erinnerte er sich, als er in einen winzigen Raum eintrat und lässig einem Nachbarn und einem alten Schulfreund zunickte. Pascal, der sich als Immobilienmakler auf rasante Weise eine goldene Nase verdiente, hatte auf seine Sticheleien nur müde reagiert. Dabei ging er sonst keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Nun gut, er würde ihm eine ordentliche Rechnung präsentieren, Pascal konnte es sich leisten. Leise Musik dudelte, Chansons auf Kanal Nostalgie. Er setzte sich an einen Tisch und dachte an seinen Auftrag. Dieser blöde Hund. Warum hatte er dem Jungen überhaupt Hoffnung gemacht? Da ihn auch nach einer Weile niemand an seinen Tisch bat oder in ein Gespräch verwickelte, nahm er sich vor, bei Katherine anschreiben zu lassen, die gerade unaufgefordert eine Tasse Kaffee vor ihm abstellte.
»Bonjour Claude, was macht dein Vater?« fragte sie. Katherine, drall und hübsch, stammte aus Ribaute, seinem Heimatdorf.
»Nicht viel Neues. Hängt am Tropf«, sagte Claude und lächelte ihr zu.
»Hoffentlich muss er nicht so lange leiden.«
Er nickte. Weil er diesem Wunsch nur beipflichten konnte, schämte er sich ein wenig und versteckte sich hinter der bunten Titelseite des Midi Libre.
* * *
Am Bahnhof von Anduze herrschte reges Treiben, es war Mittag und der Zug längst von seiner ersten Tour nach St. Jean du Gard zurückgekehrt.
»Salut, Olivier«, begrüßte Claude den Schaffner, der aus dem Fenster des kleinen Warteraumes schaute, der mit Souvenirs und Kitsch überfüllt war.
»Claude, wie immer aus dem Ei gepellt«, antwortete Olivier. Blödmann, das ist schließlich nicht einfach, dachte Claude, lächelte aber besonders freundlich. Wie erwartet lotste sein Freund ihn diskret an der Kasse vorbei, nicht nur, weil er wusste, dass Claude in der Regel abgebrannt war, sondern auch, weil der alte Monsieur Bocquillon von Beginn an im Vorstand der Dampflok-Vereinigung der Cevennen gesessen hatte. Claude hatte den Eindruck, dass die Touristen gleichermaßen die Bahnlinie wie die ganze Stadt am Leben erhielten. Gleichwohl war die Fahrt zwischen Berg und Tal stets ein Genuss für das Auge.
»Was macht die Kunst? Hast du einen neuen Fall?« Olivier scheuchte ein Mädchen von der Bahnsteigkante weg. Die zahlreichen Passagiere bestaunten die Dampflok, vor allem die kleinen Jungs, was Claude an seinen Kunden erinnerte.
»Ach, nicht wirklich. Ist dir gestern Nachmittag so ein Köter aufgefallen?« fragte Claude und erschrak, als die Lok ihren Pfeifton ausstieß. Olivier zuckte mit den Schultern und achtete darauf, dass die Fahrgäste geordnet einstiegen.
»Ja, kann sein, so ein kleiner schwarz-weißer Fiffi ist mit eingestiegen. Aber ich habe ihn nur einmal gesehen. Hör mal, ist das etwa dein Fall?« Oliviers Augen wurden groß, das Grinsen breitete sich auf seinem braun gebrannten, faltigen Gesicht aus.
Claude presste die Lippen zusammen und stieg ein. Oliviers Lachen saß ihm noch in den Ohren, als der Zug den Bahnhof verließ und in den Tunnel einfuhr. Er rümpfte seine Nase vor dem Rauch, der durch das Dunkel wirbelte. Für eine Weile herrschte tiefe Nacht, ungefähr achthundert Meter lang. Die Stampfgeräusche der Lok hallten bedrohlich laut, ein Kind begann zu weinen, doch die übrigen Fahrgäste unterhielten sich angeregt. Sobald der Tunnel passiert war, ertönte ein vielstimmiges »Ahhh!« im Wagon, und auch Claude ließ den Anblick der Landschaft auf sich wirken. Anduze lag rechter Hand, der Gardon d’Anduze leuchtete mit dem Himmel um die Wette, sein Wasser bildete einen hübschen Kontrast zu den hellen Kalkfelsen, die sich zu beiden Seiten der Stadt erhoben und sie in die Zange nahmen. Ein wenig melancholisch ließ Claude seine Blicke schweifen. Die Brücke, die schmalen Häuser an den Ufern mit ihren bunten Fensterläden, die immergrünen Büsche, die sich in die Hänge klammerten. Die ganze Fahrt war ein sinnliches Vergnügen: die Zikaden, deren schriller Gesang die Luft füllte, der unvergleichliche Geruch nach Wacholder, Kräutern und heißen Steinen, das einschläfernde Rattern der Räder. Er betrachtete die Mitreisenden. Touristen aus allen Regionen Frankreichs, einige hochgewachsene Niederländer, die stets den Eindruck machten, als kämen sie frisch geschruppt aus der Badewanne. Zwei hagere Gestalten mit Dreadlocks, Leinenrucksäcken und Sonnenfalten im Gesicht. Der Zug folgte seinem Weg durch die flirrende Landschaft, kreuzte immer wieder den blauen Fluss, der sich durch die Täler schnitt. Fotoapparate klickten, Kameras wurden aus dem Fenster gehalten. Die Kinder ließen sich den Fahrtwind um die Nase wehen, während ihre Eltern aufpassten, dass sie den Felsen nicht zu nahe kamen. Claude hatte eigentlich nicht vorgehabt, nach St. Jean du Gard zu fahren, aber da er sich den Tag einteilen konnte, wie er wollte … Seine Schultern sackten herab, als er sich dabei ertappte, sein Leben schöner zu reden als es tatsächlich war. Mit diesem Ausflug schlug er lediglich Zeit tot, Zeit, die ihm im Übermaß zur Verfügung stand und die ihn manchmal zu ersticken drohte. Die Aussicht, wenigstens morgen Mittag wieder zu etwas nutze zu sein, war der einzige Lichtblick des heutigen Tages, auch wenn es sich nur um seinen Kellnerjob im Chez moi handelte. Da kam bereits die Haltestelle La Bambouseraie de Parfranc in Sicht, flankiert von den namensgebenden Bambusgewächsen. Die Bremsen quietschten, einige Touristen stiegen aus den Wagons aus und liefen auf einem schattigen Weg dem Eingang des weitläufigen Parks entgegen. Claude besann sich auf seine Pflichten. Er nutzte die Haltezeit, um hinauszuspringen und zur Lok zu laufen. Dort lehnte sich Henri aus dem Fensterchen, das Abbild eines Lokführers aus einem vergangenen Jahrhundert.
»Salut, Henri, darf ich den Rest der Strecke mit auf die Lok? Ich suche was in der Gegend.«
Henri rückte seine dunkle Kappe zurecht und nickte. Ein wenig ungeschickt kletterte Claude in den Führerstand hinein und suchte sich einen Platz, an dem er nicht stören würde. Er achtete darauf, dass sein Jackett nicht an die dreckigen Metallgriffe, Räder, Manometer und Bügel stieß, deren Funktion er sich kaum erklären konnte. Durch die Türausschnitte und Fenster hatte man einen rundum ungehinderten Ausblick. Er hielt Ausschau nach dem Hund Jules. Der Zugang zum Park war voller Menschen, doch kein Ratonero wuselte zwischen ihren Beinen herum. Wahrscheinlich hatte man die Töle längst aufgegriffen und sie in eine der Tötungsstationen für Straßenhunde gebracht, überlegte Claude. Er nahm sich vor, als nächstes in Erfahrung zu bringen, wo das nächste Tierheim war. Vielleicht hatte er Glück. Mit seinen Kunden sollte man sich gut stellen, man musste langfristig denken. Dieser Junge kam bei erfolgreich erledigtem Auftrag vielleicht in fünf Jahren wieder, um sein geklautes Mofa suchen zu lassen, und Claude hoffte, dass sich sein Taschengeld entsprechend dem Lebensalter steigern würde.
Nachdem Henri, der gleichzeitig die Aufgaben des Heizers übernahm, das lodernde Maul der Lok mit einigen Schaufeln Kohle gefüllt hatte, fuhr diese mit einem Ruck an. Claude genoss das Beben unter seinen Füßen. Nach einer Weile merkte er, dass er dem Spiel der Dampfwolken, die aus dem Schornstein in den Himmel stiegen, mehr Beachtung schenkte als seinem Auftrag. Aufmerksam betrachtete er das Tal, das unter der Brücke lag, die sie gerade überquerten. Kieselsteine am Flussufer, dichtes Gebüsch, doch kein Jules, der aus dem Gardon soff oder sich im Sand wälzte.
»Henri, ist dir gestern ein herrenloser Hund aufgefallen, der in den Wagons war?«
»Ein Hund? Natürlich bringen die Leute auch Hunde mit.«
»Nein, ich meine so einen kleinen schwarz-weißen mit kurzem Fell, ohne Leine und ohne Herrchen.«
»Suchst du etwa einen Hund? Ist das dein neuer Auftrag?«
Henris Schnurrbartspitzen zitterten, als er laut lachte. Claude wandte sich ab, kniff die Augen zusammen und schwieg. Immer noch prustend konzentrierte der Lokführer sich auf die Strecke, denn eine enge Kurve nahte.
»Vielleicht habe ich ihn ja über den Haufen gejagt«, spottete Henri.
»Sehr witzig.«
Als die Biegung fast genommen war, zwinkerte Henri Claude zu, der sich keine Blöße geben wollte und sich nicht festhielt, obwohl der vorbeisausende Schotterstreifen ihm Respekt einflößte. Als Claude seinen Blick wieder nach vorn richtete, entdeckte er etwas, das die eisernen Linien der Gleise unterbrach. Es dauerte einige Sekunden, bis er erkannte, was sich vor ihnen befand.
Er schrie auf: »Henri, da liegt was! Brems! So brems doch!«
Henri beugte sich aus der Tür, blickte nach vorn und blieb mit offenem Mund stehen. Claude machte einen langen Schritt und stieß ihm heftig in die Rippen.
»Da liegt jemand, Henri, tu doch was! Halt diesen verdammten Zug an!«
Die Lok näherte sich einer Gestalt, die zusammengesunken auf den Schienen lag, quer über der Trasse, reglos, leblos, der Rücken war der Lok zugekehrt. Henri kam zu sich, seine Hände sprangen hin und her, als ob sie nicht sicher wären, welches Rad zuerst gedreht und welcher Griff zuerst gezogen werden sollte. Schließlich riss er mit einem Ruck eine Stange zu sich heran, die Lok bebte und quietschte. Claude hielt sich fest, als die Räder blockierten und der Zug abbremste. Das Geschehen im Führerhaus erschien ihm quälend langsam, während draußen die Zeit raste. Wann stand der mächtige Koloss endlich still? Zu seinen Füßen sausten immer noch Sträucher und Steine vorbei. Dankbar nahm er wahr, dass der vordere Teil der Lok ihm nun die Sicht versperrte. Der Körper verschwand aus dem Blickfeld. Die Lok rumpelte unmerklich, sodass Claude für diesen entsetzlichen Moment die Augen schloss und sich wie ein Henker fühlte. Er mochte sich nicht vorstellen, was soeben mit dem Mann direkt unter ihm geschah. Er schaute wieder in Henris angespanntes Gesicht, dieser biss sich auf die Lippen und raunte »Sacré.« Nach unerträglich langer Zeit kam der Zug zum Stehen, das Kreischen der Bremsen verhallte im Tal. Dann herrschte Stille, bis sie nach einer Weile den Gesang der Zikaden und den Wind wahrnahmen.
»Wir sind voll drüber«, murmelte Henri. Claude wusste nun, wie ein betrunkener Totschläger sich nach der Ausnüchterung fühlen musste. Verdammt, er hatte gerade einen Menschen überfahren. Sie zögerten, auszusteigen, doch dann befreite Claude sich aus seiner Starre. »Komm, vielleicht lebt er noch.«
»Du weißt, dass eben zweiundfünfzig Tonnen Stahl über ihn rüber sind, oder? Merde, warum musste der Arme sich gerade mich aussuchen?«
Henri nahm seine blaue Kappe ab und wischte sich mit einem Taschentuch die Stirn trocken, bevor sie hintereinander die Stufen von der Lok zur Gleisböschung hinabkletterten. Da die Hände des Lokführers zitterten, bückte sich Claude zu dem Körper, der in grotesker Stellung unter den Rädern der Lok klemmte und dessen obere Hälfte ein wenig über die Gleise herausragte. So sah man also aus, wenn man von einer tonnenschweren Dampflok bis zum Stillstand mitgeschleift worden war, dachte er und versuchte, die Fassung zu bewahren.
»Hast du ein portable?«
Henri nickte und verzichtete darauf, das Opfer seiner geliebten Lok genauer zu betrachten. Während er Polizei und Notarzt anrief, kniete Claude sich nieder und versuchte, einen Menschen in diesem geschundenen Rumpf mit den grotesk abstehenden Gliedmaßen zu erkennen. Er blickte kurz in das blutverschmierte Gesicht, dann legte er mit einigem Widerstreben die Hand auf den Oberkörper und spürte die Kanten und Beulen der gebrochenen Rippen. Der Mann war tot, daran konnte niemand rütteln. Plötzlich stutzte Claude. Diese Haare, die Form des Gesichtes – konnte er es wirklich sein? Er holte ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und tupfte vorsichtig Stirn, Wange und Kinn des Toten vom Blut frei. Ebenmäßige Züge kamen zum Vorschein und was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Diesen Mann kannte er gut, sehr gut. Sein Taschentuch fiel zu Boden. Ein saurer Kloß setzte sich in seinem Hals fest.
Henris Schritte knirschten im Kies hinter ihm.»Sie kommen sofort. Da vorn gibt es einen Feldweg, von dort können sie rankommen.«
Claude räusperte sich und stieß ein leises »Merde« aus.
»Kennst du ihn?« fragte Henri, ohne näher als nötig an die Leiche heranzutreten.
»Pascal Melot.« Claude brachte den Namen kaum heraus, ein eiserner Ring aus Bestürzung lag um seine Brust. »Ich habe heute Vormittag noch mit ihm telefoniert.«
»Der Immobilienmakler? Wie kann der sich umbringen?«
Claude rappelte sich auf und klopfte seine Hosenbeine sauber, eine instinktive Handlung, die ihm wieder einen halbwegs klaren Kopf bescherte.
»Du siehst doch, wie.«
»Ja, aber ich meine, warum? Der hat doch alles. Mon Dieu.«
Anscheinend setzte der perplexe Henri Geld mit Glück gleich. Im Paradies gab es nun mal Schlangen, niemand wusste das besser als Claude. Er schüttelte den Kopf, dann fiel ihm auf, dass der Lokführer mit einem Mal blass wie eine Gipsmaske wurde. Der Schock. Claude hielt ihn am Arm fest. »Geht es?«
Henri schwankte bedenklich. »Muss mich nur eben hinsetzen. Halt du bitte die Meute zurück.«
Einige Reisenden waren ausgestiegen, andere hingen gaffend in den Fenstern. Claude schlüpfte in die Rolle der Autoritätsperson, es tat ihm gut, barsch und streng die Situation zu erklären und zu fragen, ob ein Arzt anwesend war, weniger für den Toten als für Henri. Da dies nicht der Fall war, forderte er Geduld, bis die Polizei eingetroffen war, was sicher nur eine Verzögerung von einer halben Stunde bedeuten würde.
»Können wir denn nicht weiter fahren?«
»Das kann ja noch ewig dauern. Wollen Sie nicht einen Bus anfordern?«
»Wer leiht mir mal ein Telefon? Ich muss meiner Frau Bescheid sagen.«
Das Selbstmitleid der Wartenden war schwer zu ertragen, also stieg Claude die Böschung hinab, um das Tal in Augenschein zu nehmen. Blöde Touristen, dachte er. Kein Respekt vor dem Toten. Automatisch richtete er seinen Blick auf den Boden. Vielleicht fand er etwas, das ihn vom Anblick des blutverschmierten Körpers ablenkte – im günstigsten Fall ein weggeworfenes portable, ein in einem Strauch flatternder Abschiedsbrief oder ein abgestelltes Auto. Die Strecke bis zum Gardon de Mialet war nur kurz. Das Licht brach sich an den Wellen, das Wasser floss gleichgültig unter der Brücke hindurch, die sie vorhin überquert hatten. Claude schlenderte eine Weile am Ufer entlang, setzte sich auf einen schattigen Felsen und starrte in eine tiefe Gumpe, die der Fluss ausgewaschen hatte. Fingerlange Fische zuckten im Sonnenlicht durch das Becken, mal synchron im Schwarm, mal als Einzelgänger. Pascal war tot. Seit zwei Jahren hatten sie sich nur sporadisch gesehen, von fern zugenickt, kaum miteinander gesprochen. Und trotzdem war ihm klar, dass nun eine Episode aus seinem Dasein fehlte. Sie hatte sich aufgelöst und die anderen Schichten seiner Vergangenheit würden in die Lücke rutschen, noch instabiler und chaotischer als zuvor. Wenn sein Vater starb, was demnächst zu erwarten war, würde er bald völlig umgeschichtet sein. Es war wie ein nicht aufzuhaltender Erdrutsch in seinem Wesen.
Was hatte Pascal gefühlt? So still hatte er auf den Gleisen gelegen und die Lok schnaufen hören. Hatte er die Augen fest zugekniffen? Und sich vorher ordentlich betrunken? Claude stand auf. Irgendetwas von Pascal musste hier sein, ein Stück Leben, ein Duft in der Luft oder etwas, das er angefasst hatte. Langsam ging Claude wieder zurück, legte den Kopf in den Nacken und sah die Lok, die dort oben von ihrer blutigen Tat ausruhte. Dann schaute er auf den Boden. Und tatsächlich: im Schatten eines Strauches versteckten sich die Überbleibsel eines Picknicks. Interessiert bückte sich Claude und tastete nach einem Brotkanten. Er war noch relativ frisch, von heute Morgen. Dazu zerdrückte Weintrauben, die man wohl verschmäht hatte, eine ölverschmierte Plastikdose, die eine einsame Olive enthielt. Die halb gefüllte Weinflasche trug kein Etikett, offensichtlich eine Hausabfüllung. Ob der halbe Liter Wein schon ausgereicht hatte, um ihn gleichgültig zu machen gegen die Aussicht, gleich von einem tonnenschweren Eisenklotz zerquetscht zu werden? Er schüttete den Rest des Weins in den Fluss, quasi als Opfer, und blickte dem Wasser nach, das bald den Gardon von Anduze und dann den Gard füllen würde. Dieser Wein würde den Pont du Gard passieren, am besten im Abendlicht, das die hohen Bögen des Aquäduktes in rötliches Licht kleidete. Dann würde er in die Rhone fließen und die Fische des Mittelmeeres trunken machen. Das hätte Pascal gut gefallen, ein leckeres Schollenfilet, mariniert mit schlichtem Landwein. Als es nichts mehr zu entdecken gab, mühte Claude sich auf einem Trampelpfad zwischen Felsbrocken und stacheligen Büschen in Richtung Feldweg. Dort angekommen, setzte er sich ins Gras und dachte noch einmal nach, so als erleichterte es sein Gewissen, alle Eindrücke erneut wiederzukäuen.
Pascal Melot. Ihm fiel ein, dass er kürzlich erst von dessen Verlobung erfahren hatte. Und nun das. Das schien seltsam, aber war es das wirklich? Hatte heute Morgen nicht eine gewisse Niedergeschlagenheit in seiner Stimme gelegen? Was hatte Pascal auf dem Herzen gehabt? Und warum nur war er selbst heute Morgen am Telefon so spöttisch gegenüber seinem Freund gewesen? Beschämt ließ er den Kopf hängen. Er duckte sich in den Schatten, die Sonne versetzte ihm Stiche. Mensch, Pascal, sagte er zu sich. Ich hätte dir doch geholfen. Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Oder hatte jemand seine Hände im Spiel, jemand, der ihm übel gesinnt war und die Lok als Ablenkung benutzt hatte? Claudes Augen wanderten verwirrt hin und her, diese Möglichkeit war zu schrecklich, um sie weiter zu erwägen. Sicher kam die Polizei auf die gleiche Idee und würde Nachforschungen anstellen. Dieser Badeplatz war bekannt, man konnte nicht ausschließen, dass sich mehrere Personen hier aufgehalten hatten. Doch eindeutige Hinweise in dieser Sache hatte er nicht gefunden.
Plötzlich bewegten sich die Zweige der Sträucher, die wackelnden Äste bahnten sich ihren Weg zu ihm und mit einem Mal ragte eine Hundenase aus einem Ginsterbusch heraus. Wie elektrisiert reckte Claude sich vor und griff blindlings zu. Ein kurzes, erschrockenes Knurren, beinah hätte Claude losgelassen. Glücklicherweise hatte er sofort das Nackenfell des Ratonero mit Namen Jules erwischt. Dieser nahm ihm den Zugriff nicht übel, sondern wackelte mit dem Hinterteil, nachdem er gemerkt hatte, dass ihm keine Gefahr drohte. Als Claude den Hund mit gebotener Vorsicht näher an sich heran zog, bemerkte er, dass Brotkrümel an seinem peitschenden Schwanz hingen.
»Hallo Jules, dann war Pascal also nicht allein. Du warst hier, bei einem kostenlosen Frühstück«, sagte er und streichelte das harte Fell, das sich nicht in seine Finger schmiegte wie das weiche Haar seines Katers. Nein, eigentlich mochte er keine Hunde, sie stanken, doch als Ablenkung von seinem dumpfen Gemütszustand kam der Ratonero ihm gerade recht. Wenn Jules doch nur sprechen könnte. Er war gewiss ein aufmerksamer Zeuge gewesen. Er schaute dem Hund ins Gesicht. In diesen treuen dunklen Augen hatte sich Pascals Gestalt widergespiegelt – wie er die Weinflasche weglegte und zu den Gleisen hinaufging. Jules hechelte und sandte einen heißen Atemstoß in Claudes Richtung, sodass dieser den Kopf schnell wegdrehte. In diesem Moment wälzte sich die Staubfahne des Polizeiautos durch die Luft, das wenig später vor ihm hielt. Leutnant Jean Bertin von der Brigade Anduze-St.Jean du Gard schälte sich aus dem Sitz, nahm die Sonnenbrille ab und baute seinen Bauch vor Claude auf.
»Was machst du denn hier?«, bellte er.
Warum duzen mich die Bullen ständig, fragte sich Claude und stand auf, Jules linkisch unter den Arm geklemmt.
17. August
Gendarm Jean Bertin verließ am folgenden Morgen die Gendarmerie und trat auf den Plan de Brie hinaus. Nachdem er auf seine Armbanduhr geschaut hatte, holte er seine Sonnenbrille aus der Hemdtasche und setzte sie auf. Seine Runde auf diesem Platz drehte er lieber mit unbewegter Miene und verborgenen Augen. So hatte er das Gefühl, sich besser Respekt verschaffen zu können, jedenfalls bei den Touristen, die bald eintreffen würden. Er schlenderte an der protestantischen Kirche vorbei, warf einen Blick auf die Bank Credit Agricol und schaute zu, wie die Kellner der zahlreichen Brasserien die Stühle auf dem Trottoir mit Sitzpolstern belegten und die Sonnenschirme aufspannten. Wieder schaute er auf die Uhr. Inspektor Lambert sollte eigentlich schon angekommen sein, doch wahrscheinlich hatte ihn der morgendliche Verkehr in NÎmes aufgehalten. Bertin hoffte, dass man ihm seinen Umgang mit der Leiche nicht mehr nachtrug. Die Spurensicherung war in einem anderen Fall gebunden und da niemand aus der Rechtsmedizin die Leiche abholen konnte, hatte Bertin dem örtlichen Bestatter Bescheid gegeben. Dieser hatte den Körper von Pascal Melot geborgen und zur Gerichtsmedizin gebracht. Die Kollegen in NÎmes waren verärgert darüber, dass er den Besuch eines Kriminalbeamten nicht abgewartet hatte. Doch nachdem Bertin die große Hitze und das aufdringliche Fliegengesumm anschaulich beschrieben hatte, war die Kriminalpolizei mit seinem Handeln einverstanden gewesen. Bertin blieb vor dem Brunnen auf dem Platz stehen und betrachtete die Säulenfragmente, zwischen denen das Wasser sprudelte.
Der Brief, den man in der Wohnung des Toten gefunden hatte, wies auf einen Selbstmord hin und war insofern eine ziemliche Erleichterung für Bertin. Er hegte insgeheim die Hoffnung, dass er diese schreckliche Angelegenheit bald würde zu den Akten legen können. Er hatte sich nicht getraut, den Brief Sandrine Tessier, der trauernden Verlobten, zu überreichen. Lieber hatte er sich vage ausgedrückt und auf die noch ausstehende gerichtsmedizinische Untersuchung hingewiesen. Sandrine hatte angegeben, dass Pascal in den letzten Wochen angespannt und nervös gewesen sei, was Bertin nicht verwunderte – entspannte Menschen legten sich eher selten auf die Gleise. Er schloss seinen Rundgang ab und ging durch die Hintertür wieder in das kühle Gebäude hinein. In seinem Büro angekommen, schaute er durch das Fenster hinaus und strich sich über den Schnurrbart. Die Normalität tat ihm gut, sie beruhigte sein angespanntes Gemüt nach dem aufregenden gestrigen Tag. Die Müllabfuhr leerte die Tonnen, das Rumpeln hallte über den Platz. Der Pfarrer schloss die Kirche auf, einige Damen im Gefolge. Dann linste Bertin durch die angelehnte Tür in das benachbarte Büro und trat ein. Die Ohren des jungen Sergeanten Joberton funktionierten ausgezeichnet, der Gendarm sah nur noch die letzten Seiten der Zeitschrift – natürlich weibliche Nackedeis – unter der Schreibtischplatte verschwinden. Bertin zog die Augenbrauen hoch, doch ohne eine Ermahnung wies er seinen verlegenen Beamten an, die Protokolle der gestrigen Zeugenvernehmungen bereitzuhalten. Aus einem gefliesten Nebenraum, den er insgeheim Asservatenkammer nannte, holte er den in einer Plastiktüte eingeschweißten Abschiedsbrief hervor. Er hatte ihn aus einem Impuls heraus mitgenommen, bevor er das Haus versiegelt hatte. Die Spurensicherung würde sicher bald die Arbeit aufnehmen. Flüchtig überflog er einige Sätze:
»Meine liebe Sandrine … es tut mir so leid… dich nicht glücklich machen … dir meine Homosexualität verschwiegen … kaum noch schlafen … kann nur bei Männern meine Erfüllung finden … die Folgen … übereilte Entscheidung … verzeih mir …«
Das war so eindeutig, wie es nur sein konnte: Pascal Melot war schwul und wurde seit seiner Verlobung von Schuldgefühlen geplagt. Bertin schlug die Tüte leicht in seine Handfläche und runzelte die Stirn. So reagieren schwule, unreife Jugendliche, aber kein Mann von achtundzwanzig Jahren. Was soll’s, dachte er, ich bin ja kein Psychiater. Der erfolgreiche Makler stammte aus gutem Haus, er hatte sich mit jedem Anduzer verstanden. Mordgierige Feinde waren meilenweit nicht in Sicht. Laut Schließplan des Vermieters hatte niemand außer Pascal und Mademoiselle Tessier einen Schlüssel zu Pascals Haus. Es sprach alles für einen Selbstmord.
Dann hörte Bertin die Eingangstür quietschen, es folgte ein Wortwechsel zwischen einem Besucher und dem wachhabenden Joberton. Bertin ging in sein Büro zurück und wartete auf Inspektor Frederic Lambert.
* * *
Am Tag nach dem Unglück zwang sich Claude immer wieder, an seinen jungen Kunden zu denken. Diese Erinnerung war seinem Befinden zuträglicher als der Gedanke an den toten Pascal. Er richtete sich am ehrfürchtigen Blick des Jungen auf, der ihn ab sofort sicherlich für Superman persönlich hielt. Was der Kater empfunden hatte, der beim Anblick des Hundes unter das Bett geflüchtet war, wollte er gar nicht wissen. Als er sich die Kellnerschürze umband und die Duftmischung aus frischem Kaffee und abgestandenem Bier in seine Nase zog, konnte er es kaum erwarten, wieder Tabletts zu balancieren und die Wünsche der Kunden entgegenzunehmen. Manchmal bedauerte er, dass dieser Job die einzige Konstante in seinem Leben war, doch jetzt lechzte er geradezu nach Normalität. Es war zehn Uhr, die letzten Frühstücksgäste wurden von den ersten Vormittagsbesuchern abgelöst. Die Stühle ratschten über den Asphalt des Bürgersteigs, die Abgase der Autos hingen unter der Markise der Brasserie fest, und die knatternden Auspuffanlagen der Motorräder unterbrachen die Gespräche der Gäste. Das Chez moi lag direkt an der mit Platanen gesäumten Hauptstraße, die sich durch Anduze schlängelte. Der Laden war bei weitem nicht die einzige Brasserie ihrer Art. Mit nur einem Blick konnte Claude vier Cafés und Brasserien allein auf seiner Straßenseite erblicken. Jedes Lokal hatte sein Auskommen, die Touristen wurden wie von einem Schwamm aufgesogen und mit Kaffee und Spirituosen versorgt. Auf dem Plan de Brie, dem Platz vor der Kirche direkt gegenüber, schlenderten Besucher und Stadtbewohner einträchtig nebeneinander her. Nach Pascals Tod summte es in der Stadt wie in einem Bienenstock, Gerüchte und Tratsch machten die Runde. Claude, der an der Theke auf die nächste Bestellung wartete, hörte die Wortfetzen der Einheimischen, die lieber im Inneren saßen, um dem Lärm und Gestank zu entgehen.
»… Familie der Braut … Abschiedsbrief ... eindeutig Selbstmord ... geklärt …« So raunten die Männer und tuschelten die Frauen. Claude versuchte unwillkürlich, Erklärungen für diesen Tod zu finden, dabei wollte er das gar nicht. Es würde Pascal nicht wiederbringen. Er presste seine Kiefer zusammen. Ob die Polizei die Sache als Selbstmord abschließen würde? Nur wegen des Abschiedsbriefes? Doch konnte er selbst sich anmaßen, in das Innere eines Menschen zu schauen? Er schaute nachdenklich in den Spiegel an der Wand hinter dem Tresen und nutzte die Gelegenheit, eine Locke aus der Stirn zu streichen.
»Mon Dieu, du Lackaffe, du bist schön genug«, bemerkte Lucas, Barkeeper und Pächter des Etablissements und schob ihm ein gefülltes Tablett zu.
»Und du bist neidisch«, gab Claude zurück und richtete seinen Blick auf die Halbglatze seines Arbeitgebers.
»Das glaubst auch nur du«, stritt Lucas ab.
»Was ist das? Die Dame hat einen Caipirinha bestellt, keinen Fizz.«
»Ach, stimmt. Entschuldige.« Während Lucas seinen Fehler korrigierte, wackelte Claude mit den Zehenspitzen in den schwarzen Schuhen, um seine Füße zu entspannen. Das Chez moi war eigentlich eine normale Brasserie mit schlichter Getränkekarte, doch seitdem Lucas ein Cocktail-Seminar besucht hatte, fanden die bunten Drinks reißenden Absatz.
Die Sonne blendete Claude, als er am Rand der Markise seinen Gast bediente. Er überreichte den Caipirinha einer Brünetten, die ihn offen anlächelte und seine Hand beim Anreichen länger als nötig berührte. Claude lächelte automatisch zurück, das gehörte sich so, auch wenn er sich nicht wohl fühlte.
»Haben Sie den selbst gemacht? Er schmeckt sehr gut«, sagte die Schöne.
»Sie loben den Falschen«, wiegelte er ab.
»Meinen Sie?«
Was interessierte die denn, was er meinte? Mit einem Ruck wandte er sich ab und prüfte mit dem Finger den Feuchtigkeitsgrad der Erde in den Blumenkästen, die am schmiedeeisernen Gitter hingen, das die Brasserie von der Straße trennte. Dann floh er in den Schankraum, begleitet vom neidischen Gesichtsausdruck seines Kollegen Marcel, der ein Tablett voller Kaffeetassen am Nebentisch ablud und der zu schüchtern und zu mager war, um von der Frauenwelt überhaupt wahrgenommen zu werden. Eine Weile später, als Claude die Untertasse mit dem Entgelt von ihrem verlassenen Tisch holte, leuchtete ihm ein gelbes Post-it entgegen, auf dem in weiblicher Schrift eine Telefonnummer notiert war. Er blickte sich um. Die hübsche Kundin kramte am Laden nebenan in einem Ständer mit Postkarten und lächelte ihm unmissverständlich zu. Claude unterdrückte die Verärgerung. Routiniert hob er seine linke Hand und tippte mit dem Daumen auf seinen Ring. Ein spöttischer Blick, dann ging die Brünette mit wiegenden Schritten davon, die ihm signalisieren sollten, dass er einiges verpassen würde. Claude grinste, denn Marcel kam ihm als Opfer gerade recht. Er pappte das Zettelchen auf eine saubere Untertasse und reichte seine Gabe dem verdutzten Kellner weiter.
»Von der jungen Frau, die dort geht«, erklärte er und verkniff sich ein Lächeln über den gierigen Ausdruck, mit dem sein Kollege die unbekannte Schöne ins Visier nahm. Aber dann stutzte Marcel, zog die Augenbrauen zusammen und zischte:
»Du willst mich wohl verarschen.«
»Komm, probier es doch mal«, stichelte Claude.
»Blödmann!«, fauchte Marcel und würdigte ihn für den Rest seiner Schicht keines Blickes mehr.
Bevor Claude sich nach seiner Schicht auf den Heimweg machte, stand er auf dem Bürgersteig und reckte unauffällig seinen schmerzenden Rücken. Es war fünfzehn Uhr. Die Stadt kam nicht zur Ruhe, die Besucher schlenderten durch die engen Straßen und Torbögen, sie strömten zum oder kamen vom Parkplatz am Fluss. Der Uhrenturm und die protestantische Kirche mit ihrer Säulenfront ruhten stoisch inmitten all des Trubels. Neben dem Gotteshaus lag die Gendarmerie. Leutnant Bertin stand wie so oft auf dem Plan de Brie, die Arme verschränkt, die Beine fest auf den Boden gestemmt, die Sonnenbrille auf der Nase. Er strich sich den Schnauzbart, beobachtete die Autoschlange, die sich durch die Innenstadt quälte, verfolgte das Treiben auf dem Platz und in den umliegenden Cafés. Die Motorradfahrer aus Deutschland und die einheimischen Jungs auf ihren Rollern bedachte er mit einem misstrauischen Blick. Als er Claude sah, drehte er den Kopf verächtlich zur Seite.
Blödmann, dachte Claude und ging. Er schlängelte sich durch die Besuchermassen, wich Rucksäcken und Eiswaffeln aus. Endlich lag der Place Couvert hinter ihm, auf dem die Besucher im Schatten der Markthalle ausruhten und den Pagodenbrunnen fotografierten. Claude bedauerte, dass sich der Hintergrund auf den Fotos nicht optimal ausnahm: die Häuserfronten waren mit brüchigem, dreckigem Putz versehen, von den Fensterläden blätterte die Farbe ab, zerfetzte Gardinen schmückten die Fenster. In seiner morbiden Stimmung tat ihm dieser Anblick leid, es schien, als kleide sich Anduze für sein eigenes Begräbnis um. Die Straßen leerten sich, je weiter er ging. Nur hin und wieder bummelten Touristen an seinem Haus am Place Notre Dame vorbei, auf dem ein alter Brunnen stand. Über dem Portal seines Wohnhauses war das Baujahr in Stein gemeißelt: 1728. Er strich zärtlich über das verrostete Treppengeländer und grüßte Madame Barjac, die ihren Stuhl auf dem Treppenvorsprung platziert hatte und im Schatten saß. Das Brunnenwasser plätscherte.
»Hast Besuch, mein Junge«, quäkte ihre Altweiberstimme.
»Merci bien, Madame«, schmeichelte Claude. Sie hob ihren Kopf mit den blassen Augen, beim Lächeln zeigte sie ihre dritten Zähne. Ach, er schmolz dahin. Neugierig sprang er die Treppe hinauf, seine Schritte hallten von den Wänden wider. Vor seiner Tür stand Madame Melot – Pascals Mutter.
Wenig später saß Pascals Mutter, gekleidet in ein schlichtes, gut geschnittenes Kostüm, vor seinem verschrammten Schreibtisch. Claude hoffte, dass sie sich nicht umschaute, denn er hatte vergessen, eine Zimmertür zu schließen, durch die sein zerwühltes Bett und der schlafende Kater zu sehen waren. Nachdem sie den Kaffee abgelehnt hatte, wischte er einige unwichtige Blätter von der Tischplatte herunter und gab sich den Anschein eines erfolgreichen Ermittlers. Sie erklärte den Grund ihres Besuches und erläuterte ihm den Inhalt von Pascals Abschiedbrief, den Leutnant Bertin ihr überreicht hatte..
Verdattert sagte Claude: »Er hat geschrieben, er hätte sich und seiner Verlobten nie eingestanden, dass er schwul ist? Das ist absurd. Er war bisexuell.«
»Genau«, bestätigte Madame Melot. »Sicher, das mag er ihr verschwiegen haben, aber sie hätte ohnehin nie etwas gemerkt. Er hat beschlossen, nichts zu sagen, weil er es nicht für nötig hielt. Es war gut so, wie es war, glauben Sie mir.«
Claude senkte seinen Kopf. Madame Melot beugte sich vor und sah ihm in die Augen.
»Sie haben ihn geliebt, nicht wahr?«
Claude fühlte sich ertappt und konnte nicht verhindern, dass er errötete. Dann fasste er sich und sagte: »Ich war glücklich mit ihm.«
Madame Melot knetete ihr Taschentuch und seufzte: »Ach, warum hat es ihm der liebe Gott so schwer gemacht?«
Claude verkniff sich eine Entgegnung. Diese Frau hatte es schwer genug, er wollte ihr nicht erklären, dass nicht Gott es war, der den Schwulen das Leben schwer machte, sondern die anderen Menschen. Das war für ihn selbst Grund genug, sein offizielles Coming-out immer wieder zu verschieben. Nur nicht dran rühren, einfach alles so lassen, wie es war. Wer wusste schon, wie es nach einem Outing sein würde in dieser bigotten Kleinstadt, die er trotz allem liebte. Wäre er ein Zugezogener, hätte er sich nicht so viele Gedanken gemacht. Doch seine Familie gehörte praktisch zum Anduzer Urgestein.
»Jedenfalls war er zufrieden«, fuhr Madame Melot fort. »Er hat uns den Hochzeitstermin mitgeteilt. Ende September. Sandrine hatte ein großes Fest geplant.«
»Sandrine? Das war seine Verlobte, richtig?«
»Sandrine Tessier, ja. Ihrem Vater gehört die Keramikfabrik. Sie und ihr Bruder sind Teilhaber. Das Mädel hat Pascal sogar in die Firma eingebunden. Überlegen Sie mal ernsthaft, Monsieur Bocquillon, warum sollte er sich vor den Zug werfen? Aber ich habe diesen Inspektor nicht überzeugen können.«
»Wissen Sie, was genau in dem Abschiedsbrief stand?«
Sie nickte. »Seine Schuldgefühle Sandrine gegenüber, weil er seine Erfüllung nur mit Männern finden konnte.«
Claude runzelte die Stirn. »Wörtlich? Erfüllung nur mit Männern?«
»Ja, wörtlich.«
Claude schüttelte den Kopf und fragte: »Hegen Sie einen bestimmten Verdacht?«
Sie zögerte. »Nein, nicht wirklich. Er war in den letzten Tagen nervös, das muss ich zugeben, aber ich denke, das hatte etwas mit seiner neuen Stellung in der Firma zu tun.«
»Hat er denn gar nicht mehr als Immobilienmakler gearbeitet?«
»Doch, aber er hat schon lange in der Keramikfabrik der Tessiers geholfen. Und gleich nach der Hochzeit sollte er aufsteigen. Teilhaber wäre er geworden und in die Geschäftsführung aufgestiegen. Er wollte investieren … er hat ja mit seinen Immobilien ganz ordentlich verdient. Sandrine hat sich so für ihn eingesetzt. Monsieur Bocquillon, Sie müssen herausfinden, was wirklich passiert ist.«
Claude lehnte sich zurück, zufrieden, fast schon geschmeichelt.
Sie fuhr fort: »Ich bitte Sie eindringlich, meinem Mann nichts von diesem Auftrag zu erzählen. Er trägt schwer an Pascals Tod und fast noch mehr an dieser Enthüllung. Er wusste ja von nichts. Aber ich bin die Mutter. Ich weiß, dass er sich nicht getötet hat. Vielleicht war es ja ein Unfall. Es wird uns besser gehen, wenn wir es genau wissen.«
Mir wird es auch besser gehen, dachte Claude, dem das Rattern der Räder und das Quietschen der Bremsen wieder in den Ohren klangen.
»Wegen Ihres Honorars …«
Nach einer Schrecksekunde atmete er auf, denn sie fuhr fort:
»Ich erwarte nicht, dass Sie mir in dieser Hinsicht entgegenkommen. Ich werde für alle Kosten aufkommen.«
»Vielen Dank. Mein Stundensatz beträgt 40 Euro, plus eine Erfolgspauschale von 400 Euro. Benzin, Übernachtungen und dergleichen kommen dazu«, zählte Claude auf, wobei er sein Entgelt stillschweigend um die Hälfte kürzte. Eigentlich war er sein eigener Auftraggeber, schon seinem Gewissen zuliebe.
»Einverstanden. Was benötigen Sie?«
Pascals Mutter dachte mit, was Claude gefiel.
»Zugang zu seinen Unterlagen.«
»Die Polizei hat in der Wohnung den Brief gefunden. Und dann haben sie alles versiegelt.«
Sie schaute auf ihre Hände, die in ihrem Schoß lagen.
»War die Spurensicherung schon da?«
Sie schüttelte den Kopf. »Der Inspektor sagte, dass sie gegen Abend kommen wird. Sie hatten so viel zu tun.«
Ein ganzer Tag war seit dem Tod vergangen, und es wurde noch nichts unternommen, dachte Claude. Dieser Inspektor verstand ganz offensichtlich nichts von seinem Geschäft.
»Können Sie denn ins Haus hinein, wenn es versiegelt ist?«, wollte Madame Melot wissen.
Claude grinste. »Ja, da komme ich auch so rein. Doch besser, Sie verschweigen das.«
Sie nickte verschwörerisch.
»Wo ist Pascals portable?«
»Das weiß ich nicht. Entweder bei der Leiche oder im Haus.«
»Können Sie mich vielleicht jetzt zum Haus fahren?«
Sie erschrak für einen Moment, doch dann sprang sie von ihrem Stuhl auf. »Natürlich. Ich muss ja nicht mit hinein, oder? Das ertrage ich noch nicht.«
»Nein, das mache ich schon. Sie können mir vertrauen.«
Er merkte, dass sie aufatmete. Ihre Beherrschung nötigte ihm Respekt ab.
»Pascal hatte eine tolle Mutter, Madame Melot.«
Sie lächelte traurig. Beim Hinausgehen betrachtete seine Kundin die Fotos an der Wand: Zahlreiche junge Männer in bunten Trikots mit Sponsorenlogos, Radhelme, Menschenmengen, überfüllte Berghänge, das glückliche Lachen eines Fans, der neben seinem Star posieren durfte.
»Aber, das sind ja Sie«, wunderte sich Madame Melot und wies auf ein Bild. »Mit … wie heißt er noch, dieser Bergfahrer …«
»Richard Virenque«, klärte Claude sie auf.
Der Kater schlitterte auf ihn zu und kam kurz vor seinen Schuhen zum Stehen. Verlegen deutete Claude auf ihn: »Manchmal hört er auf seinen Namen.«
Idiot, ich habe Hunger, dachte der Kater.