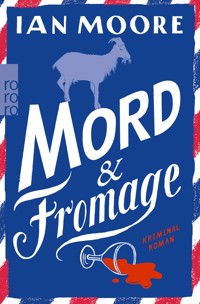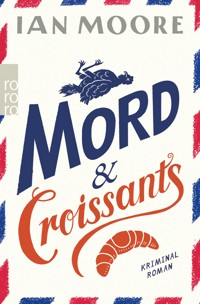
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Brite in Frankreich
- Sprache: Deutsch
Wo ist Monsieur Grandchamps? Wer hat etwas zu verbergen im Val de Follet? Und was hat das Huhn mit alldem zu tun? Richard ist Engländer, und eigentlich will er einfach seine Ruhe. Seit ein paar Jahren führt er eine kleine Pension im französischen Loiretal – dort passiert absolut nie etwas, und das ist wunderbar so. Bis eines Tages einer seiner Gäste verschwindet: der alte Monsieur Grandchamps. Was er zurücklässt, ist nicht mehr und nicht weniger als ein blutiger Handabdruck. Fast zeitgleich bezieht die beeindruckende Madame Valérie d'Orcay eines der Zimmer, inklusive Hündchen in der Handtasche. Und erstaunlicherweise interessiert sie sich sehr für das Verschwinden des Monsieurs. Während Richard eigentlich schnellstmöglich zur Tagesordnung zurückkehren möchte, ist er auf einmal Teil eines schrägen Ermittlungsteams – und spätestens als es seiner Lieblingshenne Ava Gardner an den Kragen geht, wird es auch für ihn persönlich … Ein Buch zum Hineinstolpern, herzlich Lachen, Mitgerissenwerden. Richard Ainsworth ist ein Held, genau wie wir ihn jetzt brauchen. Versprochen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ian Moore
Mord & Croissants
Kriminalroman
Über dieses Buch
Wo ist Monsieur Grandchamps? Wer hat etwas zu verbergen im Val de Follet?
Und was hat das Huhn mit alldem zu tun?
Eigentlich will Richard einfach nur seine Ruhe. Er ist Engländer, und seit ein paar Jahren führt er eine kleine Pension im Loire-Tal – dort passiert absolut nie etwas, und das findet er ganz wunderbar so. Bis eines Tages einer seiner Gäste verschwindet: der alte Monsieur Grandchamps. Was er zurücklässt: eine zerbrochene Brille und einen blutigen Handabdruck auf der Tapete.
Fast zeitgleich bezieht die beeindruckende Madame Valérie d’Orçay aus Paris eines von Richards Zimmern. Und erstaunlicherweise interessiert sie sich sehr für das Verschwinden des alten Monsieurs. Obwohl Richard am liebsten schnellstmöglich zur Tagesordnung zurückkehren möchte, ist er plötzlich Teil eines absurden Ermittlerduos. Und spätestens als es seiner Lieblingshenne Ava Gardner an den Kragen geht, wird es auch für ihn persönlich …
Vita
Ian Moore ist ein bekannter britischer Comedian und trat in Fernsehshows und auf großen Stand-up-Bühnen auf, bevor er begann, seinen originellen Blick auf die Welt in Bücher zu verpacken, und damit sehr erfolgreich wurde. Ebenso wie sein Held Richard lebt auch der Autor seit einigen Jahren im französischen Loire-Tal, gemeinsam mit seinen drei Söhnen, seiner Frau und einer lustigen Ansammlung wilder und weniger wilder Tiere. «Mord & Croissants» ist sein erster Krimi und stieg sofort auf die Times-Bestsellerliste ein.
Die Autorin und Diplomübersetzerin Barbara Ostrop arbeitet seit 1993 als literarische Übersetzerin aus dem Englischen, Französischen und Niederländischen und zählt Liebes- und Familienromane, Spannung, Historisches und Jugendromane sowie Fantasy zu ihren Schwerpunkten. Inzwischen hat sie über hundert Bücher ins Deutsche übertragen und so u.a. mehrere Romane von Simon Scarrow über das antike Rom für deutschsprachige Leserinnen und Leser zugänglich gemacht.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Death And Croissants» bei Farrago/Duckworth Books Ltd., Richmond.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Death And Croissants» Copyright © 2021 by Ian Moore
Redaktion Nadia Al Kureischi
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München,
nach dem Original von Duckworth Books, UK
ISBN 978-3-644-01669-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Natalie und die Jungs
1
Gibt es irgendetwas Freudloseres auf der Welt als Müsli?
Nicht, dass Richard Ainsworth unbedingt schlecht gelaunt war, aber Vormittage fand er generell schwierig. Zermürbend wäre vielleicht ein besseres Wort. Er empfand Vormittage als zermürbend, als etwas, das man erdulden musste, bevor man zu den geringfügig weniger zermürbenden Nachmittagen und Abenden gelangte. Vormittage sind das kalte, schmuddelige Fußbad, das man durchwaten muss, bevor man Zutritt zur Wärme und relativen Sauberkeit des öffentlichen Schwimmbeckens erhält. Er seufzte resigniert. Ihm war sehr wohl bewusst, dass viele Menschen ein Problem mit den Morgenstunden hatten, aber diese Leute führten nicht alle außerdem noch ein Bed and Breakfast. Und zudem noch ein Bed and Breakfast mitten auf dem Land im Loire-Tal, wo alles Wichtige nur am Vormittag geschah.
Selbst im besten Fall hatte man beim Frühstück eine etwas unangenehme Position inne; ganz generell fand Richard es schwierig, das heikle Gleichgewicht zwischen zwei Zielen zu finden, nämlich als Gastgeber bereitzustehen, gleichzeitig aber dem Gast Raum zu lassen, seine Morgenmahlzeit in Ruhe zu genießen – falls genießen das richtige Wort war. Der Trick bestand darin, ansprechbar, aber gelassen zu wirken. Aufmerksam, aber zurückhaltend. Sodass keiner einem vorwerfen konnte, seine Bedürfnisse zu missachten, jeder es sich aber hoffentlich zweimal überlegen würde, bevor er tatsächlich um etwas bat. Es war weniger diskrete Bedienung als ein Selbstverteidigungsmechanismus, und wie üblich vermied er den Blickkontakt und versuchte, unauffällig mit dem Hintergrund zu verschmelzen.
Tatsächlich probiert hatte er Müsli nie. Es erinnerte ihn immer an den Wellensittich seiner Oma: Vince. Vince war nach dem Sänger Vince Hill benannt gewesen, den seine Oma angebetet hatte, von dem aber sonst wohl kaum jemand etwas gehört hatte. Vince lebte in einem kleinen Käfig – der Wellensittich, nicht der Sänger. Der Käfig hing über der rechten Seite eines abgenutzten braunen Samtsofas – in den Siebzigerjahren war alles braun – und bot hervorragende Sicht auf den Fernseher. Seine Oma hatte immer auf der linken Seite des Sofas gesessen, eine große Rothmans International in den knochigen Fingern, die mit ihrer gefährlich langen Aschespitze stets zwischen Omas schmalen, lippenstiftrosa Lippen und einem riesigen Glasaschenbecher in Bewegung gewesen war. Bei seinen Gedanken an früher ging es ihm jedoch um den Boden von Vince’ Käfig, nichts als halb gefressene Samen und verschmähte Getreide- und Hirsekörner. Genau daran erinnerte Müsli ihn: an die abgelehnten Reste von Wellensittichfutter.
Diese Erinnerung und der damit verbundene kleine Seitenhieb auf die moderne Welt, sein beliebter Zeitvertreib, munterten ihn ein wenig auf. Der Gedanke, dass der durchtrainierte Fitnessfreak des einundzwanzigsten Jahrhunderts seinen Tag nicht, wie er dachte, mit einem «Superfood» begann, sondern mit verschmähtem Vogelfutter der Siebzigerjahre, würde ihn wahrscheinlich während der Frühstücksschicht aufrechterhalten. Und das war auch nötig. Es war erst 8:45 Uhr, und er war dabei, schon wieder schlappzumachen. Tatsächlich – wieder wärmte er sich an einer Kindheitserinnerung – fühlte er sich ein bisschen wie Omas altes Sofa. Alt und abgenutzt, an den Ecken zerschlissen, ständig belastet. Und ein bisschen verkatert fühlte er sich auch. Allerdings bezweifelte er, dass Sofas allzu oft unter letzterem Problem litten.
Heute Morgen übertrieb er es jedoch mit der Zurückhaltung, starrte viel zu lang in den Müslibehälter und verschmolz keineswegs mit dem Hintergrund, sondern erregte nun vielmehr die Aufmerksamkeit der italienischen Frischvermählten in der Ecke, die sich vermutlich beunruhigt fragten, ob mit ihm alles in Ordnung sei. Jedenfalls nahm er an, dass sie frisch vermählt waren. Der alte Zyniker in ihm sah in dem ständigen Bedürfnis der beiden, einander zu befingern und ihre Zuneigung öffentlich zur Schau zu stellen, ein Zeichen dafür, dass die Beziehung noch nicht lange währte. Sie waren immer noch im erregten, neugierigen körperlichen Stadium der Liebe. Der Lack war noch nicht ab. Na ja, schön für sie, so viel räumte er ein, warum nicht?
Er beschloss, lieber geschäftig zu wirken, und entfernte sich von dem Müslibehälter, um die klassische analoge Filmkamera zurechtzurücken, die am Fuß der Treppe stand und Dienst als Lampe tat. Dieses Dekorstück war eine seiner vielen Verbeugungen vor seinem früheren Leben als Filmhistoriker, die als Wanduhr genutzte Filmklappe eine andere. Er ging so energisch zur Kamera, als handelte es sich um eine wichtige Angelegenheit, und in gewisser Weise stimmte das auch; Richard Ainsworth hatte genaue Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein hatten, und auch wenn die Lampe jetzt nicht brannte, sollte die Kamera doch mit dem Objektiv die Treppe hinaufweisen, als wartete sie auf den Einzug eines Stars.
«Monsieur?» Es war der junge Ehemann, der ihn angesprochen hatte. Dafür hob er die Hand wie ein Schuljunge oder wie weltweit jeder Gast in einem Restaurant. «Monsieur? Könnten Sie bitte meine Milch warm machen?» Sein Französisch war nicht gerade toll, was Richards Selbstvertrauen ein bisschen stärkte. Sein eigenes Französisch war ziemlich gut, wenn auch nicht fließend, was bedeutete, dass er in der ständigen Furcht lebte, die Grenze seiner sprachlichen Fähigkeiten zu erreichen. Dann würde man ihm auf die Schliche kommen wie der Gestapomann dem geflohenen Gordon Jackson in «Gesprengte Ketten». Den hatte der Wunsch «Good Luck» in die Falle gelockt, und schon war das Unglück geschehen. Das war Richards ständige Sorge als Engländer in Frankreich.
«Natürlich, Signor Rizzoli …» Er ergriff Signor Rizzolis Kaffeeschale. «Und Ihre, Signora?»
«Sì, äh, s’il vous plaît», korrigierte sie sich selbst, das hübsche Lächeln nur kurz auf Richard gerichtet. Dann suchte sie, weiterhin lächelnd, die Hand ihres Mannes. Frisch Verheiratete bemühen sich immer zu angestrengt, dachte Richard.
«Haben Sie heute irgendwelche Pläne?», fragte er im Weggehen laut und deutlich. Signor Rizzoli mühte sich stammelnd mit der Antwort, doch bevor Richard ihm zur Hilfe kommen und die Frage noch einmal auf Englisch wiederholen konnte, ertönte von der Treppe her eine perfekte Übersetzung ins Italienische:
«Hai qualche piano per oggi?»
Die Rizzolis verstummten verblüfft, als Valérie d’Orçay elegant die Treppe hinunterschwebte. Ihre Körperhaltung war perfekt, und perfekt war auch die Handtasche von Louis Vuitton, die sie in der Armbeuge trug. Darin saß ein kleiner, hochmütig dreinblickender Chihuahua. Valérie d’Orçay beherrschte den Raum so, wie Kleopatra einst Ägypten beherrscht haben musste, und als sie auf der untersten Treppenstufe ankam, schob sie das Objektiv der Kameralampe zur Seite, damit es nicht länger auf sie zeigte – eine Geste, als wimmelte sie einen unverschämten Paparazzo ab. Was für ein Einzug, dachte Richard, der die Dame erst spät am Vorabend beim Einchecken kennengelernt hatte. Norma Desmond war eingetroffen, und im Vergleich mit ihr schrumpfte tatsächlich das Kino zusammen.
Mit einem cremeweißen sommerlichen Anzug bekleidet, die riesige Sonnenbrille auf den Kopf geschoben, richtete Valérie d’Orçay ein betörendes «bonjour» an den ganzen Raum, setzte den kleinen Hund mit einigen beruhigenden Worten auf einem Stuhl ab und ließ sich ihm gegenüber am Tisch nieder. Erneut fielen Richard seine Oma und Vince ein, auch wenn Welten diese Frau von Rothmans Zigaretten und abgenutzten Sofas trennten. Der Hund blickte von seiner Herrin zu Richard, der reglos dastand, leicht benommen von diesem Einzug, und zu den Rizzolis, deren Müslilöffel mitten in der Luft vor ihren geöffneten Mündern verharrten. Nur der Kopf des Hündchens war zu sehen, sein mit Edelsteinen besetztes Halsband spiegelte das Licht der Deckenlampen wie eine Discokugel. Es schien auf etwas zu warten; das galt für sie alle.
«Alles in Ordnung mit Ihnen, Monsieur?» Wie viele französische Frauen mittleren Alters, oder vielleicht auch alle Frauen mittleren Alters, oder vielleicht auch nur alle französischen Frauen, schaffte Valérie d’Orçay es, sich so nach dem Wohlergehen eines Mannes zu erkundigen, dass es gleichzeitig Sorge ausdrückte und extrem geringschätzig klang, wie etwa ein Polizist, der einen unzuverlässigen Zeugen befragt. Sie sah Richard direkt an, ein harter, durchdringender Blick, der so manchem Mann den Rest gegeben hätte.
Als sie am Vortag spät am Abend eingetroffen war, hatte sie sich tausendfach dafür entschuldigt, dass er auf sie hatte warten müssen, und über den dichten Verkehr beim Verlassen von Paris geschimpft. Es war dunkel gewesen, und er hatte inzwischen einen kleinen Schwips gehabt, daher hatte er ihr das Zimmer gezeigt und sie dann sich selbst überlassen. Ihm war gar nicht aufgefallen, dass sie einen Hund dabeihatte, was, offen gesagt, gegen die Hausordnung verstieß. Zwar war das Tier kaum größer als der Wellensittich Vince, doch Regeln waren Regeln, und das Haustierverbot stand deutlich auf allen Websites. Er musste geschickt vorgehen, dachte er, und musterte sie vorsichtig, während er die Milch der Rizzolis erhitzte.
Sie war auf diese typisch französische Weise klassisch elegant: Ihr Pagenkopf war dunkelbraun gefärbt und passte zu ihren Augen, die gleichzeitig warm und distanziert blickten, durchdringend und scharfsinnig. In den Augenwinkeln hatte sie Fältchen, die Humor vermuten ließen, doch die dunkle Iris, das Innere, machte klar, dass sie nüchtern und gradlinig war. Vermutlich entging nur wenig ihrem Blick, und Richard fühlte sich ein wenig befangen. Er hielt sich nicht für einen eitlen Menschen; er war zufrieden damit, so alt auszusehen, wie er war, und brauchte, so glaubte er, den Vergleich mit anderen Männern im selben Lebensabschnitt nicht zu scheuen. Sein Haar war an den richtigen Stellen grau meliert, und an den Schläfen wich es vielleicht ein wenig zurück, wie Wasser bei Ebbe. Er hatte ein Bäuchlein, aber mit Einatmen und geradem Aufrichten konnte er das kaschieren, zumindest vorläufig. Ja, es gab eine Menge Männer, die schlechter abschnitten als er, so hatte er sich gesagt, als wäre er auf dem Markt und müsste seine eigene kleine Partnerschaftsanzeige aufsetzen. Nun, vielleicht würde er das auch sehr bald tun. Möglicherweise. Er war sich nicht recht sicher, wie sein Beziehungsstatus derzeit aussah. Erst letzte Woche hatte ihm seine Tochter gesagt: «Dad, in Facebook-Begriffen ist es bei euch beiden, bei dir und Mom, kompliziert», als wäre das in sich eine zufriedenstellende Aussage und nicht die Falltür zu einem brodelnden Abgrund aus Unsicherheit. So oder so hatte er sich für die vorhersehbare Zukunft mit dem Junggesellendasein abgefunden, und wenn es das war, was ihn erwartete, war er mit dreiundfünfzig dafür bereit. Er hatte vielleicht nicht mehr das Aussehen eines Hauptdarstellers, aber er könnte noch als charmanter Charakterdarsteller durchgehen.
«Madame d’Orçay», sagte er mit seinem besten französischen Akzent, richtete sich dabei gerade auf und atmete leicht ein. «Wir müssen leider über Ihren Hund sprechen.»
«Passepartout?»
«Ja, äh. Passepartout.»
Passepartout schenkte ihm dankenswerterweise einen Blick, der sagte, dass er seine Zeit verschwendete.
«Ach, machen Sie sich wegen Passepartout keine Sorgen.» Sie winkte mit einer eleganten Handbewegung ab. «Ein Napf mit Wasser, mehr braucht er nicht.» Ihre Antwort erklang herablassend auf Englisch, als spräche ein arroganter Pariser Kellner, und erfüllte Richard in gleichem Maße mit Verärgerung und Erleichterung. Doch die Worte wurden von einem freundlichen Achselzucken begleitet, und die Sprechweise wechselte in einem einzigen Satz von Spott zu Femme fatale und wieder zurück. Richard holte noch einmal tiefer Luft, was sie bemerkte. «Ich meinerseits hätte auch gern ein bisschen warme Milch, für meine heiße Schokolade. Und vielleicht ein Croissant.»
«Ja, aber …» Passepartout legte sich in seiner Tasche hin und machte es sich bequem.
«Und bitte, sagen wir doch Valérie und Richard. Ich bleibe mindestens für einige Tage hier, es ist also wohl nicht nötig, so förmlich zu sein. Förmlichkeit ist mir wirklich verhasst.» Letzteres sagte sie zu den Rizzolis, die daraufhin so aussahen, als würden sie einander sogar noch inniger umfangen.
Richard öffnete den Mund zu einer Antwort und bewegte die Lippen, hatte aber keine Ahnung, wo er anfangen sollte, was die Mitte sein würde und wie er überhaupt einen Abschluss finden könnte. Mit seinem verkaterten Gehirn versuchte er, die Situation einzuordnen; ja, Valérie war attraktiv, ja, zum ersten Mal seit einer scheinbaren Ewigkeit hatte eine attraktive Frau ihn bei seinem Vornamen genannt und nicht «Monsieur» oder «oi», andererseits jedoch war er in weniger als einer Minute mit charmantem Druck an der Durchsetzung seiner Hausordnung gehindert worden.
«Jetzt laufen hier also verdammt noch mal Hunde rum, ja? Herrgott noch mal!», ertönte eine wütende Stimme von der Treppe, wo Valérie eben heruntergekommen war. Nun stand Madame Tablier dort. Ihre gestärkte, makellos weiße Schürze bildete einen lebhaften Kontrast zu den schmutzigen Wörtern in ihrem Mund. Wischmopp und Eimer hielt sie fest in den großen, eigentümlich männlich wirkenden Händen, und an ihrem Gürtel hing ein aus der Zeit gefallener Walkman der Achtzigerjahre, dessen orangerote Schaumstoffkopfhörer sie um den Hals gelegt hatte. Man hörte Johnny Hallyday, der sich bei einer Rockballade die Seele aus dem Leib sang.
«Als wär’ hier nicht verdammt noch mal alles schon schwierig genug», knurrte sie so laut, dass sie den aufgekratzten Johnny übertönte. «Wo die Leute ihren Scheiß eh schon überall rumliegen lassen. Jetzt also auch noch Hunde, ja?» Sie stampfte die letzten paar Stufen hinunter und wandte sich an den ganzen Raum. «Als hätt’ ich nicht schon genug damit zu tun, das Blut von den beschissenen Wänden zu putzen.»
2
«Ja, okay, aber ich meine, es ist … na ja, es ist nicht viel Blut, oder?» Ein wenig überzeugender Richard drehte sich um und sah Valérie und Madame Tablier an, die hinter ihm in der Tür eines der Gästezimmer im Obergeschoss standen. Die beiden Frauen hätten nicht unterschiedlicher sein können, da ihre Lebensumstände und ihr Auftreten sie denkbar stark voneinander absetzten, sodass ihr Aufeinandertreffen außerhalb einer extrem fingierten Reality-Show unwahrscheinlich wirkte. Doch in diesem Moment ähnelten sie sich vom Gesichtsausdruck so sehr, dass sie Schwestern hätten sein können. Dieser Ausdruck zeigte Zweifel, der fast schon an Ungläubigkeit grenzte, und in ihren Augen stand die Frage: Es geht nicht wirklich um die Menge des Bluts, oder?
Wenn man nur die Quantität betrachtete, hatte Richard nicht unrecht. Es war wirklich nicht viel Blut. Allerdings prangte rechts des Lichtschalters vor dem Badezimmer der sehr deutliche, tiefrote Abdruck einer Hand, ähnlich wie kleine Kinder ihn mit Farbe auf Papier patschen. Die Finger waren ausgestreckt, an den Spitzen jedoch leicht verschmiert; die Handfläche so deutlich, dass man die Handlinien sah, und das Ganze wirkte wie ein spöttisches Winken. Richard trat einen Schritt zurück, ohne den Blick von dem Fleck zu wenden, und legte den Kopf schief, als wäre er ein Kunstkritiker, der an einem neuen Trend zweifelt.
Er stieß einen tiefen Atemzug aus, der wegwerfend oder sogar spöttisch klingen sollte, jedenfalls aber so, als hätte er alles im Griff. Tatsächlich erinnerte er jedoch eher an ein verstörtes Wimmern. Typisch, so fasste er den bisherigen Verlauf des Morgens zusammen.
«Das gefällt mir nicht», knurrte Madame Tablier, und um ihrer Ablehnung mehr Nachdruck zu verleihen, schwenkte sie den Wischmopp heftig vor dem anstößigen Fleck hin und her. Richard hatte Madame Tablier «geerbt», als seine Frau Clare und er das B&B vor einigen Jahren gekauft hatten. Sie war stets bereit, sich zu empören, fluchte und schimpfte unablässig vor seinen Gästen, die sie insgesamt als überflüssiges, keimverseuchtes, Schmutz machendes Übel betrachtete, und schien, von außen beurteilt, die Welt so sehr zu hassen, dass Komm, süßer Tod, nimm mich jetzt als Motto auf ihrer makellosen Schürze hätte stehen können und nicht: Je place le bonheur au-dessus de tout, was grob übersetzt heißt: Ich stelle das Glück über alles. Gewiss war das ein Scherz. Ich habe das Glück und dergleichen verlegt, hätte es besser getroffen. Aber sie erinnerte Richard an die unbezwingbare Irene Handl, und daher war er bereit, ihr beinahe alles zu verzeihen. Außerdem musste er eine femme de ménage, die Tablier hieß, einfach bei sich arbeiten lassen. Tablier bedeutete auf Französisch Schürze, und solche Fälle, in denen der Name Programm war, hielten Richard in schwierigen Zeiten seelisch über Wasser. Sie stand zu allem bereit da, den Wischmopp erhoben, vermutlich zur Selbstverteidigung, sollte die blutige Hand von der Wand hüpfen und sie in den Po zwicken.
«Das ist recht interessant, finden Sie nicht?» Valérie d’Orçay näherte sich der Situation kühler und intellektueller. Die anderen sahen sie zweifelnd an. «Nein, wirklich», ging Valérie mit ihrer Ernsthaftigkeit über die Skepsis der anderen hinweg. «Schauen Sie.» Damit hob sie ihre eigene Hand, um sie mit dem blutigen Abdruck zu vergleichen.
«Nicht anfassen!», fauchte Madame Tablier. «Das ist ein Beweismittel!»
«Ich fasse ja gar nichts an!», schoss Valérie in einem zischelnden Flüsterton zurück, die Hand noch immer vor sich ausgestreckt.
«Ja, na gut, achten Sie darauf», war die leicht gekränkte Antwort.
«Schauen Sie.» Valéries Hand schwebte über dem roten Abdruck an der Wand. «Sehen Sie es?»
«Jetzt nicht mehr. Ihre Hand ist verdammt noch mal im Weg.»
«Madame Tablier, ich will Sie auf die Größe der Hand aufmerksam machen …»
«Und was hat das mit irgendwas zu tun?»
Richard, der im Laufe seines Lebens genug Erfahrungen gesammelt hatte, wusste genau, wann er sich besser nicht einmischen sollte. Anfang der Woche hatte er zwei seiner Hennen, Lana Turner und Joan Crawford, dabei erwischt, wie sie um eine tote Maus kämpften, und damals hatte er dasselbe Gefühl gehabt wie jetzt: Halt dich raus und lass der Natur ihren Lauf. Außerdem empfand er Streit auf Französisch wie so ziemlich alles, was viel Gefühl verlangte, sprachlich als größere Herausforderung – zu anspruchsvoll. Valérie senkte langsam den Arm, stemmte die Hände in die Hüften und wandte sich energisch zu Madame Tablier um.
«Ich versuche, Ihnen etwas zu zeigen. Stellen Sie jetzt bitte den Wischmopp weg und lassen Sie mich erklären, was ich meine.»
Richard hatte noch nie erlebt, dass jemand die Oberhand über Madame Tablier gewann. Allerdings hatte er zugegebenermaßen auch noch nie erlebt, dass jemand es versuchte. Aber ob es nun der Blick in Valéries Augen war – den konnte Richard von seinem Standort aus nicht sehen – oder einfach nur die leichte Veränderung ihrer Stimmführung, jedenfalls blinzelte die ältere Frau und senkte den Wischmopp.
Nachdem die Hackordnung geklärt war, machte Valérie weiter. Sie erhob erneut die manikürte Hand. «Der Gast in diesem Zimmer ist ein Mann, oder?»
«Ja.» Richard war leicht überrumpelt, dass sie ihn plötzlich einbezog. «Monsieur Grandchamps. Er ist hier schon mehrmals zu Gast gewesen.»
«Ein kleiner Mann?»
«Ja, ich denke schon, er …»
«Nun, er muss klein sein.» Das erklärte sie mit Nachdruck. «Ich bin keine große Frau, aber unsere Hände haben fast die gleichen Maße.»
Richard kapierte nicht recht, wieso das von Bedeutung sein sollte, aber Valérie hielt es für wichtig, und er würde ihr nicht widersprechen. Madame Tablier war jedoch noch weniger überzeugt als Richard, legte endlich den Wischmopp weg und hielt zum Vergleich die eigene Hand hoch. Daneben sah Valéries Hand wie die eines Kindes aus.
«Mein verstorbener Mann, er ruhe in Frieden, hat immer gesagt, mit meinen Händen könnte ich einem Pferd den Hals so umdrehen, wie ich es sonst mit einer Henne mache!»
In Anbetracht der Umstände war das eine unglückliche Bemerkung, und Richard und Valérie beschlossen beide, sie am besten zu ignorieren. Allerdings schafften sie es nicht, den Blick von den erstaunlichen Pranken dieser Frau zu wenden – sie waren so gewaltig groß wie zwei Schinkenkeulen, na ja, fast so groß.
«Er war schon älter», sagte Richard. Er versuchte, sich zu erinnern, aber der alte Mann hatte nichts Bemerkenswertes an sich gehabt, und ohnehin plauderte Richard nur selten mit den Gästen. «Er war kein großer Mann, nein. Aber es ist schwer zu sagen, er hatte einen ziemlich, äh …» Er suchte nach dem französischen Wort. «… krummen Rücken», sagte er dann entschuldigend auf Englisch.
«Einen krummen Rücken?» Valérie wirkte verärgert, eher wohl über sich selbst, weil sie das Wort nicht kannte, als über den dadurch in Panik versetzten Richard.
«Ja, oh, wie heißt das noch?» Er kratzte sich am Hinterkopf. «Äh …» Plötzlich fühlte er sich unter enormem Druck und beugte sich vor, um die Haltung zu demonstrieren. «Courbé!», sagte er triumphierend, richtete sich auf, schnippte mit den Fingern und deutete fast in Siegerpose auf Valérie. «Courbé!», wiederholte er erleichtert. «Monsieur Grandchamps war courbé.»
«Okay», knurrte Madame Tablier abschätzig. «Wir haben es kapiert.»
«Dieser Handabdruck sagt uns meiner Meinung nach eine Menge.» Valérie übernahm wieder das Kommando, brachte von irgendwoher einen Stift zum Vorschein und deutete auf die Wand. «Dort sieht man massenhaft Informationen …»
«Dio mio!» Der Ausruf kam von der Tür, wo Signor Rizzoli stand und sich heftig bekreuzigte.
Valérie sagte blitzschnell etwas auf Italienisch, das ihn wohl beruhigen sollte, doch der junge Italiener wirkte nicht überzeugt.
«Kann ich Ihnen helfen, Signor?», fragte Richard laut auf Englisch.
«Più caffè, per favore, più caffè», antwortete der Italiener, ohne den Blick vom Abdruck zu wenden.
«Madame Tablier, wären Sie so nett, den Herrn zu bedienen?»
«Oh, so läuft das also, ja? Ich geh los und mach die Schmutzarbeit, während Sie beide die Sache vertuschen. Ha! Ich hätte es mir denken können.» Sie stampfte an Signor Rizzoli vorbei und meckerte auf der Treppe vor sich hin.
«Runter geht’s mit meiner Bewertung auf TripAdvisor», murmelte Richard düster, während der nervöse Italiener Madame Tablier folgte.
«Was?»
«Nichts. Was meinten Sie da eben mit Informationen? Informationen worüber?»
«Darüber, wer dieser Herr ist», antwortete Valérie, als wäre es das Offensichtlichste auf der Welt. Schau» – sie hob erneut ihren Stift –, «das hier ist die Lebenslinie, aber eine kleinere Linie verläuft parallel dazu, siehst du?» Richard nickte. «Die Hauptlebenslinie schwingt sich nach oben, was für Lebenskraft und Vitalität spricht, und die kleinere Linie bestätigt das. Dein Monsieur Grandchamps hat anscheinend eine große Widerstandskraft gegen Krankheiten. Am unteren Ende spaltet sich die Lebenslinie. Das weist auf einen Einzelgänger hin, der von seiner Familie getrennt lebt. Er ist immer allein, sagtest du?» Richard folgte nun nicht mehr Valéries Stift, sondern schaute auf seine eigenen Handflächen. Leider spaltete sich seine Lebenslinie ebenfalls. «Die Kopflinie hier ist lang und gerade, er ist also ein engagierter Mann, aber auch eigensinnig.»
Erneut schaute Richard auf seine eigene Handfläche, wo die Kopflinie kaum wahrnehmbar war.
«Das hier ist allerdings interessant: Es gibt keine erkennbare Herzlinie, oder sie ist mit der Kopflinie verschmolzen. Für einen Mann ist das gut, ein starker, erfolgreicher Mensch.»
«Und für eine Frau?»
«Für eine Frau? Nicht so gut. So eine Person ist zerstörerisch und gefährlich.» Sie bewegte den Stift. «Und hier sollte die Ehelinie sein. Aber es gibt keine. Auch hieran erkennt man ihn als getriebenen Mann. Die Ehe oder das andere Geschlecht sind ihm nicht wichtig, er interessierte sich vor allem für sich selbst.»
«Oder er ist gar nicht verheiratet?», brachte Richard vor.
«Möglich.»
«Ich habe auch keine Ehelinie», sagte Richard klagend; dieser Morgen wurde immer schlimmer. «Nur ein paar Fältchen.» Valérie sah ihn streng an und musterte dann seine Handfläche.
«Nein», erklärte sie. «Du hast viele Ehelinien, schau doch, mindestens drei.»
«Drei Ehen?»
«Nicht unbedingt. Es kann mehrere Ehen bedeuten, eine Ehe und Affären oder sogar, dass du eine einzige wahre Liebe hast, sie aber dreimal so stark liebst, wie es einem Menschen möglich ist.»
Richard schloss angewidert die Hand. «Das ist verdammt vage, wenn du mich fragst!»
«Oh ja», erwiderte Valérie lässig. «Richtiger Mumpitz» – es gefiel ihm, wie sie Mumpitz sagte –, «aber manche Menschen glauben daran, und das macht es an sich schon interessant.»
Madame Tablier stapfte lautstark die Treppe hinauf und ins Zimmer. «Das hat die Italiener ganz schön aufgescheucht», sagte sie atemlos. «Nun. Haben Sie die Leiche schon gefunden?»
«Die Leiche?!» Richard schaute sich plötzlich um; merkwürdigerweise war ihm dieser Gedanke noch gar nicht gekommen. Allerdings hätte man eine Leiche auch nirgends im Zimmer verstecken können. Es gab keinen Schrank, sondern nur eine hölzerne Kleiderstange. Das Bett war so ordentlich, als hätte niemand darin geschlafen, und offensichtlich lag nichts darunter. In der Ecke stand als Dekoration ein Schrankkoffer, aufgeklappt wie üblich und mit Lavendel gefüllt, der herausquoll. Gepäckstücke waren nirgends zu entdecken. Tatsächlich wirkte der Raum, von dem blutigen Handabdruck einmal abgesehen, so, als wäre er schon für den nächsten Gast bereit.
«Das ist ja alles gut und schön», sagte Madame Tablier, «aber je länger das Blut an der Wand bleibt, desto schwieriger ist es zu entfernen. Wenn hier keine Leiche liegt, war es vielleicht einfach nur ein Missgeschick, und der Kerl ist abgehauen, ohne zu bezahlen.»
«Schon möglich. Er könnte sich beim Rasieren geschnitten haben.» Valérie wirkte ernüchtert.
«Er trug einen Vollbart», entgegnete Richard auf dem Weg ins Bad. «Beim Rasieren kann er sich nicht geschnitten haben.» Er öffnete und schloss die Schubladen unter dem Waschbecken, um zu sehen, ob überhaupt irgendetwas auf eine Übernachtung hindeutete.
«Dann vielleicht Nasenbluten», schloss Madame Tablier sich an. «Mein verstorbener Mann, er ruhe in Frieden, hatte einmal so schlimmes Nasenbluten, dass das Bad wie der Boden eines Schlachthauses aussah …»
«War Ihr Mann ein Hämophiler?» Valérie seufzte; ihre Stimme klang uninteressiert, sie wirkte enttäuscht, dass das kurze Abenteuer zu so einem profanen Ende gekommen war.
«Nein. Kommunist bis zum Tag seines Todes», kam prompt die stolze Antwort.
«Nein, ich meinte …»
«Oder …», Richard kam aus dem Bad, einen kleinen Treteimer in der Hand, «er ist hingefallen, seine Brille ist zerbrochen und er hat sich an den Scherben geschnitten.»
«Ja, sicher, es kann verschiedene Ursachen geben.» Valérie wandte sich zum Gehen, doch Richard klappte den Eimerdeckel auf. Darin lag eine zerbrochene, blutige Brille.
3
Die Hennen musterten Richard misstrauisch. Beide hatten den Kopf auf die gleiche Seite gelegt, aufeinander abgestimmt wie Synchronschwimmerinnen, jedoch ohne das starre Lächeln. Lana Turner und Joan Crawford stritten sich nicht mehr, sondern fragten sich jetzt, was los war: Warum wurden sie um diese Tageszeit gefüttert? Zu dieser Stunde war das äußerst ungewöhnlich. Die Dritte im Bunde, Ava Gardner, legte im Hühnerstall gackernd ein Ei. Tatsächlich war sie diesmal noch lauter als sonst, als beklagte sie sich als eifrigste der Legehennen darüber, dass sie etwas verpasste.
«Ist das deine Art nachzudenken, Richard?» Valérie war leise, sogar lautlos, neben ihm aufgetaucht. Eigenartig, dachte er, wie sie mühelos in eine Vertraulichkeit des Umgangs gefunden hatten. Von Monsieur und Madame zu Richard und Valérie, vom vous zum tu, und alles in weniger als einer Stunde. Normalerweise brauchte man viel länger, um über das Minenfeld der französischen Umgangsformen zu gelangen. Sie hatten es jedoch im Schnelldurchgang geschafft, wobei natürlich Valérie den richtigen Moment gewählt hatte. Richard fühlte sich dadurch geschmeichelt und gestärkt, auch wenn er nicht sagen konnte, warum.
Natürlich hatte die Möglichkeit einer Gewalttat oder sogar die von Madame Tablier geäußerte Vermutung, es könne sich um einen Mord handeln, das Zeug, Barrieren einzureißen. Wie im Krieg, wenn extreme Umstände alles beschleunigten, weil es keine Zeit für Höflichkeiten gab. Aber von der Mühelosigkeit der Beziehung einmal abgesehen, klebte tatsächlich Blut an der Wand, und außerdem war ein Gast verschwunden. Richard genoss das, was er als Stärkung seines Selbstbewusstseins auffassen musste, nämlich die frisch erworbene Freundschaft einer attraktiven Frau. Das Blut jedoch, das dafür den Anlass geboten hatte, machte ihm zu schaffen.
Gerade wollte er eine Antwort geben, die nach typisch britischem Stoizismus klingen sollte, und darauf bestehen, dass das Leben normal weitergehen müsse, während sie den nächsten Schritt planten.
«In deiner Lage würde mich das auch belasten», sagte Valérie, ohne wirklich Mitgefühl anzudeuten.
Verdammt! Sie kann direkt in mich hineinschauen. Innerlich zuckte Richard verärgert zusammen, warf die nächste Handvoll Körner zu hart nach den Hennen und erntete dafür einen strengen Blick von Joan Crawford. Die Frau kann Gedanken lesen!
«Das Leben muss weitergehen», sagte er. «Ich wollte mich einfach nur sammeln, und die Ladys mussten ohnehin gefüttert werden.» Im Hühnerstall ertönte ein lautes Gegacker, das wie Hohngelächter klang, und Richard übersah das leichte Lächeln, das kurz über Valéries Gesicht huschte.
«Und was hast du entschieden?», fragte sie und huldigte damit seiner Rolle als schweigsamer männlicher Autorität.
«Tja …» Er klappte die Futterkiste langsam zu.
«Wie oft ist er denn hier schon abgestiegen, dieser Monsieur …»
«Grandchamps?» Er wandte sich ihr zu, doch sie hatte sich hingehockt, hob ein paar auf den Boden gefallene Körner auf und hielt sie den Hühnern mit der geöffneten Hand zum Aufpicken hin. Das hatte er auch selbst schon oft versucht, aber inzwischen als unmöglich aufgegeben. Neidisch schaute er zu, wie Lana, Joan und eine aufgeregte Ava sich ihr ohne jede Vorsicht näherten. «Er war das dritte Mal da, vielleicht auch schon das vierte Mal; ich müsste es in den Unterlagen nachschauen.» Er konnte seine Verstimmung nicht verbergen.
«Du weißt es nicht mit Gewissheit?» Sie stand auf und befreite mit einem Klatschen ihre Hände vom Staub, den die Körner hinterlassen hatten. Die Hennen verweilten wie Jünger zu ihren Füßen.
«Also, wie schon gesagt, ich müsste in meinen Unterlagen nachschauen.» Richard mied den Blickkontakt.
«Aber wenn er ein Stammgast war, hast du doch das eine oder andere von ihm erfahren, oder?»
«Nein. Nein, habe ich nicht.» Er hätte gern hinzugefügt, dass er ein B&B führte, kein Gefängnis, und dass es ihn verdammt noch mal absolut nichts anging, warum ein Gast ein Zimmer bei ihm nahm. Er entschied sich aber dagegen.
«Nun?», fragte sie nach einer Pause.
«Tja …»
«Sollen wir sie uns dann einmal anschauen, deine Unterlagen?» Sie betonte die beiden letzten Wörter so, als verspräche sie sich nicht viel davon.
«Was denn … jetzt?»
«Monsieur», begann sie, und ihre plötzliche Förmlichkeit ließ bei Richard die Alarmglocken schrillen. So wie bei Eltern: Wenn die den vollen Namen ihres Kindes verwendeten, war danach auch nichts Gutes zu erwarten. «Bei dir ist ein Gast verschwunden, ein alter Mann. An der Wand ist Blut verschmiert, und eine zerbrochene Brille liegt im Mülleimer. Da sollten wir doch wohl etwas unternehmen, oder?»
Sie wartete die Antwort nicht ab, sondern marschierte stattdessen los. Hinter ihr ließ Richard die Schultern hängen. So etwas sollte nicht geschehen. Nicht ihm. Er war durchaus zufrieden damit, die Welt auf Abstand zu halten. Er versteckte sich zwar nicht gerade, aber er drängte sich auch nicht in den Vordergrund. Er war ein Statist, jemand, der sich zurückhielt. Aber als er sah, wie energisch Madame davonstapfte, obwohl sie nicht einmal wusste, wo genau die Unterlagen zu finden waren, hatte er das schreckliche, quälende Gefühl, dass Valérie d’Orçay das nicht zulassen würde.
«Wenn du kurz hier wartest, hole ich schnell den Laptop.»
Valérie musterte Richards Wohnzimmer und registrierte jede Einzelheit. Richard war sehr stolz darauf, wie gründlich Madame Tablier und er selbst in seinem B&B für Sauberkeit und Ordnung sorgten; dafür legten sie sich ordentlich ins Zeug, missbilligten den winzigsten Fleck an der Wand oder waren wie wild hinter Spinnweben her. Doch das galt nur für die Pension. Im großen Haupthaus sah es anders aus. Dass Madame Tablier hier keine Ordnung schaffte, war unübersehbar. Man könnte meinen, sein Privatdomizil stehe zum chambre d’hôtes in demselben Verhältnis wie Dorian Gray zu seinem Porträt auf dem Dachboden. Auf jeder waagerechten Oberfläche lagen Bücher, ein halbes Dutzend Kaffeetassen standen herum, überall waren DVDs ohne Hülle verstreut, und auf dem kleinen Esstisch standen zwei leere Weinflaschen. Man könnte behaupten, das Zimmer künde von einem zerstreuten Intellektuellen, einem Professor kurz vor einem entscheidenden Durchbruch. Aber tatsächlich spürte man hier einfach nur den Junggesellen, und aus irgendeinem Grund schämte Richard sich deswegen ein bisschen. Valérie schenkte ihm jedoch ein strahlendes Lächeln, räumte ein wenig Platz auf dem Tisch frei, bevor sie sich setzte, und platzierte Passepartout, den sie in seiner Tasche aus dem Frühstückszimmer geholt hatte, auf den Stuhl neben ihrem. Der Hund wirkte nicht gerade beeindruckt von der Umgebung.
«Ich bin gleich wieder da. Es muss irgendwo hier oben sein.» Richard ging die Treppe hinauf. «Ich habe darauf gestern Abend einen Film angeschaut.»
«Okay», antwortete sie, und Richard wartete auf die unvermeidliche Frage nach dem Titel des Films, doch zu seiner Enttäuschung blieb sie aus.
Ein paar Minuten später kam er wieder herunter, nachdem er das Gerät unter dem linken Kopfkissen seines Betts gefunden hatte, schaltete es ein, registrierte erleichtert, dass der Akku noch ausreichend geladen war, stellte sich neben Valérie und tippte verlegen die Zugangsdaten seiner Buchungs-Website ein.
Langsam baute sich die Seite auf. Richards uraltes MacBook, das zu beiden Seiten des Mousepads mit Bleistift gekritzelte Notizen aufwies, brummte laut und ächzte wie ein alter Mann, der von einem Stuhl aufsteht. Zum ersten Mal entstand ein unbehagliches Schweigen zwischen ihnen; Valérie saß kerzengerade vor dem Gerät, beinahe schon misstrauisch, während Richard nervös hinter ihr stand. Endlich war die Website vollständig geladen, und Richard klickte auf den Menüpunkt «Reservierungen», doch dann übernahm Valérie, als hätte sie die Beobachterinnenposition neben ihm satt, und scrollte durch die Liste der Namen.
«Dupont, Faure, Favreau, Gosse, ah, Grandchamps.» Sie öffnete die Daten mit einem Doppelklick auf den Namen. «Vincent Grandchamps – nun, er war vier Mal hier.»
«Wie ich gesagt habe», erklärte Richard mit sich zufrieden.
«Du sagtest, drei oder vier Mal», tadelte sie ihn sanft. «Tatsächlich hat er die letzten vier Mittwochabende hier übernachtet. Warum?»
«Das ist nicht wirklich …»
«Ich meine, das ist sehr eigenartig, oder?»
«Ich denke nicht …»
«Warum sollte ein alter Mann so etwas tun?»
«Nun …»
«Wie alt ist er denn?» Sie fuhr herum und sah ihn an.
Richard kratzte sich am Kopf. «Ich habe nicht die geringste Ahnung.»
Sie sah ihn ungläubig an. «Interessierst du dich wirklich so wenig für andere Menschen? Warum?», fügte sie etwas sanfter hinzu.
«Es ist nicht so, dass ich …»
«Wie alt bin ich, was meinst du?»
In seinem Kopf verkrümmte sein Gehirn sich zu etwas, das grob an Edward Munchs Der Schrei erinnerte.
«Beim Alter verschätze ich mich immer», sagte er langsam und fügte dann rasch hinzu: «Aber er war alt. Vom Alter gekrümmt. Er hat nicht viel gesagt, aber er musste immer den Kopf heben, um mit mir zu sprechen.»
«Warum mittwochs?» Sie wandte sich wieder dem Laptop zu.
«Außerdem hatte er einen Gehstock. Und er hatte einen dicken Mantel an und einen Hut auf dem Kopf. An Markttagen scheint es immer kalt zu sein.»
«Markttag?» Erneut wandte sie sich rasch zu ihm um.
«Ja», antwortete er zögernd, da ihm nicht klar war, was er damit unwissentlich enthüllt haben könnte. «Donnerstags ist Markttag.»
«Aha!» Plötzlich war sie Feuer und Flamme, wie ein Jagdhund, der eine Spur aufgenommen hat, doch genauso schnell erlosch ihre Begeisterung wieder, und sie schüttelte den Kopf. «Aber warum?»
«Vielleicht hat er ja Verwandte in der Gegend.»
«Und wieso hat er dann nicht bei denen übernachtet?»
«Vielleicht mag er sie nicht?»
Über den Rand ihrer Brille hinweg warf sie ihm einen tadelnden Blick zu, als hätte er einen unpassenden Scherz gemacht, was er als unfair empfand, weil ihm gar nicht nach Scherzen zumute war.
«Steht seine Adresse in der Datei?»
«Die geben die Gäste nicht immer an; es hängt davon ab, wie sie bezahlen», antwortete er, streckte die Hand aus und übernahm wieder die Kontrolle über das Mousepad. Er spürte, dass sie sich schon wieder anspannte. «Oh.» Er trat rasch zurück. «Da ist ja seine Adresse. Normalerweise schaue ich mir das nie richtig an.»
«Wo liegt Vauchelles? Kennst du es?»
«Ein Stück die Straße hinunter, hier im Val de Follet», antwortete Richard und kratzte sich verwirrt am Kinn. «Nur etwa zwanzig Minuten mit dem Auto.»
«Es liegt an der Busstrecke sechs.» Madame Tablier war in die Tür getreten, einen Ausdruck im Gesicht, der ein nahendes Unwetter ankündigte. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt.
«Was meinen Sie damit? Die Busstrecke sechs? Ist das wichtig?»
Richard war froh, dass Valérie hier die Führung übernahm; Madame Tablier sah nicht so aus, als würde sie sich von ihm irgendwelche dummen Fragen gefallen lassen.
«Es sind Sonderfahrten», erklärte die untersetzte Frau, allerdings zögernd, als spräche sie nur widerwillig. «Die Strecke wird nur an Markttagen betrieben, damit Leute aus anderen Städten herkommen und Klatsch und Tratsch austauschen können.»
«Und ihre Einkäufe erledigen können», fügte Valérie hinzu.
«Sie kommen vor allem zum Tratschen.»
«Woher wissen Sie das?»
Täuschte er sich, oder nahmen Valéries Fragen inquisitorische Ausmaße an?
«Eine meiner Schwestern ist vor dreißig Jahren dorthin gezogen. Seitdem hab ich sie nicht mehr gesehen.» Es klang, als wäre Vauchelles so etwas wie das Bermudadreieck oder ein kleines Dorf auf einem anderen Kontinent und läge nicht tatsächlich im selben Tal.
«Aber warum haben Sie Ihre Schwester denn seit damals nicht mehr gesehen?»
«Was, die ganze Strecke bis nach Vauchelles reisen? Ich bin doch nicht Jacques Cousteau. Für so was haben nur Klatschbasen Zeit, nicht wir, die wir schwer arbeiten. Wir schreiben uns manchmal.»
Es folgte ein Schweigen, und Richard bemerkte Valéries überraschten Gesichtsausdruck. Er selbst war dagegen überhaupt nicht erstaunt. Er erinnerte sich an eine Begebenheit, als sie gerade erst in diesen stillen Winkel des Loire-Tals gezogen waren. Damals waren sie einem benachbarten Ehepaar vorgestellt worden, das jammerte, die Tochter ziehe «weg». Clare und er hatten Mitgefühl bekundet, bis sich herausstellte, dass dieses «Wegziehen» gerade nur bis zum nächsten Dorf führte, vielleicht drei Kilometer entfernt. So sind manche Leute auf dem Land. Jede Veränderung, und sei sie auch noch so winzig, ist immer ein Riesending.
«Jedenfalls» – Madame Tablier zuckte mit den Schultern – «habe ich eine gute Nachricht und eine schlechte.» Sie hielt inne, um ihre Worte wirken zu lassen. «Dieses italienische Paar ist abgereist. Wahrscheinlich haben sie einen Schreck bekommen. Sie haben ihre Sachen gepackt, bar bezahlt und sich verpisst. Zweihundert Euro, ist das richtig? – So oder so, hier ist das Geld. Zählen Sie nach, wenn Sie mir nicht vertrauen.» Sie trat vor, und mit einer so großartigen Geste wie ein Pokerspieler, der einen Royal Flush auf den Tisch legt, warf sie vier Fünfzig-Euro-Scheine auf die Tastatur des Laptops.
«Das überrascht mich nicht», sagte Richard ernüchtert. «Blut, Gewalt und ein friedlicher Urlaub auf dem Land passen nicht zusammen.» Er nahm das Geld und gab Madame Tablier fünfzig Euro, die den Schein schweigend einsteckte. «Wieder eine schlechte Bewertung.»
«Und die gute Nachricht?», fragte Valérie.
«Das war die gute Nachricht», schnaubte Madame Tablier. «Morgen ein Zimmer weniger zu putzen und fünfzig Euro in meiner Tasche. Wenn Sie das für eine schlechte Nachricht halten, haben Sie es bisher zu einfach gehabt, Kleines!»
Richard beschloss einzuschreiten, bevor die Sache aus dem Ruder lief. «Und was ist dann die schlechte Nachricht?»
«Jemand hat den verdammten Handabdruck gestohlen. Hat ihn einfach aus der Tapete herausgeschnitten.»
«Was?» Richard glaubte beinahe, dass das die gute Nachricht war.
«Und die Brille ist ebenfalls weg. Da gehen merkwürdige Dinge vor sich, wenn Sie mich fragen.»
«Die Brille ist ebenfalls weg?»
Valérie klappte den Laptop zu, als hätte sie eine Entscheidung getroffen. «Wusste ich doch, dass beides zu offensichtlich war. Zu schön, um wahr zu sein», sagte sie, unfähig, ihre Verärgerung zu verbergen.
«Ja, da haben Sie recht», stimmte Madame Tablier ihr sofort zu. «Ich habe viele Maigrets gesehen, wissen Sie?» Bei ihr klang das wie eine Drohung.
Richard hatte nicht die geringste Ahnung, wovon die beiden sprachen, und so verhielt er sich still, machte aber für alle Fälle ein nachdenkliches Gesicht.
Valérie stand auf, griff nach Passepartouts Tasche, und gemeinsam standen die drei, Richard, Valérie und Madame Tablier, kurze Zeit schweigend da.
«Nun, Richard, was werden Sie unternehmen?»
«Ich … äh … na ja.» Richard war sich nicht sicher, ob jetzt, da alle Spuren verschwunden waren, falls es sich tatsächlich um Spuren gehandelt hatte, überhaupt noch etwas unternommen werden musste.
«Die Frage scheint mir vollkommen angemessen», knurrte Madame Tablier.
Richard, der zu dem Schluss kam, dass er sich auf seinen Stoizismus nicht länger verlassen konnte, ließ besiegt den Kopf hängen. Er hatte keine Ahnung, was er «unternehmen» würde, aber gleichzeitig war ihm angesichts der Gesellschaft, in der er sich befand, verdammt bewusst, dass die Entscheidung wahrscheinlich nicht länger bei ihm lag.
4
Wenn in einer der Technicolor-Hollywood-Gaunerkomödien der Fünfzigerjahre irgendetwas garantiert war, dann die Szene, in der die Hauptdarstellerin, üblicherweise Grace Kelly, am Steuer eines Sportwagens mit dem Hauptdarsteller, üblicherweise Cary Grant, in halsbrecherischem Tempo um die Kurven gewundener Straßen fegte, üblicherweise an der französischen Riviera. Die Fahrt sollte dem Zweck dienen, ihr die Oberhand zu verschaffen, doch obwohl der männliche Hauptdarsteller ein gewisses Unbehagen zeigte, verlor er nie tatsächlich die Contenance. Nicht zum ersten Mal im Leben und zu seinem großen Bedauern musste Richard feststellen, dass er kein Cary Grant war.
«Herrgott noch mal, würdest du bitte langsamer fahren?!», schrie er.
«So schnell fahre ich doch gar nicht», rief Valérie zurück. Der Wind brauste über die niedrige Windschutzscheibe, riss ihr die Worte vom Mund, fegte diese über die Rückbank des offenen Cabrios hinweg und schleuderte sie hinter ihnen auf den dahinfliegenden Asphalt.
Richard kniff die Augen zusammen.
Er hatte angeboten zu fahren, doch Valérie hatte kategorisch entschieden, dass seine zerbeulte alte Ente, auf deren beiden Türen der Schriftzug «Les Vignes – Chambre d’hôtes» prangte, für ihr Vorhaben zu auffällig war. Bisher war Richard nicht