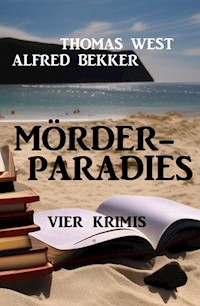
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Von Alfred Bekker, Thomas West (499XE) Krimis der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre. Mal provinziell, mal urban. Und immer anders, als man zuerst denkt. Kriminalromane der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre. Dieses Buch enthält folgende drei Krimis: Thomas West: Jesse Trevellian und das tödliche Paradies Alfred Bekker: Kubinke und die Katze Alfred Bekker: Mörderpost Alfred Bekker: Chinatown-Juwelen Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden, Sidney Gardner, Jonas Herlin, Adrian Leschek, John Devlin, Brian Carisi, Robert Gruber und Janet Farell.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Mörderparadies: Vier Krimis
Copyright
Jesse Trevellian und das tödliche Paradies
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Kubinke und die Katze
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mörderpost
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Chinatown-Juwelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Mörderparadies: Vier Krimis
Von Alfred Bekker, Thomas West
Krimis der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre. Mal provinziell, mal urban. Und immer anders, als man zuerst denkt.
Kriminalromane der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre. Dieses Buch enthält folgende drei Krimis:
Thomas West: Jesse Trevellian und das tödliche Paradies
Alfred Bekker: Kubinke und die Katze
Alfred Bekker: Mörderpost
Alfred Bekker: Chinatown-Juwelen
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden, Sidney Gardner, Jonas Herlin, Adrian Leschek, John Devlin, Brian Carisi, Robert Gruber und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Jesse Trevellian und das tödliche Paradies
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 118 Taschenbuchseiten.
Charly Mulberry, ein alter Freund aus Quantico-Zeiten, bittet Special-Agent Jesse Trevellian um Hilfe, erscheint aber nicht zum vereinbarten Treffpunkt – kurz darauf wird seine Leiche gefunden. Mulberrys Frau Ann fleht Jesse an, den Mord an ihrem Mann, dem Ex-FBI-Agenten, aufzuklären. Jesse wollte zwar gerade seinen wohl verdienten Urlaub antreten, ändert kurzentschlossen seine Pläne und macht sich auf in den Dschungel des Amazonas – dorthin führt die einzige Spur, die Mulberrys fragwürdige Reisen erklären und Licht in die geheimen Machenschaften seines alten Freundes bringen könnte … und die vielleicht auch zu seinem Mörder führt.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker.
© by Author
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Die drei Männer standen wie festgewachsen um den Schreibtisch des saalartigen Büros. Zwei kaffeebraune Schönlinge, wie man sie an den ausgedehnten Stränden der Stadt zu Tausenden finden konnte. Nur trugen die beiden keine Tangas sondern helle Sommeranzüge.
Und ein fast schwarzhäutiger Indio mit weiten dunklen Kleidern. Er stank nach altem Schweiß und war von gedrungener, zwergenhafter Gestalt.
Die Augen der drei wanderten nervös hin und her zwischen dem Dreckhaufen auf dem Schreibtisch und dem Greisen auf dem Ledersessel davor.
Carlos Maria Moreno presste die gefalteten Hände an seine fast farblosen, welken Lippen. Wie abwesend war er in die Betrachtung der anthrazitfarbenen Gesteinsbrocken auf seinem Schreibtisch versunken. Als würde er beten.
Das intensive Abendlicht prallte durch die beiden Fensterfronten seines Arbeitszimmers und brach sich in den gänzlich durchsichtigen Splittern, die das grauschwarze Gestein vor ihm auf dem Schreibtisch durchsetzten wie Tautropfen eine aufgerissene Asphaltdecke. Diamanten.
"Wir müssen sie töten." Leise und krächzend sprach Carlos Maria Moreno. Als hätte man feinen Kies in einen Blecheimer rieseln lassen - so klang seine Stimme. "Sie müssen weg. Es muss aussehen, als wären sie nie dagewesen. Keiner darf übrig bleiben."
Die Flügel seiner zerfurchten, schmalen Nase blähten sich auf, als er tief die Luft einsog. Seine knochigen Finger entspannten sich und seine Hände lösten sich voneinander. Mit einer ehrfürchtigen Geste fassten sie die beiden Zipfel des Wildledertuches, auf dem das diamanthaltige Gestein ausgebreitet war. Er zog den zerbröselten Fels zu sich heran.
"Allein was hier vor mir liegt, ist Millionen wert."
Er hob seinen Kopf und fixierte den indigen wirkenden Mann in den dunklen, staubigen Kleidern. "Und Vegas ist sicher, dass es mehr davon gibt?" Die pergamentene Haut auf seiner Stirn legte sich in hundert Falten.
Der Indio nickte, und der jüngere der beiden Schönlinge trat vor und stützte sich auf den Schreibtisch. "Vegas sagt, der ganze Berg sei voll davon." Der Indio nickte noch heftiger.
Moreno atmete noch einmal geräuschvoll durch. Für einige Augenblicke starrte er scheinbar unschlüssig auf seine Hände. Die rechteckige, goldene Uhr an seinem linken Handgelenk zeigte neun Uhr. Der Kalender stand auf dem 19. August.
Carlos Maria Moreno erhob sich und schlurfte zur Fensterfront seines Büros. Mit auf dem Rücken verschränkten Armen sah er aus dem zwanzigsten Stock des Hauses hinab auf den Strand.
Wie eine weiße Sichel lag die Copacabana zwischen der Bucht und den Hochhauskästen entlang der Avenida Atlântika. Segelyachten, Motorboote und Surfbretter bedeckten als helle Flecken das tiefe Blau des Wassers.
Für Sekunden blitzte es hell auf im grauen Hang des Zuckerhutes, der sich wie ein steinerner Busen dem dunstigen Himmel entgegenreckte - der Reflex der Abendsonne in einer der Gondeln, die noch bis kurz vor Sonnenuntergang Touristenhorden auf den weltberühmten Hausgipfel Rio de Janeiros schaukeln würden.
"Sie hätten das Land nicht verkaufen sollen, Senhor Moreno, es war ein Fehler, wir sollten ..."
Abrupt drehte der Alte sich vom Fenster weg. Sein stechender Blick brachte den smarten Mann in dem Sommeranzug und mit dem wasserstoffblonden Bürstenhaarschnitt zum Schweigen. "Scharfsinnig wie immer, José. Ungeheuer scharfsinnig." Er machte eine Kopfbewegung zu dem Indio hin. "Zahl ihm seinen Botenlohn aus. Aber bezahle ihn großzügig." Er nickte dem Indio mit ausdruckslosem Gesicht zu. Der und der Blonde verließen das Büro. Moreno wandte sich wieder dem Fenster zu.
"Vor allem dieser O'Dewly muss weg. Er darf keine einzige Zeile mehr über uns schreiben."
Der im Raum verbliebene Mann, ein knapp dreißigjähriger athletisch gebauter Adonis mit einem schwarzblau glänzenden Pferdeschwanz, bewegte sich endlich vom Schreibtisch weg und trat hinter Moreno. "Er wird spätestens nächste Woche die Kopie der Besitzurkunde erhalten."
Er sprach nicht direkt leise, aber gedämpft und so als würde er jedes Wort abwägen. Wie man mit einem Mann spricht, dessen uneingeschränkte Macht man akzeptiert.
"Und das Grundbuchamt in Brasilia wird demnächst das Dokument dem Grundbuch zufügen."
Moreno stieß ein trockenes Lachen aus. "Ein Papier kann verschwinden, Julio. Leichter noch als ein Mensch. Nimm das in die Hand und setz dich mit dem zuständigen Beamten in Verbindung. Es gibt niemanden, den man nicht kaufen könnte."
"Ich werde mich noch heute darum kümmern, Papa. Aber du weißt, dass es in Brasilia eine Menge Beamten gibt, die der Regierung treu ergeben sind."
"Ich weiß es, mein Sohn. Und du weißt, dass man auch in jungen Jahren sterben kann."
Der Jüngere schwieg für Sekunden. "Und O'Dewly und seine Leute?", fragte er dann vorsichtig.
"Wir dürfen mit ihrem Verschwinden nicht in Verbindung gebracht werden."
"Und wer soll es erledigen, wenn nicht unsere Leute?"
Moreno wandte sich zu seinem Sohn um. "Ruf gleich morgen in Kapstadt an. Die >Private Executive Corporation< hat uns früher schon gute Dienste erwiesen."
"Das kostet eine Menge Geld, Papa."
"Nur wer Geld investiert, verdient Geld, mein Sohn." Julio senkte den Blick und deutete ein Nicken an. "Vorher aber setzte dich mit Vegas in Verbindung", fuhr Moreno fort. "Er soll sämtliche Leute, die von dem Diamantenfund wissen, den Piranhas zum Fraß vorwerfen."
Sekunden später hörte Moreno die Tür seines Büros zum zweiten Mal ins Schloss fallen. Gedankenverloren sah er auf die Avenida Atlântika hinunter. Natürlich war es ein Fehler, Nelson O'Dewly das Waldgebiet in der Quellregion des Rio Jatapu zu verkaufen. Aber nur aus jetziger Sicht. Vor drei Monaten hatte niemand etwas von Diamantenvorkommen auf diesem gottvergessenen Stück Erde gewusst.
Aber es gab nichts, das man nicht korrigieren konnte. Vorausgesetzt man hatte die Macht und das Geld dazu. Und Moreno hatte beides.
Ein dunkler Wagen fädelte sich in die abendliche Rushhour der Strandstraße ein - Josés Mercedes. Er fuhr mit dem Indio in eines der nördlichen Stadtteile. Dort würde man den dunkelhäutigen Mann spätestens morgen früh im rot gefärbten Wasser einer Pfütze finden. Mit durchgeschnittener Kehle.
Und die Polizei würde ihm nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als einem tot gefahrenen Straßenköter ...
2
Der Drucker summte träge und spuckte das letzte Blatt eines Verhörprotokolls aus. Ich schaltete mein PC-Terminal ab und lehnte mich in meinen Bürosessel zurück. "Das wär's dann."
Milo war mit der Korrektur eines Berichtes für die Staatsanwaltschaft beschäftigt. Überrascht sah er von seiner Arbeit auf. "Schon fertig?"
"Klar."
Er schob ein paar Seiten seines Berichtes von seinem auf meinen Schreibtisch herüber. "Lies mal Korrektur, Partner - dein Urlaub beginnt erst übermorgen."
"Das sind nur noch wenige Stunden." Ich schob die Blätter zurück auf seinen Schreibtisch. "Mach Feierabend, Milo - die paar Kommafehler werden dem Staatsanwalt schon nicht auffallen."
Ich schlug meinen Kalender auf und genoss den Anblick: Die Übersicht für die nächste Woche war mit großen, roten Buchstaben überschrieben - U R L A U B ...
Morgen, am Freitag, würde ich mir noch einen lockeren Tag in der Federal Plaza machen. Am Wochenende ein bisschen faulenzen und meine Junggesellenklause aufräumen, Montag und Dienstag ein paar lang aufgeschobene Erledigungen, und am Mittwoch um die Zeit würde ich schon über den Wolken schweben und für mehr als drei Wochen von der Bildfläche verschwinden. Vor Anfang Oktober würde ich nicht wieder zurück sein.
"Übermorgen, Partner!" Milo riss mich aus meinen Gedanken und mimte den Strengen. "Du aalst dich wohl schon an Balis Palmenstränden."
"Neidhammel." Ich stand auf und zog mein Jackett von der Stuhllehne. "Mach Schluss, Milo - ich lad dich zu einem Bier ein."
Milo ließ sich nicht lange bearbeiten. Er schob seine Papiere zusammen und legte sie auf den beachtlichen Stapel in seinem Postausgangskorb - aus dem Sammelsurium von Verhörprotokollen, Ermittlungsberichten, schriftlichen Zeugenaussagen und Beweismittellisten würde die Staatsanwaltschaft in den kommenden Wochen die Anklage gegen einen Schleuserring zimmern, den wir vor ein paar Tagen zerschlagen hatten.
Die beiden Köpfe der Bande saßen seitdem auf Rikers Island in U-Haft. Zwei skrupellose Ukrainer, die osteuropäischen Familien ihr mühsam erspartes Vermögen abgenommen hatten, um sie in die Staaten zu schmuggeln und irgendwo im Labyrinth des Big Apples auf einer Straße stehen zu lassen.
Wir nahmen ein Cabby nach Civic Center und ließen uns vor einer Bar in der Seaportgegend absetzen - dem >North Star Pub<. An der großen Theke war noch reichlich Platz. Erst zwischen sechs und sieben Uhr abends strömten die Manhatties aus ihren Büros, Praxen und Banken hierher, um sich den Frust des zurückliegenden Arbeitstages aus dem Schädel zu spülen, oder um gute Geschäfte oder eine Gehaltserhöhung zu feiern.
Ich orderte zwei Budweiser und wir stießen an. "Auf die Palmenstrände Balis", sagte ich.
"Auf mich." Ein süßsäuerliches Grinsen legte sich auf das vertraute Gesicht meines Partners. "Immerhin muss ich mich vier Wochen ohne dich durchschlagen."
"Vier Wochen lang mit der U-Bahn in die Federal Plaza, vier Wochen lang niemand, der deine Krawatten bewundert - verdammt, du tust mir leid." Natürlich wusste ich genau, was los war. So gern jeder von uns seinen Job tat - ohne den anderen machte es nur halb soviel Spaß. Mit den Jahren hatten wir ähnliche innere Drähte entwickelt, wie sie Zwillingen nachgesagt werden. Ich musste mir auch immer in den Hintern treten, wenn Milo seinen Jahresurlaub antrat.
Wir tranken unser Bier, wir plauderten über Mr. President, der seine erotischen Abenteuer vor dem Fernsehvolk ausbreiten musste, wir gratulierten uns zu unserem Single-Status, und ich schwärmte ein bisschen von Bali. Obwohl ich die Insel bisher nur aus den Prospekten des Reisebüros und einem halben Dutzend Reiseführer kannte, die ich in den letzten Wochen gewälzt hatte.
Der North Star Pub füllte sich, eine dichte Klangwolke aus Stimmen, Gläserklirren und Musik vibrierte über unseren Köpfen. Ich hatte gerade die zweite Runde Budweiser bestellt, als das Handy in der Brusttasche meines Sommerhemdes losjammerte.
Ein Männerstimme meldete sich. Undeutlich und von der Geräuschkulisse in der Bar überlagert. Ich begriff nur, dass es nicht der Chef sein konnte.
"Ich versteh' Sie nicht", rief ich und rutschte vom Barhocker. "Moment, ich geh mal eben vor die Tür!" Schon in der Eingangsschleuse ebbte der Lärm ab und mit der zufallenden Tür verstummte er ganz. "So, jetzt - Trevellian hier, mit wem spreche ich denn?"
"Mulberry. Hi, Jesse."
Die Stimme klang vertraut und doch fremd. Ich spürte förmlich, wie sie durch meine Hirnwindungen rauschte. Mulberry, Mulberry ... Dutzende von Gesichtern flimmerten über meine innere Bühne und verschwanden wieder in den dunklen Höhlen meines Gedächtnisses. Bis ein Gesicht schließlich blieb.
"Charly! Ich werd' verrückt! Von dir habe ich ja schon seit hundert Jahren nichts mehr gehört!" Charles Mulberrys Gesicht stand überdeutlich vor mir - sehr weiße Haut, rötliche Sommersprossen, rötliches Borstenhaar, lachende Augen und seine große Raubvogelnase. Den "Habicht" hatten wir ihn in Quantico genannt.
"Hör zu, Jesse - können wir uns treffen?" Er sprach hastig und nicht so laut, wie man eigentlich spricht, wenn man nach Jahren mal wieder einen alten Freund am Telefon hat. "Ich stecke in gottverdammten Schwierigkeiten."
"Was ist los, Charly?" Was er sagte, wie er es sagte - seine ganze Art beunruhigte mich. Das war nicht der alte Charles Mulberry.
"Ich sprech' hier von einer Telefonzelle aus. Die Leute stehen Schlange." Seine Stimme senkte sich noch mehr. "Ich brauch deine Hilfe, Jesse. Können wir uns morgen sehen?"
"Ja. Wo?"
"Kennst du die Schwulenkneipe in SoHo, Wooster Street kurz vor der Kreuzung Grand Street?" Dumpf, fast flüsternd redete er jetzt. Offenbar schirmte er seinen Mund und die Sprechmuschel mit der Hand ab.
"Nein, aber werd' ich schon finden. Wie heißt der Laden?"
">Tower of Song<. Wie wäre es gegen zwölf?"
"Ein Uhr könnte ich besser einrichten."
"Okay. Ich warte auf dich." Die Verbindung brach ab. Nachdenklich ließ ich das Handy in die Brusttasche rutschen und ging zurück in den Pub. Ich hatte jahrelang Zeit gehabt, menschliche Telefonstimmen zu studieren - Charlys hatte geklungen, wie die eines Mannes, der unter Druck steht. Er schien tief in der Tinte zu sitzen.
"Unser Chef?" Neugierig sah Milo mich an.
Ich schüttelte den Kopf. "Charly Mulberry."
"Ich werd' verrückt!" Milo klatschte sich auf die Schenkel. "Der alte Haudegen! Wie geht's ihm denn?"
Ich zuckte mit den Schultern und betrachtete die sich auflösende Schaumkrone meines Biers. "Er klingt ganz so, als wäre es ihm schon besser gegangen."
Milo runzelte die Stirn und wartete schweigend ab, bis ich weitersprechen würde. "Er hat nichts Genaues erzählt, nur dass er in Schwierigkeiten steckt und meine Hilfe bräuchte. Aber was würdest du von einem Mann halten, der dich von einer Telefonzelle aus anruft, dabei hektisch und leise spricht und kaum zu flüstern wagt, wenn er dir einen Treffpunkt vorschlägt?"
"Wenn du eine Frau wärst, würde ich sagen, er will einen Seitensprung verbergen."
Ann, Charlys Frau, fiel mir ein. Nach der Hochzeit, bei der ich Trauzeuge war, hatte ich zwei, drei Jahre lang einen ziemlich guten Kontakt zu den beiden gehabt. Nachdem Charly das FBI verlassen hatte, hatte ich Ann nur noch zweimal gesehen. Das letzte Mal vor drei Jahren.
"Ich bin aber keine Frau, und Charly ist ein ehemaliger G-Man", sagte ich. "Und zwar einer, der sich selbst vom Teufel zu einem Drink einladen lassen würde, wenn er dadurch irgendeinen Mobster hinter Gittern bringen könnte."
"Stimmt." Milo stützte sein Kinn in die Faust und starrte nach rechts oben, wo der riesige Ventilator träge über dem Gastraum rotierte. Als würden dort Bilder vergangener Zeiten aufblitzen.
"Ich vergesse nie, wie wir zusammen die Mistkerle über den Tisch zogen, die sich mit einer Handvoll japanischer Geisel auf dem Empire State Building verschanzt hatten. Charly war ohne mit der Wimper zu zucken aus einem Fenster des zweiundachtzigsten Stockwerks gestiegen, um an der Außenfassade aufs Dach hinaufzuklettern."
"Ich entsinn' mich." Mein Bier schmeckte mir nicht mehr. "Er hat einen der Kerle vom Dach geworfen und musste deswegen in Washington beim Office of Professional Responsibility antanzen."
"Dort hat er bald mehr Zeit verbracht als in der Federal Plaza." Milo seufzte und zog eine Schachtel Camel ohne Filter aus der Jackentasche. "Später war Timothy Harding eine Zeit lang sein Partner. Genauso ein Verrückter wie er."
"Schade, dass die beiden sich mit den Wadenbeißern vom OPR angelegt haben." Fast reflektorisch griff ich zu der Zigarette, die Milo mir anbot. "Aber sie waren einfach unverbesserliche Heißsporne. Die Firma zu verlassen war vielleicht das Vernünftigste, was sie tun konnten damals."
"Hat Charly eigentlich Kinder?"
"Zwei", sagte ich. "Als ich ihn das letzte Mal sah, hat er mir Bilder gezeigt. >Die trage ich deswegen immer bei mir, damit ich nicht vergesse, wie sie aussehen<, hatte er damals gesagt. Sein Job hat ihn elend beansprucht."
"Er hat's als Privatdetektiv versucht, stimmt's?" Milo gab mir Feuer.
"Irgend so was." Der Rauch meiner Zigarette sammelte sich in der Holzverschalung des Strahlers über der Theke.
"Und Harding? Hast du von dem mal wieder was gehört?"
"Ich glaube, der hat sich in Harlem als Privatbulle engagieren lassen. Von irgendeiner schwarzen Bürgerinitiative, die ihre Kids vor den Jugendgangs schützen wollten." Ich drückte die halb gerauchte Zigarette aus. Das Gespräch mit Charly hatte mich nervös gemacht.
"Nimm mich mit morgen, Jesse." Milos Stimme klang plötzlich kühl und energisch. "Nicht, dass es eine Falle ist."
3
"Genau dort muss es hängen!" Nelson O'Dewly fuchtelte mit beiden Armen. Seine massige Gestalt füllte den Eingang zu dem Holzhaus fast vollständig aus. "Augenblick, Marilyn!" Er walzte zu dem Tisch in der Mitte des Raumes und griff nach den zurechtgelegten Werkzeugen. Mit Hammer und Nagel in den Händen ging er zu seiner Tochter.
Marilyn nahm den Rahmen mit dem Dokument von der Holzwand und sah zu, wie ihr Vater den Nagel einschlug. Keine Minute später hing die Kopie des Grundbuchauszugs an der Wand.
"Ich hab's geschafft, Angel. Das Land gehört mir." O'Dewly war zwei Schritte zurückgetreten. Fast ehrfürchtig betrachtete er das gerahmte Dokument. "Man muss sein Ziel kennen. Man muss dort ankommen wollen. Und irgendwann ist man da. Es gibt nichts, was man nicht erreichen kann."
Ein zufriedenes Lächeln legte sich auf sein braun gebranntes und von zahllosen feinen Falten zerfurchtes Gesicht. Er fuhr sich mit der Rechten durch seine üppige Mähne, die schon seit Jahren schlohweiß war, obwohl Nelson O'Dewly erst vor wenigen Wochen seinen fünfundfünfzigsten Geburtstag gefeiert hatte. In einem merkwürdigen Kontrast zu diesem Zeichen vorzeitiger Alterung standen seine dunkelblauen Augen - die funkelnden, lachenden Augen eines Jugendlichen.
Wie meistens trug er eine weite Hose aus dünnem, grünem Baumwollstoff und darüber ein weißes Leinenhemd, das bis zum Brustbein offen stand. Das drahtige Gestrüpp auf seiner Brust war eigenartigerweise noch fast schwarz.
Marilyn fiel dem großen, breitschultrigen Mann um den Hals. "Ich wusste, dass du es schaffst, Dad." Er drückte sie an seine Brust und küsste sie zärtlich.
Arm in Arm traten sie auf die Veranda der Pfahlhütte. Feuchtheiß war die Luft, und kein Windhauch bewegte die Laubfirste der Regenwaldriesen. Die meisten Bewohner der Ufersiedlung lagen dösend in ihren Hütten, und die traumhafte Stille des Mittags ruhte flimmernd auf der Siedlung.
Von allen Behausungen der Ufersiedlung lag Nelson O'Dewlys Pfahlhütte dem Fluss am nächsten. Nur einen Steinwurf entfernt von der Veranda schob sich eine weiße, von vielen Füßen aufgepflügte und von nur wenigen dunkelgrünen Büschen bestandenen Landzunge in die fast hellblauen Fluten des Rio Jatapu. Nur in der Karibik und unten, am Rio Tapajós hatte Nelson Wasser von ähnlicher Färbung gesehen.
Einige Kinder tummelten sich an dem zauberhaften Flussstrand.
"Das gehört nun dir", seufzte Marilyn.
"Uns", korrigierte Nelson. "Uns gehört es - dir und mir, den Indios und unseren landlosen Freunden."
Er betrachtete das tief braune Profil seiner Tochter - die hochstehenden Wangenknochen, der gerade Nasenrücken, die leicht vorgeschobene Kinnpartie unter dem großen Mund: Das Profil einer energischen Frau, die gewohnt war, unter allen Umständen das zu tun, was sie sich in den Kopf gesetzt hatte.
Seit vor dreizehn Jahren ihre Mutter bei einer Expedition auf dem Rio Negro ertrunken war, zählte Nelson seine inzwischen achtundzwanzigjährige Tochter zu seinen engsten Vertrauten.
Sie wandte ihm ihre großen, braunen Augen zu. Einige Sekunden lang sahen sie sich an. Marilyn wusste, was ihr Vater dachte. Und er ahnte, was hinter ihrer hohen Stirn vor sich ging. "Du weißt, dass ich nicht hier bleiben kann, Dad. Jedenfalls jetzt noch nicht. Ich will so bald wie möglich zurück nach Kalifornien und meine Doktorarbeit abschließen. Und was danach kommt ..." Sie zuckte mit den Schultern und stützte sich auf das Geländer der Holzterrasse.
"Du bist genauso ehrgeizig, wie deine Mutter es war." Nelson versenkte seine kräftigen Hände in den Hosentaschen. Breitbeinig stand er da und betrachtete ihre schwarzbraunen Schultern und ihren kerzengeraden Rücken. "Und genauso eigensinnig." Seine Miene nahm einen resignierten, wehmütigen Zug an. "Bleib wenigstens noch so lange, bis unsere Freunde aus Rio hier ankommen. Dann werde ich dein Organisationstalent benötigen."
"Versprochen." Marilyn drehte sich zu ihm um. Ihre Lippen gaben ihre perlenweißen Zähne frei als sie ihn anstrahlte. Nelson wusste, dass er auf sie bauen konnte.
Am Abend trafen sie sich auf dem Sandplatz, um den sich die etwa zwanzig Hütten der kleinen Flusssiedlung gruppierten. Eine Art Marktplatz, auf dem man sich zum Essen, zu Festen und zu Beratungen traf.
Ein paar Indios hatten einige Meilen flussabwärts einen fast hundert Pfund schweren Pirarucú aus dem Wasser gezogen. Ihre Frauen zerlegen den großen Fisch und grillten das Fleisch über drei Lagerfeuern. Nelson ließ einen der Bierkästen aus seiner Hütte holen, die das Versorgungsschiff aus Manaus letzte Woche gebrachte hatte.
Nach dem Essen setzte er sich in die Mitte des Platzes. Die anderen versammelten sich um ihn. Etwa vierzig Menschen - Indios aus dem Tembé-Stamm, die sich auf der Flucht vor Brandrodungen in diese Gegend zurückgezogen hatten, ehemalige Kautschukarbeiter mit ihren Familien, einige sehr junge Männer und Frauen, die den Slums in Belém, Salvador oder Rio de Janeiro entflohen waren, und andere entwurzelte Menschen.
Natürlich waren auch zwei US-Amerikaner dabei, die Nelson als eine Art Guru betrachteten, und schließlich ein knapp dreißigjähriger Franzose. Er war ähnlich wie Nelson aus ethnologischem Interesse in das Amazonasbecken gekommen und hier hängen geblieben.
Sie alle sahen Nelson mit erwartungsvollen Mienen an. "8. September", begann er. "Kreuzt euch diesen Tag in euren Kalendern an: Die Besitzurkunde ist heute gekommen", sagte er laut. "Das Land gehört jetzt endgültig uns."
Ein Jubelschrei wie aus einer Kehle schallte in den Wald hinein und über den Fluss. Und während ein Papageienschwarm krächzend aufflatterte und einige Wasserschweine sich erschrocken aus der Uferböschung in die Fluten stürzten, fielen sich die so unterschiedlichen Menschen um den Hals und klopften sich gegenseitig auf die Schultern.
Anschließend wurde Nelson und seine Tochter am Waldrand entlang um die Siedlung getragen und lautstark gefeiert. Danach begann eine feuchte und ausgelassene Nacht.
Nelson war einer der Ersten, der irgendwann gegen Morgen die Holzsprossen zu seiner Pfahlhütte hinaufkletterte. Mit der Taschenlampe beleuchtete er das gerahmte Stück Papier an der Wand seiner Hütte.
Vor etwa zwölf Jahren, kurz nach dem Tod seiner Frau, hatte er davon zu träumen begonnen, einmal ein Stück Land in diesem letzten Paradies der Erde kaufen zu können. Das vom Lichtstrahl seiner Stablampe erhellte Dokument an der Wand war der letzte sichtbare Beweis für die Erfüllung seines Traumes.
"Wähle, was du willst, und wenn du es nur leidenschaftlich genug willst, wirst du es bekommen", murmelte er und genoss das Glücksgefühl, das ihm durch den Brustkorb perlte.
Und dann trat er an die Wand heran und küsste die Besitzurkunde.
Nicht mehr lange, und er würde sie verfluchen.
4
"Bewegung, zum Teufel! Du sollst dich bewegen!" Der kleine schwarze Mann sprang wieselflink um die beiden Boxer herum und brüllte seine Anweisungen heraus. "Wenn du dastehst, wie eine in den Boden gerammte Zielscheibe bist du nach spätestens zwei Runden k.o.!"
Der Angesprochene, einer von zwei Jugendlichen mit Helmen und Boxhandschuhen, begann hin und her zu tänzeln. "Locker, locker nicht so steif!"
Etwa zwanzig Schritte vom Ring entfernt öffnete sich der rechte Türflügel. Ein Mann steckte seinen Kopf in die Halle und rief: "Tim! Telefon!"
Seine Stimme wurde überlagert von keuchenden Stimmen, auf den Holzboden knallenden Schuhsohlen und auf Sandsäcke klatschenden Boxhandschuhen. Gut zwanzig junge Männer trainierten in der Halle, alle schwarzhäutig wie der Mann, der nun an der Hallentür stand und zum Ring hinüberschaute.
"Harding!", brüllte er. Endlich wurde er von dem Boxtrainer wahrgenommen. "Da ist jemand am Telefon für dich! Ich glaub', es ist ein Ferngespräch!"
Einige der schweißglänzenden, schwarzen Jungen unterbrachen ihre Kämpfe und ihr Sandsacktraining. Die älteren vor allem. Sie beobachteten, wie der kleine drahtige Mann sich unter die Seile hindurchbückte und vom Podest des Ringes sprang. Ihre Blicke begleiteten ihn quer durch die Halle hindurch, bis er hinter dem Türflügel am Halleneingang verschwand.
Sie warfen sich verstohlene Blicke zu. Das letzte Mal hatte man den beliebten Trainer vor etwas mehr als einem Jahr zu einem Ferngespräch ans Telefon gerufen. Damals war es auch mitten im Training gewesen. Und danach musste sich der Boxclub für fast vier Monate einen Ersatztrainer suchen.
"Harding?"
Die Männerstimme am anderen Ende sprach ein schwerfälliges Englisch. "Hier ist die >PEC<, Kapstadt. Wir haben ein Projekt reinbekommen."
"Was für ein Projekt?"
Die Männerstimme erklärte ihm das Projekt. "Wir dachten an Sie als stellvertretenden Leiter."
"Und wer ist der Boss?"
"Ein alter Bekannter von Ihnen." Die Männerstimme nannte den Namen, und Timothy Hardings Gesicht verzog sich zu einem Grinsen.
"Also gut, ich bin dabei."
"Wir senden Ihnen die Vertragsunterlagen zu. Wir können Ihnen 900 US-Dollar pro Tag bezahlen."
"Das lässt sich hören."
"Haben Sie Personalvorschläge?"
"Auf jeden Fall Cooper und Leclerc. Fritz wär' auch nicht verkehrt."
"Gut. Wir werden das prüfen."
Harding legte auf und trat aus dem Umkleideraum, wo das Wandtelefon hing, hinaus auf den Gang. Gedankenverloren starrte er auf die Bürotür des Clubdirektors. Und zu der zweiflügeligen Hallentür. Die trainierenden Jungens veranstalteten einen Höllenlärm.
Ein wehmütiger Zug legte sich auf sein etwa fünfunddreißig Jahre altes Gesicht, während er den vertrauten Geräuschen lauschte. Er würde die Burschen vermissen. Und sie ihn auch.
Er gab sich einen Ruck und klopfte an die Tür des Direktors.
"Herein!" Harding öffnete die Tür. Der skeptische Blick des anderen traf ihn. "Du brauchst mir gar nichts sagen - schätze wir brauchen eine Zeit lang einen Ersatz für dich."
"Korrekt."
"Wie lange?"
"Ein paar Wochen."
5
Ich wunderte mich über die vielen Gäste, die um diese Zeit schon in das Bistro an der Wooster Street strömten. Vor allem Männer, und die meisten zwischen fünfundzwanzig und fünfzig Jahre alt. Offenbar nutzten viele der Angestellten hier in der Gegend ihre Mittagspausen, um im >Tower of Song< einen Imbiss zu nehmen.
Das Kartoffelgratin, das vor mir in einer flachen weißen Schüssel dampfte, lieferte mir die Erklärung: Die Kneipe reizte nicht nur durch ihr lockeres, unaufdringliches Ambiente, sondern schien einen ausgesprochen fähigen Koch in der Küche stehen zu haben.
Milo saß an der Theke und ließ sich ein Steak schmecken. Wir hatten vereinbart, uns nicht zusammen an einem Tisch sehen zu lassen. So wie Charly am Telefon drauf gewesen war, hätte er empfindlich darauf reagieren können. Wenn er erst mal neben mir Platz genommen hatte, würde ich ihm Milos Anwesenheit immer noch erklären können.
Aber er nahm nicht an meinem Tisch Platz. Als ich um viertel nach eins die fast leere Schüssel beiseiteschob und einen Kaffee bestellte, war er immer noch nicht aufgetaucht.
Ich erinnerte mich an unsere gemeinsame Zeit in Quantico. Charly und ich waren damals gemeinsam in die Firma eingestiegen. Mich hatte Milo entdeckt und dafür gesorgt, dass ich einen Ausbildungsplatz auf der Akademie bekomme, und Charly war damals von dem älteren Harding abgeschleppt und für das FBI rekrutiert worden.
Seine Unpünktlichkeit war damals schon sprichwörtlich gewesen. Also dachte ich mir nichts dabei, als er gegen halb zwei immer noch nicht im Eingangsbereich des Bistros auftauchte.
Erst gegen zwei fand ich mich damit ab, dass mein alter Freund mich wohl versetzt hatte. Ich setzte mich zu Milo an die Theke und winkte dem für meinen Geschmack etwas zu freundlichen Kellner mit der Brieftasche.
"Dein alter Kumpel hat seine Schwierigkeiten wohl ohne deine Hilfe gelöst." Milo legte eine Zehndollarnote neben seine Kaffeetasse auf den Tresen. Sein lauernd umherschweifender Blick verriet mir, dass er die These von der Falle noch nicht aufgegeben hatte.
"Möglich." Ich war ein bisschen sauer. Versetzt zu werden, gehörte nicht zu den Dingen, die ich besonders schätzte. Andererseits hatte mich ein ungutes Gefühl beschlichen.
Das ließ mich auch für den Rest des Tages nicht los.
Am Abend lud ich die ganze Mannschaft in >McSorley's Old Ale House< ein. Die Bar in der East Village war die älteste in Manhattan. Ich hatte schon am Vortag einen Tisch bestellt. Ich hatte einfach das Bedürfnis, mich vernünftig von den Jungs zu verabschieden. Immerhin würde ich sie vier Wochen lang nicht sehen.
Ich weiß, dass man in anderen FBI-Büros bei solchen Anlässen so schnell verschwindet und froh ist, bestimmte Gesichter eine Zeit lang nicht ertragen zu müssen. Bei uns in New York City hatten wir ein Ausnahme-Betriebsklima. Und jeder tat sein Bestes, um es zu pflegen.
"Gib's zu - du willst, dass wir dich in guter Erinnerung behalten, falls du dich entschließt in Bali zu bleiben!", scherzte Jay Kronburg.
"Nein - ich will dich grinsend in Erinnerung behalten!", sagte ich. "Und da deine Laune erst gegen Abend in Schwung kommt, blieb mir nichts anderes übrig, als dich zum Abschied hierher einzuladen ..."
Wir ließen uns irisches Bier schmecken und hatten eine Menge Spaß. Gegen Mitternacht gelang es Milo und Orry, zwei zauberhafte Ladys an unseren Tisch zu locken. Und kurz darauf das lästige Vibrieren in meiner Hemdtasche - mein Handy.
"Trevellian?"
"New York City Police, Detective Anderson." Ich kannte weder die Stimme noch den Namen. Im Hintergrund hörte ich den Verkehrslärm irgendeines Highways rauschen.
"Was gibt's denn?"
"Sie sind Jesse Trevellian?" Er nannte meine Adresse und Telefonnummer.
"Korrekt, Detective, der bin ich. Was hab' ich schon wieder verbrochen?"
"Wir haben ihre Karte gefunden. Bei einer Leiche."
Das Stimmengewirr in >McSorley's Old Ale House< trat schlagartig in den Hintergrund. Die Gesichter der Kollegen und der beiden Frauen verschwammen. Ich wandte mich ab und presste das Handy ans Ohr. "Wie heißt er?"
"Woher wissen Sie, dass es ein Mann ist?"
Ich fühlte, wie meine Mund trocken wurde. "Wie heißt er?!"
"Mulberry. Charles Mulberry ..."
6
Armanda Mirellas tat so, als würde sie konzentriert die Personalien der Formulare vor ihr auf dem Schreibtisch in die Datenbank ihres PCs eingeben. In Wahrheit lauschte sie konzentriert dem Telefonat, das ihr Chef führte.
Sie hatte genau beobachtet, wie er sich ruckartig von der Sessellehne seines ledernen Bürostuhls abgestoßen und seine gedrungene Gestalt sich gestrafft hatte. Ihr entging nicht, dass die Knöchel der Finger, mit denen er den Telefonhörer umklammert hielt, plötzlich hervortraten, und auch dass die weiße Haut seines Vollmondgesichtes auf einmal eine gelblich Färbung annahm, registrierte sie aufmerksam.
"Ich denke, wir vergessen dieses Gespräch sehr schnell wieder Senhor Moreno. Das möchte ich Ihnen jedenfalls dringend empfehlen", hörte Armanda ihren Chef sagen, und seine Stimme klang merkwürdig gepresst.
"… wenn Sie Unregelmäßigkeiten im Geschäftsgebaren ihres Partners vermuten, sollten Sie nicht uns, sondern Ihre Anwälte konsultieren, Senhor Moreno. Meines Wissens verfügt doch Ihr Vater über ein ganzes Heer solcher Spezialisten ..."
Armanda Mirellas bemerkte sehr wohl den zynischen Unterton in der Stimme ihres Chefs. Eine für Lutzenbergers Verhältnisse geradezu heftige Gefühlsäußerung, denn der deutschstämmige Leiter des Grundbuchamtes in Brasilia war bekannt für seine stoische, sachliche Denk- und Verhaltensweise. Paragraphen und Verwaltungsrichtlinien waren das Einzige, was diesen Mann bewegten und sein Handeln bestimmten. Armanda hatte ihn noch nie ärgerlich oder erregt erlebt, sie hatte ihn noch nie über einen Witz lachen gehört.
"… bitte verstehen Sie mich richtig, Senhor Moreno - wir sind eine Behörde, wir verwalten rechtlich vollzogene Tatbestände, und das Dokument, von dem Sie sprechen, ist gewissermaßen der Endpunkt eines privat- und verwaltungsrechtlichen Aktes. Wenn Sie es also anfechten wollen ..."
Plötzlich verstummte Lutzenberger und starrte den Telefonhörer an. Offensichtlich hatte sein Gesprächspartner ohne Vorwarnung aufgelegt. Beflissen tippte Armanda die Daten in ihren PC.
Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie Lutzenberger zum Fenster ging und minutenlang hinaussah. Dabei hielt er die Hände auf dem Rücken verschränkt und wippte von Zeit zu Zeit auf den Schuhspitzen.
Irgendwann setzte er sich wieder und wandte sich an seine Stellvertreterin. "Das war der Sohn von Carlos Maria Moreno. Sein Vater behauptet, er habe einem Betrüger ein Stück Land verkauft und verlangt von uns die Besitzurkunde nicht ins Grundbuch einzufügen."
Armanda kannte den Namen Carlos Maria Moreno. Er gehörte zu einer Vereinigung von politisch weit rechts stehenden Großgrundbesitzern, die alles taten, um die Landreform des Präsidenten zu blockieren.
"Wir sollten zusehen, dass wir das Dokument noch morgen dem Grundbuch zufügen." Lutzenberger sprach wieder in seiner gewohnt monotonen, fast gleichgültig wirkenden Stimmlage. "Und ich werde eine offizielle Aktennotiz über diesen Anruf anfertigen und eine Kopie davon an die Regierung senden."
Eine halbe Stunde später verabschiedete er sich. Wie immer, ohne Armanda dabei anzusehen. Armanda trat ans Fenster und sah ihn über den Parkplatz laufen und in seinen Volvo steigen. Erst als sein Wagen das Gelände der Behörde verlassen hatte, ging sie zurück zu ihrem Schreibtisch und griff zum Telefon.
Die Organisation der Großgrundbesitzer verfügte über ein zentrales Büro in der Hauptstadt. Dort erfuhr sie die Nummer Morenos in Rio de Janeiro. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis sie Julio Moreno am Apparat hatte. Aber wenn es darum ging, sich etwas hinzuzuverdienen, konnte Armanda erstaunlich hartnäckig sein.
Sie berichtete dem Sohn des Großgrundbesitzers von dem kurzen Gespräch mit ihrem Chef. "Er wird die Regierung informieren und das Dokument vorläufig unter den noch zu bearbeitenden Vorgängen auf seinem Schreibtisch behalten."
"Sie haben Zugang zu dem Dokument?", wollte Julio Moreno wissen.
"Ja."
"Auch zu den anderen Akten?"
"Auch dazu."
Es verschlug Armanda für einen Moment die Sprache, als der Mann ihr zehntausend US-Dollar bot. Sie atmete tief durch und stieß krächzend ihr >Ja< aus.
Am nächsten Morgen erschien Lutzenberger nicht zum Dienst. Armanda steckte sämtliche Akten, die den Verkauf eines großen Landstückes am Rio Jatapu dokumentierten in ein wattiertes Kuvert, das sie in der Mittagspause persönlich zu Post brachte. Adressiert an Carlos Maria Moreno in Rio de Janeiro.
Am Nachmittag verbreitete sich die Nachricht vom plötzlichen Tod des Amtsleiters wie ein Lauffeuer in der Verwaltungsbehörde aus - Lutzenberger war mit seinem Volvo unter merkwürdigen Umständen von der Straße abgekommen und eine Schlucht heruntergestürzt.
Am Abend rief Armanda in Lutzenbergers Villa an, um seiner Frau ihr tiefstes Bedauern über den schweren Verlust zum Ausdruck zu bringen ...
7
Grelles Licht leuchtete Büsche, Bäume und Rasen aus. Die Kollegen von der New York City Police hatten Scheinwerfer aufgestellt. Obwohl es lange nach Mitternacht war, drängten sich Schaulustige und Reporter vor dem gelben Absperrband. Keine zehn Schritte von uns rauschte der Verkehr über den Henry Hudson Parkway.
Anderson hob die Plastikplane. Die Gesichtshaut war auf der linken Hälfte bis hinauf zum Scheitel abgeledert. Sommersprossen und Schrammen übersäten die rechte Seite dessen, was einmal Charly Mulberrys Raubvogelgesicht gewesen war.
"Er ist es", murmelte ich. Milo nickte, und der Detective ließ die Plane wieder auf die Leiche sinken.
"Sie haben ihm drei Kugeln verpasst und dann bei hoher Geschwindigkeit aus einem Wagen geworfen." Er machte eine Kopfbewegung hinüber zum Hudson Parkway.
"Was sagt der Pathologe über den Todeszeitpunkt?" Milo trat aus dem Bereich des grellen Scheinwerferlichtes. Wir folgten ihm.
"Zwei bis vier Stunden." Anderson kramte eine Schachtel Marlboro aus seiner Jackentasche. Ich griff zu, als er uns die Schachtel hinhielt.
"Dann hatten sie ihn gut zehn Stunden lang in ihrer Gewalt." Ich beugte mich über die kleine Flamme aus Andersons Feuerzeug. Offenbar war er ein sparsamer Mensch. Ich richtete mich auf und blies den Rauch in die Dunkelheit. Die Augen des Detectives hingen fragend an meinen. "Ich war um eins mit ihm verabredet", beantwortete ich seine unausgesprochene Frage. "Ein Uhr Mittags. Er kam nicht. Daraus schließe ich, dass sie sich um diese Zeit schon mit ihm befasst haben."
Ich erzählte von seinem Anruf, und was ich sonst von Charly wusste.
Anderson schrieb sorgfältig mit und fragte hier und da nach. Besonders über Charlys Vergangenheit beim FBI wollte er einiges wissen. Dann klappte er sein Notizbuch zu und angelte sich die nächste Zigarette. "Tja", brummte er und zündete sich seine Zigarette an. "Wenn Sie ihn so gut kannten, Trevellian ...", er unterbrach sich und sah zu den beiden Kollegen, die sich eben anschickten Charlys zerschundenen Körper in einen Leichensack zu legen.
"… wenn Sie ihn so gut kannten - wir wär's, wenn Sie dann seine Frau informieren?"
Für einen Moment spürte ich den heißen Wunsch, Anderson seine Zigarette verkehrt herum in den Mund zu stopfen. Doch dann dachte ich an Ann, und machte mir klar, dass ich es Charly vielleicht sogar schuldig war, seiner Frau die Hiobsbotschaft zu überbringen.
Ich nickte. Grußlos wandte ich mich ab und ging zurück zu meinem Sportwagen. "Vielleicht können Sie Anfang der Woche mal auf dem Revier vorbeikommen und ihre Aussage unterschreiben!", rief Anderson mir nach. Ich winkte zur Bestätigung. Ohne mich noch einmal umzusehen.
Milo ließ sich neben mir auf den Beifahrersitz fallen. "Warum hast du so schnell zugesagt?"
"Weil ich schlechte Nachrichten auch lieber von vertrauten Leuten bekommen würde, wenn ich's mir aussuchen dürfte."
"Stimmt", knurrte Milo. Sein Gurt rastete ins Schloss. Der Motor des Sportwagens sprang donnernd an. "Fahren wir gleich zu ihr?"
Ich nickte und steuerte meinen Wagen vorsichtig durch die Menge der Schaulustigen.
Charly und Ann wohnten am nordwestlichen Rand des zoologischen Gartens in der Bronx. Nach zwanzig Minuten schon hielten wir vor dem kleinen Reihenhaus.
Zähe Sekunden verstrichen, während wir auf der Vortreppe standen und den Klingelknopf anstarrten. Milo steckte seine Hände demonstrativ in die Hosentaschen. Endlich drückte ich auf den Knopf. Ich zuckte zusammen, als das Glockenspiel hinter der Haustür ertönte.
Sofort flammte hinter einem der Fenster Licht auf, und Sekunden später wurde die Tür aufgezogen. Ann sah mich schweigend an. Und ich sah sie schweigend an. "Jesse ...", flüsterte sie.
"Wir haben schlechte Nachrichten für dich, Ann."
Sie atmete tief durch. "Charly ist tot ..."
"Ja ..."
Sie schloss die Augen, weiter nichts. So stand sie da. Ich betrachtete ihr weiches Gesicht und ihr dunkles hochgebundenes Haar. "Sie hat sich nicht verändert", dachte ich. Und: "Komischer Gedanke in dieser Situation."
Immer noch stand sie reglos und mit geschlossenen Augen. Ich merkte, wie ihre Unterlippe zu zittern begann. "Wir bleiben einen Moment bei dir", sagte ich und griff nach ihrer Hand auf der Türklinke.
Wir führten sie in ein dämmrig erleuchtetes Kaminzimmer. Dort zog ich sie auf eine Couch. Sie klammerte sich an mich und ein Weinkrampf schüttelte ihren Körper durch. Ich beglückwünschte Anderson zu seiner Idee, mir die Sache aufzudrücken und streichelte ihr behutsam über den Kopf.
Währenddessen schenkte Milo ihr einen Bourbon ein, kümmerte sich um die Kinder, die vom Klingeln wach geworden waren und telefonierte mit Anns Eltern. Sie wohnten in Brooklyn und versprachen, sich sofort auf den Weg zu machen.
Ann hing einfach an meinem Hals, lehnte ihren Kopf gegen meine Schulter und weinte. "Ich hab's gewusst ... ich hab's gewusst ...", mehr war von ihr nicht zu erfahren.
Nach etwas mehr als einer Stunde tauchten Charlys Schwiegereltern auf.
"Ich komm' morgen vorbei", verabschiedete ich mich von Ann.
Im Wagen kramte Milo seine Camel aus der Tasche. "Ich weiß, dass man in deinem Sportwagen nicht raucht, aber ich rauche jetzt", sagte er barsch.
"Was hast du ihnen erzählt?"
"Wem?"
"Den Kids."
"Dass es ihrem Dad schlecht geht. Mehr wollte mir nicht über die Lippen."
"Vielleicht geht's ihm jetzt gar nicht so schlecht ..."
Milo stieß den Rauch aus. Er wehte gegen die Windschutzscheibe und zerstob dort nach allen Seiten. "Wem werden sie's sagen, wenn es bei uns so weit ist?"
"Wenn's mich erwischt, werden sie's dir zuerst sagen." Ich drehte den Zündschlüssel herum. "Falls du nicht sowieso dabei sein wirst ..."
8
Henry Cooper umklammerte den Joystick und steuerte seine Maschine aus der Direktperspektive durch den Pulk feindlicher Helikopter. Das Fadenkreuz seines Gefechtsstandes huschte über die Angreifer. Vier explodierten, einen fünften traf er immerhin so effektiv, dass er trudelnd der Wasseroberfläche entgegenstürzte. Aus den Boxen rechts und links des Monitors Detonationslärm, Hämmern von Rotoren und Meeresrauschen ...
"Henry, Telefon!" Er fuhr herum. Seine Frau stand in der offenen Tür und streckte ihm das schnurlose Gerät entgegen. Sie hätte ihm nicht sagen müssen, wer am Apparat war - er sah es ihren großen Augen an. Ängstlich verfolgten sie jede seiner Bewegungen, während er sich von seinem Schreibtischsessel erhob und auf sie zuging. Sie sagte es trotzdem. "Kapstadt ist am Apparat."
Henry nahm ihr das Gerät ab. Sie verließ wortlos den Raum und schloss die Tür hinter sich. Die Regeln waren klar und brauchten nicht jedes Mal neu diskutiert zu werden.
"Cooper?" Henry ging zurück zu seinem PC und schaltete den Ton aus.
"Wir haben einen lukrativen Auftrag und bräuchten Ihre Fachkompetenz, Sir."
"Worum geht's?"
Er hörte sich Umfang, voraussichtliche Dauer und Ziel des Auftrages an. "Das klingt realistisch", sagte er dann. "Wie sieht es mit dem Honorar aus?"
"Achthundert Dollar pro Tag, Sir. Zuzüglich Reisekosten und Spesen selbstverständlich."
"Faxen Sie mir die Vertragsformulare."
Er brachte das Telefon zurück in den Flur. Seine Frau stand im Türrahmen der Küche und sah ihn an. Sie war blass.
"Ich fahr' übermorgen für ein paar Tage weg", sagte Cooper. Sie fragte nicht, wohin.
9
Er nahm das Fernglas von den Augen und legte es vorsichtig neben seine Knie auf den Boden des Hochstandes. Den Hirsch konnte er jetzt mit bloßen Augen sehen. Vorsichtig näherte er sich der Lichtung. Alle paar Meter stehen bleibend und nach allen Seiten sichernd.
Claude Leclerc schob das Gewehr über den Rand des Ausgucks und spähte durch das Zielfernrohr. Das Geweih des Zwölfenders erschien im Fadenkreuz. Der kräftigte Bursche steuerte zielstrebig die Stelle an, wo er seit zwei Wochen zu äsen pflegte.
Doch der Rothirsch interessierte Claude nur sekundär, und sein Gewehr war auch nur mit Schrot geladen. Er stellte die Flinte gegen die Blendwand und griff sich erneut seinen Feldstecher. Sorgfältig suchte er die dichten Haselnusssträucher zwischen den Eichen am Rande der Lichtung ab - die Stelle, wo er gestern die Zigarettenkippen entdeckt hatte.
Kippen der gleichen Zigarettenmarke hatte er vor zwei Wochen in dem Waldstück gefunden, in dem ein Reh abgeschossen wurde. Und davor in einem anderen Teil seines Jagdreviers, wo plötzlich eine Bache spurlos verschwunden und Claude nichts anderes übrig geblieben war, als ein Dutzend Frischlinge abzuschießen.
Seit Mitternacht hatte er sich hier in dem gut getarnten Hochstand versteckt und auf die Morgendämmerung gewartet. Er wollte nicht länger Claude Leclerc heißen, wenn er den verdammten Wilderer heute nicht erwischte.
Endlich fing er dünne, sich schnell auflösende Rauchschwaden ein. Sie stiegen aus dem Laubwerk des Haselnussstrauches auf. Etwa hundert Meter von Claudes Versteck entfernt. Er griff sich seine Flinte und spähte durch das Rohr. Deutlich konnte er einen schwarzen Haarschopf im Gestrüpp erkennen. Und darunter eine dunkelgrüne Jacke.
Jetzt trat auch der Hirsch auf die Lichtung. Claude legte an. Er wollte den Prachtburschen demnächst selbst erlegen, also durfte er nicht länger zögern.
Der Schuss zerriss die morgendliche Stille über dem Wald - der Hirsch stob davon, aus dem Haselnussstrauch ein Schrei. Claude bewegte seinen Körper so schnell die Sprossen des Hochstandes herab, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan. Dabei war der Vierzigjährige alles andere als ein Federgewicht.
Rascheln im Unterholz, Stöhnen und das Brechen von Ästen - jemand rollte sich aus dem Haselstrauch und rannte hinkend davon.
"Stehen bleiben!", brüllte Claude. "Sonst kriegst du die nächste Ladung!" Grimmige Freude erfüllte ihn, als er anlegte. Es war schon ein Jahr her, dass er zuletzt auf einen Menschen geschossen hatte. Und er bedauerte es fast, als der hinkende Mann in der dunkelgrünen Armeejacke stehen blieb und die Hände hob.
Fluchend näherte Claude sich ihm. "Du verdammter Bastard! Du hast zum letzten Mal in meinem Wald herumgewildert! Und wenn du auch nur eine Bewegung machst, spick' ich dir dein dämliches Gesicht mit Schrot! Das kannst du mir glauben ...!"
Er war nur noch fünf Schritte hinter dem Mann, als der sich umdrehte. Beide erschraken gleichermaßen. Für Sekunden starrten sie sich nur verblüfft an. Dann nahm der Wilderer seine Rechte herunter und legte die Fingerspitzen der ausgestreckten Hand an seine Wollmütze, um einen militärischen Gruß anzudeuten. "Major Leclerc ...", flüsterte er.
"Verdammt ...", knurrte Claude. Er erkannte den Mann sofort. Vor Jahren hatte er als Offizier der Fremdenlegion in Ostafrika ein Infanterie-Bataillon kommandiert. Dieser Kerl, der dort vor ihm im dampfenden Gestrüpp des Waldbodens stand, war einer seiner Unteroffiziere gewesen. Der beste, den er je hatte.
Claude ließ die Flinte sinken. "Rühren, du Arschloch. Kannst du dich nicht erkundigen, wer die Leute sind, in deren Wäldern du wilderst?"
"Tut mir leid, Monsieur Major ..."
"Wo wohnst du?"
"Avignon ..."
"Auto?"
"Vierhundert Meter von hier ..."
"Schaffst du's, oder habe ich dich so gründlich erwischt, dass ich dich auch noch tragen muss?" Claude sah, dass Hemd und Hose des Mannes in der Hüftgegend feucht dunkle Stellen aufwiesen.
"Ich schaff's allein ..."
"Dann hau ab." Der Mann hinkte davon.
Claude hätte gerne einen Wilderer gefangen genommen und persönlich bei der Gendarmerie abgeliefert. Er wunderte sich selbst, dass er ohne allzu großen Verdruss den Ortsrand seines Heimatortes erreichte. So unverhofft einen alten Mitstreiter zu treffen, hatte seine Stimmung beflügelt.
Er parkte seinen Peugeot vor seinem Stammcafé am Marktplatz. Noch bevor er sein Frühstück ordern konnte, legte der Wirt ihm ein Kuvert auf den Tisch. "Pierre war eben hier und hat das für Sie abgegeben, Monsieur Leclerc." Pierre war Claudes Gutsverwalter.
Er öffnete den Umschlag und zog vier dünne, eng bedruckte Papierbögen heraus. "Na, endlich", murmelte Claude. Sein Herz begann zu klopfen, und seine Laune hob sich noch weiter.
Es war ein umfangreiches Fax aus Kapstadt. Drei Seiten Vertragsformular und eine Seite Information. Gierig verschlang er Wort für Wort des Anschreibens. Sogar den Flug hatten sie schon gebucht. Morgen Abend, von Lyon aus über Paris, London und Mexico City.
"Warum nicht", murmelte Claude. "Bring mir als Erstes ein Glas Champagner!", rief er dem Wirt zu ...
10
Ich besuchte Ann zwei Tage nach dem Mord an ihrem Mann. Es war ein strahlender Sonntagvormittag. Der Spätsommer hatte sein mildes Licht über die aufgeräumt wirkende Wohnsiedlung am Rande des Zoos geworfen.
Kids tobten auf der Straße herum, Jugendliche rasten mit ihren Inlinern über die Bürgersteige, und in den Vorgärten der Nachbargrundstücke saßen die Menschen beim verspäteten Frühstück um ihre Gartentische. Und ich hatte weiche Knie und einen trockenen Kloß im Hals, als ich vor Anns Tür stand und den Klingelknopf drückte.
Eine Stunde zuvor hatte ich mich telefonisch bei ihr angemeldet, und sie öffnete sofort. Sie trug ein eng anliegendes, schwarzes Kleid und hatte das dunkle Haar zu einem straffen Knoten im Nacken zusammengebunden. Schwarze Ringe lagen unter ihren rot geweinten Augen, ihr Gesicht wirkte eingefallen und blassgelb.
"Komm herein, Jesse", sagte sie heiser und führte mich ins Wohnzimmer. Es war still im Haus und ich vermutete, dass die beiden Kids mit ihren Großeltern nach Brooklyn mitgefahren waren.
"Kaffee?" Ich nickte. Ann stellte eine Tasse mit dampfenden Kaffee vor mich hin und ein Tablett mit Zucker, Milch und ein paar Biskuits.
Wortlos hielt sie mir eine Schachtel West hin. Ich lehnte ab. "Ich bin froh, dass du gekommen bist, Jesse", sagte sie, während sie sich die Zigarette anzündete. Ich bemerkte, dass ihre Hände zitterten.
"Die Polizei hat keine Spur, aber Charly hat in letzter Zeit ein paar Fälle bearbeitet, die er Loch-im-Kopf-Aufträge nannte." Sie sprach mit monotoner Stimme und langsamer als ich es in Erinnerung hatte. Wahrscheinlich hatte ihr Hausarzt ihr ein Beruhigungsmittel verschrieben.
"Hat er die letzten Jahre als Privatdetektiv gearbeitet?"
"Seit dem vorletzten Jahr nur noch sporadisch. Er verreiste dafür öfter mal. Manchmal für Wochen. Einmal sogar für drei Monate."
"Und was tat er in dieser Zeit?"
"Ich weiß es wirklich nicht, Jesse." Sie zuckte mit den Schultern und schnippte einen langen Aschenkegel in den Aschenbecher. "Es kam immer eine Menge Geld herein, und ich habe nie nachgefragt. Das war unser Deal."
"Du musst doch wissen, wo er in diesen Wochen steckte?", wunderte ich mich.
"Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass seine Briefe aus Liberia, Südafrika oder Bosnien kamen."
"Freitagnacht hast du immer wieder gerufen: >Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst ...<" Fragend sah ich sie an.
"Charly war ungewöhnlich nervös in den letzten beiden Wochen. Etwas musste ihn schrecklich belastet haben. Manchmal, wenn ich nachts aufwachte, war das Bett neben mir leer. Ich fand ihn dann rauchend vor seinem Laptop."
"Die Loch-im-Kopf-Aufträge?"
"Ich glaube nicht." Sie schüttelte heftig den Kopf. "Du weißt doch wie er war - er kannte keine Angst. Ich hatte das Gefühl, er würde mit sich selbst kämpfen, als würde sein Gewissen ihn quälen. Er hatte angekündigt, bald verreisen zu müssen."
Sie wandte sich um und blickte auf den Kalender hinter sich neben dem Türrahmen. "Genau heute wollte er fliegen, am 8. September. Nach Südamerika."
"Diesmal hat er dir also verraten, wohin es gehen sollte?"
Sie schüttelte den Kopf. "Nein. Aber als ich eines Nachts in sein Arbeitszimmer kam, sah ich, dass er eine Karte auf sein Laptop geladen hatte. Eine Karte von Südamerika."
"Hast du der Polizei davon erzählt?"
"Natürlich. Sie haben die Festplatte auf einen Streamer gezogen. Aber der Detective, dieser Anderson, hat mir keine Hoffnung gemacht. Bis nach Südamerika reiche der Arm der New York City Police nicht."
Sie drückte ihre Zigarette aus und sah mich flehend an. "Wenn er noch Beamter wäre, würde sich das FBI um den Fall kümmern. Du würdest seinen Mörder finden, Jesse, das weiß ich genau. Du und Milo." Immer noch klebten ihre Augen an meinen, und immer noch dieser bittende Ausdruck darin.
"Kann ich das Notebook sehen?"
Schweigend stand sie auf. Mit einer Handbewegung bedeutete sie mir, ihr zu folgen. Ich stieg hinter ihr eine Wendeltreppe hoch, die sich über ein Obergeschoss bis zum Dachboden hinauf wand. Dort öffnete Ann eine Tür aus hellem Kiefernholz.
Das Dachgeschoss war vollständig ausgebaut. Ich betrat das große Arbeitszimmer von Charly Mulberry. Ein klammes Gefühl beschlich mich, als ich den mit unzähligen Papieren, Magazinen und Büchern beladenen Schreibtisch betrachtete, und den Drehstuhl, auf dem Charly vor nicht viel mehr als fünfzig Stunden noch gesessen haben mochte.
Zwischen hunderten von Büchern entdeckte ich in den Regalen allerhand exotischen Kram, der mir eher in das Kaminzimmer eines Forschungsreisenden zu passen schien, als in das Büro eines Privatdetektivs. Oder was Charly sonst noch gewesen sein mochte, um die Dollars nach Hause zu bringen.
Während Ann das Laptop aufklappte und den PC hochfuhr, ging ich staunend an der langen Regalwand entlang. Ein Raubtiergebiss, das einmal einem Geparden gehört haben konnte, lag neben einem kleinen Dolch, dessen Griff mit bunten Vogelfedern geschmückt war. Dann ein ausgestopfter weißer Kakadu, zwei steinerne Speerspitzen und in der Ecke zwischen zwei Regalen ein halbes Dutzend fast mannshohe Pfeile aus Schilfrohr.
Vasen, Schalen und anderes afrikanisches Kunsthandwerk, zwei angeschliffene Drusen, Kopulierende Paare aus Ebenholz, eine volle Flasche Slibowitz, eine Offiziersmütze, dessen Schildemblem das Wappen eines ostafrikanischen Landes trug, und schließlich das Foto eines völlig zertrümmerten Gebäudes. Mitten in der Ruine ein Mann, der Geige spielte.
>Die zerstörte Nationalbibliothek von Sarajewo< stand auf dem Passepartout des gerahmten Fotos, und davor lag ein angekohltes Buch. Ich nahm es vom Regal und schlug es auf. Immerhin erkannte ich, dass es sich wohl um kyrillische Schriftzeichen handelte.
"Eine indiskrete Frage, Ann - ich behalte deine Antwort auch für mich." Ich legte das Buch wieder zurück zu dem Foto. "Wie viel Geld hat Charly mit diesen Reisen gemacht?"
"Viel Geld. Sehr viel. Was glaubst du, wovon wir dieses Haus gekauft haben? Es ist schuldenfrei." Sie drehte sich zu mir um. Hinter ihr auf dem Schreibtisch flimmerte die Windowsoberfläche auf dem Display des Notebooks. "Als er damals drei Monate unterwegs war, fand ich hinterher knapp hundertfünfzigtausend Dollar auf unserem Konto."
Ich zeigte mein Erstaunen nicht, sondern setzte mich vor das Notebook - ein High-End-Gerät von Toshiba, das gut und gern seine achttausend Dollar wert war.
"Ich komme nicht in den Explorer, ohne das Passwort."
"Ich kenne es nicht", sagte Ann.
Die Kollegen von der City-Police würden irgendeinen Spezialisten vor den Computer gesetzt haben, der ihnen das Passwort inzwischen sicher schon ausgeknobelt hatte. Ich war kein solcher Spezialist. Aber ich kannte einen: Meinen smarten Kollegen Medina.
"Würdest du mir das Gerät für ein, zwei Tage leihen?"
"Natürlich." Ich schaltete es aus und klappte es zusammen. Mein Blick fiel auf ein dickes Buch, das auf dem Chaos des Schreibtischs lag. >Countdown am Amazonas< lautete der Titel. Ich nahm es auf und betrachtete das Cover - ein Farbbild mit einem dschungelartigen Flussufer. Im Wasser ein braunhäutiger Indio. Über seinem Kopf umklammerte er mit beiden Händen einen Speer und zielte auf die Wasseroberfläche.
Ein Papierbogen ragte aus dem Buch. Ich zog ihn heraus und entfaltete ihn. Ein Farbausdruck. Das Foto eines Weißen: Braun gebranntes, zerfurchtes Gesicht, unglaublich junge, blaue Augen, weißes, dichtes Haar. >Professor Nelson O'Dewly<, war unter dem Bild zu lesen. Ein Blick auf das Buchcover bestätigte es: Dieser Mann war der Verfasser des Buches.
"Charly hat in den letzten Tagen viel in diesem Buch gelesen." Die Traurigkeit in ihrer Stimme verursachte mir einen Knoten im Bauch. "Nimm es mit. Vielleicht hilft es dir weiter."
Ich fragte nicht, wobei es mir helfen sollte. Unten an der Tür sah Ann mich wieder mit diesem flehenden Blick an. Sie sprach die Frage nicht aus, die ihr auf der Zunge lag. Oder zumindest auf dem Herzen. Ich kannte sie trotzdem: Diese Frau gab sich der Hoffnung hin, ich würde den Mörder ihres Mannes suchen und finden.
"Ich melde mich morgen bei dir", sagte ich und steuerte meinen Sportwagen an. Die Mittagssonne reflektierte sich im roten Lack meines Wagens. Das schöne Wetter drückte meine Stimmung erst recht in Richtung Nullpunkt ...
11
Er hielt ihr einen Zwanzigdollarschein hin. Ihre großen, braunen Augen huschten unruhig zwischen der Banknote und seinem Gesicht hin und her. Er sah die Angst in ihrem Gesicht. Natürlich gehörte Angst zu ihrem Beruf, wie der eiskalte Kopf zu seinem. Und natürlich trugen die Narben auf seinem Gesicht nicht dazu bei, ihr Vertrauen einzuflößen. Selbst die große Sonnenbrille und der blonde Bart konnten das vernarbte Gewebe nicht verbergen.
Schließlich nickte die Frau, wandte sich um und klapperte mit hochhackigen Pumps vor ihm her über den verdreckten Bürgersteig.
Hagen musste sich nicht umsehen. Im Lack der parkenden Autos hatte er die drei Gestalten längst gesehen. Vorhin, als er die Straße überquerte, um das Mädchen anzusprechen. Er hatte sogar wahrgenommen, dass sie ihre Hände in den Hosentaschen verborgen hielten.
Niemand brauchte einem Hagen Berg erzählen, was diese drei Burschen wohl in ihren Taschen umklammerten.
Das Mädchen bog in eine Seitengasse ein. Die Fassaden der niedrigen Häuser erschienen Hagen hier noch verkommener als in den Hauptstraßen. Er bemerkte, dass sie mit dem linken Fuß umknickte. Er griff zu, um sie zu halten und grinste gleichzeitig. Ihre wachsende Unsicherheit amüsierte ihn. Wahrscheinlich war sie neu im Geschäft.
Ihr Gesicht unter der dicken Schicht Make-up war nicht einfach zu schätzen. Konnte gut sein, dass sie nicht älter als sechzehn war. "Hoffentlich macht sie sich nicht vor Angst in die Hosen", dachte Hagen. Und das war eine echte Sorge für ihn. Denn wenn er gegen etwas allergisch war, dann gegen die Gerüche menschlicher Ausscheidungen.
Das Mädchen bog in einen Hinterhof ein. Für Hagen war klar, dass die drei Burschen ihm anschließend hier auflauern würden. Es beunruhigte ihn nicht. Kein klar denkender Mann sucht ein abgefucktes Viertel im Norden Rios auf, ohne mit Straßenräubern zu rechnen.
Hagen Berg war viel zu routiniert, um sich von halbverhungerten Lümmeln aus dem Konzept bringen zu lassen. Allerdings bestand er darauf, dass das Mädchen die klapprigen Läden vor den Fenstern des einstöckigen Hinterhauses schloss. Auch den Türschlüssel ließ er sie zweimal herumdrehen. Eigenhändig schob er eine Kommode vor die Tür - zu leicht um den Eingang wirkungsvoll zu verbarrikadieren, aber hoch genug, um die Klinke zu blockieren.
Danach erst setzte er sich auf den Bettrand und holte eine Schachtel Reval aus seinem weißen Blazer. Egal in welchem Teil der Welt er sich sein Geld verdienen musste - einige Stangen der gelben Zigaretten nahm er immer mit auf die Reise.
Das Mädchen sah ihn unsicher an. Auf einmal kam ihm der Gedanke, dass sie mit den drei Burschen zusammenarbeitete. Diese Vorstellung brachte ihn zum Lachen. Er legte beide Hände auf sein strohblondes Haar und wieherte vor Lachen.
Der Blick des Mädchens wurde immer betretener. Er bemerkte, wie sie zur festgestellten Türklinke hinschielte. Bevor er seine Zigarette anzündete, gab er ihr mit einer Handbewegung zu verstehen, dass es Zeit für sie wäre, sich auszuziehen.
Nicht einmal jetzt nahm er seine Sonnenbrille ab. Feixend sah er ihrem Striptease zu. Erst als sie splitternackt vor ihm stand knöpfte er sich die Hose auf. Er trat die Zigarette aus, stand auf und ging zu ihr. Mit einer herrischen Geste zog er sie zu sich, und drückte ihr Kinn nach oben, um sie zu küssen.
Im nächsten Moment stieß er sie fluchend von sich. Sie stank erbärmlich nach Pisse und altem Schweiß. "Verfluchte Schlampe!" Er packte sie und stieß sie aufs Bett. "Kannst du dich nicht waschen, bevor du dir einen Kunden aus der Zivilisation angelst?"
Er sah sich nach einer Dusche oder Ähnlichem um, fand aber nur eine große Emailleschüssel. "Scheiß drauf!", zischte er. Die Geilheit war ihm sowieso vergangen. Er kriegte einfach keinen mehr hoch, wenn eine Frau stank.
Das Mädchen lag zitternd auf dem Bett. Hagen trat nach ihr und holte dann einen .38 Smith & Wesson aus dem Jackett. Und einen Schalldämpfer. Das Mädchen hielt den Atem an.
Hagen legte den Zeigefinger auf seine Lippen. "Wenn du schreist, mach' ich dich fertig." Sie verstand, obwohl sie natürlich kein Wort Deutsch sprach.
Hagen schraubte den Schalldämpfer auf den Lauf und spannte den Hahn des Revolvers. Mit der Linken zog er die Kommode von der Tür und schloss auf.
Gleich darauf huschte er zu einem der Fenster. Leise öffnete er es. Dann stieß er den Laden auf und legte die Waffe an. Es waren drei kaffeebraune, zerlumpte Burschen. Zwischen sechzehn und zwanzig Jahre alt. Sie lauerten dicht an die Hauswand gepresst zu beiden Seiten des Ausgangs. Zwei hielten Messer in den Fäusten, einer eine Pumpgun.
Hagen schoss genau dreimal. Sie kippten lautlos um.
Er stieg aus dem Fenster und ging vor den reglosen Körpern in die Hocke. In allen drei Köpfen klafften Löcher. Bei zweien zwischen den Augen, bei dem mit der Pumpgun in der Stirn.
Hagen ging zum Fenster zurück. Das Mädchen lag immer noch nackt und zitternd auf dem Bett. Er fand sie plötzlich erbärmlich und hässlich. Er dachte einen Augenblick daran, sie ebenfalls zu töten.
"Scheiß drauf", stieß er schließlich hervor und machte kehrt. Kein Mensch würde von ihr wissen wollen, wer die drei erschossen hatte. Je weniger von diesem Gesindel in der gottverdammten Stadt, umso besser. So dachte man doch hier, in diesen Breitengraden. Und so dachte Hagen auch.
Am Abend, nachdem er sich in einem ordentlichen Bordell gekauft hatte, was er haben wollte, fuhr Hagen mit einem Mietwagen aus der Stadt heraus zu der alten Kaffee-Fazenda, die von der Agentur aufgekauft worden war. Offiziell wurde dort Software hergestellt.
Sie waren fast alle schon da. "Hi, Fritz - lange nicht gesehen!" Ein Afroamerikaner schlug ihm freundschaftlich auf die Schulter. >Fritz< - so wurde Hagen in diesen Kreisen genannt.
Der Deutsche begrüßte sie nacheinander - Cooper, Leclerc, Harding und die sieben Männer, die er nicht kannte - drei Südafrikaner, ein Tutsi aus Uganda und drei Serben.
"Und der Projektleiter?", fragte Hagen in seinem harten Englisch. "Noch nicht da?" Er sah ein Zucken auf Hardings Gesicht. Niemand anderem, als dem kleinen, schwarzem Mann aus Harlem hatte seine Frage gegolten. Denn Hagen wusste genau, wo der Projektleiter war. Und Timothy Harding wusste es nicht.
Leclerc, der Franzose, verschränkte die Arme hinter dem Rücken und wippte einmal kurz auf den Zehenspitzen. "Ich leite das Projekt, Leutnant Berg ..."
12
Ich hatte mein Gefrierfach geplündert und drei Pizzen in den Backofen geschoben. Während ich die guten Teile bewachte, saßen Milo und Orry an meinem Schreibtisch vor Charlys Laptop. Um sie herum einige Flaschen Budweiser.
Beide waren sofort bereit gewesen, ihr Programm für den Sonntagabend umzustoßen und zu mir zu kommen. Orry versuchte seit einer geschlagenen Stunde das Passwort zu finden, dass ihm den Zugang zu Charlys Festplatte ermöglichte.
Die Pizza aß er nebenbei. Nach dem zweiten Bier, am Ende der zweiten Stunde, sein Jubelschrei. "Victory!", brüllte er. "Hab' ich dich endlich, Baby!"





























