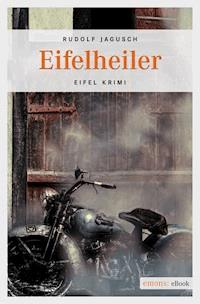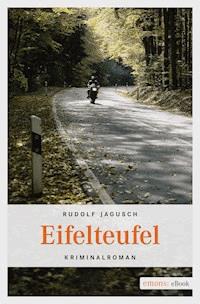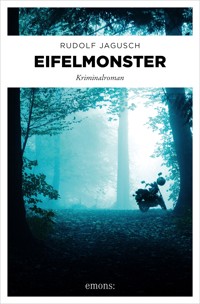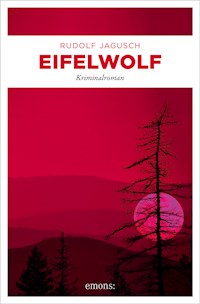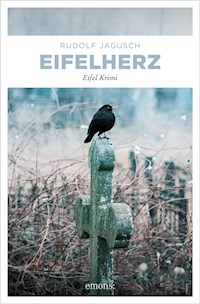5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Er kennt deine dunkelsten Geheimnisse: Der nervenaufreibende Psycho-Thriller »Mordsommer« von Rudolf Jagusch jetzt als eBook bei dotbooks. Du hast geschworen, das Geheimnis zu bewahren – jetzt holt es dich ein … Ein anonymer Brief bringt die perfekte Welt der angehenden Oberstaatsanwältin Nina Lehmann von einem auf den anderen Moment zum Einsturz – wie kann der unbekannte Absender von der Sünde aus ihrer Jugendzeit wissen, über die sie für immer den Mantel des Schweigens decken wollte? Die Suche nach der Wahrheit führt sie in ein verlassenes Dorf in der Eifel: Hier, in einem Talkessel fernab der Außenwelt, muss sie den Geistern aus ihrer Vergangenheit gegenübertreten. Für Nina beginnt ein grausames Spiel auf Leben und Tod, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint … »Ein Psychothriller der Extraklasse!« Bild Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Eifel-Krimi »Mordsommer« von Rudolf Jagusch. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Ähnliche
Über dieses Buch:
Du hast geschworen, das Geheimnis zu bewahren – jetzt holt es dich ein … Ein anonymer Brief bringt die perfekte Welt der angehenden Oberstaatsanwältin Nina Lehmann von einem auf den anderen Moment zum Einsturz – wie kann der unbekannte Absender von der Sünde aus ihrer Jugendzeit wissen, über die sie für immer den Mantel des Schweigens decken wollte? Die Suche nach der Wahrheit führt sie in ein verlassenes Dorf in der Eifel: Hier, in einem Talkessel fernab der Außenwelt, muss sie den Geistern aus ihrer Vergangenheit gegenübertreten. Für Nina beginnt ein grausames Spiel auf Leben und Tod, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint …
»Ein Psychothriller der Extraklasse!« Bild
Über den Autor:
Rudolf Jagusch wurde 1967 in Bergisch Gladbach geboren. Seit der studierte Verwaltungswirt 2006 seinen ersten Roman veröffentlichte, ist er eine feste Größe in der deutschen Krimi-Landschaft. Er lebt mit seiner Familie im Vorgebirge am Rand der Eifel, wo auch die meisten seiner Romane spielen.
Rudolf Jagusch veröffentlicht bei dotbooks seine Ermittlerkrimis um den Kölner Hauptkommissar Stephan Tries:
»Grabesruhe«
»Nebelspur«
»Todesquelle«
Außerdem bei dotbooks erschienen sind seine Thriller »Bis zur letzten Sekunde« und »Mordsommer«.
Die Website des Autors: www.rudijagusch.com
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/rudi_jagusch
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Andrey Novgorodtsev, Jr. James, Pixel
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-081-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Mordsommer« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Rudolf Jagusch
Mordsommer
Ein Eifel-Thriller
dotbooks.
Kapitel 1
Stechende Pfeile schossen durch sein Gehirn. Von Stollwerk stöhnte auf. Langsam drangen die Erinnerungen wie aufsteigende Luftblasen an die Oberfläche.
Die Stahltür zur Tiefgarage des Hochhauses, in dem er in der fünfzehnten Etage in seiner Praxis reiche Leute empfängt, die sich unter seinen geschickten Händen einer Schönheits-OP unterziehen. Er stößt die Tür auf, sieht, wie sich das Neonlicht im Lack der schicken Edelkarossen spiegelt. Sein Porsche steht rechts auf dem Privatparkplatz. Die nackten Betonwände mit den aufgemalten grünen Zahlen für die Stellplätze reflektieren hallend die Schritte. Er schaut auf die Uhr. Es war spät geworden, der Preis für den Erfolg. Er zieht den Schlüssel aus der Tasche, beugt sich vor, um das Schloss zu treffen, ohne einen Kratzer auf dem Lack zu riskieren, dann ... Schwärze ... nein, davor ein heftiger Schlag auf den Hinterkopf. Dann erst die Dunkelheit.
Entsetzt keuchte von Stollwerk auf. Jemand hatte ihn niedergeschlagen! Wie zur Bestätigung hämmerte ein dumpfer Schmerz den Nacken hinauf bis zur Schädelbasis. Eine Welle von Übelkeit schwappte über ihn hinweg. Würgend versuchte von Stollwerk den Mund zu öffnen, doch irgendetwas hinderte ihn. Augenblicklich wich die Benommenheit, die Sinne klärten sich. Etwas klebte über seinen Lippen. Jetzt erst wurde ihm bewusst, dass er nur durch die Nase atmen konnte. O Gott, wenn er sich jetzt erbrechen musste, dann würde er daran ersticken. Panisch versuchte er, die Arme nach vorne zu reißen. Sie fühlten sich taub an, etwas Scharfes schnitt in die Handgelenke.
Er hielt inne. Gefesselt? Was war hier los?
Erneut zerrte er wild. Erfolglos.
Er konzentrierte sich auf die Beine. Auch seine Fußgelenke waren wie zusammengeschweißt.
Von Stollwerk kam sich vor wie ein übergroßes Postpaket. Ohne Zweifel, er war gefesselt!
Das konnte doch alles nicht wahr sein.
Sein Herz raste, ihm brach der Schweiß aus. Heiß pulsierten Schmerzen durch seinen Kopf. Wieder würgte er. Reiß dich zusammen, befahl er sich, egal was hier los ist, wenn du dich jetzt erbrichst, wirst du daran ersticken.
Angestrengt kämpfte er gegen die Übelkeit an, zwang sich, gleichmäßig zu atmen und den galoppierenden Puls unter Kontrolle zu bringen. Einatmen, ausatmen, ein, aus, ein, aus. Er beruhigte sich so weit, dass er wieder denken konnte.
Verdammt, was hatte das alles zu bedeuten?
Er riss den Kopf herum. Er versuchte etwas zu erkennen, aber da war nur absolute Dunkelheit. Der Schweiß brannte ihm in den Augen. Wie gerne hätte er jetzt darübergewischt.
Er horchte. Und dann wurde ihm schlagartig klar, wo er sich befand. Ein stetiges Brummen, ein Motor. Wellenartige Bewegungen. Der stickige Geruch.
Ein Auto.
Er versuchte sich aufzurichten, schlug jedoch nach wenigen Zentimetern mit der Schläfe gegen etwas Hartes. Die Beine zu strecken, um die von der verkrümmten Lage brennenden Muskeln zu entlasten, funktionierte ebenfalls nicht. Die Schuhe stießen gegen etwas und erzeugten einen blechernen Klang.
Ein Kofferraum. Er befand sich im Kofferraum eines Wagens. Wütend trat er mehrfach gegen das Blech. Jemand hatte ihn gefesselt und hier eingesperrt. Er war entführt worden.
Nach einer Weile wich die Wut aus den Gliedern und machte einer Beklommenheit Platz, die sich ihm wie ein Stein auf die Brust legte. Ob sein letztes Stündlein geschlagen hatte?
Dreh jetzt bloß nicht durch! Wenn der Angreifer dich töten wollte, hätte er es schon längst getan.
Er zwang sich, seine Lage zu analysieren. Vielleicht erkannte er so einen Silberstreif am Horizont, einen Funken Hoffnung in dieser beschissenen Situation.
Also, was hatte man mit ihm vor, was wollte der Entführer?
Halt! Wer sagte ihm denn, dass es sich nur um einen Entführer handelte? Es konnten genauso gut mehrere sein. Vielleicht eine ganze Bande. Das war zu diesem Zeitpunkt unmöglich herauszufinden.
Weiter. Um was ging es hier?
Um Geld? Naheliegend, ja, sogar äußerst wahrscheinlich. Immerhin: Es wäre zwar ärgerlich, ein paar Ersparnisse zu verlieren, stellte jedoch grundsätzlich kein Problem dar. Er gehörte zur Oberschicht. Die Höhe der geforderten Summe würde keine Rolle spielen, er konnte sie auftreiben.
Aber was wäre, wenn den Entführer eine andere Motivation antrieb? Was dann? Rache? Hatte er Feinde? Ein Patient, der mit dem Ergebnis der Operation nicht zufrieden war? Das kam vor, doch bisher hatte von Stollwerk alles im gegenseitigen Einverständnis regeln können. Er korrigierte ohne Zusatzkosten. Schließlich hatte er einen Ruf zu wahren. Und sich gegen die übermächtige ausländische Konkurrenz, insbesondere die in Thailand, durchzusetzen war nicht immer leicht. Kulanz hieß das Zauberwort.
Oder steckte ein gehörnter Ehemann hinter der Sache? Hm, nicht auszuschließen. Mit der athletischen Figur, die er regelmäßig im Fitnessstudio stählte, seinen blauen Augen und den blonden, fülligen Haaren kam von Stollwerk bei Frauen gut an. Auf Eheringe nahm er bei seinen Eskapaden keine Rücksicht. Er hatte es nicht zu vertreten, wenn es in einer Ehe kriselte. Fairerweise machte er den Frauen keinerlei Hoffnungen auf eine längerfristige Beziehung. Er wollte ungebunden bleiben und verheimlichte dies auch nicht. Aber würde ein betrogener Ehemann so weit gehen und einen der renommiertesten und angesehensten Ärzte Münchens kidnappen? Wütend ins Büro stürmen, schreien, die Fäuste fliegen lassen, ja, das konnte sich von Stollwerk noch vorstellen. Aber eine Entführung? Eher nicht. Da war eine enttäuschte Geliebte wahrscheinlicher. Bei solchen Furien setzte oftmals der Verstand aus, die waren zu allem fähig. Andererseits ... er wog neunzig Kilo. Konnte eine Frau einen solch schweren Körper tragen? Warum nicht? Es gab ziemlich kräftige Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts. Im Fitnessstudio bewunderte er regelmäßig die braun gebrannten Schönheiten mit akzentuierten Muskeln, hart wie Beton. Allerdings bandelte er mit denen nicht an. Er mochte eher die zarten, wohlgeformten Frauenkörper mit den Rundungen an den richtigen Stellen. Der Krankenhausaufenthalt vor einigen Jahren fiel ihm ein, die Grippe, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Schlapp hatte er im Bett gelegen, kaum fähig zu schlucken, geschweige denn aufzustehen oder sich auch nur aufzurichten. Trotzdem hatten ihn die Krankenschwestern mühelos hin und her gewendet wie ein Spiegelei in der Pfanne. Alles eine Frage der Technik. Somit konnte es sich durchaus um einen weiblichen Entführer handeln.
Einige Minuten kramte er in den Erinnerungen nach möglichen Tätern. Ohne Erfolg.
Trotz der unbequemen Position und der schrecklichen Situation spürte er eine bleierne Müdigkeit. Die Schmerzen, der Sauerstoffmangel, das Brummen des Motors und die sanften Schaukelbewegungen des Fahrzeuges zeigten Wirkung. Von Stollwerk versuchte dagegen anzukämpfen, gab es aber schließlich auf. Sicher war es besser, dem Entführer ausgeruht entgegentreten zu können. Bei der erstbesten Gelegenheit würde er seine Chance ergreifen. Bevor ihn endgültig die Müdigkeit übermannte, nahm er sich fest vor, keine Milde walten zu lassen.
Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Er besaß die Fähigkeit, Hemmungen zu überwinden und andere schwer zu verletzen, ja, sogar zu töten.
Kein Pardon, keine Gnade.
Fast freute er sich auf die Konfrontation. Der Entführer ahnte nicht, mit wem er sich hier angelegt hatte.
Kapitel 2
Nina Lehmann hatte es geschafft.
Sie taumelte fast vor Glück über den Flur des Landgerichts Köln. Sie hatte den Dreckskerl eingelocht, trotz dürftiger Beweislage und einer Schmutzkampagne der Pressemeute, die ihr und der Polizei schlampige Ermittlungsarbeit vorgeworfen hatte.
Genau aus dem Grund hatte sie sich für eine Karriere als Staatsanwältin entschieden: Sie wollte den menschlichen Abschaum hinter Gitter bringen. Nicht umsonst nannte man sie »Madame Gnadenlos«. Wenn sie sich in einen Vorgang verbiss, gab es kein Erbarmen, dann kämpfte sie für die Höchststrafe. Nichts hasste sie mehr als »verständnisvolle« Richter, die Mitleid mit Straftätern hatten. Doch diesmal war alles nach ihren Vorstellungen gelaufen.
Lebenslänglich!
Ein Sieg auf der ganzen Linie. Fest klemmte sie ihre Akten unter den Arm, öffnete die Tür zu ihrem Büro und trat ein. Der muffige Papiergeruch, den die staubigen Akten verbreiteten, störte sie heute nicht. Sie schloss die Tür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Am liebsten hätte sie vor Freude gejubelt. Ach, was soll’s: Sie riss die Arme nach oben, die Akten klatschten auf den Boden. Einige Papiere rutschten heraus und verteilten sich über dem Teppichboden. »Yeah!«, rief sie und schob dann noch ein dreifaches »Ja! Ja! Ja!« hinterher. Es spielte keine Rolle, wenn die anderen sie hörten. Ihr Erfolg hatte sich garantiert bereits herumgesprochen, jeder konnte sich so einen Reim auf ihren Jubel machen. Der Flurfunk sendete mit Lichtgeschwindigkeit. Vielleicht hatte irgendeiner der Kollegen eine Flasche Sekt im Kühlschrank stehen, die sie köpfen könnten. Zwar war Alkoholtrinken während des Dienstes streng verboten, in solchen Fällen wurde es von den Vorgesetzten jedoch geduldet.
Zufrieden schloss sie die Augen und genoss den Moment des Triumphes. Sie spürte, wie die Anspannung der letzten Monate von ihr abfiel. Wie viel Zeit jetzt für private Dinge zur Verfügung stand. Endlich mal wieder ausgiebig joggen. Ein paar Freunde anrufen und sich zum Plauschen verabreden.
Aber dann schüttelte sie belustigt den Kopf. Klang alles verheißungsvoll, doch sie kannte sich. Spätestens nach einer Woche würde sie sich wieder den schwierigsten Fall an Land ziehen und erneut auf Hetzjagd gehen. Sie konnte nicht anders, das war ihr Ding, ihr Lebensinhalt.
Sie sammelte die Akten auf, legte sie in das Regal links an der Wand und setzte sich hinter ihren Schreibtisch. Die Sommersonne fiel durch das Fenster und malte ein helles Rechteck auf den Boden. Im Licht tanzten Staubpartikel. Nina Lehmann zog die oberste Schublade auf und kramte aus den Kosmetikartikeln, die sie dort deponierte, einen Lippenstift und einen Schminkspiegel hervor. Die ersten Gratulanten würden gleich auftauchen, sie wollte ein makelloses Siegergesicht vorweisen können. Sie zog die Lippen nach und betrachtete sich dann ausgiebig in dem kleinen Spiegel: die hohen Wangenknochen, die grünen Augen, die winzigen Krähenfüße – kaum der Rede wert für eine Frau Anfang vierzig – und eine blonde Mähne, die ins Rot changierte. Eigentlich perfekt.
Eigentlich.
Missmutig warf sie den Spiegel in die Schublade und schob sie mit einem Ruck zu. Gut auszusehen, reichte nicht, um einen Partner zu finden. Bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, klopfte es an der Tür.
»Ja, bitte«, rief sie, erleichtert über die Ablenkung. Jetzt konnte die Party beginnen.
Doch statt einer Horde gut gelaunter Kollegen sah sie ein Gesicht mit großen braunen Kulleraugen, einem weißen Rauschebart und einer Glatze zur Tür hereinschauen. »Darf ich reinkommen?«
»Herr Oberstaatsanwalt?«, entfuhr es Nina Lehmann. Sogleich ärgerte sie sich darüber, ihre Überraschung zum Ausdruck gebracht zu haben. Sie mochte es nicht, wenn sich ihr Innenleben in ihrer Ausdrucksweise widerspiegelte. Sie bevorzugte, überlegt und nüchtern zu wirken. Je weniger ihr Gegenüber sie einschätzen konnte, umso besser – das verschaffte ihr selbst zwangsläufig eine überlegene Position. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie in den letzten Jahren nicht mehr bei Männern landen konnte.
Ein schelmisches Lächeln stahl sich in das Gesicht des Oberstaatsanwaltes. »Und? Darf ich jetzt? Oder soll ich später wiederkommen?«
»Ja, ja, doch, selbstverständlich«, sagte sie und stand auf. »Treten Sie ein.«
Sie schnappte sich den Besucherstuhl und schob ihn so hin, dass der Oberstaatsanwalt sich bequem an den Schreibtisch setzen konnte. Dann nahm sie ihren Stuhl und platzierte ihn an seine Seite. Sie wollte nicht, dass sie durch den Tisch getrennt waren.
Oberstaatsanwalt Voss verschränkte die Hände über dem feisten Bauch. Das einstmals maßgeschneiderte Jackett spannte an allen Ecken und Enden, und die Hose hätte inzwischen auch eine Nummer größer sein müssen. Wie stets strahlte Voss eine Ruhe aus, die Nina Lehmann an einen tief verwurzelten Baum mit mächtigem Stamm zum Anlehnen erinnerte. Sie mochte den alten Mann, der kurz vor der Pensionierung stand. Voss sah nicht nur gutmütig aus, er war es auch. Nie erhob er die Stimme, rüde Gesten waren ihm fremd. Trotzdem genoss er im Kollegenkreis Respekt und Anerkennung, da man sich auf sein Wort ohne Wenn und Aber verlassen konnte. Nicht jeder zeigte so viel Rückgrat.
»Ausgezeichnete Arbeit«, lobte er.
»Danke.«
Lob anzunehmen war für Nina Lehmann nichts, was sie verlegen machte, zumindest, solange es gerechtfertigt war.
Voss schlug die Beine übereinander und strich sich über den Bart. »Ich beobachte Sie schon eine geraume Zeit. Sie haben Biss. Das gefällt mir, Ihre ganze Art gefällt mir. Sachlich, kompetent und ergebnisorientiert, den Blick auf das Ziel gerichtet.«
»Ich tue mein Bestes.«
»Dazu ein sicheres Auftreten, äußerst attraktiv und mit einem ausgezeichneten Modegeschmack.«
Nina hob eine Augenbraue.
»Was soll das jetzt werden?«
Voss lachte. »Bitte nicht falsch verstehen. Sie wissen, dass ich glücklich verheiratet bin. Daran möchte ich auch nichts ändern. Es liegt mir fern, Ihnen den Hof zu machen, keine Sorge.«
»Schade«, kokettierte Nina spielerisch und lachte.
Voss lachte ebenfalls, erklärte dann: »Bitte fassen Sie es einfach als Kompliment auf.«
»Dann fühle ich mich geschmeichelt.« So langsam fragte sich Nina, was das Geplänkel sollte.
Voss schien ihre Gedanken erraten zu haben. »Kommen wir zur Sache. Wie Sie wissen, Frau Lehmann, es sind mir nur noch einige Monate in dem hohen Haus hier vergönnt. Nicht dass ich das groß bedaure, schließlich habe ich sechsunddreißig Jahre hier in den Gemäuern verbracht. Und ich habe so einiges mitgemacht, wie Sie sich denken können, Erfreuliches und weniger Erfreuliches. Insgesamt aber überwiegen die positiven Erlebnisse.«
»Das hört man gern.«
»Ich habe viele Kollegen kommen und gehen sehen, habe für zig Hochzeiten, Geburten und Geburtstage gespendet. Leider waren auch nicht wenige Kranzspenden dabei.« Für einen kurzen Moment ging sein Blick in die Ferne. Dann räusperte er sich. »Ich schweife ab, entschuldigen Sie bitte die Gefühlsduselei eines alten Mannes ...«
Nina schenkte ihm ein verständnisvolles Lächeln.
»Ich könnte stundenlang von alten Zeiten erzählen, aber ich möchte Sie nicht langweilen. Sie haben das Leben noch vor sich, Sie stehen am Anfang des Weges, den ich bereits zurückgelegt habe. Sie sind in der Spur, haben einen Kompass im Gepäck, der Sie weit bringen wird.«
»Vielen Dank für Ihren Zuspruch.«
Bekräftigend nickte er. »Worauf ich hinaus möchte: Können Sie sich vorstellen, meine Nachfolge anzutreten?«
Erstaunt straffte Nina sich. »Ich?« Sie war völlig überrumpelt. Es gab zahlreiche dienstältere Kollegen, die sich Hoffnung auf die Beförderung zum Oberstaatsanwalt machten. Niemals hätte sie damit gerechnet, zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein solches Angebot zu erhalten. Zumal es als Frau immer noch schwierig war, die Karriereleiter zu erklimmen.
»Ja, selbstverständlich.« Voss lachte gackernd. »Darum habe ich doch eben Ihre Qualifikationen und Vorzüge betont. Sie sind genau die Richtige.« Er deutete mit dem Zeigefinger auf Nina. »Sie sind meine Favoritin.«
Jetzt fühlte sich Nina doch ein wenig verlegen. Fachlich war sie die beste Wahl, niemand im Kollegenkreis konnte ihr das Wasser reichen. Doch qualifizierte sie das nicht automatisch für die Aufgabe einer Oberstaatsanwältin, das wusste sie nur zu gut. Ihr fehlten die Erfahrungen als Führungskraft. »Ihr Vertrauen schmeichelt mir, aber ...«, setzte sie an, doch Voss unterbrach sie augenblicklich.
»Ich weiß, dass Sie eine gesunde Selbsteinschätzung pflegen. Und ja, es gibt Dinge, die Sie noch lernen müssen. Das stellt jedoch keinerlei Hinderungsgründe dar. Sie werden es schaffen, davon bin ich fest überzeugt.«
Nina kam ein Gedanke. »Es geht hier doch nicht etwa um eine Quote, oder? Wenn es so wäre ...«
Voss lachte auf. »Um Gottes willen, nein, nein. Ehrlich nicht.«
Sie glaubte ihm. »Gut, okay, ich fühle mich geschmeichelt. Aber wie wollen Sie es hinbekommen, dass ich die Stelle bekomme? Es wird sicher eine Ausschreibung und zahlreiche Bewerbungen geben.«
Er winkte ab.
»Lassen Sie das mein Problem sein. Sie wahren einfach Stillschweigen über unser kleines vertrauliches Gespräch. Sie bewerben sich, wie es sich gehört. Alles andere wird sich regeln.« Mühsam erhob er sich. »Wo wir das jetzt geklärt haben, noch eine andere Sache.«
»Ja?«
Nina zwang sich, weiterhin konzentriert zuzuhören. Am liebsten hätte sie ein zweites Mal am heutigen Tage ein lautes »Yeah!« ausgestoßen. »Oberstaatsanwältin« hörte sich in ihren Ohren plötzlich sehr verlockend an.
»Dieser Serienmörder hier in Köln, Sie wissen schon ...« Stöhnend drückte er das Kreuz durch. »Mein Rücken bringt mich noch um«, murmelte er.
»Sie meinen die ›Bestie‹?«
Seit einiger Zeit versetzte ein Serientäter die Stadt in Angst und Schrecken. Fünf Opfer waren bisher zu beklagen, vier Frauen und ein Mann. Allesamt waren brutal gefoltert worden. Ihre Körper sahen aus wie von einem Raubtier zerfleischt, was dem Täter den Spitznamen eingebracht hatte. Nina mochte sich gar nicht vorstellen, welches Leid die Opfer erlebt haben mussten. Der Tod musste ihnen wie eine Erlösung vorgekommen sein.
»Ja«, bestätigte Voss und ballte die Fäuste. Auch ihm ging die Sache an die Nieren, das sah man ihm an. »Kurz bevor ich zu Ihnen aufgebrochen bin, hatte ich noch ein Telefonat mit dem Polizeipräsidenten. Es gibt vielversprechende Spuren. Gut möglich, dass sie das Schwein bald schnappen.«
»Das wäre ein großer Erfolg.«
»Durchaus. Wenn es so kommen sollte, will ich meine beste Kraft an dem Fall dran haben.« Er legte ihr eine Hand auf die Schulter und sah ihr tief in die Augen. Jegliche Wärme war aus ihnen verschwunden. »Sie werden den Fall übernehmen. Bringen Sie das Schwein hinter Gitter, ein für alle Mal.«
Leicht beschwipst verließ Nina am Nachmittag das Büro. Nachdem Voss sich von ihr verabschiedet hatte, waren die Kollegen doch noch mit einigen Flaschen Sekt aufgetaucht. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit hatte Nina sich zu zwei Gläsern hinreißen lassen. Dabei vertrug sie gar keinen Alkohol.
Frische Sommerluft umschmeichelte ihre Haut. Von der Wiese in der Mitte des Reichenspergerplatzes wehte der Geruch nach gemähtem Gras zu ihr herüber. Sie beschloss, auf die U-Bahn zu verzichten und lieber zu Fuß zu gehen. Sie schlug den Weg in Richtung Rhein ein, folgte dann dem Konrad-Adenauer-Ufer flussaufwärts. Es bedeutete zwar einen Umweg, doch konnte sich das nur positiv auf ihren Schwips auswirken. Zahlreiche Jogger, Spaziergänger und Radfahrer kamen ihr entgegen. Das Leben in der Stadt pulsierte.
Nina genoss den freien Blick auf die mächtige Stahlkonstruktion der Hohenzollernbrücke, auf den Rhein mit den vorbeifahrenden Kähnen und auf die Spitzen des Kölner Doms. Sie liebte die Skyline Kölns, die unkomplizierten, toleranten und lebensfrohen Menschen und natürlich die fünfte Jahreszeit – den Karneval. Nie wäre ihr der Gedanke gekommen, von hier fortzugehen. Und nach Voss’ Angebot musste sie sich mit derartigen Überlegungen auch in Zukunft nicht beschäftigen. Ihre Karriere konnte sie in ihrer geliebten Stadt fortsetzen.
An der Bastei bog sie in den Theodor-Heuss-Ring ein. Nach wenigen Hundert Metern erreichte sie den Häuserblock, in dem sich ihre kleine Wohnung befand. In der Musikhochschule auf der anderen Straßenseite übte ein Student am Klavier. Die weich angeschlagenen Töne hallten von den Häuserwänden wider. Beethoven, dachte Nina und schloss die Haustür auf. Links hingen die Briefkästen. Werbebroschüren quollen aus den Schlitzen. Sie zog sie heraus und stopfte sie in den Kasten ihres Nachbarn. Den konnte sie nicht leiden, ein Querulant, der das ganze Haus terrorisierte. Sollte der sich um den Papiermüll kümmern. Er meckerte ohnehin bei jeder Gelegenheit darüber, dass die anderen Hausbewohner zu blöd zur Mülltrennung waren. Dann konnte er es direkt selbst erledigen.
Nina öffnete den Briefkasten und entnahm die Post. Dann ging sie in die zweite Etage, schloss die Wohnungstür auf und trat ein. Sie warf den Schlüssel und die Briefe auf die Flurkommode, hängte ihre Jacke an den Haken und zog die Pumps aus. Zufrieden seufzte sie. Was für eine Erlösung. Die Schuhe quälten sie bereits den ganzen Tag. Sie nahm die Post mit in die Küche und setzte Teewasser auf. Die Fliesen kühlten ihre gemarterten Füße. Während sie auf das Wasser wartete, sah sie die Briefe durch. Eine Rechnung vom Frauenarzt und ein Angebot für Kabelanschluss. Beim dritten Umschlag stutzte sie. Die Briefmarke fehlte, keine Absenderinformation, und ihre Adresse war mit einer ihr unbekannten steilen Handschrift geschrieben.
Seltsam.
Sie legte die anderen Briefe zur Seite und hielt den Umschlag gegen das Licht, dann tastete sie darüber. Nichts Ungewöhnliches zu spüren. Gut. Sie hatte so viele von den harten Jungs hinter Gitter gebracht, da konnte man nicht vorsichtig genug sein. Wer wusste schon, ob nicht einer von denen auf die Idee kam, ihr aus Rache Milzbranderreger zuzusenden.
Behutsam öffnete sie eine Ecke des Kuverts und drehte es über der Spüle auf den Kopf. Nichts rieselte heraus.
Na also. Harmlos. Bestimmt nur ein Rundschreiben der örtlichen Kirchengemeinde.
Entschlossen riss sie den Umschlag auf und zog ein Blatt hervor.
Der Teekessel flötete. Sie zog ihn von der Platte und schaltete den Herd aus. Anschließend faltete sie den Brief auseinander.
Eine einzige Zeile.
Vier Worte und eine Zahl.
Entsetzt schwankte Nina.
Es war geschehen, was nie hätte geschehen dürfen.
Kapitel 3
Der Wagen schaukelte, und die Stoßdämpfer quietschten. Konzentriert horchte von Stollwerk. Das monotone Motorengeräusch war seit etwa dreißig Minuten einem Auf und Ab der Drehzahl gewichen. Von Stollwerk war sich sicher, dass sie die Autobahn verlassen hatten. Die anschließende kurvige Fahrt, das häufige Schalten und das Knirschen der Reifen auf Kies bestätigten die Annahme.
Seine Wadenmuskeln verkrampften sich. Fest presste er die Fußspitzen gegen das Blech. Nach einigen Sekunden ließ der Schmerz nach, dafür drückte seine Blase inzwischen umso mehr. Der ganze Unterkörper schien plötzlich nur noch aus diesem zum Bersten gefüllten Muskel zu bestehen. Vielleicht sollte er dem Entführer einfach in die Augen pinkeln. Ein irres Kichern erfasste ihn. Ja, einfach mit dem harten Urinstrahl das Arschloch auf Distanz halten und vor sich hertreiben, wie die Polizei Demonstranten mit einem Wasserwerfer. So wie es sich anfühlte, konnte von Stollwerk bestimmt einige Minuten den Druck aufrechterhalten. Ach Scheiße, so wie er hier lag, konnte er noch nicht mal den Pimmel aus der Hose holen.
Mit einem Ruck stoppte der Wagen. Der Motor erstarb, eine gespenstische Stille breitete sich aus.
Von Stollwerk schwitzte. Was würde nun kommen? Auf der Fahrt war sein Leben sicher gewesen. Jetzt war alles wieder offen. So absurd es war: Er wünschte sich, der Entführer würde den Motor wieder starten und weiterfahren.
Aber – warum stieg der Kerl nicht aus?
Aus weiter Ferne hörte von Stollwerk Wasser plätschern. Ein Bach? Ein Fluss? Wo waren sie? Das Geräusch verstärkte seinen Durst, der ihn seit dem Aufwachen quälte. Der Hals fühlte sich wund an, selbst das Atmen schmerzte. Niemals zuvor hatte er sich so sehr nach einem Schluck Wasser gesehnt, volle Blase hin oder her.
Endlich wurde die Fahrzeugtür geöffnet. Schritte knirschten auf Kies. Sie kamen um das Fahrzeug herum.
Von Stollwerk hyperventilierte fast, seine Nasenflügel blähten sich. Mehrmals blinzelte er den brennenden Schweiß aus den Augen. Vielleicht könnte er dem Entführer die Füße gegen die Brust hämmern, ihn so zurückstoßen. Mit ein wenig Glück würde das Arschloch stolpern und sich den Kopf an einem Stein anschlagen. Nur: Wie wahrscheinlich war das? Vermutlich würde er nur Wut beim Entführer schüren. Aber egal, besser, als tatenlos alles mit sich geschehen zu lassen. Der Typ sollte wissen, dass er sich nicht kampflos seinem Schicksal ergeben würde.
Von Stollwerk versuchte, den Körper in Position für einen Angriff zu bringen. Er stieß mit dem Kopf gegen ein scharfes Metallteil, in der Enge des Kofferraums konnte er sich einfach nicht drehen. Es war zwecklos.
Ein Schlüssel klimperte im Schloss, der Kofferraumdeckel sprang einen Spaltbreit auf. Licht fiel gleißend herein. Geblendet kniff von Stollwerk die Augen zu. Verdammt, er musste etwas sehen. Mit eisernem Willen riss er die Augen auf und sah den dunklen Umriss eines Menschen vor der tiefstehenden Sonne. Bevor er Einzelheiten erkennen konnte, presste der Unbekannte ihm einen süßlich riechenden Lappen auf die Nase. Wild warf von Stollwerk den Kopf hin und her, doch der Stoff schien mit dem Gesicht verwoben zu sein. Die Luft wurde ihm knapp, verdammt, wollte der Dreckskerl ihn hier und jetzt ersticken? Panisch rang von Stollwerk um jedes Sauerstoffmolekül. Seine Sinne schwanden.
Chloroform.
O Gott!
Sein Blickfeld verengte sich, Schatten schienen von der Seite auf ihn zuzukommen. Dann war die Schwärze total.
Kapitel 4
Ich kenne dein Geheimnis 1992.
Wieder und wieder las Nina die eine Zeile auf dem Blatt Papier, das in ihren Fingern zitterte. Den Tee hatte sie vergessen, schlagartig war die Euphorie des Tages verschwunden. Eine eiskalte Hand schien ihr Herz zu umklammern. Sie fror, ihre Knie wurden weich. Sie taumelte zum Stuhl und ließ sich darauf fallen. Ihre Nerven summten, als ständen sie unter Starkstrom. Sie warf das Blatt auf den Tisch und stemmte den Kopf in die Hände.
Das konnte nicht sein.
Niemand wusste davon.
Niemand!
Sah man von den restlichen Mitgliedern der Clique ab. Und die würden nichts verraten, nie im Leben. Feierlich hatten sie es sich geschworen. Damals wollten sie sich ihre Zukunft nicht wegen eines einzigen aus dem Ruder gelaufenen Experiments verbauen. Zumal ja niemand ums Leben gekommen war.
Jedenfalls nicht so wirklich.
Nina richtete sich auf und nahm den Brief wieder zur Hand. Erneut drehte sie ihn im Licht, suchte nach Anhaltspunkten, die den Absender verraten könnten, ein Wasserzeichen oder ein besonderes Papier. Am besten wäre natürlich ein eindeutiger Fingerabdruck. Doch Umschlag und Brief waren schlicht und blütenweiß.
Sie betrachtete die Buchstaben der Adresse. Ein Kugelschreiber, schwarze Tinte, die Handschrift spitz, klar und kräftig, doch ihr leider völlig unbekannt.
Minutenlang zermarterte Nina sich den Kopf, wer ihr den Brief geschickt haben könnte. Wer könnte noch von ihrem Geheimnis wissen?
Damals, 1992, hatten sie den Kopf aus der Schlinge ziehen können, weil sie zusammengehalten hatten und es niemanden gab, der sie hätte belasten können. Wütend schlug sie mit der Faust auf den Tisch. Verdammt, niemand hatte sie gesehen. Sonst wäre der ganze Mist schon damals aufgeflogen.
Eine Weile brütete sie dumpf vor sich hin. Von der Straße summte der Feierabendverkehr zu ihr hinauf. Über ihr in der Dachgeschosswohnung stolzierte die junge Blonde, die so gerne Model werden wollte, auf High Heels über das Laminat. Tock, tock, tock, immer hin und her. Wie ein Specht, der an Ninas Schläfen hämmerte. Am liebsten hätte Nina ihr zugerufen, wie unsinnig das war. Eine eins sechzig große Frau mit mindestens zehn Kilogramm zu viel auf den Hüften entsprach einfach nicht den Idealmaßen. Da konnte man noch so hübsch und niedlich aussehen, es war zwecklos. Sie versuchte, die Geräusche auszublenden.
Wenn nur die Clique von dem Vorfall wusste, dann ... Ruckartig richtete sie sich auf. Folgte man diesem Gedanken bis zum Ende, gab es nur eine Möglichkeit: Jemand aus ihrer Clique war der Absender. Aber wenn es wirklich so wäre: Was wollte der- oder diejenige damit bezwecken? Eine Zeile, die nur auf das damalige Ereignis Bezug nahm, jedoch keine Forderung stellte. Warum sollte überhaupt jemand nach mehr als zwanzig Jahren auf die Idee kommen, die längst vergessene Sache wieder ans Tageslicht zu zerren? Egal, welches Mitglied der Clique dahintersteckte: Er oder sie würde sich doch nur selbst schaden. Das konnte doch niemand riskieren. Oder hatte einer von ihnen nichts mehr zu verlieren? Nina nickte langsam. Ja, nur so wurde ein Schuh daraus. Stand jemand am Rande des Abgrunds, könnte er sein Wissen nutzen, um sie zu erpressen. Sie musste herausfinden, wer sein Leben gegen die Wand gefahren hatte.
Entschlossen stand sie auf, neue Energie durchflutete sie, die Kälte, die sie ergriffen hatte, war verflogen. Ermittlungsarbeit, damit kannte sie sich aus, hier war sie auf sicherem Terrain.
Rasch wechselte sie in bequeme Kleidung, zog sich ihre Kuschelsocken an, brühte sich einen neuen Tee auf, ging ins Arbeitszimmer und klappte das Notebook auf. Während der Rechner hochfuhr, suchte sie nach dem alten Fotoalbum aus ihrer Jugendzeit. Seit sie ihr Elternhaus verlassen hatte, war sie dreimal umgezogen. Zunächst in eine Studenten-WG, danach in ein kleines Apartment in der Nähe der Universität und schließlich hierher, unweit des Gerichts. Dabei hatte sie sich jedes Mal von zahlreichen Gegenständen getrennt. Kaum etwas aus dem alten WG-Zimmer hatte es bis hierher in die Wohnung geschafft. Sie hing nicht an den Dingen. Wenn etwas aus der Mode kam, sich als unpraktisch herausstellte oder ihr schlicht nicht mehr gefiel, dann warf sie es weg. Den Keller bis zur Decke mit ausgesondertem Gerümpel zuzustellen kam für sie nicht infrage. Das Fotoalbum war dabei nie in Gefahr geraten. Sie hütete es wie einen Schatz. Doch so gern sie auch wegschmiss und entrümpelte, in ihrem privaten Arbeitszimmer herrschten eigene Gesetze. Stumm verfluchte sie die Unordnung. Der Schreibtisch quoll über, Gesetzestexte, lose Kopien, Schreiben, die auf Ablage warteten, Rechnungen und ein Sammelsurium an Büromaterialien summierten sich zu einem fast undurchdringlichen Chaos. Die Schubladen schlossen nicht mehr richtig, zu viel hatte sie hineingestopft. Längs der Wände in den Regalen sah es auch nicht besser aus. Die Böden bogen sich unter der Last unzähliger Bücher, alter Zeitschriften, diverser Ordner und Sammelkisten. Wenn ihre Kollegen das sehen könnten, würden sie sich verwundert die Augen reiben. Im Büro der Staatsanwaltschaft achtete Nina pedantisch auf Ordnung. Dort stapelte sich nichts, alles hatte seinen Platz. Das kostete Zeit und Nerven, was sie hinnahm, um schneller zu einem Ergebnis zu kommen. Hier zu Hause brachte sie dagegen die Disziplin und Kraft nicht ein weiteres Mal auf. Vielleicht sollte sie mal wieder umziehen. Sie kicherte bei dem Gedanken.
Endlich fand sie das Fotoalbum unter einem Stapel Fachzeitschriften. Vorsichtig zog sie es heraus, darauf achtend, dass die vier oder fünf Jahrgänge der Neuen Zeitschrift für Strafrecht nicht zu Boden fielen. Leider misslang das Vorhaben. Die Hefte entwickelten ein Eigenleben, das sie nicht mehr aufhalten konnte. Knallend landeten sie auf dem Boden. Mit dem Fuß schob Nina sie notdürftig zusammen. Wie einen wertvollen Schatz hielt sie das Fotoalbum in den Händen und setzte sich auf den Bürostuhl.
Das Album hatte im Lauf der Jahre ziemlich gelitten. Einzelne Seiten hatten sich gelöst. Der stoffbespannte, grüne Umschlag war abgewetzt und ausgeblichen. Sie schlug die erste Seite auf. Ganz oben stand mit verspielt jugendlicher, geschwungener Handschrift: »1992«. Ansonsten nahm die Seite nur ein großes Foto ein. Es zeigte die Mitglieder ihrer Clique. Der coolsten Gemeinschaft des Jahrganges, nein, der gesamten Oberstufe. Allesamt stammten sie aus wohlhabenden Familien und hatten Aussicht auf ein Abitur mit Bestnoten. Versonnen strich sie über die Seite. Das Foto war vor dem schicksalhaften Tag aufgenommen worden. Selbstsicher, fast überheblich, lächelten sie in die Kamera. Irgendwann Anfang des Jahres musste das gewesen sein. Sie trugen noch dicke Jacken, die ihre pubertierenden Körper einhüllten. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Welt noch in Ordnung. Wenig später brach alles auseinander.
Kapitel 5
Ein Plätschern weckte von Stollwerk.
Wasser!
Seine ausgedörrte Kehle schrie nach Feuchtigkeit. Mühsam hob er den Kopf und öffnete die Augen.
Wasser!
Sein Nacken schmerzte, die Kopfwunde pulsierte, und die linke Körperseite brannte.
Einige Sekunden verstrichen, bevor er sich erinnerte – das Chloroform, die schwarze Gestalt, die ihm den Lappen auf das Gesicht gepresst hatte.
Wasser!
Wo war er hier?
Wasser! Wasser! Wasser!
Flüssigkeit lief an seinem Körper hinunter. War er nackt? Was war mit seinen Armen? Er hatte die Arme über den Kopf gestreckt. Seine Hände waren gefesselt. Hing er in der Luft? Verdammt, wäre er nur nicht so benebelt.
Wasser?
Regen!
Er legte den Kopf in den Nacken und öffnete den Mund. Es goss in Strömen, der Regen kühlte sein Gesicht. Es dauerte eine schreckliche Ewigkeit, bis er die erste winzige Menge im Mund gesammelt hatte. Er zwang sich, vorsichtig zu schlucken. Nur nicht zu gierig und das Wasser nicht in die Luftröhre bekommen. Bloß nicht wieder alles aushusten, dafür war es zu kostbar. Das Wasser rann durch die Kehle, benetzte die wunden Stellen und milderte so das Leid. Fast hätte er wie irr aufgelacht. Kostbar? Eine Handvoll Wasser, ein jämmerliches Schlückchen, stellte für ihn das Wertvollste dar, wonach es ihn im Moment verlangte? Lächerlich, einfach verrückt ... aber die schreckliche Wahrheit.
Einige Male wiederholte er die Prozedur, schluckte und streckte die Zunge erneut dem Regen entgegen. Dann war der Durst zwar nicht verschwunden, aber so weit gemildert, dass er wieder über andere Dinge nachdenken konnte. Die Furcht kehrte zurück und krallte sich in die Muskeln. Er war nackt. Jetzt konnte er es sehen: Er hing an einem Drahtseil. Das fahle Mondlicht fiel durch eine kreisrunde Öffnung weit über ihm und schimmerte auf dem Metall. Vage konnte er dort oben auch den Schatten eines Balkens erkennen, an dem vermutlich das Seil befestigt war. Er wandte den Kopf hin und her. In einer Schulter knackte es. Ein schmerzender Stich schoss in das Rückgrat. Verdammt, er war eindeutig zu alt, um hier wie ein totes Schwein am Haken zu hängen. Lange würde er es nicht aushalten können. Er versuchte, die Schmerzen so weit wie möglich zu verdrängen.
Kreisförmig um sich herum erkannte er feuchtes, unverputztes Mauerwerk. Es roch modrig. Vielleicht ein Brunnen. Ja, er hing in einem Brunnen, und der Balken über ihm war kein einfacher Balken, sondern die Winde, mit der normalerweise das Seil für den Eimer aufgewickelt wurde.
Er blickte nach unten. Seine Zehen fühlten sich an, als würden sie im Eis stecken. Eine Wasseroberfläche glitzerte im Licht. Bis zu den Knöcheln hingen die Füße in dem kalten Wasser. Er zog die Knie an, bis er die Zehen sehen konnte. Bereits nach einigen Sekunden keuchte er. Lange konnte er die Position nicht halten, das war ihm klar.
Ihm fiel auf, dass seine Blase nicht mehr drückte. Offensichtlich hatte er sich während der Bewusstlosigkeit erleichtert.
War er deswegen nackt? Hatte der Entführer ihn ausgezogen, weil die Kleidung stank wie ein Autobahnraststättenklo an einem Samstag in den Sommerferien? Ein Funken Mitgefühl?
Nein, davon durfte er nicht ausgehen. Bisher war er alles andere als mit Samthandschuhen angefasst worden. Vermutlich sollte er nur noch mehr gedemütigt werden.
Die Oberschenkelmuskulatur brannte vor Anstrengung. Am liebsten hätte er die Beine wieder hängen lassen. Doch er fürchtete die Konsequenzen. Wie lange konnte er es aushalten, die Füße in das kalte Wasser zu tauchen? Wann würde er ernsthaften Schaden davontragen? Er erinnerte sich an den Obdachlosen, dem er in seiner Zeit als Assistenzarzt vor gut zehn Jahren vier Zehen wegen Erfrierungen amputieren musste. Schwarze, abgestorbene Stümpfe, die aussahen wie Kohlen.
Er schüttelte sich. Sollte ihn hier das gleiche Schicksal ereilen? Nicht wenn er es verhindern konnte. Er versuchte, sich nach oben zu ziehen. Da er aber mit den gefesselten Handgelenken keine Möglichkeit fand umzugreifen, gab er es auf. Aber vielleicht gelang es ihm zumindest, eine andere Position einzunehmen. Mit den tauben Füßen drückte er sich am Mauerwerk ab. Er schwang einige Zentimeter zurück und stieß mit dem Gesäß gegen die andere Seite. Für Sekunden gelang es ihm, sich wie ein Korken in der Flasche zwischen den Steinen einzuspreizen, mit dem Rücken auf der einen Seite, die Fußsohlen auf der anderen. So saß er knapp einen Meter über dem Wasser. Diese Technik hatte er als Kind benutzt, um sich im Türrahmen der Küche nach oben zu drücken. Könnte es hier auch glücken? Einen Versuch war es wert.
Vorsichtig schob von Stollwerk sich mit dem Rücken nach oben. Die Kanten der kalten Steine drückten unangenehm in die Wirbel, das Seil surrte. Als Nächstes folgte das erste Bein, dann das zweite. Es funktionierte. Hoffnung keimte auf. Er würde es dem Dreckskerl zeigen. Der würde sich wundern. Von Stollwerk freute sich darauf, ihm alles heimzuzahlen, ihm das Seil um den Hals zu legen und zuzuziehen.
Weitere Zentimeter ging es nach oben. Die Oberschenkelmuskeln zitterten vor Anstrengung, Schweiß perlte trotz der Kälte in dem Schacht aus jeder Pore. Weiter, weiter, nicht aufgeben, spornte er sich selbst an. Fünf Minuten später schnaufte er wie ein untrainierter Marathonläufer nach dem ersten Kilometer. Sein Rücken fühlte sich wundgescheuert an. Noch einmal die gleiche Strecke und die Knochen würden freiliegen, fürchtete er.
Wie weit war es noch? Er blickte hoch, versuchte die Entfernung bis zum rettenden Rand abzuschätzen. Zehn Meter? Das Seil hing inzwischen durch, die malträtierten Schultergelenke waren entlastet. Zumindest eine winzige Erleichterung bei der ganzen Qual.
Der Blick nach unten auf die glitzernde Wasseroberfläche verriet ihm, dass er bestenfalls einen Meter geklettert war. Verbissen mobilisierte er alle Kräfte, die er in seinem überanstrengten Körper finden konnte. Zentimeter für Zentimeter schob er sich aufwärts, presste vor Anstrengung so fest die Zähne aufeinander, dass es knirschte.
Er würde es schaffen ... er musste den Rand erreichen ... weiter ... wer weiß, was der Typ sonst noch mit ihm vorhatte ... wieder drei Zentimeter ...
Ohne Vorwarnung verhärtete sich sein linker Wadenmuskel.
Ein Krampf!
Von Stollwerk jaulte wütend auf. »Scheiße«, presste er durch die zusammengebissenen Zähne und spürte zugleich, wie er abrutschte.
Für ein paar Sekunden hielt er sich noch in seiner Position, dann hatte er den Kampf gegen den Muskel und die Schwerkraft verloren. Er fiel nach unten, das Seil spannte sich und riss ihn in die Senkrechte. Die Handgelenke knackten wie trockene Äste, auf die jemand trat. Heiß pulsierte vom rechten Gelenk ein bösartiger stechender Schmerz durch den Arm bis hoch zur Schädeldecke. Von Stollwerk schrie auf, helle Punkte tanzten vor seinen Augen.
Verfluchte Scheiße! Gebrochen! Ich habe mir das Handgelenk gebrochen.
Als Arzt gab es für ihn daran keinen Zweifel. Ein Fluchtversuch war damit unmöglich. Schon jetzt fühlte sich jede noch so kleine Bewegung an, als würde ihm jemand mit einem Dolch den Arm aufschlitzen. An einen erneuten Aufstieg war nicht zu denken. Er konnte froh sein, wenn es ihm gelang, regungslos zu verharren.
Die Ausweglosigkeit traf ihn mit voller Wucht, raubte ihm jede Hoffnung. Er öffnete den Mund, wollte die Verzweiflung herausschreien. Doch nur ein Krächzen entwich seiner Kehle. Er sammelte seine Kräfte, legte die ganze Wut in den einen Schrei. Vielleicht würde ihn ja jemand hören und befreien.
Er schrie.
Im selben Augenblick schoss ein Stromschlag durch seinen Körper und elektrisierte von den Fingerspitzen bis zu den Fußsohlen jeden Muskel. Unkontrolliert zuckte er, die Kiefermuskeln verkrampften. Wieder knackte etwas.
Endlich wurde der Strom abgeschaltet.
Blut sammelte sich in seinem Mund. Hustend spuckte er es mit einem Stück Backenzahn aus.
Der Typ ist wahnsinnig! Völlig wahnsinnig!
Zum ersten Mal wurde von Stollwerk bewusst, dass es um Leben und Tod ging.
Kapitel 6
Ninas Blick wanderte über das Gruppenbild. Wie jung sie damals gewesen waren. Sie saßen auf den Stufen der Treppe, die vom Rheinufer zum Heinrich-Böll-Platz hinaufführte. Das Foto hatte ein Engländer geschossen, der zufällig vorbeigekommen war. Ein windiger Tag, daran erinnerte sie sich noch genau. Dem Engländer, ein junger Bursche bepackt mit einem riesigen Rucksack, waren immer wieder die langen Haare ins Gesicht und über die Linse geweht.
Kerzengerade und mit einem stolzen Blick in die Kamera saß Rike ganz links. Ihre nachtschwarzen Haare glänzten seidig, ihre zierliche Figur verbarg sie unter viel zu großer Kleidung. Sie war das Küken in der Clique gewesen. Allerdings benahm sie sich nicht so. Sie provozierte gern, brachte sich mit Vorliebe in brenzlige Situationen. Ihr freches Mundwerk hatte ihr immer wieder blaue Flecken eingetragen. Nie zeigte sie Schwäche, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Aber Nina wusste, dass es auch eine andere Seite gab, eine einfühlsame, empfindliche, verletzliche Rike. Doch die bekam man nur in seltenen Momenten zu Gesicht.
Neben Rike saß Mike, lässig einen Arm um sie gelegt, und grinste anzüglich in die Kamera. Die beiden waren kein Paar gewesen, wenngleich Mike alles unternommen hatte, um Rike von seinen Vorzügen zu überzeugen. Rike ertrug es mit stoischem Gleichmut, vermutlich, weil sie in Gefahrensituationen stets auf Mikes Fäuste schwingende Unterstützung zählen konnte. Wie ein Bulldozer walzte er dann mit seinem massigen Körper von fast zwei Metern Länge und 120 Kilo Gewicht alles nieder, was Rike in die Quere kam. Bud Spencer war im Vergleich zu Mike ein schmächtiger Waisenknabe. Stets hatte er eine Baseballkappe auf dem Kopf getragen, die vermutlich die dünnen und schütteren blonden Haare verbergen sollte.
Eine Stufe höher hinter Mike saß Tim und hielt Mike mit zwei ausgestreckten Handflächen Hasenohren an den Hinterkopf. Mit seiner spitzbübischen Erscheinung und den amüsiert hochgezogenen Mundwinkeln wirkte er, als könnte er keiner Fliege etwas zuleide tun. Noch heute war Nina davon überzeugt, Tims Auftreten hatte ihnen damals den Hintern gerettet. Niemand hätte Tim zugetraut, dass er einem frech ins Gesicht lügen konnte, ohne rot zu werden.
Rechts neben Tim saß Fabian, ein sehniger, schlaksiger Typ. Auf Fabians Wange leuchteten frische Kratzspuren. Ein Andenken an eins ihrer »Spiele«. Ein angenehmes Kribbeln lief über Ninas Rücken, vergleichbar mit einem gering pulsierenden Stromstoß, der über die Haut mäanderte. Ein Empfinden, das sie so lange nicht mehr gespürt hatte. Gleichzeitig krampfte sich ihr Magen zusammen. Widerstreitende Gefühle rangen in ihr, bezogen konträre Positionen, wie schwarz und weiß, Licht und Schatten, Recht und Unrecht oder ... Macht und Erniedrigung.
Es waren alles andere als »Spiele« gewesen. Trotzdem hatte es sie entspannt und gleichzeitig in Euphorie versetzt. Wenn sie »spielten«, konnten sie ihre Umwelt komplett ausblenden, den ganzen Schulstress, den Druck, den ihre Eltern ausübten, und die Unsicherheit, die vermutlich jeder Heranwachsende mit seinem sich verändernden Körper spürt. Längst vergessene Bilder tauchten vor ihrem inneren Auge auf, das elektrisierende Kribbeln verstärkte sich.
Fabian umarmte die etwas pummelige Jana, die auf seinen Oberschenkeln hockte und ihn mit ihren dunklen Kulleraugen verliebt anhimmelte.
Nina grinste. Dick und Doof hatten sie die beiden heimlich genannt.
Das Klingeln des Telefons holte sie aus der Vergangenheit. Sie ignorierte es. Sie wollte nicht gestört werden. Doch der Anrufer gab nicht auf. Leise fluchte sie. Warum hatte sie nicht daran gedacht, das Telefon abzuschalten? Sie schloss das Album und sah zum Telefon auf dem Schreibtisch. Das Gerät stand in der Ladestation, das Display leuchtete bläulich. Unbekannt, las sie.
Ring ... ring ... ring ...
Sicherlich eine Nervensäge von der Presse, die sie interviewen wollte. Darauf verspürte sie im Moment überhaupt keine Lust. Wann schaltete sich ein Anruf eigentlich automatisch ab? Irgendwann ging die Leitung doch auf besetzt, oder? Es dauerte eine Ewigkeit, endlich verstummte das Klingeln.
Erleichtert schnaufte Nina durch und schlug das Album wieder auf. Ihr Blick blieb bei Steffs kantigem Gesicht hängen. Seine blauen Augen strahlten wie zwei Topase. Die Augen! Wahnsinn! Nach all den Jahren faszinierten sie Nina immer noch. Dieser Klarheit konnte man sich nicht verschließen, sie jagte ihr Wonneschauer über die Haut.
Steff.
Sie seufzte. Alles, was Steff von sich gab, hatte völlig überzeugend geklungen. Als würde er sie bei jedem Satz hypnotisieren. Vermutlich war es nicht nur ihr so ergangen. Steff war der konkurrenzlose Kopf der Clique gewesen. Sie hatten nie darüber abgestimmt, Steff hatte es nie eingefordert, es war einfach so. Ein stummer Konsens hatte ihn dazu befördert.
Steff saß vor Jana und Fabian auf der Stufe darunter. An seiner Seite, mit dem Kopf an seine Schulter gelehnt, erkannte sich Nina selbst. Sie waren ein Herz und eine Seele gewesen, total ineinander verknallt. Für ihn hätte sie Vater und Mutter verraten und noch nicht einmal ein Judasgeld dafür verlangt.
Sanft streichelte sie über die Stelle auf dem Bild. Ihre Finger zitterten. Der angelaufene Silberring an ihrem Ringfinger kratzte auf dem Papier. Ihr Verlobungsring. Steff hatte ihn ihr vor dem ersten Mal geschenkt und ihr sein Versprechen gegeben, sie irgendwann zu heiraten. Ein Teenagerversprechen, so viel wert wie ein falscher Fünfziger. Das wusste sie heute. Doch damals hörte sich alles so gut und aufrichtig an, ein Versprechen für die Ewigkeit, bis der Tod sie scheiden würde. Und wer weiß, vielleicht wäre es tatsächlich so gekommen, in einer normalen Welt, in einem gewöhnlichen Leben. Doch das große, das letzte »Spiel« hatte etwas in ihnen zerbrochen.
Nina kämpfte gegen die Tränen an. Verdammt, warum hatten sie alle sich nur darauf eingelassen? Sie wischte sich mit dem Ärmel über die Augen.
Ihre Wege hatten sich mit Beginn des Studiums getrennt, sie studierte in Köln, er in Berlin. Anfänglich gab es noch Telefonate, in den Hörer gemurmelte Liebesschwüre, von seiner Seite Plattitüden, sie spürte es, ignorierte es aber tapfer. Es durfte nicht sein, sie liebte ihn doch. Nicht lange danach schlief alles ein. Anfänglich war sie dann sogar erleichtert gewesen. Nicht mehr mit Steff zu reden bedeutete zugleich, nicht mehr an das schreckliche »Spiel« erinnert zu werden. Das Vergessen fiel ihr so leichter. Vermutlich war genau das auch der Grund, warum die Clique zerbrach und sich die Mitglieder in alle Himmelsrichtungen verteilten. Doch die Sache war damit nicht erledigt. Nach einer Weile spürte sie, dass sie von Steff nicht wirklich loskam. Die Liebe zu ihm brannte heiß in ihrem Körper, wurde mit jedem Tag der Trennung stärker und bestimmte ihre Gedanken. Sie kam zu dem Entschluss, ohne ihn nicht leben zu wollen. Nur reagierte er nicht mehr auf ihre Annäherungsversuche, ließ sich von Kommilitonen verleugnen, Briefe liefen ins Leere. Irgendwann hatte einer seiner Freunde ein Einsehen und teilte ihr mit, Steff hätte längst eine neue Liebe in Berlin gefunden. Nina war es wie ein Verrat vorgekommen, sie hatte den Silberring vom Finger gerissen und in die Ecke gefeuert. Rollend war er unter dem Sofa verschwunden. Dort hatte sie ihn während des später folgenden Umzugs entdeckt – und wieder angesteckt.
Ein schleifendes Geräusch aus dem Flur erregte Ninas Aufmerksamkeit. Sie runzelte die Stirn, legte das Fotoalbum zur Seite und stand auf. Auf den ersten Blick konnte sie nichts Ungewöhnliches erkennen. Dann sah sie den Umschlag, den jemand unter der Wohnungstür durchgeschoben hatte. Verwundert nahm sie ihn hoch. Wieder kein Absender, wieder die steile Handschrift. Diesmal nur ihr Name: Nina.
Ihr Puls begann zu rasen, Adrenalin schoss durch ihre Blutbahn. Er war hier gewesen, direkt vor ihrer Tür. Bestimmt war er es auch gewesen, der eben versucht hatte, sie telefonisch zu erreichen. Sicherlich hatte er gedacht, sie sei nicht zu Hause.
Na warte.
Nina riss die Wohnungstür auf, stürmte an das Geländer und sah hinunter. Das Treppenhaus war so gebaut, dass sich in der Mitte ein Lichtschacht befand. So konnte man bis zu den Fliesen im Erdgeschoss blicken. Ganz unten am Treppenabsatz sah sie eine Gestalt in einem schwarzen Sweatshirt, auf dem Kopf eine graue Stoffmütze. Das musste er sein. Wer lief schon bei den Temperaturen mit solch warmer Kleidung herum, wenn er nicht möglichst unerkannt bleiben wollte?
Mit großen Sätzen sprang Nina die Stufen hinunter. Sie musste den Fremden einholen, dann wäre der Spuk schnell vorbei.
Der Typ schien sie bemerkt zu haben, denn sie hörte ihn jetzt laufen. Kurz darauf fiel die Haustür krachend ins Schloss.
Nina beeilte sich. Auf den Fliesen im Erdgeschoss schlitterte sie auf ihren Socken, ein wildes Armrudern rettete sie vor dem Sturz. Entschlossen zog sie an der Haustür und lief auf den Gehweg. Dort blieb sie stehen und sah sich um. Wo war der Kerl hin? Autos parkten in engen Reihen links und rechts der Straße. Versteckte er sich dahinter? Eine Frau kam von rechts, zwei riesige Einkaufstüten in der Hand, Kinder fuhren auf dem gegenüberliegenden Gehweg Fahrrad.
Da war er!
Fünfzig Meter entfernt bog die Gestalt gerade nach links in die nächste Seitenstraße ein. Fast hätte Nina ihn übersehen. Ein mit Stoffbahnen verkleidetes Gerüst am Nachbarhaus warf einen Schatten, mit dem der Flüchtende in der dunklen Kleidung fast verschmolz.
Nina spurtete los. Geschickt sprang sie über einen Hundehaufen, wich einer zerbrochenen Bierflasche aus, schoss Sekunden später um die Straßenecke – und rannte in einen Kinderwagen hinein. Der Wagen sprang in die Höhe und krachte zurück auf den Gehweg. Babyspielzeug rasselte über den Beton. Schmerzhaft bohrte sich das Gestell des Wagens in Ninas Unterleib. Keuchend klappte sie zusammen und setzte sich hin.
Ein Baby schrie laut.
Eine Frau zeterte in einer fremden Sprache.
Nina achtete nicht weiter darauf. Der Kinderwagen stand aufrecht, außer einem Schreck war dem Kind nichts passiert. Mühsam rappelte sie sich auf, murmelte eine Entschuldigung und sammelte das verstreute Spielzeug ein. Dann ließ sie die immer noch lautstark schimpfende Frau stehen und nahm die Verfolgung wieder auf. Doch bereits an der nächsten Kreuzung erkannte sie, dass die Gestalt ihr entkommen war. Nirgends war jemand mit einem dunklen Sweatshirt zu sehen. Nur zwei Männer schraubten an einem parkenden Auto mit geöffneter Motorhaube. Sollte sie die beiden befragen? Allerdings hingen die Männer tief mit den Köpfen im Motorraum und unterhielten sich lautstark über Ventilspiel und Nockenwelle. Kaum anzunehmen, dass sie irgendetwas um sich herum wahrgenommen hatten.
»So ein Mist«, fluchte Nina. Hätte die Mutter mit dem Kinderwagen nicht im Weg gestanden, wäre jetzt vielleicht schon alles aufgeklärt. So war er entkommen und konnte das Spiel weiterhin mit ihr treiben.
Resigniert wandte sich Nina um und machte sich auf den Heimweg.
Kapitel 7
Warum macht sich niemand die Mühe und entfernt das Moos auf dem Grabstein? Es sieht so ungepflegt aus, so lieblos, als wäre es egal, wer in dem Grab liegt.
Na ja, zumindest sprießen bunte Blumen vor dem Stein. Sind das Veilchen? Oder Tulpen? Auf keinen Fall sind es Rosen, die kann ich zuordnen. Und Hortensien, die erkenne ich auch. Die blühen im Sommer neben dem Springbrunnen, bei dem ich im Garten so gerne sitze. Ansonsten kenne ich mich mit dem Grünzeug nicht aus. Wie auch, so etwas hat mir ja niemand beigebracht. Wie so vieles nicht. Nicht der Mühe wert, Perlen vor die Säue. Ich weiß genau, was die Leute denken. Nur wenige kennen mich wirklich und wissen, was in mir steckt. Wie mein Bruder zum Beispiel. Er steht neben mir, die Hände gefaltet, den Blick gesenkt.
Die meisten nehmen mich gar nicht richtig wahr. Häufig schmerzt das, dann brodelt Wut in mir, und ich würde sie am liebsten anschreien. Aber ich sollte nicht so streng mit meinen Mitmenschen sein. Sie können nichts dafür, vermutlich wäre ich genau so in ihrer Situation.
Wer hat schon jeden Tag Lust, aus seinen Träumen gerissen zu werden? Tief in Gedanken zurückgezogen zu sein ist gelegentlich ganz angenehm. Auf die abstrusesten Ideen kommt man so und kann über die besten Foltermethoden nachsinnen. Wasserfolter. Ja, Wasser ist toll. »Waterboarding« kenne ich nur zu genau. Simuliertes Ertränken. Das Opfer fesseln, ein Tuch über das Gesicht legen und schön feucht halten. Der Würgereflex erledigt den Rest. Ertrinken auf dem Trockenen, ha, ha. Und das alles, ohne eine Spur von körperlicher Gewalt zu hinterlassen. Ich kenne da ein paar Leute, bei denen ich das bei nächster Gelegenheit ausprobieren werde.
Tief atme ich durch und konzentriere mich wieder auf das Hier und Jetzt. Es ist ruhig auf dem Friedhof. Die Baumkronen über uns werfen Schatten auf die gekiesten Wege. Nur vereinzelt verirrt sich ein Sonnenstrahl bis zu uns. Die wenigen Besucher schleichen umher, als fürchteten sie, die Toten aufzuwecken. Die Atmosphäre gefällt mir. Alles wirkt so friedlich.
Zum ersten Mal hat mein Bruder mich hierher zum Grab unserer Eltern mitgenommen. Er schlägt mir nie eine Bitte ab. Ich bin ihm dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Mein Groll über den ungepflegten Stein verpufft. Mein Bruder ist ein vielbeschäftigter Mann, er kann sich nicht um alles kümmern. Und schließlich ist es auch egal, wie so ein Grab aussieht. Was wirklich wichtig ist, sind die Bilder, die man sich bewahrt.
Ich sehe meine Mutter in unserer Küche stehen. Ich sitze am Tisch und schau ihr zu. Wie alt war ich da? Vier? Fünf? Auf jeden Fall noch nicht eingeschult. Sie entkernt Kirschen, die sie auf dem Wochenmarkt gekauft hat. Kirschen sind teuer, erklärt sie mir, aber selbstgemachte Marmelade, darauf möchte sie nicht verzichten. Fast spüre ich den fruchtigen, zuckersüßen Geschmack der Marmelade auf meiner Zunge. Ich habe Mühe, den Speichel zu schlucken.
Sie war der gute Geist im Haus gewesen, nichts brachte sie aus der Ruhe. Streng in der Erziehung, keine Frage, aber immer gerecht. Ich habe sie geliebt, trotz der Tracht Prügel, die sie mir hin und wieder verabreichte.
Wie gerne hätte ich es ihr noch ein einziges Mal gezeigt. Doch sie ist zu früh gegangen, ich hatte keine Chance mehr dazu. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass sie es sicher gespürt hat.