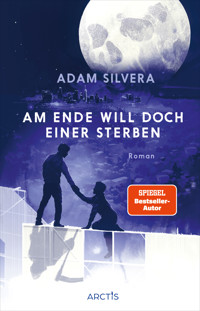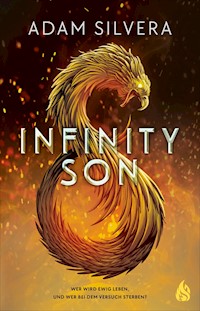13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das bewegende Debüt des SPIEGEL-Bestsellerautors jetzt auch auf Deutsch Nicht umsonst vom TIME Magazine unter die 100 besten Jugendbücher aller Zeiten gewählt: Adam Silveras ›More Happy Than Not‹ ist eine Gefühlsachterbahn durch die bittere wie schöne Realität. In Aarons Leben gibt es vieles, das er lieber für immer vergessen würde. Doch erst als sein bester Freund Thomas Aarons Gefühle für ihn zurückweist beschließt er, sich mit Hilfe einer neuartigen Gehirnmanipulation seine Erinnerungen an alles, was war, und alles, was er ist, löschen zu lassen. Auf schmerzlichste Weise muss er lernen, dass das Herz sich erinnert, auch wenn der Verstand längst vergessen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Adam Silvera
More Happy Than Not
Roman
Aus dem Englischen von Lisa Kögeböhn
Dieses Buch enthält Szenen und Gedanken zum Thema Suizid und homophobe Gewalt, die einige Leser:innen beunruhigen könnten. Betroffene finden Hilfe unter anderem bei der TelefonSeelsorge (www.telefonseelsorge.de) oder bei der LGBT+ Helpline (www.lgbt-helpline.ch).
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel More Happy Than Not bei Soho Teen, ein Imprint von Soho Press, Inc. 2020 erschien die Neuauflage als Deluxe Edition mit einem Vorwort von Angie Thomas und einem Zusatzkapitel ebenfalls bei Soho Teen.
Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Buch wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich 2022
© Text: Adam Silvera, 2015
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
© Vorwort: Angie Thomas, 2020
Published by Arrangement with ACTHOMASWRITESLLC
Übersetzung: Lisa Kögeböhn
Coverillustration: Alexis Franklin
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03880-158-0
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Für alle, die feststellen mussten, dass das mit dem Glück gar nicht so einfach ist.
Und natürlich für Luis und Corey, meine beiden Lieblingsmenschen, mit denen mich nur die besten Erinnerungen verbinden.
VORWORT
More Happy Than Not hat mich verändert, keine Frage.
Aaron Sotos Geschichte hatte von der ersten Zeile an eine Sogwirkung auf mich. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich den Roman im Buchladen um die Ecke aus dem Regal genommen und aufgeschlagen habe – ich lese nie den Klappentext, sondern immer die ersten paar Sätze. Nach dem ersten Satz las ich die erste Seite, dann die zweite und dritte. Ich war wie gebannt. Und ich war perplex, denn beim Lesen dieser ersten paar Seiten dämmerte mir:
Ich kenne diese Figuren.
Aaron, Genevieve, Brendan, Baby-Freddy und sogar Me-Crazy waren Kids, die ich von früher kannte. Nein, ich bin nicht in der Bronx aufgewachsen, sondern Welten entfernt davon in Mississippi, wo es weder eine U-Bahn noch Eckläden gibt, und trotzdem kamen mir diese Figuren bekannt vor. Ihre Geschichten zu lesen, fühlte sich an, als würde ich meine eigene Welt durch eine andere Brille sehen: eine einzigartige, faszinierende Brille, die völlig anders war als alles, was ich bis dahin aus Young-Adult-Romanen kannte.
Dadurch, dass Adam Silvera eine Welt erschaffen hatte, die seiner eigenen ähnelte, kam es mir plötzlich vor, als hätte er mir die Erlaubnis gegeben, es ihm gleichzutun. Ich hielt ein Buch über junge People of Color in der Hand, die endlich selbst die Stars sein durften statt wie sonst immer nur die Sidekicks. Aaron durfte komplex, kompliziert und so viel mehr als nur ein Stereotyp sein.
Ich gbe zu, zeitweise ist mir das Buch an die Nieren gegangen, aber das sollte es ja auch. Ich werde jetzt garantiert nicht das Ende verraten, aber lasst euch gesagt sein, dass ich hinterher tagelang zu nichts zu gebrauchen war. Ich bekam Aaron und seine Geschichte einfach nicht aus dem Kopf und hätte gern nach ihm geschaut, als wäre er ein echter Mensch. (Ehrlich gesagt habe ich Adam in unserem ersten Gespräch tatsächlich gefragt, wie es Aaron geht.) Aber mit seinem herzzerreißenden Ende hat Adam mich noch an etwas anderes erinnert – auch ein nicht ganz so glückliches Ende ist okay, beziehungsweise ist es okay, wenn es mal weniger gut läuft, als man es gerne hätte. Gerade junge Menschen sollten wissen, dass es okay ist, wenn ein Ende mal nicht märchenhaft ist. Vor allem, weil ihr Leben doch gerade erst anfängt. In More Happy Than Not geht es genau darum, und nachdem ich es in diesem Roman gesehen habe, halte ich es in meinen eigenen Romanen genauso.
Ich hoffe, More Happy Than Not lässt dich wie gebannt lesen und zerreißt dir das Herz. Ich hoffe, es erinnert dich daran, dass es total okay ist, wenn mal nicht alles okay ist. Nein, mehr noch, ich hoffe, du vergisst es nie.
Danke, Adam.
Danke, More Happy Than Not.
Angie Thomas, Autorin von The Hate U Give
TEIL EINS:GLÜCK
1ERINNERUNGEN, DIE RICHTIG REINHAUEN
Der Leteo-Eingriff ist offenbar doch kein Fake.
Als ich das Plakat in der U-Bahn zum ersten Mal sah, dachte ich, es wäre Werbung für irgendeinen Science-Fiction-Film und kein echtes Institut, das einem beim Vergessen hilft. Und als ich die Überschrift »Heute da, morgen weg!« auf dem Titelblatt einer Zeitung las, dachte ich an ein neues Grippemittel oder so was Lahmes – wer hätte auch ahnen können, dass von Erinnerungen die Rede war. An dem Wochenende hat es total geregnet, deshalb chillten meine Freunde und ich im Waschmaschinenraum vor dem alten Fernseher des Wachmanns. Auf allen Nachrichtensendern wurden Vertreter vom Leteo-Institut interviewt, die was über die »revolutionären Erkenntnisse zur Gedächtnisanpassung und Erinnerungsunterdrückung« erzählten.
Alles Fake, dachte ich nach jedem einzelnen Interview.
Inzwischen wissen wir allerdings, dass der Eingriff zu hundert Prozent wirksam und zu null Prozent Fake ist, weil einer von uns ihn hinter sich hat.
Zumindest laut Brendan, meinem fast-besten Freund. Und der ist genauso für seine Ehrlichkeit bekannt wie Baby-Freddys Mutter dafür, auf Teufel komm raus jedem Gerücht auf den Grund zu gehen. (Angeblich macht sie gerade einen Französischkurs, weil sie wegen der Sprachbarriere nicht zweifelsfrei feststellen kann, ob ihre Nachbarin wirklich eine Affäre mit dem verheirateten Hausmeister hat. Aber gut, das ist auch nur ein Gerücht.)
»Also ist das mit Leteo kein Quatsch?« Ich setze mich neben die Sandkiste, in der keiner spielt, weil man sich sonst was darin einfangen kann.
Brendan läuft hin und her und dribbelt mit dem Basketball von unserem Kumpel Deon zwischen seinen Beinen herum. »Deswegen sind Kyle und seine Eltern weggezogen«, sagt er. »Neustart.«
Ich muss nicht fragen, was Kyle vergessen wollte. Sein Zwillingsbruder Kenneth wurde im Dezember erschossen, weil er mit der kleinen Schwester von Jordan geschlafen hat. Dabei war es eigentlich Kyle, der mit ihr im Bett war. Was Trauer angeht, kenne ich mich ziemlich gut aus, aber mit so was zu leben, kann ich mir nicht vorstellen – zu wissen, dass der Bruder, mit dem ich Gesicht und Geheimsprache geteilt habe, mit Kugeln aus dem Leben gerissen wurde, die eigentlich für mich bestimmt waren.
»Ist doch schön für ihn, oder?«
»Klar, Mann«, sagt Brendan.
Außer uns sind die üblichen Verdächtigen unterwegs. Skinny-Dave und Fat-Dave – sie sind nicht verwandt oder so, dass sie beide Dave heißen, ist Zufall – kommen mit Trinkpäckchen und Chipstüten aus dem Good Food’s Store, unserem Laden an der Ecke, in dem ich seit ein paar Monaten jobbe. Baby-Freddy fährt auf seinem neuen Rad in Orange-metallic vorbei, und ich weiß noch, dass wir ihn ewig wegen seiner Stützräder fertiggemacht haben – dabei bin ich der Letzte, der sich lustig machen darf, immerhin ist mein Vater nicht mal dazu gekommen, mir überhaupt Fahrradfahren beizubringen. Me-Crazy sitzt auf dem Boden und unterhält sich mit der Wand, und alle anderen, genauer gesagt alle Erwachsenen, bereiten sich auf das Event des Jahres vor, das am Wochenende ansteht.
Family Day.
Das wird der erste Family Day ohne Kenneth und Kyle, ohne Brendans Eltern und ohne meinen Dad. Nicht dass ich mich auf Vater-Sohn-Aktionen wie Schubkarrenrennen oder Basketball gefreut hätte – wenn, dann waren sowieso immer nur Dad und mein Bruder Eric ein Team –, aber alles Vater-Sohn-Mäßige wäre besser als nichts. Für Brendan ist es garantiert auch nicht leichter, dabei leben seine Eltern noch. Vielleicht ist es sogar schlimmer, weil sie unerreichbar in zwei winzigen Zellen sitzen, aus unterschiedlichen Gründen: seine Mutter wegen bewaffnetem Raubüberfall und sein Vater, weil er einen Polizisten angegriffen hat, der ihn beim Meth-Dealen erwischt hat. Jetzt wohnt Brendan bei seinem achtundachtzigjährigen Großvater, von dem man auch nicht so genau wissen will, wie der sich durchschlägt.
»Die erwarten bestimmt freundliche Gesichter von uns«, sage ich.
»Die können die sich sonst wo hinstecken«, kontert Brendan. Er schiebt die Hände in die Hosentaschen, in denen er garantiert Gras hat – Dealen ist seine Taktik, schneller erwachsen zu werden, dabei hat genau das seinen Dad vor acht Monaten in den Knast gebracht. Er guckt auf die Uhr, und es fällt ihm sichtlich schwer, die Zeiger richtig zu lesen. »Muss los, bin verabredet.« Und schon ist er weg, ohne auf meine Antwort zu warten.
Er redet nie viel, deshalb ist er auch nur mein fast-bester Freund. Ein echter bester Freund würde einem mit richtig vielen Worten klarmachen, dass das Leben doch irgendwie schön ist, wenn man drüber nachdenkt, es zu beenden. So wie ich. Stattdessen ist er auf Abstand gegangen, weil er sich verpflichtet fühlte, mit den anderen Schwarzen Kids abzuhängen, was totaler Schwachsinn ist – fand ich damals und finde ich auch immer noch.
Ich vermisse die Sommerabende, an denen wir viel länger draußen geblieben sind, als wir durften, auf der schwarzen Gummimatte unter dem Klettergerüst rumlagen und über Mädchen und die Zukunft geredet haben – beides gefühlt unerreichbar. Damals hatte ich das Gefühl, alles könnte gut werden, solange wir zusammen hier festhängen. Inzwischen ist es eher Gewohnheit als Freundschaft, die uns verbindet.
Noch was, womit ich klarkommen muss, oder zumindest so tun, als ob.
Wir vier wohnen in einer Zweizimmerwohnung. Ich meine, wir drei. Drei.
Ich teile mir das Wohnzimmer mit Eric, der demnächst von seiner Schicht im Secondhand-Videospielladen auf der Third Avenue nach Hause kommen müsste. Dann wird er eine seiner beiden Spielkonsolen anschmeißen, sich per Headset mit seinen Online-Freunden unterhalten und zocken, bis sein Team um vier Uhr morgens aussteigt. Ich wette, Mom will ihn wieder überreden, Collegebewerbungen zu schreiben. Die Diskussion tu ich mir dann aber nicht an.
Auf meiner Zimmerseite liegen stapelweise ungelesene Comics. Die kaufe ich billig in meinem Lieblingscomicladen, für irgendwas zwischen fünfundsiebzig Cent und zwei Dollar, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht unbedingt lesen will. Ich hab einfach gerne eine Sammlung zum Angeben da, wenn Freunde vorbeikommen, die mehr Geld haben als ich. Eine Serie, The Dark Alternates, hab ich sogar abonniert, als letztes Jahr auf einmal die halbe Schule drauf stand, aber bisher bin ich nur dazu gekommen, sie durchzublättern, um zu gucken, ob den Künstlern irgendwas Spannendes eingefallen ist.
Wenn ich ein Buch wirklich mag, zeichne ich meine Lieblingsszenen: Bei World War Z den Sieg der Zombies in der Schlacht um Yonkers; bei Die Legende von Sleepy Hollow den Moment, in dem der Kopflose Reiter auftaucht, weil die Geistergeschichte, die bis dahin so lala war, mich da auf einmal gepackt hat; und bei Scorpius Hawthorne und der Sträfling von Abbadon – dem dritten Teil meiner Lieblings-fantasyreihe über einen bösen jungen Zauberer – die Szene, in der Scorpius den grausamen Abbadon mit seinem Zerreiß-Spruch erledigt.
In letzter Zeit habe ich kaum gezeichnet.
Die Dusche braucht immer ein paar Minuten zum Warmwerden, also drehe ich das Wasser auf und gehe nach Mom gucken. Ich klopfe an die Schlafzimmertür, aber sie reagiert nicht. Nur der Fernseher ist zu hören. Wenn dein einziger noch lebender Elternteil nicht reagiert, musst du automatisch daran denken, dass dein Vater tot in der Badewanne gefunden wurde – und an die Möglichkeit, dass hinter der Tür ein Leben als Waise wartet. Ich gehe rein.
Sie wacht gerade aus dem zweiten Schläfchen des Tages auf, Law & Order läuft. »Alles okay, Mom?«
»Alles okay, mein Sohn.« Sie nennt mich kaum noch Aaron oder »mein Baby«, und obwohl ich auf Letzteres nie besonders scharf war, vor allem in Gegenwart meiner Freunde, war es wenigstens ein Zeichen, dass noch Leben in ihr steckt. Jetzt ist sie einfach nur fertig.
Neben ihr liegen ein angebissenes Stück Pizza, das ich von Yolandas Pizzeria holen sollte, der leere Kaffeebecher, den ich ihr von Joey’s mitgebracht hab, und ein paar Leteo-Flyer, die sie selbst irgendwo mitgenommen haben muss. Sie hat schon immer an den Eingriff geglaubt, aber das muss nichts heißen, sie glaubt ja auch an Santería. Sie setzt ihre Brille auf, die praktischerweise die tiefen Falten kaschiert, die sie dem krassen Schichtdienst zu verdanken hat. Fünf Tage die Woche ist sie als Sozialarbeiterin im Washington Hospital und zusätzlich vier Abende an der Fleischtheke im Supermarkt, damit wir dieses mickrige Dach über dem Kopf nicht verlieren.
»Hat die Pizza nicht geschmeckt? Ich kann dir auch was anderes holen.«
Mom sagt nichts. Sie steht auf, zieht den Ausschnitt des Shirts zurecht, das sie irgendwann mal von ihrer Schwester geerbt hat und das jetzt dank ihrer »Armutsdiät« auch endlich passt, und umarmt mich so fest, wie sie es seit Dads Tod noch nicht getan hat. »Ich wünschte, wir hätten irgendwas tun können.«
»Äh …« Ich lege die Arme um ihre Schultern und weiß wie immer nicht, was ich sagen soll, wenn sie wegen dem weint, was Dad gemacht hat und was auch ich fast gemacht hätte. Mein Blick fällt auf die Leteo-Flyer. Wer weiß, vielleicht hätten die ihm helfen können – aber wir hätten eh nicht die Kohle dafür gehabt. »Ich muss mal unter die Dusche, sonst ist sie gleich wieder kalt. Tut mir leid.«
Sie lässt mich los. »Alles gut, mein Sohn.«
Ich tue so, als wäre alles gut, und gehe ins Bad, wo der Spiegel schon beschlagen ist. Schnell ziehe ich mich aus. Aber vor der Wanne zögere ich, weil sie – dank massenhaft Bleiche endlich wieder sauber – für immer der Ort bleiben wird, an dem er sich das Leben genommen hat. An jeder Ecke lauern Erinnerungen auf meinen Bruder und mich, die so richtig reinhauen: die Filzstiftmarkierungen an der Wand, wo er uns gemessen hat; das Ehebett, wo wir immer toben durften, wenn er Nachrichten geguckt hat; der Backofen, wo er uns Empanadas zum Geburtstag gemacht hat. Wir können nicht einfach davor weglaufen, indem wir in eine neue, größere Wohnung ziehen. Nein, wir sitzen in diesem Loch fest, wo wir Mäusekacke aus unseren Schuhen schütteln und vor dem Trinken in die Gläser gucken müssen, weil sich Kakerlaken reinstürzen, sobald wir uns wegdrehen.
Das Wasser ist nie lange heiß, deshalb steige ich unter die Dusche, bevor es zu spät ist.
Ich lege die Stirn an die Wand, lasse mir das Wasser über Kopf und Rücken laufen und überlege, welche Erinnerungen Leteo für mich begraben sollte. Sie haben allesamt mit dem Leben in einer Dad-losen Welt zu tun. Ich sehe mir die Narbe an meinem Handgelenk an. Nicht zu fassen, dass ich der Typ gewesen sein soll, der sich einen lachenden Mund ins Handgelenk geschnitten hat, weil er meinte, er würde niemals Glück finden, außer im Tod. Was auch immer meinen Dad dazu gebracht hat, sich umzubringen – seine schwere Kindheit mit acht großen Brüdern, sein Job in der berüchtigten Postfiliale einen Block weiter oder einer von Millionen anderen Gründen –, ich muss weitermachen und mich an die Leute halten, die nicht den einfachen Ausweg wählen, sondern meinetwegen am Leben bleiben, egal, wie scheiße es ist.
Ich fahre mit dem Finger über den Grinsesmiley, von links nach rechts und wieder zurück, und bin froh, dass er mich daran erinnert, nicht noch mal so eine Scheiße zu bauen.
2TAUSCH-DATE (KEIN PARTNERTAUSCH!)
Letztes Jahr im April, als wir im Fort Wille Park waren, hat Genevieve mich gefragt, ob ich mit ihr zusammen sein will. Meine Freunde meinten alle, das wär voll der krasse Rollentausch, aber die sind halt auch echt rückständige Idioten, was so was angeht. Für mich ist das jedenfalls eine wichtige Erinnerung – also, dass sie mich gefragt hat –, weil es heißt, dass Genevieve was Besonderes in mir gesehen hat und mein Leben so interessant fand, dass sie dran teilhaben wollte, und nicht so uninteressant, dass man es genauso gut wegwerfen könnte.
Dass ich vor zwei Monaten Du-weißt-schon-was begehen wollte, war nicht nur egoistisch, sondern peinlich. Wenn du überlebst, wirst du nämlich wie ein Kind behandelt, das man an die Hand nehmen muss, wenn man über die Straße geht. Sogar noch schlimmer, alle glauben, du wärst entweder nur auf Aufmerksamkeit aus gewesen oder zu dumm, es richtig zu machen.
Ich gehe zehn Blocks Richtung Downtown, wo Genevieve mit ihrem Dad wohnt. Ihr Dad kümmert sich kaum um sie, aber wenigstens lebt er noch. Ich drücke auf die Klingel und wünschte, ich hätte mit dem Fahrrad herfahren können. Meine Achseln stinken, und das T-Shirt klebt mir am Rücken, die Dusche vorhin hätte ich mir sparen können.
»Aaron!« Genevieve steckt den Kopf aus dem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock, und die Sonne bringt ihr Gesicht zum Leuchten. »Bin gleich da, muss nur kurz Hände waschen.« Sie zeigt mir ihre Hände, die mit gelber und schwarzer Farbe beschmiert sind, und zwinkert mir zu. Ich stelle mir vor, dass sie einen comichaften Smiley malt, aber bei ihrer Fantasie ist irgendwas Magisches wahrscheinlicher. Ein Hippogreif mit gelbem Bauch und rabenschwarzen Augen, der sich in einem Spiegelwald verirrt hat und nur mit der Hilfe eines goldenen Sterns wieder nach Hause finden kann. Oder so.
Ein paar Minuten später kommt sie runter und hat immer noch ihr fleckiges weißes Mal-Shirt an. Sie lächelt mich an und umarmt mich, und diesmal ist es nicht so ein halbes Lächeln wie sonst meistens. Es gibt nichts Schlimmeres, als sie traurig und mutlos zu sehen. Ihr Körper ist ganz verkrampft, und als sie sich endlich entspannt, rutscht ihr der hellgrüne Stoffbeutel, den ich ihr letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt habe, von der Schulter. Inzwischen ist er komplett bemalt – mit winzigen Städten und Szenen aus ihren Lieblingssongs.
»Hey«, sage ich.
»Hi.« Sie stellt sich auf die Zehenspitzen und küsst mich. Ihre grünen Augen glänzen feucht. Sie erinnern mich an das Regenwaldbild, das sie vor ein paar Monaten gemalt und dann abgebrochen hat.
»Was ist los? Ich stinke, oder?«
»Ja, total, aber das ist es nicht. Das Malen stresst mich gerade mega. Du bist meine Rettung.« Sie boxt mir gegen die Schulter, ihre aggressive Art zu flirten.
»Woran sitzt du denn gerade?«
»An einem Japanischen Zwergkaiserfisch, der aus dem Meer rausspaziert.«
»Hm. Ich dachte, du malst was Cooleres. Irgendwas Magisches mit einem Hippogreif oder so.«
»Tja, ich bin halt nicht gerne durchschaubar, Volltrottel.« So nennt sie mich seit unserem ersten Kuss kurze Zeit nach dem Tag im Park. Wahrscheinlich, weil wir erst zweimal mit den Köpfen aneinandergerasselt sind, als wäre ich der ahnungsloseste, unfähigste Küsser aller Zeiten. »Hast du Lust auf Kino?«
»Nee, eher auf ein Tausch-Date.«
Ein Tausch-Date hat nichts mit Partnertausch zu tun. Bei einem Tausch-Date – Erfindung von Genevieve – suche ich erst einen Ort aus, der sie interessiert, und dann umgekehrt. Und weil wir dabei unsere Lieblingsbeschäftigungen austauschen, hat sie es Tausch-Date genannt.
»Klar, gerne.«
Wir spielen Schere, Stein, Papier. Der Verlierer muss sich zuerst was einfallen lassen, und mit ihrem Papier hat sie keine Chance gegen meine Schere. Ich hätte zwar auch ohne Auslosen den Anfang machen können, weil ich sowieso weiß, wo ich mit ihr hinwill, aber ich will ihr was Bestimmtes sagen und weiß noch nicht genau, wie, deshalb schinde ich lieber ein bisschen Zeit. Sie geht mit mir zu meinem Lieblingscomicladen auf der 144th Street.
COMIC-ANSTALT
GESTÖRTVIELAUSWAHL
Die Eingangstür ist wie eine alte Telefonzelle lackiert, so eine, wie sie Clark Kent immer benutzt, wenn er sich in Superman verwandeln muss. Was er ausgerechnet an dieser Telefonzelle vorm Daily Planet so toll fand, hab ich nie ganz kapiert, aber als ich durch die Tür trete, geht es mir so super wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Ist Monate her, dass ich hier war.
Für Geeks wie mich ist die Comic-Anstalt der Himmel auf Erden. Der Typ hinter der Kasse hat ein Captain-America-Shirt an und füllt gerade Stifte auf, die wie Thors Hammer geformt sind. Kosten allerdings sieben Dollar. Genauso teure Figuren von Wolverine, Hulk und Iron Man stehen auf einem Regal, das aussieht wie der Kamin in Wayne Manor. Ich erwarte, dass der vierzigjährige Typ vor dem Regal, der garantiert noch Jungfrau ist, gleich einen Anfall wegen der Marvel-DC-Mischung kriegt, passiert aber nicht. Es gibt sogar einen Schrank voller Capes, die man kaufen oder für ein Fotoshooting im Laden ausleihen kann. Aber meine Lieblingsecke ist der Ausverkauf-Ständer mit den Dollar-Comics, weil, na ja, Comics für einen Dollar eben unschlagbar sind. Sie haben auch Actionfiguren, mit denen Eric und ich als Kinder gerne gespielt hätten, zum Beispiel einen Doppelpack aus Spiderman und Dr. Octopus. Oder die Fantastic Four, wobei Die Unsichtbare wahrscheinlich schnell irgendwo in unserem Zimmer verschwunden wäre – haha, kleiner Scherz! –, weil mein Lieblingsheld die Menschliche Fackel war und die von Eric Mr. Fantastic. Die Bösewichte fand ich eigentlich auch ganz cool, den Grünen Kobold und Magneto und so, weil mein Bruder immer nur auf die Guten stand und es sonst langweilig gewesen wäre.
Genevieve sucht bei Tausch-Dates eigentlich immer den Comicladen aus, weil sie genau weiß, dass ich hier glücklich bin, auch wenn das Freibad, wo ich Schwimmunterricht hatte, bis ich fast ertrunken wäre (lange Geschichte), auch keine schlechte Wahl war. Sie schlendert zu den Postern rüber, und ich steuere direkt auf den Ausverkauf-Ständer zu. Ich bin auf der Suche nach irgendwas Krassem, was mich auf Ideen für meine eigenen Comics bringt. Zuletzt hab ich an einem Panel von Sun Warden gearbeitet, meinem Held, der als Kind eine außerirdische Sonne verschluckt hat, um sie zu bewachen. Jetzt ist das Problem, dass seine Freundin und sein bester Freund vom Himmelsturm in den Schlund des Drachen zu fallen drohen, er aber nur einen retten kann und sich entscheiden muss. Superman hätte natürlich Lois Lane gerettet, bei Batman bin ich mir nicht so sicher – wahrscheinlich hätte er sich für Robin entschieden und nicht für seine Freundin der Woche. (Der Dunkle Ritter lässt nichts anbrennen, Mann.)
Ein paar Typen unterhalten sich gerade über den neuen Avengers-Film, also suche ich mir schnell zwei Comics aus und gehe zur Kasse. Wenn jemand mich spoilert, werd ich nämlich zum Hulk. Als der Film im Dezember im Kino lief, hab ich ihn verpasst. Kein Wunder, wir waren alle noch völlig fertig wegen Kenneth.
»Hey, Stanley.«
»Aaron! Lange nicht gesehen.«
»Ja, ich hatte viel um die Ohren.«
»Klingt geheimnisvoll. Musstest du mit einer Maske von Dach zu Dach zu springen?«
Ich brauche einen Moment, um zu antworten. »Familienkram.«
Ich gebe ihm meine Gutscheinkarte, um meine zwei Dollar-Comics zu bezahlen, und er zieht sie über die Kasse. Er versucht es noch mal, dann sagt er: »Nichts mehr drauf, Mann.«
»Was? Da waren auf jeden Fall noch ein paar Dollar übrig.«
»Ich fürchte, du bist ärmer als Bruce Wayne mit eingefrorenem Konto«, sagt er. Er ist sich auch für nichts zu schade – erstens sollte man so nicht mit Kunden reden, und zweitens bringt er diesen lahmen Witz seit Monaten. Selbst mit gesperrtem Konto hätte Bruce Wayne noch mehr Geld als ich, so viel ist klar.
»Soll ich sie dir zurücklegen?«
»Äh, schon okay, lass ruhig.«
Genevieve kommt zu uns. »Alles okay, Babe?«
»Ja, klar. Sollen wir los?« Mein Gesicht brennt, und mir steigen Tränen in die Augen, nicht, weil ich ohne die Comics nach Hause gehen muss – ich bin keine acht mehr –, sondern weil mir das Ganze vor meiner Freundin verdammt peinlich ist.
Ohne mich anzuschauen, greift sie in ihren Beutel und holt ein paar Dollar raus, was es irgendwie nur noch schlimmer macht. »Wie viel?«
»Gen, lass, ich brauch die nicht.«
Sie kauft sie trotzdem, gibt mir die Tüte und erzählt mir von einer Idee für ein Bild, irgendwas mit halb verhungerten Aasgeiern, die Schatten von Toten jagen, ohne die Leichen über ihren Köpfen zu bemerken. Eigentlich ganz cool. Und so gern ich mich auch für die Comics bedankt hätte, bin ich froh über ihre Taktik, das Thema zu wechseln, damit ich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss.
»Weißt du noch, als Kyle den Leteo-Eingriff hat machen lassen?«
»Weißt du noch« ist so ein bescheuertes Spiel, das wir manchmal spielen, bei dem wir uns an Sachen »erinnern«, obwohl sie erst vor Kurzem passiert sind oder gerade in dem Augenblick passieren. Damit will ich sie ablenken, während wir durch den Fort Wille Park an der 147th Street gehen, ganz in der Nähe der Postfiliale, in der mein Dad gearbeitet hat, und der Tankstelle, wo Brendan und ich früher immer Schokoladenzigaretten gekauft haben, wenn wir gestresst waren. (Jetzt machen wir manchmal Witze darüber, wie dumm und kindisch das war.)
»Wie können wir uns da eigentlich sicher sein? Ich meine, es hat ihn ja niemand dabei gesehen.« Genevieve springt an meiner Hand auf eine Bank und balanciert superwackelig über die Lehne. Irgendwann bricht sie sich noch das Genick, das weiß ich genau, und dann werde ich Leteo anbetteln, dass sie mir helfen, den Anblick wieder aus dem Kopf zu kriegen. »Wer weiß, könnte doch auch eine Lüge sein, die sich über die Gerüchteküche von Freddys Mom verbreitet hat. Außerdem ist es auch ein bisschen extrem, zu sagen, er hätte Kenneth vergessen, weil Leteo die Erinnerungen bloß unterdrückt. Löschen können sie die ja schlecht.« Sie hielt die Sache mit dem Eingriff schon immer für Schwachsinn, dabei hat sie früher sogar an Horoskope und Tarotkarten geglaubt.
»Na ja, aber wenn man sich nicht mehr an etwas erinnert, zählt das schon als vergessen, oder?«
»Okay, Punkt für dich.«
Genevieve verliert wie erwartet das Gleichgewicht, und ich fange sie auf, nur leider nicht so heldenhaft wie ein Prinz, der sie in den Sonnenuntergang trägt. Sie landet auch nicht waagerecht auf meinen ausgestreckten Armen, sodass ich sie wenigstens hätte küssen können, nein, ihr Körper rutscht irgendwie zur Seite, und ich erwische sie gerade noch unter den Achseln, aber ihre Beine krachen runter, und jetzt ist ihr Gesicht auf gleicher Höhe wie mein Schwanz, was reichlich unangenehm ist, weil sie ihn noch nie gesehen hat. Ich helfe ihr hoch, und wir entschuldigen uns beide – ich grundlos und sie, weil sie kopfüber in meinem Schritt gelandet ist.
Na ja, vielleicht klappt’s ja nächstes Mal.
»Äh …« Sie wischt sich die dunklen Haare aus dem Gesicht.
»Was würdest du machen, wenn uns jetzt auf einmal Zombies angreifen würden?«
Diesmal wechsle ich das Thema, damit es ihr nicht mehr peinlich sein muss. Ich nehme sie an die Hand und ziehe sie durch den Park. Unterwegs denkt sie sich halb gare Strategien aus, so von wegen auf einen Apfelbaum klettern und einfach abwarten. Ich frag mich, wer von uns beiden der Volltrottel ist …
Als Genevieve noch klein war, ist ihre Mutter immer mit ihr hergekommen, aber da gab es hier auch noch Wippen und Kletterstangen und so. Nachdem ihre Mutter vor zwei Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, als sie ihre Familie in der Dominikanischen Republik besuchen wollte, ist sie nur noch selten hier. Bei unseren Tausch-Dates gehe ich meistens woanders mit ihr hin, auf den Flohmarkt oder mittwochs, wenn man zum halben Preis reinkommt, auch mal in die Eislaufhalle, aber heute will ich uns in Erinnerung rufen, wo wir zusammengekommen sind.
Wir erreichen den Springbrunnen, in dem früher mal Wasser in Fontänen aus dem Boden kam, aber inzwischen sind alle zehn Düsen mit altem Laub, Kippen und anderem Müll verstopft.
»Ist lange her«, sagt Genevieve.
»Ich dachte, es wär lustig, wenn ich dich hier frage, ob du meine Freundin sein willst.«
»Äh, ich erinnere mich nicht, dass wir Schluss gemacht hätten?«
»Wieso?«, frage ich.
»Na ja, du kannst mich das ja wohl schlecht fragen, wenn wir eh schon zusammen sind. Das wäre, als wolltest du einen Toten umbringen.«
»Stimmt auch wieder. Dann mach Schluss.«
»Dafür bräuchte ich erst mal einen Grund.«
»Kein Problem. Äh, du bist eine blöde Schlampe, und deine Bilder sind scheiße.«
»Okay, es ist aus.«
»Großartig.« Ich grinse breit. »Tut mir leid, dass ich dich eben Schlampe genannt habe und gesagt habe, dass deine Bilder scheiße sind und dass ich Du-weißt-schon-was begehen wollte. Tut mir leid, dass du das durchmachen musstest und ich so ein Volltrottel war und dachte, ich würde niemals glücklich werden, weil ja verdammt klar ist, dass du mein Glück bist.«
Genevieve verschränkt die Arme. An ihrem Ellbogen sind noch Farbspritzer, die sie beim Händewaschen übersehen hat. »Tja, ich war dein Glück, immerhin hab ich Schluss gemacht. Jetzt frag mich.«
»Muss das sein?«
Sie boxt mich.
»Okay. Genevieve, willst du meine Freundin sein?«
Genevieve zuckt mit den Schultern. »Warum nicht? Hab eh noch nichts vor diesen Sommer.«
Wir suchen uns einen Baum, ziehen die Schuhe aus und legen uns in den Schatten. Sie sagt mir zum tausendsten Mal, dass ich mich nicht entschuldigen muss und dass sie es total verständlich fand, dass ich getrauert und gelitten hab. Das weiß ich im Grunde ja, aber ich brauchte diesen Neuanfang trotzdem, auch wenn es nur Spaß war. Nicht jeder kann es sich leisten, zu Leteo zu gehen und sein Leben auf null setzen zu lassen, und selbst dann würde ich es nicht machen. Weil ohne Erinnerung an die wichtigen Momente in meinem Leben so was wie vorhin gar nicht möglich wäre.
»Du …« Genevieve fährt mit dem Finger über die Linien in meiner Hand, als wollte sie mir die Zukunft vorhersagen und in gewisser Weise stimmt das sogar. »Mein Vater fährt Mittwoch mit seiner Freundin weg, die wollen zu irgendeiner Ausstellung.«
»Schön für ihn.«
»Er meint, er ist bis Freitag weg.«
»Schön für dich.«
Erst da begreife ich, worauf sie hinauswill. Es ist ein klassischer Glühbirnenmoment, und ich springe so hoch in die Luft, dass ich garantiert ein Aaron-förmiges Loch in den Wolken hinterlasse. Aber kaum bin ich wieder auf dem Boden angekommen, dämmert mir etwas Entscheidendes: Fuck, ich habe keine Ahnung von Sex.
3REISS DICH ZUSAMMEN, MANN
Alter, ich bin echt gefickt.
Okay, ja, schlechte Wortwahl. Ich werde natürlich mein Bestes geben, aber wenn Genevieve sieht, wie sehr ich mich anstrenge, lacht sie wahrscheinlich Tränen, und dann werden mir auch die Tränen kommen, nur leider nicht vor Freude. Ich hatte ja gehofft, mir eine ungesunde Menge Pornos reinziehen zu können, um mir ein paar Sachen abzugucken, aber in einer Zweizimmerwohnung ist das fast unmöglich. Ich kann nicht mal warten, bis Eric eingeschlafen ist, weil er die ganze Nacht zockt. Ich hatte kurz überlegt, das Pornogucken auf morgens zu verschieben, wenn Eric wie ausgeknockt schläft, aber nicht mal nackte Körper können mich dazu bringen, früh aufzustehen.
Ich weiß, ich kann schon froh sein, dass ich ein Handy habe, wenn auch mit der beschissensten Internetverbindung aller Zeiten, aber ein Laptop, mit dem ich mich im Bad einschließen und »recherchieren« könnte, wäre ein Traum. Wir haben aber bloß so ein Riesenteil von Computer im Wohnzimmer stehen, und an dem sitzt gerade Eric und bastelt eine kostenlose Internetseite für seinen Videospiel-Clan, die Alpha God Kings. Scheiße.
Ich kritzele auf der Rückseite meines Zeugnisses rum, das ich gestern bekommen haben. Wir mussten alle noch mal in die Schule, um die Spinde auszuräumen und uns für die Aufholkurse in den Ferien anzumelden, falls nötig. Zwar sind meine Noten in den letzten Monaten wegen Du-weißt-schon-was in den Keller gegangen, aber ich habe überall bestanden (sogar in Chemie, dabei kann sich das Fach gern in Salzsäure auflösen, wenn’s nach mir geht). Meine Vertrauenslehrerin wollte mit mir darüber reden, wie ich den Sommer am besten nutzen kann, um den Kopf fürs Abschlussjahr frei zu kriegen. Und damit hat die Gute ja nicht unrecht, aber heute hatte ich echt andere Sorgen als die Highschool.
Unsere Wohnung fühlt sich noch enger an als sonst, und weil mir fast der Kopf platzt, gehe ich raus, um ein paar Sekunden oder Minuten oder auch Stunden durchzuatmen. Länger auf gar keinen Fall, schließlich werde ich heute Abend Sex haben, und zwar egal, ob ich Ahnung davon habe oder nicht. Ich sehe Brendan, der gerade im Treppenhaus verschwindet, rufe ihn, und er hält mir die Tür auf. Er hat seinen ersten Blowjob mit dreizehn von einem Mädchen namens Charlene bekommen und mir hinterher ständig davon erzählt, wenn wir zusammen Computer gespielt haben. Ich hab ihn immer gehasst, weil er etwas erreicht hatte, was ich nicht hatte, aber jetzt kann ich ihn wenigstens um sein Wissen anhauen.
»Yo. Hast du kurz Zeit?«
»Äh.« Wir senken beide den Blick auf das Plastiktütchen mit Gras in seiner Hand. Seine Tage als Solitär-Nerd sind endgültig vorbei. »Nee, ich muss mich um das hier kümmern.«
Ich drücke mich an ihm vorbei, bevor er die Tür zumachen kann. Das Treppenhaus stinkt nach frischer Pisse, und ich entdecke eine Pfütze auf dem Boden. Das war garantiert Skinny-Dave, der markiert gern sein Revier.
»Rauchen oder dealen?«
Brendan guckt auf die Uhr. »Dealen. Der Kunde müsste jeden Moment kommen.«
»Dauert nicht lange. Ich will bloß wissen, wie Sex geht.«
»Na, am besten nicht zu schnell.«
»Danke, Arschloch. Hilf mir lieber.«
Er wedelt mir mit dem stinkenden Gras vor der Nase rum. »Ich muss Kohle verdienen, A.«
»Und ich muss meine Freundin glücklich machen, B.« Ich ziehe die beiden Kondome, die ich gestern bei der Arbeit gekauft habe, aus der Hosentasche und halte sie ihm unter die Nase. »Komm schon, Mann, gib mir ein paar Tipps oder sag mir, dass Mädchen ihr erstes Mal egal ist oder so, irgendwas. Und Alter, ich schwöre, ich hetz dir Me-Crazy auf den Hals, wenn du das rumerzählst, aber ich hab echt Schiss, dass ich’s nicht draufhab.«
Brendan reibt sich die Augen. »Scheiß drauf, Mann. Ich hab einfach so viele Mädchen wie möglich flachgelegt, damit ich besser werde.«
»Das würde ich Genevieve nie antun.« Aber auch andere Mädchen würde ich nie benutzen. Vielleicht ist Brendan doch nicht der Richtige für dieses Gespräch.
»Ja, weil du noch Jungfrau bist. Frag doch Nolan.«
»Nolan, der mit siebzehn schon zweifacher Vater ist? Nein, danke.«
»Hauptsache, du machst keinen Rückzieher, sonst halten dich alle für einen Schwachkopf oder ’ne Schwuchtel.«
»Hab ich nicht vor!«
Brendans Handy klingelt. »Das ist mein Kunde. Hau ab.«
Ich bleibe, wo ich bin. Von meinem fast-besten Freund hätte ich an diesem großen Tag mehr erwartet. »Nein, Mann, jetzt mal im Ernst.«
»Was denn, hat dein Vater dich nicht aufgeklärt, bevor er abgenippelt ist?«
Echt mies von ihm, so über Dads Selbstmord zu reden, ich weiß. »Nee, er hat bloß immer gewitzelt, wir hätten doch HBO. Aber ich hab mal mitgekriegt, wie er mit Eric drüber geredet hat.«
»Na siehste. Frag deinen Bruder.« Ich will protestieren, aber er würgt mich ab. »Alter, du musst jetzt wirklich abhauen, es sei denn, du willst mir das Gras abkaufen.« Brendan setzt ein falsches Grinsen auf und streckt die Hand aus. Ich drehe mich um und gehe. »Dachte ich’s mir doch«, ruft er mir hinterher. »Und reiß dich zusammen heute Abend.«
Es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich lieber machen würde, als mit meinem Bruder über Sex zu reden, aber als Jungfrau zu sterben gehört nicht dazu.
Eric spielt das neue Halo – keine Ahnung, das wie vielte es ist, ich kann nicht mehr mitzählen –, und sein Match nähert sich endlich dem Ende. Ich tue so, als würde ich lesen, und überlege krampfhaft, was ich sagen soll. Manchmal spielen wir zusammen Autorennen, inzwischen aber nur noch selten. Über wichtige Dinge unterhalten wir uns jedenfalls nie, nicht mal über Dads Tod. Sein Match ist beendet, und ich lege Scorpius Hawthorne und der Kerker der Lügen zur Seite.
»Erinnerst du dich an das Sexgespräch, das Dad mit dir geführt hat?«, frage ich ihn vom Bett aus.
Eric schaut weiter auf den Monitor, aber ich glaube, er hat mich gehört. Er spricht in sein Headset und sagt seinen »Soldaten«, dass er in zwei Minuten wieder da ist, dann schaltet er das Mikro stumm. »Ja. Hat mich nachhaltig verstört, das Gespräch.«
Wir gucken uns nicht an. Er starrt auf die Gamestats und analysiert vermutlich, was sein Team beim nächsten Mal besser machen kann, und ich lasse den Blick über die vergilbte Tapete bis zum Fenster schweifen, nach draußen, wo die Atmosphäre weniger angespannt ist als hier drinnen. »Was hat er denn gesagt?«
»Was interessiert dich das?«
»Ich will halt wissen, was er mir gesagt hätte.«
Eric hackt auf seine Tastatur ein, ohne dass auf dem Bildschirm was passiert. »Er meinte, als er so alt war wie wir, war ihm egal, ob Gefühle im Spiel sind. Grandpa hat zu ihm gesagt, er soll Spaß haben, sobald er bereit ist, Hauptsache, er benutzt immer ein Kondom, damit er nicht früher erwachsen werden muss als nötig, wie ein paar Freunde von ihm. Und er hätte dir gesagt, dass er stolz auf dich ist, weil du dich schon bereit dafür fühlst.«
Dads Worte aus Erics Mund zu hören, ist einfach nicht das Gleiche.
Ich vermisse meinen Dad.
Eric schaltet das Mikro wieder an und dreht sich so schnell von mir weg, als würde er bereuen, überhaupt mit mir geredet zu haben. Ich hätte ihn nicht zwingen sollen, an Dad zu denken, während er spielt. Er macht weiter, gibt seinem Team Befehle, ganz Alphatier. Genau wie Dad früher beim Basketball oder Baseball oder Fußball, eigentlich bei allem, was er gemacht hat.
Ich hole ein T-Shirt aus dem Schrank, das riecht wie konzentriertes Spülmittel. So was passiert halt, wenn man sich die Klamotten mit einem Bruder teilt, der alles mit Aftershaveproben aus Zeitschriften einreibt. Bevor ich gehe, sage ich: »Ich schlafe heute bei Genevieve. Sag Mom, dass ich bei Brendan bin, zum Zocken oder was weiß ich.«
Diese Worte reißen ihn endlich aus seinem Dämmerzustand. Er guckt mich einen Moment lang an, bis ihm einfällt, dass er null Interesse an meinem Leben hat, dann wendet er sich wieder seinem Spiel zu.
Auf dem Weg zu Genevieve bin ich hin- und hergerissen.
Ich stelle alles infrage. Warum renne ich nicht? Wenn ich es wirklich will, würde ich doch rennen, oder wenigstens joggen, um Energie zu sparen. Aber würde ich es nicht wollen, würde ich doch mit Absicht trödeln und vor ihrer Tür umkehren und wieder nach Hause gehen. Vielleicht mache ich ja bloß einen auf cool, indem ich ganz normal gehe, als wäre ich nicht total scharf drauf, als wäre es keine große Sache, über Nacht erwachsen zu werden, zum Mann zu werden. Ich meine, guck mich an, ich bin ein schlaksiger Junge mit einer abgebrochenen Ecke im Schneidezahn und ein paar vereinzelten Brusthaaren, und trotzdem will jemand das mit mir machen. Und zwar nicht irgendjemand. Sondern Genevieve: meine Künstlerfreundin, die über meine unlustigen Witze lacht und mich nicht verlassen hat, als es mit mir alles andere als lustig wurde.
Ich gehe noch kurz in den Laden an der Ecke, Sherman’s Deli, und kaufe ihr was Kleines, weil es sich anfühlt wie ein Arschlochmove, einem Mädchen die Unschuld zu nehmen, ohne ihr im Austausch was dafür zu schenken. Skinny-Dave meint, Blumen wären das beste Geschenk, wenn man die Blume eines Mädchens pflückt, aber der labert eh nur Scheiße.
Als ich vor Genevieves Tür stehe und klopfe, richte ich den Blick zwischen meine Beine und sage: »Wehe, du machst nicht, wofür du da bist. Wenn du streikst, mach ich dich fertig, das schwör ich dir. Ich mach Hackfleisch aus dir. Okay, Aaron, hör auf, mit deinem Schwanz zu reden. Und mit dir selbst.«
Genevieve macht mir mit einem ärmellosen gelben Shirt und Schlafzimmerblick die Tür auf. »Gutes Gespräch mit deinem Schwanz gehabt?«
»Nee, ist nicht besonders tiefgründig, der Typ.« Ich beuge mich vor und küsse sie. »Ich bin früh dran, also wenn du noch ein paar Minuten mit deinem Zweitfreund brauchst, kann ich gerne hier draußen warten.«
»Komm rein, bevor ich wieder Schluss mache.«
»Das traust du dich eh nicht.«
Sie will mir schon die Tür vor der Nase zuknallen, da rufe ich »Nein, warte!« und ziehe eine Packung Skittles aus der Hosentasche.
»Du bist der Beste.«
Ich zucke mit den Schultern. »Kam mir komisch vor, hier mit leeren Händen aufzutauchen.«
Genevieve nimmt meine Hand und zieht mich rein. Die Wohnung riecht nach den Heidelbeerkerzen, die ihre Mutter ihr geschenkt hat, und nach heißer Farbe, wahrscheinlich hat sich Genevieve gerade irgendeinen Farbton angemischt, den sie im Baumarkt nicht bekommen hat.
Nachdem mein Dad gestorben ist, habe ich sehr viel Zeit in Genevieves Wohnzimmer verbracht und ihr auf dem Sofa in den Schoß geweint. Sie hat mir jedes Mal gesagt, dass alles wieder gut wird. Und das habe ich ihr geglaubt, immerhin hat sie selbst einen Elternteil verloren – im Gegensatz zu meinen Freunden, die mich mit unbeholfenen Schlägen auf den Rücken und ausweichenden Blicken getröstet haben.
Genevieve ist der Grund, warum es mir besser geht.
Der ganze Flur ist vollgehängt mit bunten Bildern. Überall hängen Leinwände mit explodierenden Gärten, Zirkussen, in denen Clowns im Publikum sitzen und den Normalos in der Manege zugucken, leuchtende Städte im tiefschwarzen Meer, Lehmtürme, die in der sengenden Sonne schmelzen, und was nicht noch alles. Ihr Vater sagt eigentlich nie was zu ihrer Kunst, aber ihre Mutter hat immer damit angegeben, dass Genevieve schon Regenbögen in der richtigen Farbreihenfolge gemalt hat, bevor sie ihren Namen richtig aussprechen konnte.
Auf einem Tischchen im Flur stehen massenhaft gruselige Porzellanpüppchen neben einer Schale mit Schlüsseln und bergeweise Briefen. Ein Flyer mit Genevieves Namen sticht mir ins Auge. »Was ist das denn?«, frage ich und schaue mir das Foto von der Hütte darauf genauer an.
»Ach, nichts.«
»Nach nichts sieht das nicht aus, Gen.« Ich klappe den Flyer auf. »Ein Kunstcamp in New Orleans?«
»Ja. Drei Wochen im Wald Kunst machen ohne Ablenkung. Ich dachte, das wär vielleicht eine gute Chance für mich, endlich mal was fertig zu kriegen, aber …« Genevieve lächelt mich traurig an, und eine Welle von Selbsthass überrollt mich.
»Aber du kannst ja deinen Volltrottel von Freund nicht alleine lassen.« Ich gebe ihr den Flyer. »Ich halte dich nicht mehr auf, echt. Wenn du nicht fährst, dann bitte nur, weil du den ganzen Sommer lang Sex haben willst.«
Genevieve wirft den Flyer zurück aufs Tischchen. »Na, erst mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt …« Sie zwinkert mir zu und geht an der Wohnzimmertür vorbei in ihr Zimmer.
Beim ersten Besuch war ich so verwirrt von dieser großen Wohnung, dass ich im Arbeitszimmer von Genevieves Vater gelandet bin, wo er gerade an irgendwelchen Entwürfen für das neue Einkaufszentrum saß, an dem er mitarbeitet. Ja, er hat ein eigenes Arbeitszimmer, während ich mir zu Hause mit meinem Bruder das Wohnzimmer teile und mich im Bad einschließen muss, wenn ich mir einen runterholen will. Das Leben kann echt scheiße sein.
Der Geruch nach Heidelbeere wird stärker, als ich in ihr Zimmer komme. Zwei Duftkerzen stehen auf ihrer Kommode, die einzige Lichtquelle in dem dunklen Raum mit jeder Menge unfertigen Gemälden und zwei Sechzehnjährigen, die gleich erwachsen werden. Genevieve setzt sich aufs Bett, und durch die dunkelblaue Bettwäsche sieht es aus, als würde sie mitten im Meer sitzen. Ich werfe meinen Rucksack in die Ecke und mache die Tür hinter mir zu.
Es passiert wirklich.
»Wir müssen nicht, wenn du nicht willst«, sagt Genevieve. Wieder ein Rollentausch, jedenfalls nach allem, was man so in schlechten Fernsehsendungen sieht, aber nett von ihr, dass sie es anbietet. Beziehungsweise nicht anbietet.
Als wir das letzte Mal versucht haben, miteinander zu schlafen, war mir schlecht von dem ganzen Kinopopcorn. Wir hatten uns irgendeine romantische Komödie angeguckt, bei einem Doppeldate mit Collin und Nicole aus unserer Klasse – die bald ein Kind zusammen kriegen, verrückt. Aber jetzt bin ich bereit. Diesmal mache ich keinen Rückzieher.
»Bist du sicher, dass du es willst?«, frage ich.
»Komm gefälligst her, Aaron Soto.«
Ich stelle mir vor, wie ich mir das T-Shirt vom Leib reiße und auf sie zurenne, um großartigen Sex zu haben. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass ich mich unterwegs in meinem Shirt verheddere, über meine eigenen Füße stolpere und die ganze Angelegenheit alles andere als großartig wird. Also gehe ich langsam zu ihr, schaffe es, nicht zu stolpern, und setze mich neben sie aufs Bett, ganz einfach. »Äh, und, bist du öfter hier?«
»Ja, ich bin öfter hier bei mir zu Hause, Volltrottel.«
Sie legt mir die Arme um den Hals und quetscht zu. Ich würge, lasse mich auf sie fallen und tue so, als wäre ich tot. Genevieve haut mir gegen die Brust und kichert so heftig, dass sie kaum reden kann. »Kein Mensch … erstickt so schnell! Sterben hast du schon mal nicht drauf. Du bist … die mieseste Leiche aller Zeiten!«
Ich fühle mich auf einmal ganz selbstsicher in diesem kleinen Moment, in dem ich den Toten spiele und sie mich dafür auslacht. Dieser Witz gehört nur uns, weil er in einer ganz intimen Situation gerissen wurde, in der wir kurz davor sind, etwas ganz Intimes zu tun, und ich ohne jeden Zweifel weiß, dass ich es will, mit ihr. Ich reiße mich aus ihrem nicht sonderlich festen Klammergriff los, lege mich auf sie und küsse sie auf den Mund, auf den Hals, überallhin, wo es mir richtig vorkommt. Sie zieht mir das T-Shirt über den Kopf und wirft es auf den Boden.
»Weißt du noch, als du halb nackt in meinem Bett lagst?« Genevieve schaut zu mir hoch.
Ich ziehe ihr das Top aus, den BH noch nicht.
Sie macht meinen Reißverschluss auf, und ich strample so ungeschickt die Jeans von den Beinen, dass sie losprustet. Hätte ich auch nur den leisesten Verdacht gehabt, dass Genevieve über meinen Anblick in Boxershorts lacht, hätte ich mir sofort eine Ausrede ausgedacht und wäre abgehauen. Aber ich erinnere mich an keinen anderen Augenblick in meinem Leben, in dem ich mich so entblößt und trotzdem so wohl gefühlt habe. Ich mag sie so sehr, und egal, ob Dad mir das für mein erstes Mal geraten hätte oder nicht, mein Glück und ihr Glück werden für immer zum Besten gehören, was mir je passiert ist.
4TREIBJAGD AM FAMILY DAY
Der Family Day ist da. Während alle anderen im Hof sind und aufbauen, stehe ich bei Good Food’s hinter der Kasse, weil Mohad, der Besitzer, seinen Bruder vom Flughafen abholen muss. Aber es stört mich nicht, zu arbeiten, vor allem nach der Nacht. Ich habe ohne Meckern die Morgenlieferung verräumt und sogar alle Honey Buns verkauft, die morgen ablaufen, damit wir nichts wegschmeißen müssen. Im Laufe des Vormittags kamen meine Jungs einer nach dem anderen in den Laden, und ich hab sie natürlich direkt mit Einzelheiten versorgt. Wahrscheinlich sollte man lieber nicht am Morgen danach direkt mit seinen Heldentaten angeben, aber ich konnte unmöglich die Klappe halten.
Brendan hat versucht, mir ziemlich private Details über Genevieve – die heute erst später kommt – aus der Nase zu ziehen, aber zum Glück irgendwann aufgegeben, als sich hinter ihm eine Schlange bildete. Skinny-Dave wollte wissen, wie oft wir es gemacht haben (zwei Mal!) und wie lange ich durchgehalten habe (nicht lange, aber das muss er ja nicht wissen). Baby-Freddy hat natürlich wieder die Geschichte von seinem ersten Mal rausgeholt, obwohl sie echt scheiße ist und Tiffany bis heute bestreitet, dass sie es je mit ihm gemacht hat. Als Letzter kam Nolan und fragte mich, ob ich es echt durchgezogen hätte, während er Feuchttücher für seine beiden Töchter kaufte. Angeblich benutzt er immer Kondome, aber irgendwas muss er wohl falsch gemacht haben. Mehr als man von Collin sagen kann, der hat nämlich gar nicht erst eins benutzt, als er mit Nicole im Bett war.
Bei uns im Block gibt es ein paar Typen, die wir früher immer »die Großen« genannt haben und die inzwischen schon Ende zwanzig sind. Als Kinder haben wir genau beobachtet, mit wem sie sich geprügelt haben, mit wem sie zusammen waren oder wessen Ex sie abgeschleppt haben. Manche von ihnen sind aufs College gegangen und weggeblieben. Andere, wie Devon Ortiz, hängen immer noch hier rum. Devon kommt in den Laden, um Strumpfhosen für seine Mutter zu kaufen, und gratuliert mir. Kein gutes Zeichen, anscheinend hat sich die Neuigkeit schon rumgesprochen. Aber es macht mich auch ein bisschen stolz, weil es heißt, dass ich jetzt endlich auch zu den Großen gehöre.
Als Mohad zurückkommt, steht auch Brendan wieder auf der Matte, diesmal mit Nolan und Skinny-Dave. »Wann hast du Feierabend? Wir wollen eine Runde Treibjagd spielen.«
»Mohad meinte, ich soll heute bis eins bleiben«, sage ich.
Da schreit Mohad mit seinem starken arabischen Akzent quer durch den Laden: »Soto! Hau schon ab, Hauptsache, du nimmst deine stinkenden Freunde mit.«
Die anderen johlen, und wir ziehen los.
Draußen ist die Stimmung anders als heute Morgen um acht, als ich mit der Arbeit angefangen habe. Mein Bruder spielt Karten mit seinen Gaming-Kumpeln: Ronny, der online das Maul aufreißt, im echten Leben aber immer den Kürzeren zieht; Stevie, der seine Freundin Tricia auf einer Internetseite für Videospielfanatiker getroffen hat (nur dass er sie noch nicht getroffen-getroffen hat); und China-Simon, der eigentlich aus Japan kommt, sich aber erst nach einem Jahr gegen seinen Spitznamen gewehrt hat.
Meine Mom verteilt gerade Hotdogs an Fat-Dave und seinen kleinen, weniger unförmigen Bruder. Sie hat sich den Grill unserer Nachbarin Carrie geliehen, und ich hoffe, die Hotdogs sind nicht wieder so matschig wie an meinem zwölften Geburtstag. Damals haben Brendan und ich sie heimlich hinter ihrem Rücken ausgespuckt und uns stattdessen ein Meatball-Sub von Joey’s geteilt.
Skinny-Daves Mutter Kaci kommt mit einem Einkaufswagen voller blauer T-Shirts auf uns zu. Die Shirts werden immer schon Monate im Voraus bestellt, aber ich weiß, dass Mom sie sich dieses Jahr nicht leisten kann, wir werden also aus allen Fotos fürs Community Center rausstechen. Kaci gibt Fat-Dave sein XL-Shirt, was praktisch ist, weil er Senfflecken auf seinem weißen T-Shirt hat. Dann reicht sie ihrem Sohn sein Shirt und wendet sich an Brendan und mich: »Ihr tragt beide M, oder?«
»Ja, aber meine Mom hat glaub ich keins für mich bestellt«, sage ich.
»Ich hab auch keins bestellt«, sagt Brendan.
Kaci gibt uns trotzdem welche. »Hier, wir sind doch alle Familie. Viel Spaß, Jungs, und sagt Bescheid, wenn ihr was braucht.«
Wir bedanken uns und ziehen die Shirts über. Sehen irgendwie lahm aus. Ab morgen trägt sie eh keiner mehr, außer, wenn alles andere in der Wäsche ist oder man bei einem Freund übernachtet. Aber eigentlich mag ich das Zusammengehörigkeitsgefühl, das sie mit sich bringen, irgendwie … definitiv. Auf einmal fühlt sich unser Gebäudekomplex nicht mehr an wie irgendein Scheißhaus, in dem wir zufällig wohnen, sondern eher wie ein Zuhause.
Meine Mom ruft mich. Zufrieden sieht sie zwar schon länger nicht mehr aus, aber so unzufrieden wie jetzt nun auch wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, worüber sie sich gerade mit Baby-Freddys Mutter unterhält – ich verstehe die beiden nicht, weil Mom zu Hause nur selten Spanisch spricht –, aber jetzt unterbricht sie das Gespräch und keift: »Hör mal, ich bin echt stolz auf mich, dass ich nicht direkt zu dir in den Laden gestürmt bin, als ich erfahren habe, dass du heute Nacht nicht bei Brendan warst.«
Ich frage mich, wieso Baby-Freddys Mutter immer noch hier ist. Ein Gerücht, das eh schon alle kennen, ist doch wohl reichlich uninteressant.
»Wer hat dir das erzählt?«
»Dein Bruder.«
Ich hatte gehofft, es hätte sich bloß rumgesprochen. »Verräter.«
»Wir sind verantwortlich für dich, Aaron. Du hast nicht mehr die Freiheiten, die dein Vater und ich dir früher gegeben haben, das weißt du. ICH will wissen, wo du bist, und wenn du irgendwo schläfst, bespreche ICH das vorher mit den Eltern. Verstanden?«
»Okay, okay. Verstanden. Kann ich jetzt gehen?«
»Habt ihr wenigstens ein Kondom benutzt?«
»Ja, Mom.« Alter, ist das peinlich. Zum Glück wird sie von den verkohlt riechenden Hotdogs abgelenkt, und ich gehe zurück zu meinen Freunden. Brendan, Skinny-Dave und Baby-Freddy gucken mich mit ihrem Da-hat-wohl-jemand-Anschiss-von-seiner-Mami-gekriegt-Blick an. »Eric, dieser Wichser, hat mich verraten.« Ich zeige ihm den Mittelfinger, obwohl er mir den Rücken zugedreht hat. »Also was ist, geht’s los jetzt?«
So spielt man Treibjagd: Der Jäger wird bestimmt, und alle anderen haben zwei Minuten Zeit, sich irgendwo in unserem Block zu verstecken. Wenn der Jäger einen fängt, ist man in seinem Team und muss ihm helfen, die anderen Spieler zu finden, bis keiner mehr übrig ist oder eine Stunde rum ist.
Eigentlich wie Verstecken, nur wesentlich spannender.
Baby-Freddy fragt, ob jemand freiwillig den Jäger macht. Er ist so was von draußen, weil er das letzte Mal, als er der Jäger war, um neun Uhr von seiner Mutter reingerufen wurde und wir alle eine Stunde lang blöd in unseren Verstecken hockten, bis wir gerafft haben, dass er längst zu Hause war. Die beiden Daves hassen es, Jäger zu sein. Deon sagt, er macht es, und fängt an zu zählen.
Brendan und ich halten uns an Me-Crazy, der in die Tiefgarage stürmt, wo Skinny-Dave garantiert auch gleich auftaucht. Er versteckt sich am liebsten unter Autos (was schon zweimal fast böse geendet hätte). Me-Crazy ist unser Treibjagd-Freak. Der Typ ist sowieso krass drauf, vor allem, wenn ihm langweilig wird, dann ist er echt gemeingefährlich. Aber vor allem findet er die besten Verstecke. Er war es auch, der rausgefunden hat, dass man durchs Flurfenster im zweiten Stock von Haus 135 aufs angrenzende Dach kommt – wo wir immer kaputte Bälle, leere Top-Pop-Flaschen und Arizona-Dosen hochwerfen. Außerdem ist er bis heute der einzige Spieler, der es geschafft hat, aufs Dach eines fahrenden Autos zu springen, um sechs Jägern zu entkommen. Sein richtiger Name ist übrigens auch Dave, ohne Witz. Aber nach diesem irren Stunt und nachdem er mal aus Spaß einem verletzten Vogel die Flügel abgeschnitten hat, nennt er sich Me-Crazy. Wir können froh sein, dass er uns mag.
Me-Crazys Timberland-Boots sind so laut, dass es ein Wunder ist, dass sie ihn nicht verraten. »Hört auf, Me-Crazy zu verfolgen«, sagt er. »Wegen euch wird Me-Crazy noch geschnappt.«
»Nicht, wenn wir uns alle zusammen verstecken«, sage ich außer Atem. Brendan kommt kaum hinterher.
Me-Crazy bleibt stehen, aber nicht, um uns ein gutes Versteck zu zeigen. Er rollt die Augen nach hinten, bis nur noch das Weiße zu sehen ist. Dann haut er sich selbst ins Gesicht und joggt auf der Stelle.
Achtung, Crazy-Modus. Wenn er so drauf ist, legt er dich über seine Schulter, benutzt dich als Rammbock und donnert dich gegen Autos, Wände, was gerade da ist.
»Ja, Mann, wir gehen ja schon«, sage ich.