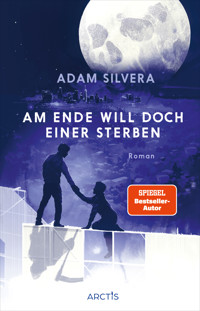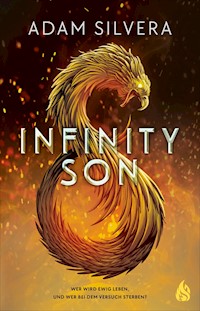10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die heißersehnte Fortsetzung und eine zweite Chance für die große Liebe. Becky Albertalli und Adam Silvera erfüllen mit dem Nachfolgeband von ›Was ist mit uns‹ den Wunsch vieler Fans. Ben und Arthur treffen, zwei Jahre nach ihrer Trennung, im schillernden New York wieder aufeinander. Beide sind inzwischen vergeben, und versuchen sich einzureden, dass da nichts mehr zwischen ihnen ist. Doch das Universum scheint anderer Meinung zu sein und wirft ihnen jede Menge Fragen vor die Füße: Ist es zu spät für Was-wäre-Wenn´s? Oder sind sie vielleicht doch füreinander bestimmt? In AUF DAS MIT UNS sprühen auf jeden Fall wieder die Funken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Becky Albertalli / Adam Silvera
Auf das mit uns
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Christel Kröning und Hanna Christine Fliedner
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Here's To Us bei Balzer + Bray und Quill Tree Books, New York
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2021 by Becky Albertalli und Adam Silvera
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
Published in agreement with the authors, c/o BARORINTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
Übersetzung: Hanna Christine Fliedner und Christel Kröning
Covermotiv: Jeff Östberg
Covergestaltung: Niklas Schütte
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03880-161-0
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Für David Arnold und Jasmine Warga,
die ersten Sterne in unserem
expandierenden Universum
Teil 1Was war, das ist vorbei
1. Kapitel – Ben
Samstag, 16. Mai
Was, wenn wir’s riskieren?
Diese Frage geht mir durch den Kopf, sobald ich an ihn denke.
Es kommt mir vor, als wäre ich sehr lange ziellos unterwegs gewesen, wie ein Paket, dessen Adressaufkleber verloren gegangen ist. Aber ich glaube, endlich hat mich jemand gefunden.
Er hat das extrafeste Klebeband aufgeschnitten und das Paket geöffnet.
Ich bekomme Licht und Luft.
Nachrichten direkt nach dem Aufstehen und heimlichen Übernachtungsbesuch.
Und Spanisch und Küsse.
Mario Colón.
Kurz bevor ich vom U-Bahn-Eingang verschluckt wurde, hat er mir noch ein Foto von sich auf einem Zahnarztstuhl geschickt. In weißem T-Shirt und Jeans-Latzhose, deren einer Träger achtlos herunterbaumelt. Die puerto-ricanische Reinkarnation von Super Mario, auf die die Welt gewartet hat. Mit dunklen Locken und glatter, olivfarbener Haut. Dass er kaum Körperbehaarung hat, zieht ihn manchmal runter, weil er glaubt, dass ihm ein Bart à la Lin-Manuel Miranda hervorragend stehen würde. Das grelle Praxislicht bringt seine grünbraunen Augen so richtig zum Strahlen. Er streckt die Zunge ein Stückchen raus, und klar ist das albern, aber ich will ihn trotzdem küssen. Genau wie vor ein paar Wochen, als wir uns wegen der Partneraufgabe für Kreatives Schreiben zum ersten Mal allein getroffen haben.
Und die etwa fünfzig anderen Male seitdem.
Etwas nervös wische ich weiter zu dem Bild, das ich ihm zurückgeschickt habe. Normalerweise mache ich mindestens ein Dutzend Selfies, bevor ich ein Mario-taugliches hinkriege. Er spielt einfach in einer ganz anderen Liga als ich. Aber diesmal musste es schnell gehen, meine Bahn kam schon. Ich habe mich von oben fotografiert, damit das T-Shirt mit draufpasst, das er für mich gemacht hat. Den Textildrucker haben seine Eltern ihm zum Schulabschluss geschenkt, weil er seine Klamotten ein bisschen aufpimpen wollte. Letzte Woche hat er mich mit diesem Der-Zorn-der-Zauberer-Shirt überrascht, mit genau der Schriftart, die Samantha für mein Cover auf Wattpad benutzt hat. Ein richtig cooles Geschenk. Wenn ich es trage, bin ich nicht ganz so selbstkritisch wie sonst.
Mario und ich haben uns im ersten Semester im Kreatives-Schreiben-Seminar kennengelernt. Anfangs hielt ich ihn für einen Autor von todernster Belletristik. Oder für einen begnadeten Poetry-Slammer. Falsch gedacht. Mario will Drehbuchautor werden. Schon seit seinem elften Lebensjahr schreibt er Skripts und hat in der Schule sogar öfter mal Probleme gekriegt, weil er seine Hausaufgaben in Dialogform zu Papier gebracht hat.
Nach meinem Exfreund Arthur war Mario der Erste, der mir so richtig ins Auge gefallen ist. Ich bemerkte, wenn er nicht zum Seminar kam, bewunderte, wie gut ihm Latzhosen standen, und mochte seine Rollkragenpullis im Winter. Beim Präsentieren seiner Texte strahlte er ein Selbstbewusstsein aus, das ich nie so ganz greifen konnte – er war immer stolz, aber nie auf eine selbstgefällige Art.
Zu Anfang gingen mir allerdings noch zu viele Was-wäre-wenns in Bezug auf Arthur durch den Kopf, als dass ich versucht hätte, Mario näherzukommen.
Jetzt betreffen die Was-wäre-wenns ihn. Mario Colón.
Was wäre, wenn wir offiziell ein Paar wären, statt bloß Freunde, die miteinander rumhängen und sich küssen?
Gerade bin ich unterwegs zum Central Park, wo ich mit meinem besten Freund Dylan und seiner Freundin Samantha verabredet bin. Mario stößt später auch dazu. Es ist das erste Treffen mit den beiden seit Weihnachten, weil sie in den Frühjahrsferien nicht nach Hause gekommen sind. Gestern wollten wir eigentlich zusammen in einen Escape-Room gehen, dann hat Dylan extremen Jetlag vorgeschoben. Der Zeitunterschied zwischen Chicago und New York beträgt eine Stunde. Aber ich habe es ihm durchgehen lassen. Ist halt typisch Dylan.
Während der Fahrt kritzele ich Ideen für ein neues Kapitel meines Fantasyromans in mein kleines Notizbuch. Den ersten Entwurf von Der Zorn der Zauberer habe ich zwar vor Ewigkeiten beendet, inzwischen habe ich aber gecheckt, dass das ganze Ding noch eine ziemliche Baustelle ist. Zu viele spannende Szenen habe ich mir für nächste Bände aufgehoben, die es vielleicht nie geben wird. Und all die Charaktere, die von meinen Freund*innen und Exfreunden inspiriert wurden, müssen für außenstehende Leser*innen dringend genauer ausgearbeitet werden.
Story of my life: Schreiben will gelernt sein.
Mario hat mich mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, irgendetwas anderes als Schriftsteller zu sein. Aber Schreiben ist das Einzige, in dem ich gut bin. Selbst wenn sich ein neuer Traum herauskristallisieren sollte, weiß ich nicht, was daraus werden würde, ohne all die Liebe, die sowohl Fremde als auch Freund*innen den zornigen Zauberern entgegengebracht haben. Arthur hat früher über die Figuren gesprochen, als wären sie alte Bekannte. Und Dylan liebt diese Welt so sehr, dass er sich im realen Leben schon mit mir in einer Drag-Bar sieht, in der sich alle als verschiedene Fantasycharaktere stylen, Elben und Trolle und so weiter.
Danke, Dylan, ich passe.
Aufwendige Verkleidungen sind nicht mein Ding. Worte sind mein Ding.
Ich liebe es, wie sie Menschen miteinander verbinden.
Und erst recht liebe ich es, wie sie Mario und mich auch auf Spanisch verbinden.
Genau wie ich ist er ein Puerto Ricaner, der als Weißer durchgeht. Aber im Gegensatz zu meinen Eltern haben seine ihn bilingual erzogen. Er baut eine Menge spanischer Ausdrücke in das Drehbuch ein, an dem er schreibt, und hofft, dass ihn später niemand zwingen wird, sie für die Zuschauer*innen zu übersetzen. Die sollen sich genauso anstrengen müssen wie seine Eltern, als sie damals herkamen. Das hat mich echt dazu motiviert, mich auch endlich reinzuhängen, und ich habe praktisch »¡Sí, por favor!« geschrien, als er angeboten hat, mein persönlicher Spanischlehrer zu werden.
Ich kann’s kaum abwarten, ihn zu sehen.
Obwohl unser gemeinsames Treffen mit Dylan und Samantha ein kleiner Balanceakt wird. Mario ist ja nicht mein Freund, aber definitiv mehr als ein Freund. Ganz schön kompliziert, diese Grauzone. Zum Beispiel wenn ich morgens beim Aufwachen direkt an ihn denke und ihm einfach so einen guten Morgen wünschen will, sich das aber manchmal nach zu viel anfühlt. Oder wenn ich mich frage, wie ich ihn am besten meinen Freund*innen vorstelle, auch wenn die natürlich wissen, wie unsere Beziehung aussieht. Oder wenn allein schon das Wort »Beziehung« zu groß für uns klingt, irgendwie unverdient im Vergleich zu richtigen Beziehungen.
Ich bin echt überfordert. Doch das ist ein Problem für mein Zukunfts-Ich. Genauer: das So-etwa-in-einer-Stunde-Ich.
Jetzt muss ich erst mal Marios wunderschönes Gesicht aus dem Kopf kriegen, sonst verpasse ich noch meine Haltestelle. Ich springe auf und schlüpfe gerade so noch aus der Bahn, ehe sich die Türen schließen. Ich darf nicht zu spät kommen. Diese ewige Unpünktlichkeit ist Geschichte. In unserem Kreatives-Schreiben-Seminar würde Mrs. García das »Figurenentwicklung« nennen.
Die Rolltreppe spuckt mich auf den Bürgersteig und ich laufe zum Westeingang des Central Parks auf der Seventy-Second Street. Es dauert nicht lang, bis ich Dylan und Samantha entdecke. Sie sitzen auf einer Bank und spielen dieses Spiel, bei dem man sich tief in die Augen schauen und dem Gegenüber auf die Hand schlagen muss, bevor der oder die andere sie wegziehen kann.
Samantha gibt Dylan einen Klaps. »Hab dich! Vier zu eins, du Loser!«
»Hey!« Ich stelle mich vor die Bank. »Geht das auch zu dritt?«
Dylan grinst. »Zu einem flotten Dreier mit dir sage ich nie Nein.«
»Von ›Dreier‹ habe ich nichts gesagt. Ich –«
»Sch«, macht Dylan, erhebt sich und zieht mich in eine feste Umarmung. Er tätschelt mir den Kopf. »Hab dich vermisst, Benny-Buddy.«
»Ich dich auch. Und gleichzeitig bist du mir schon fast wieder zu viel.«
Dylans Haare sind inzwischen so lang, dass er sich endlich diesen Männerdutt binden kann, auf den er hingearbeitet hat. Steht ihm echt gut. Wenn man Dylan fragt, ist natürlich er der Einzige, der so was tragen kann. Er steckt in einem neuen Kool-Koffee-Shirt und Jeans. »Hier im Park gibt es ein herzallerliebstes kleines Café. Mach dich bereit für einen Espresso-Marathon, mein Kaffeböhnchen. Kaffee-Benchen? Ben-Böhnchen?«
»Weder noch, wenn du mich fragst«, wirft Samantha ein. Ihre grünblauen Augen hauen mich heute genauso um wie damals, als ich sie zum ersten Mal hinter dem Tresen von Kool Koffee gesehen habe. Die dunklen Haare hat sie zu einer pinterest-reifen Flechtfrisur drapiert, die ich mir für ihr Alter Ego Sam O’Mal in meinem Buch merken sollte. Sie trägt ein dunkelblaues Oberteil, das sie in weiße Shorts gesteckt hat, und an ihrem Hals baumelt ein silberner Schlüssel. »Hi, Ben!« Sie schließt mich in die Arme.
Erleichtert stelle ich fest, dass Dylans penetrante Art, mir Spitznamen zu verpassen, bisher nicht auf sie abgefärbt hat.
»Willkommen zurück, ihr beiden.«
Beim Anblick meines T-Shirts macht Samantha große Augen. »Bei den griechischen Göttinnen, wie geil ist das denn?!«
Dylan grinst, als auch er es bemerkt. »Diese zornigen Zauberer werden eines Tages so krass steilgehen!«
Seit Dylan das Manuskript letzten Sommer vor dem Unistart gelesen hat, gab es echt einige Änderungen. Aber er ist immer noch glühender Fan. In regelmäßigen Abständen erkundigt er sich, was bei Duke Dill so abgeht. Außerdem ermutigt er mich, mir jetzt schon eine Literaturagentur zu suchen. Allerdings habe ich mich in den letzten Monaten zu einem Perfektionisten entwickelt.
Ich möchte niemanden enttäuschen.
Diese ganze Fan-Liebe stresst mich ein bisschen.
»Ich will auch so ein T-Shirt.« Samantha befühlt meinen Ärmel. »Hast du das selbst bedruckt?«
»Nein, das war Mario.«
»Super Mario!«, ruft Dylan. »Ich hoffe, es nervt ihn nicht, wenn Leute ihn so nennen. Du weißt, dass ich nicht anders kann.«
»Um ehrlich zu sein, findet er es mega.«
Ich persönlich wäre ja nach einer Weile hart genervt davon. Aber Mario? Niemals. Überhaupt habe ich ihn erst ein einziges Mal zumindest annähernd schlecht gelaunt erlebt, und zwar als Spikey aus unserem Kurs Marios Drehbuch ziemlich scharf kritisiert hat. Und selbst das hat Mario im Endeffekt mit einem Achselzucken abgetan. Spikey war bloß auf Krawall aus, weil Mrs. García seine Kurzgeschichte über den Bürgerkrieg als »historisch leider unmöglich« bezeichnet hatte und daraufhin alle lachen mussten.
»Und? Wann springt Super Mario aus einem Warp-Rohr?«
»Quasi jeden Moment. Er hatte noch einen Zahnarzttermin. Aber im Augenblick müsst ihr wohl erst mal mit mir vorliebnehmen.«
»Perfekt.« Samantha hakt sich bei mir unter, und zu dritt spazieren wir los durch den Central Park. »Sieht aus, als würde es gut laufen zwischen euch, oder?«
»Ich glaube schon.« Mit meiner Fast-Beziehung komme ich mir Samantha und Dylan gegenüber etwas albern vor. Bei den beiden ist alles total klar. Mario und ich dagegen wirken auf mich eher wie eine Mischung aus einem Ausrufe- und einem Fragezeichen – Aufregung gepaart mit Unsicherheit.
»Zeit, euren Pärchennamen festzulegen«, mischt sich Dylan ein. »Ich finde ja, ›Bario‹ klingt echt nice, und ›Men‹ wäre natürlich … muah.« Er küsst sich auf die Spitzen von Daumen und Zeigefinger. »Weil ihr ja beide Männer seid, und –«
»Samantha, wie war das Abendessen gestern?«, unterbreche ich Dylans Redeschwall.
»Lief einigermaßen glatt«, antwortet sie. »Es war sogar ganz lustig. Lieb, dass du nachfragst. Ich schätze, wir haben das Weihnachtsdebakel überwunden.«
Die O’Malleys vergöttern Dylan zwar, aber als sie in den Weihnachtsferien herausgefunden haben, dass ihre Tochter sich ihr Chicagoer Wohnheimzimmer mit ihm teilt, war die Hölle los.
»Dylan hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Na ja, zumindest von einer besseren als sonst. Tut mir übrigens echt leid, dass wir unser Escape-Room-Date absagen mussten.«
»Mach dir keinen Kopf, der Sommer fängt ja gerade erst an.«
Dylan zieht mich an sich. »Big Ben, wir wissen doch beide, dass dieser Escape-Room Teil deines geheimen Plans ist, eine Stunde mit mir auf sehr engem Raum zu verbringen. Aber dafür brauchst du keine Ausreden, mein Großer.«
»Dee, deine Freundin läuft direkt neben uns.«
»Oh bitte, nimm ihn mir mal für eine Stunde ab«, erwidert Samantha trocken.
Dylan zwinkert mir zu. »Siehst du? Meine bessere Hälfte hat nichts dagegen.«
Ich halte vor einem Brezelstand an, weil ich nur einen Bissen von dem Marmeladenbagel in den Magen bekommen habe, den Ma mir für den Weg geschmiert hat. Typisch Ben-Alejo-Style habe ich ihn dann beim Selfie-Knipsen auf die U-Bahn-Gleise fallen lassen, und sofort kam eine Ratte und ist damit davongeflitzt. Wenn ich mich nur ein kleines bisschen für TikTok interessieren würde und schnell genug gewesen wäre, das Ganze zu filmen, hätte ich damit hundertpro einen viralen Hit landen können.
»Wollt ihr zwei auch was?«, frage ich.
»Nein danke«, antwortet Samantha. »Ich habe mich schon mit Obst vollgestopft. Und Dylan hatte zum Frühstück Reste von der Ente gestern.«
»Pssst«, macht Dylan. »Hier gibt es doch Enten.«
»Glaubst du, sie rächen ihren Artgenossen?«
»Na sichi, mit den guten alten Säbel-Schnäbeln.«
Samantha schüttelt den Kopf. »Warum … Warum gebe ich mich überhaupt mit dir ab?«
»Weil meine Dee-Machine so unwiderstehlich ist.«
»Oh Mann, Leute, nehmt euch ein Zimmer«, wehre ich ab.
»Damit meine ich das Gesamtpaket. Meinen Freund da unten nenne ich –«
Samantha hält ihm den Mund zu. Eine wahre Heldin.
»Dee … ähm, Dylan, willst du einen Kaffee?«
Dylan schaut sich um. Ich deute auf den Brezelwagen.
»Netter Versuch, Ben. Du weißt genau, dass ich diese abartige Plörre nicht trinke.« An den Verkäufer gewandt fügt er hinzu: »Das geht nicht gegen Sie, werter Herr, aber sehr wohl gegen die Clowns, die Ihren edlen Wagen mit solch Spülwasser betankt haben.«
Der Verkäufer starrt Dylan an, als spräche der eine Fremdsprache.
»Okay, vielleicht besser kein Koffein mehr für dich«, stelle ich fest.
»Wir haben einen doppelten Espresso von Dream & Bean vorgetrunken.«
»Ente und Kaffee zum Frühstück. Das erklärt einiges.«
»Hör auf so zu tun, als würdest du mich erst seit einem Tag kennen.«
Wir kennen uns definitiv länger als einen Tag. Seit der Grundschule sind wir wie Pech und Schwefel. Auch wenn es an unserer Freundschaft nicht ganz spurlos vorübergezogen ist, dass Dylan jetzt in Chicago studiert.
»Mir wär’s lieb, du würdest vor unserem Lunch mit Patrick keinen Koffein-Schock erleiden«, meint Samantha.
»Bah, Patrick.« Dylan spuckt auf den Boden. »Such dir bessere Freunde, Babe. Hörst du Ben etwa endlos darüber quatschen, wie er mit Delfinen geschwommen ist und kleine Äffchen umarmt hat?«
»Nein, weil ich nichts davon gemacht habe«, wende ich ein.
Samantha wirft mir einen Blick zu. »Patrick ebenso wenig. Er und sein Cousin sind nach dem Schulabschluss einfach ein Jahr lang herumgereist.«
Ein Jahr lang herumreisen klingt toll. Mehrere Jahre würden noch besser klingen.
»Komm doch mit uns essen, Ben«, sagt Dylan. »Dann siehst du mal, wie drüber der Kerl ist.«
»Hast du gerade jemanden ›drüber‹ genannt, Dee?«
»Daran erkennst du schon, wie über-drüber der ist.«
»Ich kann nicht. Ich muss noch arbeiten.«
»Erzähl deinem Boss, dass VIPs in der Stadt sind.
»Du weißt, dass das nicht geht.«
Mein Boss ist mein Vater. Während der Weihnachtsfeiertage wurde Pa bei Duane Reade zum Filialleiter befördert. Im April hat er mich dann eingestellt, und seitdem fülle ich Regale auf und helfe an den Kassen. Kurz vor den Klausuren einen Job anzufangen hat das Studium nicht gerade einfacher gemacht, aber von meinen Eltern war in der Hinsicht wenig Mitleid zu erwarten. Sie haben während ihrer Ausbildung sogar Vollzeit gearbeitet.
»Du lernst Patrick schon noch kennen«, sagt Samantha zu mir. »Er bleibt ganze zwei Monate hier. Vielleicht können wir ja alle zusammen in einen Escape-Room gehen?«
»Du sperrst mich nicht eine Stunde lang mit Patrick in einen Raum«, warnt Dylan.
»Das spornt dich bestimmt an, die Rätsel schneller zu lösen.« Samantha stößt mir verschwörerisch den Ellbogen in die Rippen. »Wir könnten auch Mario einladen.«
»Vielleicht.« Mein Handy vibriert. »Wenn man vom Teufel spricht. Super Mario schreibt, dass er gleich da ist. Sollen wir hier kurz stehen bleiben, damit er uns leichter findet?«
Dylan schaut sich um und zeigt auf die Terrasse von Belvedere Castle. Es wirkt immer, als hätte man es aus einem Fantasyroman hier in den Central Park verpflanzt. »Sag deinem Süßen, wir treffen uns da drüben.«
»Er ist nicht mein Süßer.«
»Noch nicht.«
Schon komisch. Im Belvedere Castle waren Dylan und ich das letzte Mal, kurz nachdem ich Arthur vor dem Postamt getroffen und mit ihm weder Namen noch Kontaktdaten ausgetauscht hatte, ehe wir von dem Flashmob getrennt wurden. Weil ich danach nicht aufhören konnte, an den hübschen Unbekannten zu denken, hat Samantha ihre Nancy-Drew-Spürnase und ein paar Anhaltspunkte aus unserem Gespräch genutzt, um ihn zu finden. Unter anderem hatte er erwähnt, dass er gern in Yale studieren wollte. Samantha bekam Wind von einem Kennenlerntreffen für Yale-Anwärter*innen hier im Belvedere Castle, und ich beschloss, mit Dylan mal vorbeizuschauen. Natürlich hat Dylan sich hochtrabende Decknamen für uns ausgedacht. Er war damals Digby Whitaker. Das weiß ich auch nur noch so genau, weil ich den Namen einem der Gelehrten in DZDZ gegeben habe.
Vor zwei Jahren kam ich her, um nach einem Jungen zu suchen. Und jetzt bin ich wieder hier und warte, dass ein anderer Junge mich findet.
Wie von selbst schließen sich Dylans Finger um Samanthas und die beiden gehen Hand in Hand die Stufen hinauf.
Händchenhalten ist keine Riesensache, schon klar, aber es tut gut, ein Paar zu sehen, das sich nach zwei Jahren immer noch so sehr mag – liebt. Ich selbst habe das noch nie erlebt. Die beiden geben mir Hoffnung, dass irgendwann mal jemand dasselbe für mich empfindet.
Als wir fast oben auf der Terrasse sind, halten wir abrupt inne. Normalerweise ist hier nicht besonders viel los, meist posieren nur ein paar Leute mit dem Central Park im Hintergrund. Aber heute findet hier offensichtlich eine Hochzeit statt. Im sehr kleinen Kreis, mit nur einem Dutzend ziemlich leger gekleideter Gäste und einer Band, die leise eine Instrumentalversion von Bruno Mars’ Marry You spielt. Gerade will ich Dylan und Samantha wegziehen, damit wir die Trauung nicht crashen, da erscheint die Braut.
Ich erstarre.
Ich glaube, ich kenne sie …
Der Flashmob, der Arthur und mich im Postamt getrennt hat, war ein Heiratsantrag für die Frau hinter dem Schalter. Bei der ich das Paket mit den Sachen an meinen ersten Ex Hudson aufgeben wollte. Zwar war mir das Porto zu teuer und sie nicht besonders nett, aber heute strahlt sie, mit ihrem großen Lippenring und einer schwarzen Seidenstola über einem schlichten weißen Kleid.
Erst Belvedere Castle, jetzt sie. Das Universum könnte mir auch gleich ein Schild mit Arthur Seuss’ Namen in blinkenden, broadwayverdächtigen Neonbuchstaben vor die Nase halten.
Seit Monaten hatten wir keinen Kontakt, aber das muss ich ihm schicken.
Schnell filme ich mit dem Handy, wie die Braut auf den Bräutigam zuschreitet. Dylan und Samantha sehen zu und schmiegen sich aneinander. Ich öffne Arthurs Nachrichten – die letzte ist vom siebten April, meinem Geburtstag. Ich habe nicht geantwortet, weil … na ja. Ich habe es einfach nicht über mich gebracht. Alles lief gerade so gut mit seinem neuen Freund und ich wollte nicht so tun, als hätte ich einen tollen Geburtstag. Ich hätte mich trotzdem melden sollen. Denn jetzt fühlt es sich irgendwie seltsam an.
Als würden wir uns kaum noch kennen.
Ich öffne Instagram. Für mein Seelenheil habe ich sein Profil stumm geschaltet. Es tat zu sehr weh, online zu gehen und Bilder vom glücklichen Arthur und vom glücklichen Mikey zu sehen, wie sie gemeinsam ein glückliches Pärchen sind. Ich musste ein bisschen Abstand nehmen. Das Leben war schon stressig genug, mit den Kursen am College, dem Gefühl, zu Hause festzusitzen, und der Einsamkeit ohne Dylan oder eine eigene neue Beziehung.
Arthurs Feed anzuschauen ist so ähnlich wie ein Pflaster abzureißen. Der Blick aus seinen blauen Augen auf dem runden Profilbild geht mir immer noch durch und durch. Ich sehe die Übersicht seiner letzten Posts: das Bild eines Kartons in seinem Wohnheimzimmer, ein Zitat der demokratischen Politikerin Stacey Abrams »No matter where we end up, we’ve grown from where we began«, ein altes Foto mit seiner Mom und eins von Arthur und Mikey im Theatersaal ihrer Uni mit einem Programmheft in der Hand. Mir steigt Hitze in die Wangen. Und dann zieht sich mir das Herz zusammen. Ein Selfie von Arthur: Er hält eine Postkarte des Central Parks in die Kamera. Genau die habe ich ihm im Sommer vor zwei Jahren zum Abschied geschenkt. Auf der Rückseite steht eine sexy Szene zwischen unseren Charakteren aus Der Zorn der Zauberer, Ben-Jamin und König Arturo, die nur für seine Augen bestimmt ist.
Warum hat er ein Foto von sich mit dieser Postkarte gemacht?
Ich lese die Caption:
Arthur Seuss geht auf Tournee! Nächster Halt – New York City! 17. Mai
Er kommt hierher.
Morgen.
Und er hat eine Postkarte aus unserer gemeinsamen Vergangenheit verwendet, um zu verkünden, was seine Zukunft bringt.
In den Kommentaren überschlagen sich Mikey, seine beste Freundin Jessie und seine ehemalige Kollegin Namrata mit lieben Worten. Ich bin das einzige Arschloch aus New York, das kein bisschen Begeisterung gezeigt hat. Das Bild jetzt zu liken fühlt sich komisch an. Aber was, wenn das der beste erste Schritt zu mehr Kontakt ist? So, wie ich uns kenne, laufen wir uns doch eh früher oder später zufällig über den Weg. New York hat uns einander immer nähergebracht – zumindest als wir noch beide in der Stadt waren.
Ich like den Post. Und obwohl ich mich nicht bewege, schießt mein Puls in die Höhe, als würde ich einen Sprint hinlegen.
Bevor ich auch noch einen Kommentar hinterlassen kann, entreißt Dylan mir das Handy.
»Wir werden hier gerade Zeugen von Liebe in Reinform!«
»Wir können sie von hier aus ja nicht mal hören …«
»Fühl die Liebe, Ben, fühl sie.«
»Ob ihr’s glaubt oder nicht, ich war sogar schon bei ihrem Antrag dabei.«
»Dein Ernst?«, fragt Samantha.
»Jap. Das war am selben Tag, an dem ich Arthur getroffen habe. Ich hab euch doch von dem Flashmob erzählt? Der war für die beiden hier.«
Und in dem ganzen Tumult damals bin ich einfach verschwunden. Ich hatte mich gerade erst von Hudson getrennt, und obwohl ich das Gespräch übers Universum echt genossen habe, dachte ich in dem Moment nicht, dass das mit Arthur irgendwohin führen würde. Nicht eine Sekunde habe ich geahnt, dass ich mich so sehr in den Jungen mit der Hotdogkrawatte verlieben würde.
»Was für ein Zufall, dass du jetzt auch in ihre Trauung stolperst«, bemerkt Samantha.
Klingt eher, als hätte das Universum hier die Finger im Spiel.
»Sie sind noch so jung. Was meint ihr, knapp über zwanzig?«, frage ich.
»Sie sind seit vorletztem Sommer verlobt.« Samantha flüstert, als würde sie versuchen, die Gelübde zu hören. »Sie müssen es ernst meinen.«
»Meine Eltern haben jung geheiratet«, wirft Dylan ein. »Und das ist auch gut gegangen.«
»Deine Mutter hasst deinen Vater«, entgegnet Samantha.
»Sie hasst es, dass er mit offenem Mund kaut, nie die Klorolle wechselt, bei der Steuer trickst und sie mitten in der Nacht weckt, um ihr zu erzählen, was er geträumt hat, bevor er es vergisst. Aber sie hasst nicht ihn.«
Ich kenne seine Eltern – ein paar Hass-Vibes spürt man schon.
Nicht zu glauben, dass ich gerade live Lippenrings Hochzeit miterlebe. Und auch wenn sie damals echt unfreundlich zu mir war: Beim ersten Kuss der frischgebackenen Eheleute jubeln wir, als wären sie alte Freunde von uns. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass das die erste Hochzeit werden würde, bei der ich dabei bin. Vielleicht kann ich die Anekdote eines Tages in einem meiner Bücher verwenden.
Plötzlich wird es dunkel. Eine Hand bedeckt meine Augen. »Rate, wer ich bin, Ben Hugo Alejo«, sagt eine vertraute Stimme.
»Jemand, der super ist«, antworte ich.
Mario nimmt die Hand weg. »Worauf du wetten kannst.«
Ich wirbele herum und betrachte ihn. Ich bin mal wieder sprachlos darüber, wie gut er aussieht. Und das, ohne sich Mühe zu geben. Er ist nicht bloß fotogen, er ist auch im echten Leben schön. Seine grünbraunen Augen sind unglaublich, auch wenn sie mir im Gegensatz zu Arthurs blauen nicht sofort aufgefallen sind. Je besser Mario und ich uns kennenlernen, desto fesselnder finde ich sie. Manchmal dauert es eben etwas länger, bis sich Anziehung entwickelt. Aber das macht sie nicht weniger stark.
»Der Mario zu Bens Luigi«, ruft Dylan.
»Der Duke Dill zu Bens Ben-Jamin«, kontert Mario und schließt Dylan ohne zu zögern in die Arme, als würden sie sich schon ewig kennen. Mario und ich haben mal darüber gesprochen, dass unsere puerto-ricanischen Eltern uns zu einem sehr herzlichen Umgang erzogen haben, selbst Fremden gegenüber, und dass wir beide aber versuchen, anderer Leute Grenzen zu respektieren. Bei diesen beiden hier scheint es allerdings keinerlei Probleme zu geben. Mario wendet sich an Samantha: »Und die weltberühmte Cover-Designerin.«
Samantha lächelt. »Jap, so kennt man mich.«
Dylan schaut sie an. »Zum Glück wirst du nicht rot. Andererseits … wie kannst du es wagen?! Sieh dir diesen wunderschönen Mann an! Erröte für ihn. Lass diese Schönheit nicht unerrötet.«
Mario dreht sich zu mir. »Er ist haargenau so, wie du ihn beschrieben hast.«
»Ich kann halt mit Worten umgehen.«
»Oh ja, ich weiß.«
Und er erst! Wie macht er das? Oh ja, ich weiß. Nur vier kleine Wörtchen, und ich steh in Flammen.
Am liebsten möchte ich ihm jetzt ganz nah sein. So nah, wie es sich in öffentlichen Parkanlagen definitiv nicht gehört. Gleichzeitig kreisen meine Gedanken darum, dass er mich zur Begrüßung nicht mal flüchtig geküsst hat. Oder umarmt. Eine kleine Erinnerung, dass wir eben kein Paar sind. Sonst würden diese Dinge viel automatischer ablaufen. Ich wünsche mir jemanden, der seine Lippen nicht von mir lassen kann, oder dessen Hand immer meine sucht, als wären sie dazu bestimmt, eins zu sein. Aber bei Mario fällt es mir oft schwer einzuschätzen, ob er gerade überhaupt Lust hat, mich zu küssen oder meine Hand zu halten. Manchmal zeigt er mir sogar süße Typen, die vorbeilaufen, als würde er mich auffordern, sie anzusprechen. Als würde ihm das nichts ausmachen. Ich dagegen wüsste überhaupt nicht, wohin mit mir, wenn er in meiner Gegenwart mit einem anderen flirten würde.
Ab und an scheint sich aber die Chemie zwischen uns zu verändern. Dann kann ich vergessen, dass wir nicht zusammen sind, und wir haben einfach Spaß miteinander.
»Was ist das für eine Hochzeit? Freunde von euch?«, fragt Mario.
»Eine Freundin von Ben«, antwortet Dylan.
»Echt?«
»Lange Geschichte«, sage ich bloß.
»Erzählst du sie mir später?«
»Klar.«
»Estupendo.« Mario klatscht in die Hände. »Ich habe Geschenke dabei. Aber nicht für das Brautpaar.« Er greift in seinen Rucksack und holt zwei Der-Zorn-der-Zauberer-T-Shirts hervor.
Samantha klappt die Kinnlade nach unten. »Du bist ja der Hammer!« Sie zieht das T-Shirt über ihr Oberteil.
»Ich musste dir ja auch eins machen, damit du mich nicht wegen der Copyright-Geschichte verklagst.« Mario wendet sich an Dylan. »Und du sollst nicht denken, ich hätte dich vergessen.« Er zwinkert ihm zu, aber irgendwie seltsam, eher, als hätte er was im Auge. Auf gewisse Art ist das noch liebenswerter als ein perfektes Zwinkern.
Auch Dylan probiert sein Geschenk an. »Oh Gott, jetzt werde ich rot. Guck!« Und seine Wagen färben sich tatsächlich. Er lacht. »Mario, mein Guter, eigentlich ist es doch paradox, dass jemand wie du Klamotten herstellt. Mit deinem Aussehen solltest du jeden Tag nackt herumlaufen.«
»Vorsicht, sonst werde ich gleich auch noch rot«, erwidert Mario.
»Oh Mann, Ben«, sagt Samantha zu mir, »ich glaube, wir haben sie verloren.«
»Jap, sieht so aus.«
Mario zieht sein Handy aus der Tasche. »Ich muss ein Foto von euch dreien in den T-Shirts machen.«
»Nur, wenn du auch mit draufkommst«, mahnt Dylan.
»Ja!«, ruft Samantha.
»Geht klar.«
Ich lege den Arm um Mario; Dylan und Samantha schmiegen sich an uns. Mario so zu halten fühlt sich toll an, und nachdem wir das Selfie geschossen haben, lasse ich meinen Arm noch ein bisschen länger liegen.
Gemeinsam betrachten wir das Foto. Das Sonnenlicht taucht uns alle in schmeichelhaftes Licht und ist besser als jeder Filter.
Alle vier sehen wir so glücklich aus. Ich hoffe, das ist die erste von vielen glücklichen Erinnerungen, die wir diesen Sommer festhalten können. Und je weiter ich meine Welt für Mario öffne, desto mehr möchte er vielleicht ein Teil von ihr sein und seine auch für mich öffnen.
So läuft es ja in jeder Beziehung. Am Anfang ist da nichts, doch dann ist plötzlich alles drin.
2. Kapitel – Arthur
Samstag, 16. Mai
Meine Klamotten liegen auf dem Boden und Mikey in meinem Bett. Na ja, auf meinem Bett. Er hat sich mein Kissen in den Rücken geschoben, trägt eine Flanell-Pyjamahose, seine Brille und sonst nichts außer einem Klausurenwoche-Dreitagebart. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Der Sexy-Stoppel-Mikey ist mein Lieblingsmikey.
Seinem vorbildhaften Ordnungssinn kann jedoch keine noch so stressige Klausurenwoche etwas anhaben. So besteht kein Zweifel, welche meiner Umzugskartons er gepackt hat. Es sind die, die mit akkuraten Stapeln aus Handtüchern, Laken und so weiter gefüllt säuberlich mit Edding beschriftet in Reih und Glied am Fußende meines Bettes stehen: Arthurs Bettwäsche, Arthurs Bücher. Momentan ist er damit beschäftigt, die Fotos von der Wand neben sich zu knibbeln, wobei er das abgelöste Patafix zu einem hühnereigroßen Patafixklumpen zusammendrückt.
Ich lasse mich neben ihn plumpsen. »Weißt du, wie das aussieht?«, frage ich und zeige auf den Klumpen.
»Wie Patafix?«
»Warte, das Auge fehlt.« Ich drücke mit dem Finger ein Loch hinein und sehe Mikey erwartungsvoll an.
»Wie Patafix mit Augenhöhle?«
»Mikey! Das ist der Blob aus Monsters vs. Aliens!«
»Ah.« Er klebt ein weiteres Klümpchen Patafix drauf, wodurch der Blob ein Toupet zu tragen scheint.
»Na toll, jetzt sieht er aus wie Trump.« Schnell klopfe ich Blob-Trump platt wie einen Pfannkuchen und werfe ihn auf den Nachttisch. »Viel besser.«
»Ein wahrer Aktivist«, sagt Mikey.
»Mh-hm.« Ich küsse ihn. »Weißt du was?«
»Was?«
»Mir ist langweilig.
»Langweile ich dich?!«, beschwert er sich.
»Das Packen! Das langweilt mich.« Ich streiche ihm den Pony aus dem Gesicht und küsse ihn noch einmal.
»Du weißt schon, dass wir nie fertig werden, wenn du immer wieder mit so was anfängst?«
Ich lächle bloß, weil Mikey eben durch und durch Mikey ist. Obwohl wir jetzt schon monatelang zusammen sind, wird er immer noch ganz verlegen, wenn ich ihn küsse. Manchmal räuspert er sich danach und sagt: Also dann. Oder er sieht auf die Uhr oder fragt, ob die Tür auch wirklich abgeschlossen ist, und wochenlang dachte ich, damit würde er ablenken und verhindern wollen, dass wir uns weiterküssen. Doch inzwischen weiß ich Bescheid. Mikey ist so einer, der sich etwas wünscht und dann aber Panik kriegt, sobald der Wunsch sich erfüllt.
Ich lehne meinen Kopf an seine Schulter und lasse den Blick durchs Zimmer schweifen: schiefe Bücherstapel, herumfliegender Papierkram. Hier zeigt sich mein Messietum in ganzer Pracht. Mikey hat sein Zimmer natürlich schon vor vier Stunden komplett ausgeräumt.
»Danke, dass du hier bist«, murmele ich.
Wenn er wollte, könnte er schon in Boston sein. Aber wir wissen beide, dass kein Universum existiert, in dem Mikey nicht dableibt, um mich zu retten.
Ich stehe auf, rolle ein gelb gestreiftes Poloshirt zusammen, das ich vor zwei Jahren aus Dads alter Kiste mit Highschool-Andenken geklaut habe, und stopfe es in meine New-York-Reisetasche – ein riesiges Ungetüm, das vor lauter Shirts, Jeans, Büchern und Was-weiß-ich-nicht-alles bereits aus allen Nähten platzt. Ich bin gespannt, ob und wie ich das morgen in den Zug kriege. Mittlerweile bin ich einfach nur froh, wenn ich es überhaupt nach New York schaffe. Denn vorher muss ich noch meine dreißig Tonnen Mist aus diesem Wohnheimzimmer schaffen.
Ich stupse einen der Kartons mit dem Fuß an und raufe mir die Haare. »Was muss noch in die Reisetasche? Ich habe mein Ladegerät, T-Shirts, Jeans –«
»Unterwäsche?«, fragt Mikey.
»Check.«
»Kleidung für die Arbeit? Anzug und Krawatte?«
»Anzug und Krawatte? Damit ich aussehe wie Bürojob-Bob?« Ich schüttle den Kopf. »Michael McCowan, hier geht es um queeres Off-Broadway-Theater! Die lachen mich doch von der Bühne!«
»Von der Bühne?« Mikey kneift die Augen zusammen. »Du bist der Praktikant eines Assistenten.«
»Praktikant des Regieassistenten! Hast du eine Ahnung, wie viele sich für diesen Job beworben haben?«
»Vierundsechzig.«
»Ganz genau, vierundsechzig«, bestätige ich nur leicht verlegen. Dann habe ich Mikey eben ein Ohr abgekaut, während ich ein, zwei oder vielleicht auch ein paar hundert Mal über mein Praktikum gesprochen habe. Aber kann man es mir übel nehmen? Es geht schließlich um mein allergrößtes Luftschloss von Traumberuf. Mein Luft-Versailles. Eigentlich kann ich immer noch nicht glauben, dass es wahr wird. Keine Woche mehr, dann arbeite ich für niemand anderen als Jacob Demsky! Für den Lambda-Award-prämierten Theaterautor! Den Regisseur, der zwei Mal bei den New York Innovative Theatre Awards ausgezeichnet wurde! Wie könnte ich da nicht zumindest den einen oder anderen Luftsprung machen vor Glück?
Ich hatte irgendwie gehofft, Mikey würde auch ein paar Glückssprünge machen, weil er sich für mich freut. Oder würde, na ja, zumindest versuchen, nicht jedes Mal eine I-Aah-Miene zu ziehen, wenn ich es erwähne.
Ich meine, ich versteh’s ja. Natürlich verstehe ich es. Wir hatten schon alles so schön geplant für unseren Sommer zu zweit: Wir hätten ihn in Boston verbracht, hätten im Gästezimmer von Mikeys Schwester gewohnt und tagsüber bei einer Ferienbetreuung gearbeitet. Nicht gerade ein Job, der wahnsinnig den Lebenslauf aufwertet, aber darum ging’s mir ja auch gar nicht. Es ging mir um Emack-&-Bolio’s-Eis, um Donuts am Bostoner Union Square und um Tagesausflüge nach Salem und Cape Cod an den Wochenenden. Es ging mir um Mikey.
Aber dann hat Jacob Demsky dieses Praktikum ausgeschrieben und ich bekam es beim besten Willen nicht mehr aus dem Kopf.
Die Bezahlung, dachte ich mir, beträgt zwar weniger als die Hälfte des Ferienbetreuerlohns, aber sparsam wohnen könnte ich trotzdem, dank Onkel Miltons Apartment. Die Zeit mit Mikey zu verpassen, dachte ich weiter, wäre zwar echt doof, aber ich würde schließlich nicht auf den Mond ziehen. Und nach den Ferien wären wir ja wieder vereint. Außerdem brauchte ich mir eigentlich ohnehin keine Gedanken zu machen, denn Jacobs Wahl würde nie im Leben auf mich fallen. Mir war klar, dass sämtliche queeren Broadway-Fans des Landes um diesen Job wetteifern würden. Und die meisten hatten sicher beeindruckendere Referenzen vorzuweisen als die Rolle des Beauregard in Beauregard und Belvedere bei Ethan im Keller.
Trotzdem. Ich legte mein ganzes Herz in diese E-Mail und klickte auf Senden.
Dann versuchte ich hauptsächlich, nicht mehr daran zu denken. Ich konzentrierte mich auf Boston und Mikey und lernte unter Einsatz von Blut, Schweiß und Tränen, wie man Freundschaftsarmbändchen knüpft, denn, wow, Ferienbetreuerfähigkeiten wie diese wurden mir beileibe nicht in die Wiege gelegt. Doch Ferienbetreuer würde ich werden. In Boston. Denn Boston war real und New York war eine geheimer- und sinnloserweise in einen gähnenden Abgrund geworfene E-Mail.
Zumindest bis vor zwei Wochen.
Ich werde nie vergessen, wie Mikey erstarrte, als ich es ihm erzählte. Dass ich zum Zoom-Vorstellungsgespräch eingeladen war.
Ich betrachte ihn einen Augenblick. Mikey Phillip McCowan, mein armes blasses Häufchen Elend von einem Freund. Mit um die Beine geschlungenen Armen sitzt er da und vermeidet Blickkontakt.
»Mikey-Maus«, sage ich eilig. »Mach Don’t Lose Ur Head an.«
Wenn ein Album Mikey ein Lächeln entlocken kann, dann ist es die Aufnahme des vom Original-Cast gesungenen Musicals Six.
Folgsam stöpselt er mein Handy vom Ladegerät ab, tippt mein Entsperr-Passwort ein, aber dann … macht er erst recht ein langes Gesicht. Wortlos starrt er auf mein Handydisplay.
Und lächelt definitiv nicht.
Mein Herz tritt aufs Gaspedal. »Alles in Ordnung?«
»Ja. Klar.« Mikey tippt ein paarmal aufs Display, und Anne Boleyns Stimme ertönt aus meinem Bluetooth-Lautsprecher. Sonst singt Mikey immer lautlos mit, doch diesmal bleibt sein Mund eine übellaunige schmale Linie.
Es ist, als hätte sich ein Tiefdruckgebiet im Zimmer breitgemacht.
Ich streiche über einen der Umzugskartons, die ich im Haus meiner Oma unterstellen will. Bubbe hat einen riesigen Keller, die passen da locker noch rein. »Vielleicht trag ich den schon mal runter zum Auto.«
»Was wäre, wenn du einfach … nicht gehst?«
»Zum Auto?«
»Nach New York.«
Ich starre Mikey an, und er starrt durch die Brille mit todernstem Blick zurück.
»Mikey.« Ich schüttle den Kopf. »Ich habe einen Job, der –«
»In Boston hattest du auch einen«, unterbricht er mich sanft.
Mir dreht sich der Magen um. »Ich hätte es dir eher sagen sollen, Mikey. Es tut mir so –«
»Nein. Stopp.« Er schüttelt den Kopf und wird rot. »Du musst dich nicht schon wieder entschuldigen. Ich bin einfach … noch nicht bereit für morgen.«
»Ich auch nicht.« Ich lasse mich wieder neben ihn aufs Bett fallen.
»Ich wünschte, du würdest mit nach Boston kommen.«
Das nächste Lied fängt an. Heart of Stone. Ich ergreife Mikeys Hand und verschränke meine Finger mit seinen. »Na, zum Glück sind es nur zwei Monate.«
»Zehn Wochen.«
»Okay, zehn Wochen. Aber die vergehen ruckzuck, du wirst sehen. Wir werden nicht mal dazu kommen, uns zu vermissen.«
Mikey lächelt traurig. »Ich vermisse dich irgendwie jetzt schon.«
Ich sehe zu ihm auf und bin so bestürzt, dass ich kurz nach Luft schnappen muss. Ich vermisse dich irgendwie jetzt schon.
Ich meine, ich weiß ja, dass Mikey mich mag. Daran hatte ich nie einen Zweifel. Dass er es aber so direkt zeigt, ist eine echte Ausnahme, vielleicht sogar eine Premiere.
»Ich dich doch auch«, sage ich. »Aber in zwei Wochen sehen wir uns schon wieder.« Ich stupse ihn in die Seite. »Dann zeig ich dir all meine New Yorker Lieblingsorte. Central Park, Times Square, Levain Bakery – was du willst!«
Mikey runzelt die Stirn.
Ich kneife die Augen zusammen. »Was?«
»Ich habe nichts gesagt.«
»Du hast die Stirn gerunzelt.«
Mikey löst seine Hand aus meiner. »Es ist nur …« Er reibt sich den Nacken. »Warst du da überall mit Ben?«
»Oh. Nun. Ja.« Plötzlich bin ich nervös. »Aber das ist zwei Jahre her. Und Ben und ich haben seit Ewigkeiten nicht mal mehr miteinander gesprochen. Seit Februar nicht mehr.«
Mikey zuckt die Schultern, als würde er mir nicht recht glauben.
Doch es stimmt. Monate sind vergangen, seit Ben und ich das letzte Mal geredet oder uns auch nur geschrieben haben. An seinem Geburtstag im April habe ich sogar versucht, ihn per FaceTime zu erreichen, aber er hat nicht abgenommen. Er hat nicht mal auf die Nachricht reagiert, die ich ihm später geschrieben habe.
Mikey sieht mich aus traurigen Basset-Hundeaugen an. »Wirst du ihn treffen?«
»Ben?«
»Ihr seid dann ja schließlich in der gleichen Stadt.«
»Mikey, ernsthaft. Ich habe seit Februar kein Wort mit ihm gewechselt. Er weiß nicht mal, dass ich hinfahre.«
»Doch, ich glaube, das weiß er.«
Irgendetwas an Mikeys Tonfall ist verkehrt.
»Wovon redest du?«
Das nächste Lied fängt an. I Don’t Need Your Love. Ich könnte schwören, dass ich höre, wie Mikeys Herzschlag sich verändert. Er lehnt sich aus dem Bett, ertastet mein Handy und reicht es mir. Als ich das Display entsperre, springt mir die Instagram-Benachrichtigung schier ins Gesicht.
@ben-jamin gefällt dein Bild.
Mein Herz macht einen Satz. Seit Monaten hat Ben keins meiner Bilder mehr gelikt.
Ich hatte versucht, es nicht persönlich zu nehmen. Ist schließlich normal, dass Menschen sich aus den Augen verlieren, oder? Insbesondere Exfreunde.
Ich hatte nur nicht gedacht, dass es uns passieren würde. Ben und mir. Uns hatte ich irgendwie für unzerstörbar gehalten.
Und zu Anfang waren wir das ja auch.
Ich werde nie jene erste Woche vergessen, nachdem ich aus New York wieder nach Hause geflogen war. Ben und ich haben jede einzelne Nacht telefoniert, bis unsere Handyakkus leer waren. Und den Rest des Abschlussjahrs schrieben wir einander mindestens jeden zweiten Tag. Ich lief so oft mit ihm facetimend durchs Haus, dass Mom und Dad immer schon »Hi, Ben!« ins Handy riefen, ohne erst nachzugucken, ob er es überhaupt war. Manchmal klinkten sogar Bens Eltern Diego und Isabel sich ein, und die vier kaperten unser Telefonat für ein eigenes Gespräch unter sich. Ben und ich haben uns dann immer lautstark beschwert, aber insgeheim fanden wir es wohl irgendwie schön, dass unsere Eltern quasi nicht voneinander lassen konnten.
Und zumindest mir gefiel es sehr, dass das Gleiche für Ben und mich galt.
Ich dachte, im Studium würde es einfach so weitergehen. Oder sogar besser werden. Eigentlich sogar definitiv besser, weil ich nicht mehr jedes Mal, wenn ich nach einem Telefonat mit Ben aus meinem Zimmer käme, die wissenden Blicke meiner Mom würde ertragen müssen. Das macht übrigens, nur so fürs Protokoll, einen Heidenspaß: Man versucht, nicht in den Ex verliebt zu sein, während der sich auf FaceTime einfach herzallerliebst über Erzähltheorie aufregt, und wird dabei von den Eltern komplett durchschaut. All die elterliche freundbezogene Frotzelei ohne den dazugehörigen Freund.
Also Privatsphäre: gut. Die Nähe der Wesleyan zu New York: noch besser. Mit dem Zug keine drei Stunden Fahrt. Zwei, wenn ich mit dem Auto bis zu Bubbe fahren und dann in New Haven einsteigen würde. Natürlich habe ich nicht erwartet, dass Bens und meine Beziehung direkt dort anknüpfen würde, wo sie damals zu Ende gegangen war – nicht zwangsläufig jedenfalls. Andererseits schien Ben sich ehrlich zu freuen, dass ich in seine Nähe zog. Er sprach über Monate von nichts anderem mehr.
Als ich dann allerdings in Connecticut ankam, wurde alles sehr schnell sehr merkwürdig.
Ja, wir telefonierten immer noch ständig, und Ben sagte jedes Mal, dass ich ihm fehlte. Ja, ich fand morgens nach dem Aufwachen immer noch ausschweifende Weißt-du-noch-Nachrichten auf dem Handy vor. Aber immer, wenn ich ihm konkrete Zugabfahrts- und Ankunftszeiten nannte, änderte er schwindelerregend schnell das Thema.
Einmal schickte er mir einen Screenshot meines eigenen Instagram-Profilfotos, gefolgt von einem Herzaugensmiley. Daraus entspann sich eine zweistündige FaceTime-Beratschlagung mit Ethan und Jessie darüber, wie man am besten beiläufig und doch eindeutig folgende Frage stellt: Ähm, ich glaube ja, du flirtest bloß im Scherz, aber darf ich dich nur für den Fall, dass du ernsthaft an mir interessiert bist, bitte daran erinnern, dass ich über ein Einzelzimmer im Wohnheim verfüge?
Das alles hat mich irre gemacht und so wütend, und schon mutierte ich wieder zum komplett ben-ebelten Wirrkopf: Im einen Moment wollte ich unangekündigt vor Bens Haustür auftauchen, im nächsten knallhart seine Telefonnummer blockieren. Und, hey, ich war von lauter süßen Typen umgeben, die kein Blatt vor den Mund nahmen und gerne knutschen wollten, also probierte ich genau das. Doch im Endeffekt landete ich immer wieder allein in meinem Zimmer und brütete weiter über Ben Alejos Nachrichten.
Bis Mikey kam.
@ben-jamin gefällt dein Bild.
Ich kann den Blick nicht von der Benachrichtigung losreißen. Stünde da doch bloß, welches Bild er gelikt hat. Naheliegend wäre das Foto von gestern beim Packen. Aber es könnte auch mein Repost des Stacey-Abrams-Zitats von heute Nacht sein. Oder das Kinderfoto von Sonntag, als Muttertag war. Oder … alles Mögliche im Grunde. Mir jucken die Finger, so dringend will ich die App aufrufen, aber vor Mikey geht das natürlich nicht.
Ein Gefällt-mir-Herzchen.
Wenn ich nur wüsste, was es bedeutet.
Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich hat er beim Scrollen nur versehentlich draufgetippt. Wahrscheinlich hat er es nicht mal gemerkt. Ich frage mich, ob er seinen Like zurücknimmt, sobald er ihm auffällt. Verschwindet die Benachrichtigung dann einfach? Oder kriege ich eine neue, oder –
Erschrocken fahre ich zusammen, als mir bewusst wird, dass Mikey gerade gesprochen hat. Und ich kein Wort mitbekommen habe.
»Hm?« Ich schlucke schuldbewusst und mache die Musik aus. »Was hast du gesagt?«
Mikey sieht mich an. »Ich sagte, wenn du ihn treffen willst, dann solltest du das tun.«
»Mikey, hör mir doch zu: Ben und ich haben nicht mehr miteinander geredet seit –«
»Februar. Ich weiß.« Mikey zwinkert heftig. »Das sagtest du bereits. Mehrmals.«
Ich werde rot. »Es stimmt ja auch.«
Seit dem zwölften Februar nicht mehr, um genau zu sein.
Und ich hasse es. Ich hasse es, wie weit ich zu Bens letzten Nachrichten nach unten scrollen muss. Ich hasse es, nicht zu wissen, ob er seine neueste DZDZ-Überarbeitung abgeschlossen hat. Nicht zu wissen, ob seine Eltern sich durchgesetzt haben und er sich einen Job suchen musste. Ich hasse es, nicht zu wissen, was er heute Morgen zum Frühstück gegessen hat.
Und ich hasse es, dass ich selbst schuld daran bin. Durch mich wurde es zwischen Ben und mir erst recht merkwürdig. Wohl von da an, als Mikey und ich Silvester wieder zusammenkamen. Mikey kann ich keinen Vorwurf machen, denn er hat mich nicht etwa darum gebeten, die Freundschaft mit Ben zu beenden. Er wurde bloß jedes Mal, wenn ich Ben erwähnte, irgendwie gereizt und verschlossen.
Also hörte ich auf, Ben zu erwähnen.
Und wahrscheinlich hat Ben sich dadurch wie etwas gefühlt, das ich verstecke.
»Mikey, nur weil Ben einen meiner Insta-Posts likt, heißt das nicht, dass wir auf einmal wieder beste Freunde sind«, sage ich in einem Tonfall, der möglichst irgendwo zwischen gleichgültig und belustigt liegen soll. Doch selbst ich höre die defensive Schärfe heraus.
Mikeys Tick, bei dem er sich unterm Brillensteg in den Nasenrücken zwickt, flammt wieder auf. Im ersten Semester hat er das ständig gemacht. Tatsächlich fällt mir wohl erst jetzt richtig auf, dass er zwischenzeitlich damit aufgehört hatte. Er schließt einen Moment lang die Augen. »Darf ich ganz ehrlich sein?«
»Natürlich!« Ich rutsche ein Stück näher.
Doch er schweigt zunächst. Und dieses Schweigen fühlt sich uferlos und dick wie Watte an. Seine Stimme ist tonlos, als er endlich das Wort ergreift. »Ich weiß, dass du nicht mehr mit ihm geredet hast. Und selbst falls doch, vertraue ich dir, Arthur. Du würdest nie fremdgehen. Das weiß ich. Ich habe bloß Angst.«
Ich drücke mein Bein gegen seins. »Wovor?«
»Keine Ahnung. Ich schätze, ich fühle mich bedroht. Er war deine erste Liebe. Deine große Broadway-Lovestory.«
»Vor zwei Jahren. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr getroffen. Das weißt du.«
Mikey nickt. »Aber was wird passieren, wenn du ihn dann eben doch wiedertriffst?«
»Warum sollte ich? Seiner Meinung nach sind wir offenbar nicht mal mehr befreundet.«
»Und deiner Meinung nach?«, fragt Mikey und wirft mir einen komischen Blick zu.
Mir steigt das Blut ins Gesicht. »Also, wir waren es, würde ich sagen. Keine Ahnung. Er ist mein Ex. Vor einer Million Jahren waren wir für wenige Wochen ein Paar. Aber jetzt bin ich mit dir zusammen. Und, Mikey, ich mag dich wirklich sehr gern. Ich mag das mit uns.«
Und das ist die Wahrheit. Ich mag Mikeys Gesicht, seine Stimme, sein verschlungenes Nerdhirn – manchmal ist er so niedlich, dass ich es fast nicht aushalte. Und wir sind ein echt gutes Team. Wir streiten fast nie. Also, wegen New York war er in letzter Zeit etwas launisch, aber ich weiß, dass wir das hinkriegen werden. Wir kriegen es immer hin. Weil wir reife Erwachsene in einer reifen erwachsenen Beziehung sind. In einer guten, entspannten, soliden Beziehung. Und ich bin glücklich.
»Ich mag das mit uns auch«, sagt Mikey.
Ich nehme wieder seine Hand und drücke sie.
Es ist doch so: Ben war meine große Broadway-Lovestory, klar, aber da war ich sechzehn. So fühlt sich Verliebtsein mit sechzehn nun einmal an. Nur weil es sich jetzt anders anfühlt, ist es nicht weniger echt.
Ich betrachte Mikeys Gesicht. »Okay«, sage ich dann. »Ich zeig dir jetzt was. Eigentlich wollte ich dich damit ja in New York überraschen, aber …«
Ich stehe auf, strecke mich und stecke verlegen mein Shirt wieder in die Hose, was mir ein flüchtiges Lächeln von Mikey einbringt. Meine Umhängetasche lehnt gepackt und bereit am Bücherregal. Ich schnappe sie mir und trage sie zum Bett hinüber, wo ich den kleinen Reißverschluss an der Seite aufziehe.
Mikey sieht mir neugierig zu.
»Momentchen …« Nach kurzem Suchen ziehe ich zwei zusammengefaltete Blätter hervor. Ich reiche sie Mikey, doch er zögert. Ich stupse ihn an. »Nimm schon.«
Er gehorcht, faltet die Blätter auf, und hinter den Brillengläsern werden seine Augen groß wie Untertassen. »Was?! Dein Ernst?!«
»Heute in zwei Wochen. Matinee-Vorstellung. Aber ich sag’s dir gleich: Die Plätze sind leider furchtbar.«
Mikey starrt mich ungläubig an. »Wir gehen in Six?!«
»Wir gehen in Six!«
»Arthur, das … ist viel zu teuer. Das hättest du nicht machen müssen.«
»Als Entschuldigung. Weil ich unsere Ferien ruiniert habe.«
»Du hast sie nicht ruiniert.«
»Mh-hm. Doch, hab ich.« Ich lehne meinen Kopf an seine Schulter. »Und deswegen sollte es etwas Besonderes sein, weißt du? Etwas Besonderes für uns.«
»Arthur.« Mikeys Stimme klingt ganz erstickt.
»Und so teuer waren die Karten auch gar nicht«, sage ich schnell und hebe den Kopf, um ihm in die Augen zu sehen. »Ich meine, teuer schon, aber ich kriege Rabatt.« Ich zwinkere ihm zu. »Praktikantenbonus.«
»Warum zahlen sie dir nicht stattdessen mehr Lohn?«
»So funktioniert das nicht.« Ich küsse ihn auf die Wange. »Sorry, du wirst in den sauren Apfel beißen und dir die beste Show am Broadway mit mir ansehen müssen. Und weißt du was?«
Mikeys Mundwinkel wandern nach oben. »Was?«
»Du hast recht, ich muss eine Krawatte einpacken. Bürojob-Bob macht sich broadwayfein.« Ich stehe auf und blicke mich um. »Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo die Krawatten verstaut sind.«
»Im Paket neben deinem Schreibtisch mit der Aufschrift: Arthurs besondere Momente.«
Ich presse beide Hände ans Herz. »Du hast mir einen Karton für besondere Momente gepackt?«
»Mh-hm.« Schwach lächelnd betrachtet Mikey mich. Dann steht er ebenfalls auf und pflückt sein Shirt vom Boden. »Okay. Wie wär’s, wenn du jetzt zu Ende packst? Währenddessen gebe ich meinen Schlüssel ab und hole uns auf dem Rückweg was zu essen.«
»Mikey-Maus, du bist mein Held!« Nachdem er gegangen ist, lächle ich noch zwei oder drei Sekunden die geschlossene Tür an.
Doch dann schnappe ich mir mein Handy.
@ben-jamin gefällt dein Bild.
Offenbar will mein Herz aus seinem Brustkorb ausbrechen. Wegen einer Instagram-Benachrichtigung. Lächerlicher geht’s wohl nicht.
Jedenfalls tippe ich sie an, und zwei Sekunden später starre ich auf meinen New-York-Post von letzter Woche. Ein Selfie, auf dem ich die Central-Park-Postkarte hochhalte, die Ben mir vor zwei Jahren zum Abschied geschenkt hat. Auf ihrer Rückseite steht eine handgeschriebene Ben-Jamin-und-Arturo-Szene. Aber natürlich hat der einzige Mensch, der die Karte hätte wiedererkennen können, den Post mal wieder komplett ignoriert, wie üblich.
Gefällt @ben-jamin und weiteren Personen.
Bis heute. Dem letzten Tag vor meinem Aufbruch nach New York.
3. Kapitel – Ben
Sonntag, 17. Mai
Einen Vorteil hat es, dass Pa jetzt mein Chef ist: Zur Abwechslung werde ich dafür bezahlt, wenn ich tue, was er sagt.
Den Großteil meines Duane-Reade-Gehalts konnte ich in meinen hoffentlich nächsten Job investieren: Mega-Bestseller-Autor von Der Zorn der Zauberer. Ich habe mir ein Schreibprogramm angeschafft, das mir hilft, die Fäden meines Worldbuildings zusammenzuhalten, und den Domainnamen für die Website meines Projekts gekauft. Das ist zwar sehr optimistisch, aber Mario hat mich hervorragend gehypt und meinte, meine Reihe könnte das nächste große Ding werden. Wie grandios wäre es bitte, ein komplettes Franchise zu haben, mit Filmen und Spin-off-Comics und Computerspielen, die alle in meiner Welt angesiedelt sind? Ma und Pa müssten dann natürlich nicht mehr arbeiten, auch wenn es durchaus was für sich hätte, Pa in meinem DZDZ-Freizeitpark herumzukommandieren.
Vorerst händigt er mir allerdings einen Korb voller Schwangerschaftstests und Kondome aus. »Hier ist noch Nachschub für den Familienplanungsgang.«
»Sollten Kondome nicht eigentlich woanders hin? Was hältst du davon, wenn wir einen Keine-Familie-Planungsgang einführen?«
»Klar, nur zu. Ich bin sicher, die Firma sähe nichts lieber, als dass der neunzehnjährige Sohn eines ihrer Filialleiter hier den kompletten Grundriss umwirft.«
»Warum nicht? Alle lieben Vetternwirtschaft.«
Echt nicht zu fassen, dass ich in meinem ersten richtigen Job für meinen Vater arbeite.
Eher hatte ich mir vorgestellt, neue Bücher in einem Buchladen einzusortieren. Aber als Pa mir gesteckt hat, dass Duane Reade neue Leute sucht, habe ich mich doch beworben. Ich dachte, ich müsste bloß Regale einräumen und könnte dabei Musik hören. Tja, falsch gedacht. Vielmehr muss ich mir so schnell wie möglich einprägen, wo welche Sachen im Laden sind, weil Kund*innen es hassen, wenn du die Antwort nicht in Google-Suchgeschwindigkeit parat hast. Und ich muss außerdem an der Kasse arbeiten, was mich hart stresst, wie sich herausgestellt hat. Einmal habe ich einem Kunden zu wenig Wechselgeld rausgegeben, und er wollte meinen Chef sprechen. Bedröppelt habe ich »meinen Chef« dann vor dem Kunden Pa genannt, worauf der sich vom Kunden anhören musste, er habe mir das Zählen nicht richtig beigebracht. Ich lief puterrot an und Pa biss sich auf die Zunge. Beide waren wir für den Rest der Schicht nicht besonders gut drauf.
Klar also, dass ich jede Gelegenheit nutze, hinten im Lager Kartons auszupacken. Keine Kunden plus Extrazeit, um über meine Welten nachzudenken – die echten und die ausgedachten.
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche.
»Kein Telefon während der Arbeitszeit«, sagt Pa.
»Ich schau nur auf die Uhr. Lo siento.«
»Está bien. Triffst du dich nachher mit diesem Jungen?«
Er meint Mario. »Nur mit Dylan.«
»Ah, dann ist ›nur‹ das falsche Wort. Selbst wenn es ›nur Dylan‹ ist, Dylan ist nie ›nur‹ irgendwas.«
Für Dylan hat Pa trotzdem deutlich mehr übrig als für Mario. Er findet, ich verdiene jemanden, der sich zu mir bekennt. Dabei hat sich zwischen Mario und mir erst vor etwa einem Monat mehr entwickelt. Über so vieles haben wir noch gar nicht geredet. Zum Beispiel über Marios Expartner oder darüber, ob er überhaupt auf der Suche nach einer festen Beziehung ist. Mir gefällt es nicht, wenn Pa ihn dafür verurteilt, dass er nicht »mein Freund« ist.
Pa klopft mir auf die Schulter. »Wenn ich dir auf Spanisch einen Penny für deine Gedanken versprechen würde, würdest du das schon verstehen?«
»No.«
»Das war immerhin die richtige Sprache.«
Ich starre weiter die Kondompackungen an.
Pa schnipst mit den Fingern. »Benito, rede mit mir.«
»Wir sind bei der Arbeit.«
»Ich bin immer noch zuerst dein Vater und nur in zweiter Instanz dein Chef. Es sei denn, du willst früher weg oder spontan freinehmen.«
Er versteht nicht, dass das Teil des Problems ist. Er ist mein Vater und mein Chef. Mag ja sein, dass er dieses Gespräch gerade führen will, aber ich bin ziemlich geschlaucht und brauche mal eine Verschnaufpause. Alles wäre halb so wild, wenn meine Familie mehr Geld hätte, so wie Dylans, und ich woanders aufs College hätte gehen können. Aber ich werde einen Teufel tun, irgendwas davon hier mit Pa zu besprechen, während wir unsere Duane-Reade-Kluft tragen. Wobei, zu Hause eigentlich auch nicht. Ich möchte einfach ein bisschen Privatsphäre.
»Es ist alles okay«, murmele ich.
Pa seufzt. »Wenn du das sagst. Also dann, gib Gummi mit den Gummis, dann kannst du früher Feierabend machen.«
»Danke.«
Pa räuspert sich übertrieben, wie immer, wenn er will, dass ich Spanisch spreche. Seit Mario zu meiner persönlichen Duolingo-App geworden ist, pusht Pa mich, es regelmäßig zu üben. Noch ein Grund, aus dem er vermutlich nicht ganz warm mit Mario wird, obwohl er das nie zugeben würde: Pa hatte seine Chance, mir Spanisch beizubringen, und sie nie genutzt. Jetzt habe ich mir dafür jemand anderen geholt.
»Niemand braucht Spanischunterricht, um gracias sagen zu können.«
»Jedes bisschen zählt.«
»Gracias, Pa.«
Er drückt meinen Arm. »Ese es mi hijo.« Sein Walkie-Talkie knistert, dann bittet Alfredos Stimme um Verstärkung an den Kassen. »Vergiss nicht, tschüss zu sagen, bevor du gehst«, mahnt Pa.
»Meinst du adiós?«
Pa schenkt mir eine angedeutete Verbeugung und eilt nach vorne in den Laden.
Wenn Pa so nett ist, habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich mich so abschotte. Aber warum eigentlich? Steht mir nicht ein bisschen Zeit zu, um in Ruhe meine Gefühle zu sortieren?
Beim Einräumen der Kondompackungen kommt mir ein weiterer Nachteil des Zusammenlebens mit meinen Eltern in den Sinn. Letzten Monat hat Pa beim Wäschemachen eine Kondomverpackung in meiner Hosentasche gefunden. Das führte dann zu diesem ernsten Gespräch, bei dem er mich fragte, ob ich »sexuell aktiv« bin. Als ich ihm gestand, dass ich sowohl mit Hudson und Arthur als auch mit Mario geschlafen habe, war er ziemlich schockiert. Und wurde nervös. Vermutlich kann man noch so viele Artikel darüber lesen, wie man mit seinen Kindern über Sex reden soll, man ist trotzdem überrumpelt, wenn der neunzehnjährige Sohn schon mehr Sexualpartner hatte als man selbst. Letzten Endes erklärte Pa mir schlicht, es würde ihn sehr erleichtern, dass immer Kondome im Spiel seien, und bot mir an, auch Ma reinen Wein einzuschenken, um mir das zu ersparen. Im Grunde macht es mir nichts aus, dass sie Bescheid wissen, aber den ganzen restlichen Abend konnte ich keinem von beiden in die Augen schauen.
So langsam sollte ich meine Gedanken mal von den Schwangerschaftstests und Kondomen wegsteuern, doch mein bester Freund lässt das nicht zu.
»Aha!«, tönt Dylan. »Ich hätte wissen müssen, dass ich dich hier finde.«
»Warum?«
»Na, wahrscheinlich bereitest du dich auf einen Sexmarathon mit deinem hotten Freund vor.«
»Er ist nicht mein Freund.« Und als Dylan schon den Mund öffnet, füge ich hinzu: »Und nein, wir veranstalten keine Sexmarathons.«
»Wie kann es sein, dass du nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit deinen Hintern an dem dieser perfekten Kreatur reibst?«, will Dylan wissen und fügt hinzu: »Meine Theorie ist ja, dass Mario von irgendeinem notgeilen Dr. Frankenstein im Labor gezüchtet wurde. Und Samantha glaubt das auch. Zumindest hatte sie keine Gegenargumente. Ich meine …« Dylan pfeift leise durch die Zähne.
»Stimmt, er ist wirklich schön.«
»Du meinst: heiß!«
Ich fülle noch mehr Schwangerschaftstests nach, obwohl es hier im Gegensatz zu den Kondomen eigentlich keinen Nachschub braucht. Die Zahlen sprechen für sich.
»Zwischen uns geht’s aber nicht nur um Sex.« Ich stehe auf, um die überschüssige Ware zurück ins Lager zu bringen.
»Ich weiß, Big Ben. Ich habe euch zusammen gesehen. Du wirst hundertpro sein Luigi, und ihr werdet trotzdem eure Rohre entlangrutschen und …« Dylan hält kurz inne, während ein kleines Kind an uns vorbeiläuft. »… dann –«
»Du brauchst diesen Satz wirklich nicht zu beenden«, unterbreche ich ihn hastig.
Ich verschwinde nach hinten, stempele aus und tausche die khakifarbene Hose und das Poloshirt gegen Jeans und ein blaues T-Shirt mit V-Ausschnitt. Die Farbe erinnert mich an den Nagellack, den Mario manchmal trägt. Als ich zurückkomme, studiert Dylan gerade den Klappentext eines Liebesromans aus unserem Sortiment. Ich stelle mich dicht vor ihn, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, aber er liest weiter halblaut vor, wie eine Elitesoldatin und ein Grundschullehrer sich rettungslos ineinander verlieben.
»Wär’s schwul, das zu kaufen?«, fragt er mich.
»Was glaubst du denn?«
Dylan denkt kurz nach. »Nein?«
»Korrekt.«
»Mega. Wie viel Mitarbeiterrabatt kriegst du? Fünfzig Prozent?«
»Nein.«
»Siebzig?«
Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass wir mit diesem Schmachtfetzen vor den Kassen anstehen, winkt Pa uns jetzt auch noch ausgerechnet zu seiner hinüber.
»Dylan, willkommen zurück!«
»Es ist mir eine Ehre, Diego.« Dylan salutiert.
Pas höfliches Lächeln erinnert an die Male, wenn er von Kunden genervt ist, aber trotzdem nett zu ihnen sein muss. Er wendet sich an mich. »Du hättest dich doch nicht anstellen müssen, um tschüss zu sagen.«
»Habe ich auch nicht.«
Dylan tritt vor und hält ihm das Corpus Delicti unter die Nase.
»Für Samantha?«, fragt Pa.
Dylan schüttelt den Kopf. »Diego, Diego. Ich hätte Sie etwas moderner eingeschätzt.«
»Sagt der Typ, der mich gerade noch gefragt hat, ob es schwul wäre, das Buch zu kaufen«, werfe ich ein.
»Sagt der Typ, der gern Liebesromane liest.« Dylan zwinkert Pa zu. »Das zahlt sich aus bei den Frauen – und bei Ihrem Sohn.« Er legt mir den Arm um die Schulter.