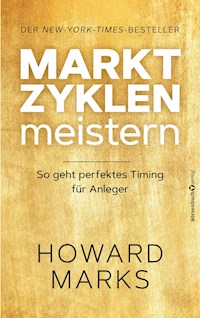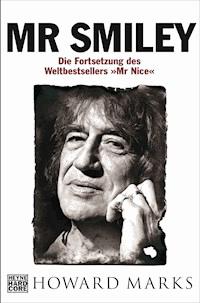
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Millionenbestsellers »Mr Nice«
Howard Marks war der berühmteste Drogenschmuggler seiner Zeit und gleichzeitig Held einer ganzen Generation. Nach seiner Freilassung aus einem der härtesten amerikanischen Gefängnisse schrieb er den Millionen-Bestseller »Mr Nice«. Was kaum einer wusste: Neben seiner Rolle als Bestsellerautor geriet er Mitte der Neunziger in den Strudel der Ecstasyund Clubkultur. Und hatte es plötzlich wieder mit Verbrecherbossen und Gangstern zu tun. »Mr Smiley« nimmt den Leser mit auf eine unglaubliche Reise durch die Drogen-, Clubbing- und Verbrecherszene der Neunziger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Howard Marks war der berühmteste Drogenschmuggler seiner Zeit und gleichzeitig ein Held einer ganzen Generation. Nach seiner Freilassung aus einem der härtesten amerikanischen Gefängnisse, schwor er sich, fortan ein sauberes Leben zu führen. Keine Drogen, kein Schmuggel, keine gefälschten Pässe. Er wollte mit seiner Familie auf einer kleinen balearischen Insel in Spanien in Frieden seinen Lebensabend verbringen. So ganz gelang ihm das nicht.
Mitte der Neunziger – der Hochzeit von Ecstasy und der Clubkultur – war Ibiza das Mekka der sogenannten E-Generation. Marihuana wurde von Pillen abgelöst. Statt zur Musik der Rolling Stones bedröhnte man sich zu den Trance-Klängen von Paul Oakenfold. Es dauerte nicht lang, bis auch Howard von der Welle erfasst wurde. Und schon bald hatte er es wieder mit Verbrecherbossen und Gangstern zu tun, wie etwa jenen, die 1983 am legendären Goldraub von Heathrow beteiligt gewesen waren. Während sich die Party-Gemeinde auf einen der heißesten Sommer des Jahrzehnts einstimmte, bereitete sich Howard auf seine bislang unglaublichste Operation vor.
Zum Autor
Howard Marks, Jahrgang 1945, ist Großbritanniens berühmtester Drogenschmuggler, der sieben Jahre in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis einsaß, bevor er 1995 entlassen wurde und mit seiner Autobiografie Mr Nice einen Weltbestseller landete. Der frühere Oxford-Physikstudent wurde im Laufe der Zeit mit so unterschiedlichen Gruppierungen wie der CIA, IRA, MI6 und der Mafia in Zusammenhang gebracht. 2014 wurde bei Marks Krebs im Endstadium diagnostiziert. Mr Smiley ist somit sein Vermächtnis.
HOWARD MARKS
MR SMILEY
MEINE LETZTE PILLE UNDMEIN TESTAMENT
Aus dem Englischenvon Urban Hofstetter
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
MR SMILEY
bei Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, London
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das kompletteHardcore-Programm sowie den monatlichen Newsletter.
Weitere News unter www.facebook.com/heyne.hardcore
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2015 Howard Marks
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Der Abdruck des Auszugs aus Falling Angel bei den Eingangszitaten erfolgtmit freundlicher Genehmigung. Falling Angel © 1978 William Hjortsberg
Redaktion: Petra Hofmann
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,unter Verwendung des Original-Artworks von Stuart Wilson
Foto Frontcover © Andrew Davies Photography
Gesetzt bei Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-18543-5V001
www.heyne-hardcore.de
Die Namen von einigenin diesem Buchvorkommenden Personenwurden geändert.
»Ich habe nach etwas Verborgenem gesucht,nach jemandem, der nicht gefunden werden wollte,mich in die älteste Art von Gefahr begeben.«
Falling Angel von William Hjortsberg(fürs Kino adaptiert unter dem Titel Angel Heart)
»Wir hatten einen Traum,und die Gangster haben gemordet.«
Tony Wilson, im Gespräch mit Howard Marks
Dieses Buch ist meiner TochterMyfawny Marks gewidmet.
Am letzten Tag des Jahres 1996, weniger als zwei Jahre nachdem ich wegen guter Führung vorzeitig aus dem amerikanischen Staatsgefängnis Terre Haute entlassen wurde, wo ich eigentlich eine fünfundzwanzigjährige Haftstrafe wegen Drogenschmuggels absitzen sollte, trug ich ein Päckchen extrem reines MDMA durch einen Flughafen. Natürlich ließen sie, als ich beim Zoll von Palma de Mallorca auftauchte, sofort einen Spürhund auf mich los. Die Entscheidung, wen man filzt, wird normalerweise im Voraus aufgrund der Passagierliste getroffen. Und da ich unter meinem richtigen Namen von London aus eingereist war, hatte ich mit Schwierigkeiten gerechnet. Aber ich hatte das Chaos erlebt, in dem der Flughafen während der Renovierungsarbeiten versunken war, die in diesem Jahr stattfanden. Und so schlich ich mich, nachdem man mich durch die Passkontrolle gewunken hatte, in einen Lagerraum, der – wie ich wusste – nicht verschlossen war. Als ich von einem Zwei-Mann-Team zur Leibesvisitation in eine Kabine bugsiert wurde, befand sich das Päckchen MDMA in einem anderen Teil des Flughafens, mit Bienenwachs ummantelt und an die Innenseite einer Schranktür geklebt – ich hatte es dort versteckt, als wir nach der kurzen Fahrt von der Landebahn zum Terminal aus dem Bus gestiegen waren.
Nachdem sie mich durchsucht und nichts gefunden hatten, ließen sie mich mit sichtlichem Widerwillen ziehen. Vor den Türen standen ein paar Angestellte vom Boden- und vom Reinigungspersonal und rauchten; sie sahen zu mir her, als ich zwischen den Bretterbuden vor dem Terminal hindurchging, sprachen mich aber nicht an. Ich blickte zum Hauptgebäude zurück, so, als wollte ich dorthin. Sobald ich jedoch vom Eingang und den Fenstern des Terminals aus nicht mehr zu sehen war, ging ich zurück zu den Busparkplätzen. Im Gehen streifte ich mir Arbeitskleidung aus meiner Reisetasche über.
Das Päckchen war da, wo ich es zurückgelassen hatte, in einem Gebäude, das zur spanischen Charterfluglinie Aviaco gehörte. Ich steckte es in die Hosentasche, wo es klebrig gegen mein Bein drückte, und bemerkte, dass mir die Menschenmengen, die ich durch die Fenster im Transitbereich sah, keine Angst mehr machten. Auch die weiten offenen Flächen schienen kleiner und nicht länger beunruhigend. Zum ersten Mal, seit ich das Gefängnis verlassen hatte, fühlte ich mich wieder gut und als Herr der Lage.
Ich konnte meine wahre Natur nicht verleugnen: So wie ein echter Läufer zum Laufen geboren ist und ein Schriftsteller zum Schreiben, war die Sehnsucht des Schmugglers nach Nervenkitzel ein tiefverwurzelter Teil meines Wesens – wie ein Retrovirus, das jederzeit aktiviert werden kann. Wahrscheinlich könnte keine andere Lebensweise mich je wirklich befriedigen, und ganz plötzlich schien es mir wichtig, diesen Moment der Erkenntnis auf irgendeine unauslöschliche Weise festzuhalten.
Am Straßenrand sah ich das Bild einer Madonna und hielt den Wagen an. Ich hatte eine Abkürzung durch die Vororte von Palma genommen. Es war bereits ziemlich dunkel, als ich aus dem Auto stieg, und so konnte ich kaum ihre Gesichtszüge erkennen. Mit einem etwas bangen Gefühl ließ ich mich auf die Knie sinken und schwor einen feierlichen Eid, dass ich mir, noch bevor das Jahr in wenigen Stunden zu Ende ging, wieder selbst treu sein würde. Kaum hatte ich den Schwur geleistet, da schien die Luft um mich herum von einem heiseren Gelächter erfüllt zu sein. Ich blickte mich um, konnte dessen Ursprung aber nicht ausmachen, ganz so, als ob das Lachen vom Madonnenbild selbst stammte. Vermutlich drang es aus einem der Nachbargebäude oder einem in der Nähe parkenden Auto, aber ich hatte das Gefühl, dass es allein mir galt.
In einer Bar in der Stadt warteten meine Töchter Amber und Francesca auf mich. Sie waren so schön und selbstsicher wie eh und je, genau wie in jenen ersten Wochen nach meiner Rückkehr. Während der Jahre meiner Haft waren sie beide zu stärkeren und klügeren Menschen herangereift, als ich je zu hoffen gewagt hatte. Und als ich mit ihnen zusammensaß, lastete mein Eid schwer auf mir und fühlte sich von Minute zu Minute mehr wie ein Fluch an als wie etwas, das ich wirklich wollte.
Nach achtzehn Monaten, in denen ich herauszufinden versucht hatte, was ich mit meinem Leben nach sieben Jahren im Gefängnis anfangen sollte, war ich gerade von einer Publicity-Tour aus England zurückgekehrt, auf der ich meine Memoiren mit dem Titel Mr Nice vorgestellt hatte. Und obwohl meine Zukunft in mancherlei Hinsicht wieder etwas rosiger aussah, wurde ich das Gefühl nicht los, dass in meinem Leben etwas Wichtiges fehlte.
Ich muss wohl ungewöhnlich still gewesen sein, weil die Mädchen mir immer wieder besorgte Blicke zuwarfen und das Eis zu brechen versuchten, indem sie das Gespräch auf Musik lenkten – das einzige Thema, zu dem ich immer etwas zu sagen hatte. Da im Gefängnisradio nur Country gelaufen war und es im von Schwarzen dominierten Gemeinschaftsraum ausschließlich Hip Hop zu hören gegeben hatte, kannte ich mich mit den neuen Musikrichtungen Trance und Acid House, für die Francesca mich begeistern wollte, nicht aus. Dabei erwähnte sie immer wieder, dass es überhaupt keinen Sinn hatte, sich diese Musik anzuhören, wenn man nicht auf Ecstasy war. Aus ihren Worten schloss ich, dass sie bereits Erfahrung mit der Droge hatte. Dann erzählte sie mir von einem Rave – etwas, das ich noch nie erlebt hatte –, der in einer Höhle bei Gal Dent stattfand, etwa vierzig Autominuten von Palma entfernt in den Bergen nahe Llucmajor, und dass wir da hinfahren würden.
Als die Uhr Mitternacht schlug, hielt ich ein Glas Cava in der einen und einen Joint in der anderen Hand. Ich küsste meine Mädchen und spuckte gemäß einer spanischen Sitte für jedes Jahr, das ich hinter Gittern verbracht hatte, einen Traubenkern aus. Als der Zeitpunkt kam, gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen, spukte wieder die Madonna, deren Gesicht ich nicht deutlich hatte sehen können, durch meine Gedanken. Die Worte meines Eids und das darauf folgende meckernde Lachen hallten noch in meinem Kopf wider. Ich wusste, ich hätte mir wünschen sollen, von meinem Schwur entbunden zu werden. Aber der Moment für einen Wunsch verstrich, und es war zu spät.
Als wir die Berge erreichten, vergaß ich beim Anblick des schönen Panoramas, was geschehen war; die Dämmerung sandte bereits ihre ersten zarten Lichtstrahlen; der winterliche Himmel, der in überirdischen Rosa- und Gelbtönen zu brennen schien, wurde allmählich blassblau. Auf halbem Weg, die schlammige Straße hinauf, sahen wir vor uns Leute mit Sonnenbrillen, die in demselben geisterhaften Halblicht zu erstrahlen schienen. Das Auto blieb im Schlamm stecken, so wie die meisten der Fahrzeuge um uns herum, und wir mussten den Rest des Weges bis zu der von Bergen eingeschlossenen Höhle zu Fuß zurücklegen, während das Licht des anbrechenden Tages unserer Umgebung allmählich eine sichtbare Form verlieh. Als wir an den letzten Autos vorübergingen, nahm ich eine Pille aus meinem Vorrat und war gespannt, was mich erwartete.
Die Musik war laut, und um mich herum tummelten sich ein paar Hundert Partygäste, von denen einige T-Shirts mit Acid-Smiley-Gesichtern trugen. Ich hatte mit mehr Menschen gerechnet. Man hatte mir erzählt, dass Ecstasy Lust auf Tanzen machte, und ich tanzte, damit die Wirkung einsetzte. Gerade als ich eine weitere Pille einwarf, strömten ungefähr tausend Menschen aus einem dunklen Tunnel. Die Menge wogte um mich herum und zog mich mit sich in einen Katakombengang, wo Fremde mich umarmten, mir Feuer für meinen inzwischen ausgegangenen Joint gaben und mich auf ein schwaches Licht zuführten, das immer heller leuchtete, je weiter sich der Raum vor mir auftat.
Um mich herum torkelten und tanzten Leute zwischen über uns aufragenden Bogenkonstruktionen; die Stroboskoplichter wirbelten, von donnernden Beats angetrieben, über die Höhlenwände. Mein Körper schien beinahe schwerelos zu sein, und ich glaubte mit den anderen zu verschmelzen, als wäre ich eine einzelne Zelle in einem gigantischen Wesen. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass Ecstasy-Musik eine Frequenz von 140 Beats pro Minute hat – genau wie der Herzschlag eines Embryos –, und in diesem Moment fühlte ich mich tatsächlich wie in einem sicheren und tiefen Schoß, aus dem ich niemals mehr hinauswollte. Hier drinnen fühlte ich mich angekommen und vollendet. Und ich war mir sicher, dass ich diesen Schoß schließlich als neuer Mensch verlassen würde, geläutert und wiedergeboren. Dann tauchten Amber und Francesca wieder an meiner Seite auf und lachten und tanzten.
Bereits während sie mich zum Auto zurückführten, begannen die Eindrücke zu verblassen – viel zu schnell, wie die Erinnerung an einen Traum; und ich hatte das Gefühl, mich durch eine kalte und undurchdringliche Dunkelheit zu bewegen.
KAPITEL 1
Ecstasy hatte mich nie besonders interessiert. Wie viele andere auch, hörte ich von dieser Droge zum ersten Mal in den Siebzigern, als das Gerücht von einer neuen »Liebespille« aufkam, die kalifornische Therapeuten verabreichten, um Paare zusammenzubringen. Ungefähr zu dieser Zeit las ich dazu auch einen Artikel in Newsweek. Außerdem hieß es, Timothy Leary habe seine Frau Barbara geheiratet, nachdem er ein paar dieser Pillen genommen hatte. Er sagte damals voraus, dass diese Liebespille die alles bestimmende Droge der Achtzigerjahre werden würde. Ich schenkte diesem Gerede jedoch keine große Beachtung, da ich das Ganze für ein vorübergehendes Phänomen hielt. Als mir die Droge Ende der Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre ein paarmal in New Yorker Clubs angeboten wurde, lehnte ich jedes Mal ab. Ich war nicht sicher, wie lange ihre Wirkung anhielt, und ich verhandelte zu dieser Zeit gerade einen komplizierten Marihuana-Deal mit der Gambino-Familie, die den Flughafen JFK kontrollierte, an dem die Ware eintreffen sollte. Ich hatte das Gefühl, auf der Hut sein zu müssen, und hielt es unter diesen Umständen für zu riskant, mit einer unbekannten Größe zu experimentieren.
In den frühen Achtzigern, als ein schwuler Freund mich eines Abends in die Paradise Garage mitnahm – einen Club in der Nähe des Hudson Square –, wurde die Droge zum ersten Mal als Ecstasy angeboten und nicht mehr unter einem der anderen bis dahin gebräuchlichen Namen wie Adam, love juice oder disco biscuit. Natürlich wusste ich damals noch nicht, dass die Bezeichnung Ecstasy hängen bleiben sollte. Wegen der ständig wechselnden Namen hielt ich die Droge noch immer für etwas Kurzlebiges, eine bloße Modeerscheinung und keinesfalls etwas Dauerhaftes. Aids wuchs sich gerade zur Epidemie aus, und der Club war von der Schließung bedroht. Aus Angst vor immer weiteren Ansteckungsfällen erhielten die meisten Schwulen-Clubs keine Verlängerung ihrer Lizenzen. Ich muss zugeben, dass ich mich in der Paradise Garage ein wenig unwohl fühlte und dass ich angesichts der Panik, die damals überall herrschte, Angst hatte, etwas Neues auszuprobieren. Und so winkte ich auch an diesem Abend ab, als man mir am Eingang die kleinen weißen Pillen hinhielt.
Im oberen Stockwerk legte der legendäre Larry Levan auf, den ich bereits vom Studio 54 kannte. Mit seinem schlabberigen weißen Hemd ohne Kragen oder Aufschläge stellte er seinen üblichen Piraten-Look zur Schau. Um ihn herum hatte sich eine andere Szene als im Studio versammelt. Wegen der Hitze, die trotz des Winters hier drinnen auf der Tanzfläche herrschte, trugen die Menschen leichte Sommerkleidung, und obwohl kein hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt wurde, sahen alle auf eine Weise zugedröhnt aus, die ich so noch nie gesehen hatte. Das waren nicht die rhythmischen Bewegungen von Tänzern auf Kokain oder Quaaludes, damals die beiden beliebtesten Disco-Drogen. Stattdessen machten die Leute einen eher selbstvergessen und tranceartigen Eindruck auf mich. Anders als im Studio, wo man vor allem Freunde treffen und jemanden abschleppen wollte, schienen die meisten der Gäste hier nichts Sexuelles im Sinn zu haben; diese Party wirkte mehr wie irgendeine religiöse Zusammenkunft. Ein Laufsteg, in den zahllose funkelnde weiße Lichter eingelassen waren, führte hinunter in die wogende Menge. Ich fühlte mich wie auf einem Kreuzfahrtschiff, das sich auf eine letzte Reise mit geplant tödlichem Ausgang begeben hatte. Und die Musiker hörten nicht auf zu spielen.
Der Freund, mit dem ich an diesem Abend unterwegs war, hieß Ed Miles. Er war in der Szene als Ed von Nirgendwo bekannt und gehörte zu einer neuen Generation von Dealern, die in den Clubs groß geworden waren. Er war noch nicht wirklich erwachsen und sah mit seinem wilden blonden Schopf und seiner hoch aufgeschossenen Figur wie ein Strichmännchen aus. Das ganze Jahr über trug er Sommerklamotten und Sonnenbrillen in grellen Farben, wie ein Entertainer in Kindershows. Aber trotz seiner komischen Erscheinung war Miles ein gewiefter Geschäftsmann. Ein paar Jahre lang war er der Liebling von Susan Dee gewesen, der Haus- und Hofdealerin der New Yorker Society; über sie hatte er Kontakt zu Juan Royal in Texas geknüpft – dem einzigen Ecstasy-Großhändler zu jener Zeit –, von dem Miles seine Ware beinahe zum Erzeugerpreis bezog. Jetzt, da die Clubs in Manhattan einer nach dem anderen dichtmachten, begann er seine Geschäfte nach England zu verlagern: im Flugzeug schmuggelte er kleine Mengen Ecstasy, die er als Vitamintabletten ausgab, und verkaufte sie im Limelight, Legends, Browns, Haven und anderen Clubs im Londoner West End.
Die Kundschaft dort konnte sich Preise von bis zu fünfundzwanzig Pfund pro Pille leisten, und da Miles damals noch die einzige ernsthafte Quelle war, verlangte er Höchstpreise. Mit den Drogen, die er bei Royal erwarb, strich er in der britischen Hauptstadt ungefähr tausend Prozent Gewinn ein – doppelt so viel, wie er zu Hause gemacht hatte. Aber da London im Vergleich zu New York ein relativ kleiner Markt war, dauerte es nicht lange, bis er auch in andere Städte expandierte – solche, in denen es bereits Club-Szenen mit einem Netzwerk von Dealern gab, die er anzapfen und versorgen konnte; so wie etwa Manchester im Norden Englands, wo seit der Post-Punk-Ära eine aktive Underground-Musikszene entstanden war.
Das nächste Mal, dass ich von Miles hörte, war im Jahr 1986. Ich hielt mich gerade in England auf, wo ich mich um eine Lieferung Thai-Gras kümmerte, die in einem Frachtschiff voller Kokosmatten aus Laos im Hafen von Liverpool eintreffen sollte.
Um ehrlich zu sein, hatte ich Miles vermisst, seit ich wieder in Europa war – seinen Humor, seinen unverfälschten Blick auf die Welt und seinen beeindruckenden Geschäftssinn. Und so freute ich mich sehr, als er sich bei mir meldete. Er war wieder mal geschäftlich in Manchester unterwegs, einem Ort, von dem er während seiner Zeit in den New Yorker Clubs vermutlich noch nicht mal gehört hatte und der so fernab von der glamourösen Welt Manhattans lag, wie man es sich überhaupt nur vorstellen konnte. Doch überraschenderweise klang er am Telefon ganz begeistert: »Komm mich besuchen«, sagte er. »Ich werde dir die Zukunft zeigen.« Eine solche Einladung konnte ich nur schwer ausschlagen. Also verließ ich am nächsten Abend Liverpool, wo ich bei Freunden gewohnt hatte, und machte mich auf den Weg zu ihm.
Miles holte mich vom Bahnhof ab und brachte mich zu einer Siedlung namens Hulme, einer der schlimmsten Wohngegenden von Manchester. Er hatte sichtlich Schwierigkeiten mit dem Linksverkehr und damit, ein Auto mit Schaltgetriebe zu fahren. Immer wieder schlingerte er zwischen den Spuren hin und her und wechselte krachend die Gänge. Wahrscheinlich hatte er niemals Fahrstunden genommen. Zwar besaß er Führerscheine aus mehreren Ländern – die waren aber alle ebenso falsch und unehrlich erworben wie seine Sonnenbräune.
Nachdem Miles sich immer wieder verfahren hatte, parkten wir schließlich in Hulme und gingen auf einen halb verfallen aussehenden Wohnturm zu. Dabei passierten wir ein paar Möchtegernräuber, die am anderen Ende eines Durchgangs lauerten. Die Jugendlichen starrten Miles fasziniert hinterher. Wie gewöhnlich trug er Strandklamotten und eine Sonnenbrille. Zielsicher lotste er mich durch ein Labyrinth aus unbeleuchteten Wegen.
Die Wohnung, in die wir schließlich eintraten, sah aus, als hätten sie Hausbesetzer in Beschlag genommen. Ein paar der Zimmer waren zu Tanzflächen umgewandelt worden, und mir war auf den ersten Blick klar, dass ich etwas völlig Neues vor mir hatte. Es spielte zwar die gleiche Musik wie in der Paradise Garage, aber hier waren nicht nur Männer. Kaum einer trank etwas, und der vorherrschende Kleidungsstil bestand aus Schlabber-Klamotten und Chucks. Die Tänzer bewegten sich unbeholfen und abgehackt, und jeder schien seinem eigenen Rhythmus zu folgen. Es war das erste Mal, dass ich Mädchen sah, die ohne Make-up ausgegangen waren und beim Tanzen schamlos schwitzten. Und es war auch das erste Mal, dass ich einen ganzen Raum voller Menschen vor mir hatte, die alle gleichzeitig bis über beide Ohren grinsten. Als ich mich umschaute, sah ich immer wieder die Smiley-T-Shirts, die mir schon in den Clubs von New York aufgefallen waren.
Miles’ Zukunftsprognose schien sich zu bewahrheiten, als die Szene innerhalb nur weniger Monate die Mainstream-Clubs von Manchester erreichte – zuerst das Hacienda, in dem bald so viel Ecstasy konsumiert wurde, dass niemand mehr Alkohol bestellte. Vom Hacienda sprang der Funke auf Londons größten Schwulen-Club, das Heaven, über. Dann folgten das Clink in South Bank und schließlich die Partys im Ministry of Sound. Damit begannen die Großveranstaltungen, die die nächsten Jahre bestimmen sollten und bei denen nicht mehr Alkohol und Abschleppen, sondern Fahrgeschäfte, Gast-DJs und Lichtshows für die Unterhaltung sorgten.
Als die Szene bereits im folgenden Sommer zu gewaltiger Größe anschwoll, mit Acid-House-Abenden in Clubs wie dem Limelight und in Pubs an der Portobello Road, trugen die Partygäste bald überall die gleichen Smiley-Shirts und schlabberigen, übergroßen Strandklamotten, die ich in jener Nacht in Hulme gesehen hatte. Es war, als ob Miles selbst diesen neuen Dresscode inspiriert hätte.
Und immer wenn ich diesen Look sah, musste ich an Miles denken, der irgendwann in dieser Zeit ganz unvermittelt aus meinem Leben verschwunden war und eine Lücke hinterlassen hatte, die kein anderer ausfüllen konnte. Aber ich nahm an, dass er irgendwo im Hintergrund immer noch ein wichtiger Teil der Szene war.
Ab dem Frühjahr 1987 sprach man in Dealer-Kreisen viel über das große Geld, das sich mit Ecstasy verdienen ließ. Freunde von Miles erklärten mir, sie hätten in den Dschungelwäldern von Thailand und Laos Drogenlabors eingerichtet und würden für den Transport nach Europa die etablierten Marihuana- und Heroin-Routen benutzen. Sie erzählten mir auch von dem Dealer-Gipfeltreffen, das 1986 in Barcelona stattgefunden hatte.
Im Rückblick war schon damals klar, aus welcher Richtung der Wind in Zukunft wehen würde: Der althergebrachte Drogenhandel veränderte sich rasch angesichts des verlockenden neuen Rauschmittels, mit dem sich schnellere, größere und allem Anschein nach auch sicherere Gewinne erzielen ließen. Doch weil ich damals noch nicht verstand, was sich da anbahnte, vergrub ich den Kopf im Sand, blieb weiter bei meinem Geschäft und tat das, womit ich mich auskannte.
Was 1986 in einem besetzten Haus in Manchester seinen Anfang genommen hatte, sollte sich nur drei Jahre später, während des zweiten sogenannten Summer of Love, zur größten Clubszene entwickeln, die Europa jemals gesehen hatte.
1995 kam ich aus dem Gefängnis frei. Ich hatte mir zwar fest vorgenommen, mein Leben in Ordnung zu bringen und von nun an gesetzestreu zu bleiben. Doch das Schicksal führte mich mitten in eine der extravagantesten Drogenszenen dieses Planeten. Für mich – einen Ex-Knacki, der nichts konnte außer schmuggeln – war die Versuchung, dabei mitzumischen, einfach überwältigend.
Nur wenige Monate bevor ich Miles 1986 in Manchester traf, hatte sich im obersten Stockwerk des Hotel Majestic am Passeig de Gràcia in Barcelona eine Gruppe von Großdealern zusammengefunden, um über Ecstasy zu diskutieren. Ich selbst war zwar nicht anwesend, habe aber von Leuten, die dabei waren, in allen Einzelheiten erfahren, was bei diesem Treffen besprochen wurde.
Dem Hotelpersonal, das an dem Tag Dienst hatte, war mitgeteilt worden, dass es sich bei der Zusammenkunft um eine Konferenz bedeutender Plastik-Erzeuger handle. Sowohl die Penthouse-Suiten als auch die Dachterrasse mit Blick auf die Sagrada Família waren von den Sicherheitskräften aller beteiligten Fraktionen abgeriegelt und für die Öffentlichkeit gesperrt worden. Seit Lucky Luciano und die anderen Mafiabosse sich drei Jahrzehnte zuvor im Hotel Nacional versammelt hatten, um den Heroinhandel unter sich aufzuteilen, hatte es kein vergleichbares Treffen mehr gegeben.
Auf der Tagesordnung standen vor allem das bevorstehende Verbot des Methamphetamins MDMA in den USA und die Frage, welche Konsequenzen sich daraus ergeben würden. Obwohl MDMA damals in Kanada und dem größten Teil Europas bereits verboten war, hatte man es in den USA bislang legal verkaufen können. Und viele der Anwesenden hatten dabei ordentliche Profite erzielt; allen voran der Mann, der das Treffen einberufen hatte: ein US-Amerikaner mexikanischer Herkunft namens Juan Royal.
Royal war das Oberhaupt der Texas Group, die mit dem MDMA-Handel Gewinne von vielen Millionen Dollar einstrich und von der auch Miles seine Vorräte bezog. Ihre Kunden konnten den Stoff über eine gebührenfreie Telefonnummer bestellen und mit Kreditkarte bezahlen. Verschiedene Nachtclubs in Dallas, Fort Worth und Houston, an denen Royal beteiligt war, verkauften MDMA ganz offen über die Theke. Die Pillenproduktion der Gruppe war inzwischen auf beinahe eine Million Stück pro Monat angewachsen, und Royal achtete peinlich genau darauf, dass die Steuern stets ordentlich abgeführt wurden.
Sie boten MDMA in ihren Clubs als Tanzdroge an und profitierten dabei von den neuen Musikstilen, die sich aus den letzten Ausläufern der Gay Disco entwickelt hatten: House und Garage von den DJs aus Chicago und New York sowie Techno aus Detroit. Es dauerte nicht lange, bis auch das benachbarte Kanada auf den Zug aufsprang, und bald danach sollte Europa folgen; hauptsächlich dank britischer Stars wie Boy George oder Marc Almond, die von der MDMA-geschwängerten Szene im Studio 54 und der Paradise Garage fasziniert waren und den neuen Trend begeistert nach Hause trugen. Die Texas Group reagierte auf die wachsende Nachfrage von der anderen Seite des Atlantiks und exportierte MDMA fortan auch in Länder, in denen der Besitz und der Konsum illegal waren und wo Kunden bereit waren, fünfundzwanzig Dollar oder mehr pro Pille auszugeben. Um auf diesen Wachstumsmärkten Fuß zu fassen, ging die Gruppe Allianzen mit mächtigen Verbrecherorganisationen in Kanada und Europa ein.
Und Vertreter von genau diesen Organisationen hatte Juan Royal an diesem Abend in seiner Suite in Barcelona um sich versammelt. Der wichtigste Punkt auf der Agenda waren die Verhandlungen darüber, wie die Territorien in den Vereinigten Staaten und Europa zukünftig untereinander aufgeteilt werden sollten. Bei diesen Gesprächen kam es zu keinen größeren Unstimmigkeiten. Schließlich kontrollierten die meisten der Anwesenden profitable Absatzmärkte und hatten kein Interesse daran, den derzeitigen Status quo zu gefährden. Die zentralen Punkte, auf die man sich während dieses Treffens verständigte, sollten den globalen Drogenmarkt über Generationen hinaus regeln.
Als sich die Anführer der Syndikate schließlich zum Aufbruch bereit machten, wies ein Mann namens Spencer Purse, der zu Royals Rechten saß, mit einer Geste auf das Meer hinaus. Purse war ein Brite, der schon sehr lange alles Mögliche, von südafrikanischen Diamanten bis hin zu afghanischem Haschisch, schmuggelte. Außerdem betrieb er eine ganze Reihe erfolgreicher Firmen, die als legale Fassade für seine Geschäfte dienten: eine Antiquitäten- und Kunsthandlung in London, Chemiefabriken in der Schweiz, Deutschland und Taiwan sowie Hersteller von Erfrischungsgetränken in Spanien und Italien. Er verkaufte MDMA zwar erst seit etwa einem Jahr, hatte jedoch in der spanischen Clubszene sehr schnell Fuß gefasst und sich damit den Respekt der Anwesenden erworben.
»Und die Balearen?«, fragte er nun beiläufig, als wäre ihm der Gedanke gerade erst gekommen.
Die meisten der Männer am Tisch zuckten nur die Achseln. Sie hatten kaum je von den Baleareninseln gehört, die ungefähr dreihundert Kilometer südöstlich von ihrem momentanen Aufenthaltsort lagen und nur spärlich besiedelt waren – abgesehen von ein paar bei nordeuropäischen Sommerurlaubern beliebten Küstenorten. Auf diesen Inseln gab es keinen nennenswerten Drogenhandel, ließ man eine Handvoll Zigeuner und Alt-Hippies außer Acht, die marokkanisches Marihuana und LSD verkauften. Darüber hinaus fanden sich an den Stränden ein paar Freiluft-Nachtclubs, in denen verschiedene DJs aus aller Welt während der Sommermonate auflegten. Es wurden kleine Mengen Ecstasy konsumiert, aber das war es auch schon. Jedenfalls gab es keinen offensichtlichen Grund, warum sich irgendjemand für die Balearen interessieren sollte. Als Purse um Bestätigung bat, dass sie auch weiterhin Teil seines Einflussgebietes bleiben würden, willigten Royal und die anderen ohne zu zögern ein.
Und damit wurde das wahrscheinlich einträglichste (und nachträglich umstrittenste) Abkommen in der Geschichte des Rauschgifthandels geschlossen. Denn bereits wenige Monate später hatte sich die Baleareninsel Ibiza zu dem Ort mit dem weltgrößten MDMA-Konsum entwickelt – allein mit den Pillen sprang dort ein geschätzter Jahresgewinn von fünfzig Millionen Dollar heraus. Was dazu führte, dass Purse mit seinem Wohlstand und seinem Einfluss schon bald Royal und der Texas Group Konkurrenz machte.
Dieses Abkommen bestimmte in den folgenden Jahren nicht nur den globalen Drogenhandel, sondern auch die Entwicklung der Popkultur und der Musik auf der ganzen Welt. Und ab Mitte der Neunzigerjahre nahm es auch direkten Einfluss auf mein Leben – als ich zu meiner Familie auf die Baleareninsel Mallorca zurückkehrte, die nur wenige Kilometer von Ibiza entfernt lag und die, als ich sie verlassen hatte, nichts als ein verschlafener Außenposten der späten Hippie-Bewegung gewesen war.
Doch damals in den späten Achtzigerjahren hielt ich es noch für besser, bei meinen bewährten Geschäften zu bleiben. Und so konzentrierte ich mich weiterhin auf den Export von thailändischem Marihuana in die USA – bei dem die Gewinne eine bekannte und stete Größe darstellten.
Wahrscheinlich hatte ich die falsche Entscheidung getroffen. Denn im Zuge einer der größten und kompliziertesten Einsätze in der Geschichte der amerikanischen Drogenermittlungsbehörde DEA wurde ich 1988 in Haft genommen – und mit mir siebzehn meiner Geschäftspartner aus sieben verschiedenen Ländern. Womit mein Leben, so wie ich es bis dahin kannte, ein abruptes Ende fand. Danach verbrachte ich den größten Teil meiner Zeit mit Anwälten und dem Versuch, meiner Auslieferung von Spanien nach Florida zu entgehen. Doch vergeblich: Schließlich wurde ich in die USAabgeschoben und dort von einem Bundesgericht zu fünfundzwanzig Jahren Haft verurteilt.
Damals dachte ich gelegentlich an Miles und fragte mich, wie es ihm wohl ergehen mochte. Doch nach ein paar Monaten tauchte sein Gesicht immer seltener vor meinem inneren Auge auf. Er schien einer Welt anzugehören, zu der ich vielleicht nie wieder zurückkehren würde. Ich schrieb ihm, erhielt jedoch keine Antwort. Ich probierte auch ein paarmal, ihn bei seiner Produktionsfirma in Laurel Canyon zu erreichen, wo er offensichtlich versuchte, sich im Filmgeschäft neu zu erfinden. Aber er schien zu respektabel geworden oder zu abgehoben zu sein, um meine Anrufe entgegenzunehmen. Ich versuchte, deswegen nicht zu verbittern. Stattdessen wünschte ich Miles von ganzem Herzen alles Gute und konzentrierte mich auf meine neue Lebensaufgabe, die darin bestand, die nächsten Monate und Jahre zu überstehen, ohne den Verstand zu verlieren.
KAPITEL 2
Während meiner sieben Jahre im Gefängnis bekam ich es nur einmal mit Ecstasy zu tun. Erst sehr viel später wurde mir klar, dass das, was an jenem Tag passierte, großen Einfluss auf mein zukünftiges Leben haben sollte. Es ist keine Übertreibung, wenn ich behaupte, dass es das prägendste Ereignis in meiner zweiten Lebenshälfte war und für immer die Leben auch all jener veränderte, die mit mir in den Sog der daraus folgenden Ereignisse gerieten.
Ich hatte inzwischen vier Jahre von meiner Haftstrafe im US-amerikanischen Bundesgefängnis Terre Haute abgesessen und glaubte damals noch, dass ich insgesamt ein Vierteljahrhundert hinter Gittern verbringen würde. Eines Tages kam ein Wachmann zu meiner Zelle und erzählte mir, dass unangekündigter Besuch für mich gekommen sei und dass er in zehn Minuten zurückkommen werde, um mich zum Verhörraum zu führen.
Ich hatte an diesem Tag niemanden erwartet, und ohne sowohl meine ausdrückliche Genehmigung als auch die der Gefängnisleitung durfte mich kein Mensch von außerhalb besuchen. Ich vermutete, dass es sich wohl um den Methodistenprediger handeln könnte; er genoss unbeschränkte Zugangsrechte und schneite alle paar Monate rein, um nachzusehen, wie es denen erging, die weit weg von zu Hause in Haft saßen. Aber er war erst eine knappe Woche zuvor bei mir gewesen und kündigte seine Besuche außerdem immer vorher an; es handelte sich also vermutlich um einen ausländischen Polizisten oder Geheimagenten.
Mein Deal mit dem Gericht schloss zwar aus, dass ich mit den Ermittlungsbehörden der USA zusammenarbeiten musste – Agenten aus anderen Ländern konnten jedoch jederzeit auftauchen und mich befragen. Ein paar Monate zuvor hatte mich die deutsche Polizei um Unterstützung bei der Anklageerhebung gegen den mutmaßlichen IRA-Terroristen James McCann gebeten. Man beschuldigte ihn, in einen Deal mit marokkanischem Hasch verwickelt gewesen zu sein. Ich war keine große Hilfe. Ich schwor, dass ich nichts mit einem marokkanischen Haschdeal zu tun gehabt hatte und dass das meines Wissens auch für James McCann galt. Er wurde daraufhin von den Vorwürfen freigesprochen – und das, obwohl die deutschen Staatsanwälte zu einem ungewöhnlichen Mittel griffen: Sie bezahlten dem DEA-Agenten, der mich verhaftet hatte, Geld, damit er nach Deutschland flog und dort vor einem Gericht elf Stunden lang die Glaubwürdigkeit meiner Aussage in Zweifel zog.
Es dauerte wesentlich länger als die üblichen zehn Minuten, bis der Wachmann zurückkehrte, meine Zellentür entriegelte und mich in das Büro des Gefängnisdirektors führte. Nach einer eingehenden Leibesvisitation brachte mich ein anderer Wachmann in den leeren Besucherraum. Gerade als ich Platz nahm, traten zwei hochrangige kanadische Polizeibeamte in Mounty-Uniform durch die Tür. Einer von beiden ergriff das Wort. Er hatte blonde Haare, ein fliehendes Kinn und wässerige Augen.
Sie waren anscheinend aufgetaucht, um Informationen über einen Ecstasy-Dealer einzuholen, der ihnen durch die Lappen gegangen war. Einer meiner Mitangeklagten, Gerald Wills, war bei der DEA bereits als Ecstasy-Schmuggler aktenkundig, und ich vermutete, dass es um ihn ging. Aber die Agenten erklärten mir, ihr Besuch habe nichts mit Wills zu tun.
»Wir überwachen MDMA-Lieferungen von Europa an die amerikanische Ostküste und nach Kanada«, erläuterte der mit dem fliehenden Kinn. »Wir glauben, dass ein einsamer Wolf dahintersteckt, ein Großimporteur namens Hebo.« Er machte eine Pause und wartete, ob von mir eine Reaktion kam. Zwar sagten mir weder der Name noch die Unternehmung irgendetwas, aber ich hörte weiter zu und bemühte mich, kooperativ zu erscheinen und den Eindruck zu erwecken, dass ich diesen Hebo möglicherweise kannte.
»Vor zwei Monaten hörten unsere Transponder auf zu senden. Es ist, als wären Hebo und seine Operation vom Erdboden verschluckt. Es gibt keine Spur von ihm oder den Drogen. Wir haben in diese Ermittlungen eine Menge Zeit und Geld investiert, und im Moment können wir rein gar nichts vorweisen.«
Daraufhin legte er wieder eine kurze Sprechpause ein, in der die beiden Männer mich weiter aufmerksam beobachteten. Sie gaben einiges an Informationen preis – mehr als in solchen Situationen üblich –, und ich konnte nicht beurteilen, wie viel davon stimmte. Ich vermutete, dass sie einfach mal bei europäischen Schmugglern die Runde machten, bei jedem ein wenig auf den Busch klopften und auf diese Weise irgendetwas zu finden hofften. Sie hatten vermutlich bereits eine ganze Reihe Gespräche geführt, bevor sie bei mir angelangt waren, und dabei einige Flugmeilen gesammelt. Ich hielt ihren Blicken stand und schwieg.
Schließlich erhoben sie sich von ihren Plätzen. »Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie jederzeit mit uns in Kontakt treten«, sagte Fliehendes Kinn noch, bevor sie gingen. Aber selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich ihnen nicht weiterhelfen können.
Obwohl ich es damals noch nicht ahnte, hatten die Worte der Kanadier eine Art Samen in mich eingepflanzt – eine fixe Idee, die noch mein Leben bestimmen sollte. Ich war überzeugt davon, dass die Kanadier nicht so viel in einen Einsatz investiert hätten, wenn ihre Zielperson nicht eine beträchtliche Menge Drogen verschoben hätte.
Es ist kein Geheimnis, dass Drogenschmuggler harte Arbeit scheuen. Sie gehören zu jener Sorte Geschäftsleute, die mit dem geringstmöglichen Aufwand den maximalen Gewinn erzielen wollen. Das erklärt vermutlich auch, warum es bei den hartnäckigsten Schmugglermythen niemals um den Handel mit eigenen Drogen geht. Stattdessen geht es darum, wie man sich die Vorräte eines anderen Dealers aneignet. Vorräte, die größer sind als alles, was man je selbst beschaffen könnte – ein wirklich epischer Riesenhaufen, der seinen Besitzer auf einen Schlag von allen Zwängen und Geldsorgen befreit. Diese Mythen, deren Helden entweder gewitzt sind oder einfach nur Glück haben, üben auf Drogenschmuggler die gleiche Faszination aus wie vergrabene Schätze auf Piraten, wie der große Bankraub auf gewöhnliche Verbrecher oder der Lotto-Jackpot auf gesetzestreue Bürger – in ihnen geht es um die Chance, mit geringem Risiko und minimalem Aufwand auf einen Schlag die ganz fette Kohle zu machen.
Was die Mounties mir erzählt hatten, verblasste bald in meiner Erinnerung, bis ich es angesichts der eintönigen Gefängnisroutine schließlich ganz vergaß. Doch dank ihrer Geschichte bot sich mir später die Chance, mehr Geld einzustreichen, als ein normaler Mensch in dreißig Lebensspannen verdienen kann. Und was das Wichtigste war: Ich bekam die Gelegenheit, die eine Sache zu tun, bei der ich mich so richtig lebendig fühlte. Aber bis dahin sollten noch ein paar Jahre vergehen.
Und so träumte ich in den Wochen, Monaten und Jahren im Gefängnis nur gelegentlich davon, dass ich eines Tages den einen letzten, lebensverändernden Deal über die Bühne bringen würde, mit dem meine Familie und ich für den Rest unseres Lebens ausgesorgt hätten.
KAPITEL 3
In Terre Haute versuchte ich so oft wie möglich für mich allein zu bleiben. Obwohl ich in der Bibliothek mit anderen Insassen zusammenarbeitete und ihnen sowohl in den Fitnessräumen als auch auf den Trainingsplätzen im Freien begegnete, sorgten meine ehemaligen Verbindungen zur Gambino-Familie dafür, dass die Aryans, die Hispanics und die anderen Gefängnisgangs mich weitestgehend in Ruhe ließen. Dadurch war ich aber auch von ihren Kommunikationsnetzwerken abgeschnitten.
Im März 1995, als der Tag meiner Entlassung immer näher rückte, dämmerte mir allmählich, dass ich nur wenig darüber wusste, was sich zwischenzeitlich in der Welt draußen getan hatte. Ich hatte eine ganze Zeit lang weggehört, wenn von Drogendeals jenseits der Gefängnismauern die Rede war, und mich generell von allem ferngehalten, was meine vorzeitige Entlassung hätte gefährden können. Auf das meiste, was man im Gefängnis hörte, konnte man sich eh kaum verlassen – bei manchem war allein der Wunsch Vater des Gedanken, anderes war bewusst gestreute Fehlinformation und vieles schlicht und einfach falsch, nachdem es als Stille Post die Runde gemacht hatte. Meiner Erfahrung nach führte es nie zu etwas Gutem, wenn man auf Knastgerede hörte. Aber meine Abgeschiedenheit hatte ihren Preis.