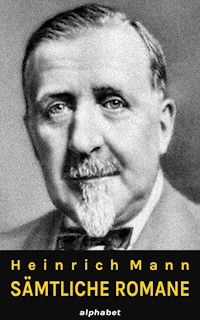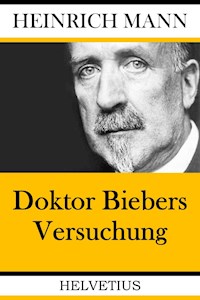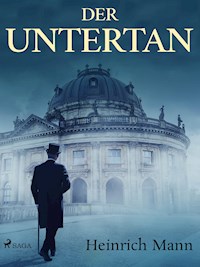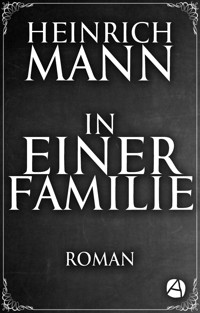Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinrich Manns erster Roman über Leben und Leiden in der Weimarer Republik.Berlin, Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist groß. Aus finanzieller Sorge setzt das junge Dienstmädchen Marie ihr Kind aus. Jahre später wendet sich das Blatt: Marie ist abenteuerliche Weise und durch Heirat zur reichen Baronin aufgestiegen. In dem jungen Valentin glaubt sie ihren Sohn wiederzuerkennen. Geplagt von Schuldgefühlen, versucht sie ihren Sohn zurückzugewinnen – und das Schicksal nimmt erneut seinen Lauf. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Mutter Marie
Saga
Mutter Marie
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1927, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726885682
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Erstes Kapitel
Im Klubsessel saß der Präsident, im Schaukelstuhl der General. Vor dem mit Bronze eingelegten Tischchen aus buntem Marmor, auf einem der zu ihm passenden Stühle im Empiregeschmack hielt die Generalin sich überaus gerade. Ihr Inneres drohte schlankweg einzubrechen, um so gerader hielt sie sich. Die große blasse Nase wirkte noch schärfer. Wenn der Präsident während seiner unliebsamen Eröffnungen einmal die Nase der Generalin ansah, ward er sogleich zurückhaltender.
Schaukelnd und sein einziges Auge gesenkt, hörte der General den Präsidenten an. »Das verkaufte Haus«, sagte der Präsident und legte die Stirn so schief, daß unter ihren fleischigen Falten der Blick sich verlor. »Die Schulden, der Sohn …« Die Generalin wendete den Kopf, als langweilte sie sich. In Wahrheit schätzte sie ihren Salon ab. Er war zusammengestellt aus den Resten des Herrenzimmers, das ihr Gatte angeschafft hatte, zu der Zeit, als er Generaldirektor beim Präsidenten war, und aus der noch übrigen Marmor- und Bronzepracht, die sie selbst einst mitgebracht hatte. Alles Entbehrliche war verkauft – alles, was bisher entbehrlich erschienen war. Der Begriff des Entbehrlichen ward allmählich umfassender, sie wußte es schon. Sah es hier noch nicht arm aus?
Sie hörte den Präsidenten laut rechnen. Hinter der Glastür, der sie den Rücken kehrte, ward hörbar der Flügel geöffnet. Zu erwarten war, daß sogleich dort drinnen der Professor präludierte und die Prinzessin sang. Die Generalin benutzte dies, um aufzustehen. In dem fast leeren Musikzimmer saß die Prinzessin, süßlila und gedankenlos, wie immer, auf dem kleinen Sofa aus altem Rohr, die Vergoldung war schon so blaß wie die rosa Seide der Kissen. Die Prinzessin las Noten mit ihren großen, verständnislosen Augen. Ihr alter Lehrer wartete am Flügel geduldig. Die Generalin stellte durch die Glastür fest, daß im Musikzimmer kein Teppich lag. Hier der Salon hatte doch noch seinen matten Perser, das glich viel aus. Auch hatte er in der Mitte den Monumentaltisch – und dann die vier großen Spiegelkonsolen, zwei zu den Seiten der hohen, in Wolkenstores gehüllten Gartentür, zwei drüben in den abgerundeten Ecken. Die Nachbarschaft der anderen Ausgänge, links zum Musik-, rechts zum Eßzimmer, rückwärts auf den Gang, wies nichts mehr auf, dafür kamen um so größere Flächen hellgelber Seide zur Geltung. Die Wandbespannung war nirgends zerrissen, nur hinter dem Klubsofa. Grade darum mußte es die Wand decken rechts neben der Gartentür, und alle Sitzmöbel waren hinzugeschoben. Die Mitte hielt einzig der Monumentaltisch in Marmor und Bronze, aber der weite Raum um ihn her wirkte im Grunde nur vornehmer. »Wenn ich mir nichts vormache«, dachte die Generalin.
Inmitten des Momumentaltisches, einsam auf weitem Feld, erhob sich der »Jüngling«, die einst berühmte Marmorfigur, die Ina Schollendorff noch in Hamburg gekauft hatte, lange bevor sie den Hauptmann Veit Vogel von Lambart heiratete. Als dann das Kind heranwuchs, glich es dem »Jüngling«. »Wenn ich mir nichts vormache«, dachte die Generalin wieder. Sie vergewisserte sich, daß das gemalte Bildnis ihres Sohnes, drüben über dem Klubsofa, nichts mit dem »Jüngling« gemein hatte. »Und doch ist das Bild zehn Jahre her, da war er fünfzehn, wie der Jüngling.«
Die Generalin versank, ohne den Kopf deshalb weniger hoch zu tragen, in sich selbst, einen Augenblick hörte sie nicht mehr, was der Präsident sagte. Sie setzte sich in Bewegung, ging aber links um den Monumentaltisch und langsam gradaus in Richtung des Pfeilerspiegels neben der wolkenverhangenen Gartentür. Auf diesem Wege erschien ihr, Schritt um Schritt, ihre Person und auch ihr Leben.
»Meine Augen glänzen«, dachte sie, denn dies erschien ihr im Spiegel zuerst. »Ich bin nun mager, nicht mehr schlank, ich muß den Hals bedecken, und er war berühmt. Der Präsident sagt, daß uns das Haus nicht mehr gehöre und daß wir ausziehen müssen. Er kann uns zwingen, er hat die Verbindungen, wir haben keine mehr. Er zahlt Abstand, dann kann ich irgendwo Zimmer vermieten. Ich habe noch meine glänzenden Augen.« Alles in einem Schritt. Beim nächsten: »Alabasterstirn, sagte Graf Oetzen auf meinem ersten Ball. Man sagt das nicht mehr, übrigens hat der Alabaster jetzt Kratzer. Ich trage aber immer noch die Haare aus der Stirn. Sie waren nie stark, jetzt sind sie dünn und werden grau.«
Da sie dem Spiegel noch näher kam: »Und ich spreche nicht von meinem Mund, weil ich meine schmalen Lippen nie gemocht habe. Ich darf ihnen keinen Ausdruck geben, sonst bilden sich daneben Falten wie Spinnen, es sieht pervers aus. Ich und pervers! … Valentin hat weiche, breite Lippen, er küßt damit wohl die Prinzessin. Mein Sohn der Verlobte einer Prinzessin! Ihre Augen sind groß, aber geistlos. Die alternde Frau dort im Spiegel hat glänzende Augen. Ich war immer ein Snob. Die Prinzessin ist arm, noch ärmer als wir, und überdies geistig beschränkt. Was nützt es mir, aber ich will, daß mein Sohn sie heiratet und Mitglied eines bis vor sieben Jahren regierenden Hauses wird. 1925, schon gleich sieben Jahre währt der Unfug. Ich war aus reichem Haus, eine große Dame. Der Kronprinz sagte 1907 im Manöver: eine wirkliche große Dame – als er erfuhr, ich sei eine Schollendorff. Jetzt dies alte Kleid, jetzt mit den Resten unserer Habe auf die Straße. Der Präsident sagt – und meine Augen glänzen! Wovon wohl Augen glänzen?«
Hier schlug eine Uhr, die Generalin erwachte. Ein Blick nach den Herren, sie waren in demselben Satz, der vorhin begonnen hatte, sie hielten sogar die Köpfe noch wie vorhin. »Meine Abwesenheit kann nur Sekunden gedauert haben.« … Die Uhr schlug immer noch? Ach, es war die Prinzessin, sie übte einen und denselben Ton, es klang hoch, fein und metallen, es klang nach ungelöster Kraft. Die Generalin empfand Widerwillen bei dem Gedanken an die Heirat. Fast gleichzeitig ward sie daran erinnert, daß ihr Sohn schon hätte dasein müssen. Ob es sieben Uhr war? Sie sah hinaus auf die Straße – und spürte einen Ruck. Das unheimliche Automobil! Dort stand es wieder.
Sein Vorhang war auf dieser Seite geschlossen, wie noch jedesmal. Es hielt gegenüber an gewohnter Stelle, Ecke Berliner Straße und Platz am Knie. Über den Platz stürmten aus allen Richtungen, Berliner, Hardenberg-, Bismarck-, Marchstraße, die Wagen herbei, sie verdeckten zu oft das Auto mit dem geschlossenen Vorhang. Die Generalin war nie ganz sicher, ob ein Gesicht darin erschien. Aber sie nahm an, eine Frau sitze drinnen und warte auf Valentin. Das Auto hielt drüben regelmäßig nur so lange, bis Valentin nach Haus kam. Es war groß, neu, höchst gepflegt, der Chauffeur benahm sich streng dienstlich. Saß keine Frau darin, wer zog dann drüben auf Wache – täglich, bevor Valentin kam? Die Generalin mußte sich zusammennehmen, um nicht ihren Mann zu rufen.
Nein, Dinge jener anderen Art erwähnte niemand hier. Was Valentin aus Leichtsinn davon verraten hatte, war besser nicht vorhanden, die Eltern wußten nichts. Warum daran denken. Es konnten Angelegenheiten jeder Art sein, in denen jenes dunkelblaue Auto wartete, Spielaffären ebensogut wie Liebe. Das Leben Valentins war unregelmäßig, gewiß, leider war es so – aber gefährliche Dinge? Dinge, in die er vor zwei Jahren, als der Weltuntergang nahe schien, vielleicht hineingezogen worden war von seinen jungen Gesinnungsfreunden? Die hatten keine Folgen mehr, entschied die Generalin. Dies war eine Frauengeschichte.
Um es sich zu beweisen, dachte sie an die Dame, die sie neulich ertappt hatte. Die Dame hatte hinter dem Gitter des Vorgartens gestanden und heraufgesehen. Es war damals frühmorgens und nur Zufall, daß die Generalin schon auf war, da stand dort unten die Dame im Frühlingskostüm, mindestens von Drecol. Dieselbe war es, die jetzt im Auto saß, natürlich sie! Damals stand sie in dem Hut mindestens von der Friedländer und starrte nach der Mansarde, wo Valentin noch schlief. Woher hatte sie gewußt, daß er dort oben wohnte, sie war also öfter hier gewesen? Hatte die Gelegenheit ausgekundschaftet wie eine Einbrecherin? Die Generalin zog damals den Wolkenvorhang fort und sah die Dame so lange an, bis jene es fühlte und ihr Gesicht von der Mansarde trennte. Sie senkte es, es war besonders weiß und wohlgeformt.
Der anderen Frau entging nicht, daß es über dreißig war. Die Augen waren groß und schwarz, man konnte sie prachtvoll nennen. Als sie auf die Augen der Generalin trafen, stockte darum ihre Bewegung nicht. Sie stiegen von dem hohen, geschweiften Dach der alten Villa zu ihrem einzigen Stockwerk nieder, gingen über die langgestreckte Front hin, kehrten zu der breiten Gartentür und der kleinen Freitreppe nochmals zurück … Dann hatte die Dame sich abgewendet, ruhig aber nochmals umgeblickt wie zur Feststellung der Gegend, in der es zwischen Straßenzügen von heute noch Landhäuser von 1860 gab. Ihr Gang war schnell und sonderbar geschmeidig gewesen. Die Generalin hatte ihr nachgesehen, sie verschwand um die Ecke der Marchstraße, Richtung Tiergarten.
Eine Tänzerin? Oder reich unterhaltene Lebedame? Irgend etwas an ihr verbot der Generalin, die Verehrerin ihres Sohnes für eine wirkliche Dame zu halten, wieviel schmeichelhafter wäre es sonst gewesen! In Ermangelung von Rang und Klasse freilich hielt jetzt drüben das gepflegte Automobil, man konnte nicht sagen, daß Valentin sich wegwarf. Aber saß überhaupt eine Frau darin? Und warum verspätete sich Valentin? Um sieben Uhr sollte er die Prinzessin ins Konzert führen. Die Generalin sagte, bevor sie es überlegt hatte, laut zum General hin:
»Valentin verspätet sich.«
Aber es war der unrichtige Augenblick, ihr Gatte hörte nicht. Er war aus dem Schaukelstuhl aufgestanden und fragte den Präsidenten: »Wollen Sie mich nicht schonen?«
»Sie verlangen zu viel«, sagte der Präsident, er kam aus dem Klubsessel hervor.
»Ich? Was verlange ich? Daß Sie mich am Leben lassen«, erklärte der General.
»Ich bin doch nicht Ihr Feind«, beteuerte der Präsident in unglaubwürdigem Ton.
Hierauf schwiegen sie, die Generalin verstand, weshalb. Der Präsident war zu weit gegangen und wunderte sich nun selbst. Ihr Mann aber war, wie immer, peinlich davon berührt, daß er der Gemeinheiten des Lebens sich erwehren mußte, er in eigener Person. Daher gab er seinem einzigen Auge sicher jenen unwahrscheinlich furchtbaren Ausdruck. Die Generalin konnte von rechts nur das dunkle Monokel sehen, mit dem er die leergeschossene Höhle verdeckte. Er hielt den Kopf einmal nicht auf die rechte Schulter geneigt, stand straff und hoch, da wirkte plötzlich auch das runde Gesicht nicht mehr zu weich. »Wäre er immer so gewesen«, dachte die Generalin. »Er hätte Armeeführer sein können … Jetzt ist er weiß und ohnehin alles vorbei. Befehlen kann hier nur der Präsident.«
Daher ging sie zu dem Präsidenten über. Er war blond und hatte eine schöne, kaum ergrauende Haarwelle, auffallend bei einem so großen Geschäftsmann. Nach hinten ward das Haar dünner, man sah die Schädelform, die einen Vorsprung hatte, nicht übel für einen Geldmenschen. Aber diese Stirn! Nur Fleisch, ein wechselndes Gebild aus sich faltendem und entfaltendem Fleisch, und die ganze grauweiße Masse der Falten nahm den Weg links abwärts. Unversehens zogen sie sich nach oben zusammen, und die Augen erschienen. Das Fleisch ließ sie frei, sie traten aus dem Schatten, gingen weit auf und richteten sich gegen den armen General, trafen ihn schwarzblau und so hart wie Steine, die aber Licht durchlassen.
Der General trat zurück. Der Präsident verharrte noch, stieß sich dann aber mit seiner großen, starken Hand vom Klubsessel ab und machte zwei ungleiche Schritte. Er hinkte.
»Tatsächliches ist nicht mehr zu sagen«, stellte er fest. »Ich bin gewohnt, meine Zeit produktiv zu verwenden.« Er grüßte und wollte gehen.
Jetzt schmetterte aber nebenan die Prinzessin. Sie war im Verlauf ihrer Übungen auf dem Höhepunkt ihrer Stimmkraft angelangt, auch Vielbeschäftigte konnten sie nicht überhören. Der Präsident fragte:
»Ist das die Prinzessin von –?« Er beugte sich vor, um von weitem durch die Glastür zu spähen. Dabei errötete er, es konnte von der Anstrengung des Vorbeugens sein. Er sprach plötzlich, als habe er etwas im Mund.
»Sie wohnt hier? Zahlt sie denn ihre Miete?«
»Unsere Verbindung ist zu nahe, wird besonders künftig zu nahe sein«, sagte die Generalin mit Betonung. »Von der Prinzessin nehme ich nichts.«
Der Präsident öffnete die Augen.
»Die Fürstenabfindung steht bevor«, sagte hochmütig die Generalin. »Wenn die Prinzessin Adele reicher sein wird als Sie, Herr Präsident – ist noch Zeit, von der Miete zu sprechen«, ergänzte sie ironisch.
Der General mußte husten und kehrte ihnen den Rücken. Die Generalin aber hielt den offenen Augen des Präsidenten stand, obwohl sie gelogen hatte. Von einer künftigen Bereicherung der Prinzessin Adele konnte im Ernst nicht die Rede sein. Ihr Vater, der Herzog, hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als ihre ältere Schwester Alexandra an seinen Vetter, den Großherzog, zu verheiraten. Diesem seinem Ehrgeiz opferte er bedenkenlos Adele. Sie würde nichts abbekommen haben von der Fürstenabfindung, selbst wenn nicht ihre unbesonnene Liebe zur Gesangskunst sie dem Herzog entfremdet hätte.
Die Generalin nahm an, dem Präsidenten einer noch so großen Industriegesellschaft würden hoffentlich Tatsachen verborgen geblieben sein, die nur ihrer eigenen höfischen Erfahrung zugänglich schienen. Aber der Präsident kannte sie. Er schwieg, als sei er betroffen. Die Generalin triumphierte – indes der Präsident doch nur überlegte, daß es richtiger sei, sich durch die Vermögensaussichten der Prinzessin beeindruckt zu zeigen als durch ihren Namen. In Wahrheit verlangte ihn nach ihrer Bekanntschaft einzig, weil sie eine Prinzessin war. Er staunte selbst über seine Schwäche – sagte aber:
»Das eröffnet neue Verhandlungsmöglichkeiten. Bitten Sie die Dame doch her!«
»Die Prinzessin? Das geht nicht.« Die Generalin war entschlossen, es nicht zuzulassen. »Sie hören doch, sie singt.«
Gerade trillerte die Prinzessin. Alle lauschten.
»Sie trillert gut«, bemerkte der Präsident – und als sei dies ein Grund: »Ich werde warten.«
»Bitte«, schloß die Generalin, und alle drei setzten sich auf ihre vorigen Plätze.
Nach einer Pause, die nur dem General sehr lang schien, begann seine Frau: »Mein Sohn wird Sie sogleich erlösen. Um sieben soll er hiersein, er begleitet die Prinzessin in die Singakademie.«
»Es ist nach sieben«, bemerkte der General. Der Präsident sagte höflich, denn die Unterredung ward rein familiär: »Das tröstet mich. Ihr Sohn ist bei Ihnen nicht pünktlicher als bei mir im Büro.«
»Ist er dort denn unpünktlich?« Die Generalin zögerte. »Was vermuten Sie, daß er statt dessen treibt?« Ihr Blick ging von selbst durch den Wolkenvorhang nach jenem Automobil. Der Präsident seinerseits beugte sich aus dem Klubsessel gegen die Glastür, hinter der die Prinzessin jetzt tiefe Glockentöne machte. Hier äußerte der General:
»Ich will nur hoffen, daß mein Sohn sich besser in Ihre Geschäfte einlebt, als ich es meiner Natur nach konnte.« Dabei schaukelte er sich.
Der Präsident ließ ruhig die Pause vergehn. »Herr General«, sagte er dann freundlich, »den Schaukelstuhl müssen Sie sich kürzlich vom Boden heruntergeholt haben. Wir haben uns sonst ausschließlich in Klubsesseln gekannt. Ihre Rückkehr zum Schaukelstuhl beweist mir, wie satt Sie die Geschäfte hatten.«
Der General sah ihn an. Er hatte ein mildes Auge, alle Bitterkeit lag ihm fern, er schien sich nur zu unterhalten. Seine Frau war es, die eingriff.
»Herr Seehase«, sagte sie – und wartete, bis der Präsident seinen Namen hinlänglich genossen hatte. »Mein Mann war ein schlechter Generaldirektor, soviel weiß ich. Denn sonst hätte er Ihnen nicht beim tiefsten Stand der Währung dies Haus verkauft – für Papiergeld, das Sie in Unmengen selbst herstellten.«
»Aber ich mußte es auch selbst in Zahlung nehmen«, sagte der Präsident gelassen. »Oder glauben Sie, ich hätte damals nur billig gekauft? Sie mißverstehen das Wirtschaftsleben, meine gnädigste Frau.«
»Ich bin aufgewachsen in einem seiner Mittelpunkte. Aber es hatte damals ein anderes Gesicht. Auch die Herren, die es vertraten, hatten andere Gesichter.«
»Ich danke Ihnen« – der Präsident blieb höflich. Seine fleischige Stirn verschob sich links abwärts. Davon glitt die Haarwelle tiefer, im Verein mit den kritisch geschlossenen Augen sah es nach Geistigkeit aus. Die Generalin begriff ihren Fehler.
»Herr Präsident, ist Ihr Konzern nicht fast die einzige Gründung jener Zeit, die alle Krisen bisher glücklich überstanden hat?«
»Unbesorgt, er übersteht sie weiter«, warf er ein. Sie sagte, ohne abzusetzen: »Ich bewundere Sie. Dabei waren Sie kein Anfänger, Ihnen fehlte doch sicher die blinde Dreistigkeit, die damals der Jugend bei allen ihren heute vergessenen Unternehmungen so sehr zustatten kam …«
Sie machte Handbewegungen. Mit angeregtem Lächeln hörte sie sich sprechen. »Wir bewundern Sie«, sagte sie nochmals und wollte ihren Mann zum Zeugen nehmen. Aber der General sah aus dem Fenster, ablehnend, wie ihr schien. Sie erschrak, jetzt war sie nach der Seite der Anerkennung zu weit gegangen.
Die Prinzessin schmetterte. Der General lenkte den Schaukelstuhl rechtsum nach der Gartentür. Der Präsident veränderte im Klubsessel schon wieder seine Lage, um endlich den Blick ins Nebenzimmer freizubekommen. Die Generalin sagte scharf, um durchzudringen:
»Von Ihnen nehme ich eher an, daß nur die Verzweiflung Sie so kühn machte. Sie hatten schon manchen Rückschlag erlitten im Leben. Ich glaube nicht jede dunkle Geschichte, die erzählt wird, ich will nur sagen: Sie kennen das Leben. Die Nachkriegskonjunktur fand Sie grade im letzten Augenblick, bevor es für Sie zu spät war – zu spät will heißen den Jahren nach und auch im Hinblick auf das Vertrauen Ihrer Mitbürger …«
Hier kehrte der Geist des Präsidenten aus dem Musiksalon zurück. Sein Kopf machte einen Ruck, der mineralische Blick sprang weit auf.
»Ich fand immer noch das Vertrauen des Generals von Lambart – den ich mir aussuchte aus der Schar der anderen Bewerber. Denn ich fand das Vertrauen zahlreicher Generäle, die nach Beförderung zum Generaldirektor strebten.«
Der General interessierte sich nur lebhafter für die Straße. Er stand sogar auf. Hatte auch er jenes Auto endlich entdeckt, und suchte er im Vorhang nach dem Gesicht? Die Generalin saß wortlos. Was sie hätte vorbringen können, sagte der Präsident selbst.
»Gern gebe ich zu, daß der Name des Generals Vogel von Lambart mir für den Aufbau meines Unternehmens von Nutzen gewesen ist. Dafür habe ich ihn hoch bezahlt – den Namen, nicht das Können«, schloß der Präsident.
Die Generalin sagte im Konversationston: »Hoch bezahlt – und jetzt ist sogar unsere Generalspension verpfändet, und aus unserem, einst unserem Haus wollen Sie uns vertreiben.«
Der Präsident ebenso: »Nicht ich, Gnädigste. Meine Gesellschaft, der ich Rechenschaft schulde. Was kann ich tun? Wir haben dies Grundstück und müssen bauen.«
»Sie haben mehr Grundstücke.«
»Keins in dieser Lage. Gleich drüben steht unser Hauptgeschäftshaus.«
»Es sieht sogar aus wie eine Kriegsmaschine – ein Tank« – was klang, als sei die Generalin nur erfreut über den gefundenen Vergleich, indes sie doch starr vor Grauen den Kampf um das Leben verlorengehen sah. Plötzlich lachte sie – leicht und gesellschaftlich.
»Komisch, wenn ich denke. Wir plaudern hier. Und 1907 in Klein-Wendrin sagte der Kronprinz – Er kam nach Klein-Wendrin im Manöver. Es war unser Gut. Das heißt, es gehörte mir und meinem Vetter in Hamburg. Durch die Inflation ist es in seinen Alleinbesitz übergegangen. Komisch, mein ganzes Vermögen, das er verwaltete, ward zu nichts. Das seine keineswegs. Komisch, die Geschäftsleute.«
»Und das war Ihr Vetter. Was wundert Sie dann bei Fremden? Jeder handelt nach Gesetzen und kann von ihnen bei eigener Todesgefahr nicht abweichen. Aber es sind nicht die Gesetze der Juristen – und auch nicht die, die wir aus Höflichkeit im Munde führen …«
Er sah die Generalin würgen, vermutlich an Tränen.
»Erkennen Sie, bitte, an, daß ich Ihren Sohn an eine Stelle gebracht habe, der er nicht entspricht, ja, daß ich ihn zum Schaden meiner Gesellschaft dort erhalte. Ich kann es nur verantworten, weil die Stelle vergleichsweise klein und unwichtig ist. Das Verhältnis zu meinem Generaldirektor aber mußte ich lösen, als es für mich nicht mehr tragbar war.«
»Für mich, für mich«, rief der General über die Schulter. Er kam mit offenkundigem Widerwillen näher, aber er kam. Der Präsident sah ihm staunend entgegen.
»Heute stehen Sie sicher, wie ich höre.« Die kleine elegante Verneigung drückte Glückwunsch aus. »Aber, Verehrtester, als ich zu Ihnen kam, bewegten Sie sich eher in der Sphäre der kühnen Verzweiflung, wie meine Frau es nennt. Zugegeben?«
»Was war, zählt nicht«, sagte der Präsident.
»Soll das auf mich gehen?«
»Es geht auf alle.«
»Na schön. Aber es war doch. Wissen Sie noch, der Grenzbahnhof? Ihre Siedlungsstadt? Die Baracken, an denen Bank oder Grand Hotel geschrieben stand? Und Ihre Abrechnungen mit den Staatsbehörden! Die Blankorechnungen Ihrer Subunternehmer, in die Sie einsetzten, was Sie wollten, und bekamen es vom Staat. Wie machten Sie das? Nach Ende der Inflation bekamen Sie alles ohne Nachprüfung auf Goldbasis. Wie machten Sie das?«
»Sie wollen andeuten, Verehrtester, daß ich bestach. Ich lasse es dahingestellt. Es soll wirklich vorgekommen sein. Aber die wichtigere Frage ist: was wurde aus dem Geld, das auf diese, von Ihnen angezweifelte Art verdient und damit« – erhobener Ton – »der Wirtschaft erhalten worden war?«
»Angezweifelt? Mich drückt kein Zweifel. Ich weiß, warum ich die Sache hinwarf, die ich nicht mehr verantworten konnte.«
»Verantwortung«, sagte der Präsident achselzuckend. Dennoch war der General jetzt etwas zu laut geworden. Stille folgte, in der der Präsident sein Herz spürte. Es war nicht mehr einwandfrei. Die Generalin trat an die Gartentür. Noch immer hielt drüben der dunkelblaue Wagen. Plötzlich fühlte sie Angst. Nicht Angst vor der Person im Wagen – die Angst jener Person war es, sie fühlte sie mit. Es war halb acht, noch immer erschien im Hasten der Straße kein Valentin. Man wartete in dem Auto, man wartete hier am Fenster, und auch im Musikzimmer bemerkten sie endlich, daß er ausblieb. Sie schwiegen. Sollte die Generalin hineingehen? Zuletzt hielt sie es doch für richtiger, durch ihre Gegenwart die beiden Herren zu mäßigen.
In der Stille sprach der Präsident gelassen fort. »Jenes Geld arbeitet jetzt in einem, auch nach Ihrer Ansicht einwandfreien Industrieunternehmen. Allein das Berliner Werk ernährt Tausende, darunter Ihren Sohn. Dieses wertvolle, der Wirtschaft lebensnotwendige Unternehmen würde heute wackeln wie andere, ja, es wäre nie aufgebaut worden ohne das damals Erworbene.«
Da der General ansetzte, aber schwieg, ging der Präsident weiter.
»Damals wurde auf andere Art verdient als heute. Was Sie tadeln, sind die Dinge, nicht die Menschen. Dieselben Menschen von damals, glauben Sie es mir, sind heute streng korrekt. Gegen Bestechungen hegen wir wahren Abscheu, übrigens sind sie unergiebig geworden.«
Der Präsident öffnete die Augen.
»Sollten auch Sie, Herr General, manches nicht mehr ganz verstehen, was Ihresgleichen im Kriege zu tun und zu lassen erlaubt fand?«
Der General ward rot, wenig fehlte, daß er losging. Dann sagt er aber doch nur gedämpft:
»Das ist kein Gegenstand für Sie, Ihnen fehlen die Voraussetzungen.«
Er sah in die geöffneten Augen des Präsidenten und schien bis in vergessene Hintergründe zu blicken.
»Ich kenne Sie«, schloß er.
Darauf fielen die Augen wieder zu.
Die Stirn des Präsidenten verzog sich weltenschwer. Niemand hätte auf starkes Herzklopfen geschlossen.
»Ich bin Republikaner«, erklärte er nicht ohne Würde und Kraft.
»Ich bin es als Wirtschaftsführer, denn nur Regierungen, die von der internationalisierten Wirtschaft kontrolliert werden, gewähren der Welt die Aussicht auf Frieden und auf eine erträgliche Zukunft … Für diesen Gegenstand aber fehlen, ich muß es fürchten, wieder Ihnen die Voraussetzungen. So darf ich heute vielleicht damit schließen, daß ich Ihren Beruf, Herr General, höher geachtet habe als andere Berufe. Ich nahm Sie bei mir nicht wie einen Untergebenen auf.«
Hier machte er, stark hinkend, schon zwei Schritte rückwärts.
Der General blieb unnachgiebig. »Ich hätte nicht zu Ihnen kommen sollen, Seehase. Sie brauchten mich und meinen Rang, ich habe ihn Ihnen verkauft. Das war falsch. Meinesgleichen darf Ihnen nicht helfen. Hätten sich das nur alle Soldaten gesagt, dann hätten sie ruhig zugesehen, wie ihr sozialisiert wurdet. Nahe daran wäret ihr.«
Der Präsident behandelte dies als mißglückten Scherz. »Subversiv, Herr General? Und Ihr Sohn, wollen Sie ihn proletarisiert sehen?« Mit echter Trauer sagte der Präsident: »Freilich wer dankt uns, daß wir dem Ansturm standhalten!«
Er strich die Welle aus der Stirn, verfügte sich zu der Generalin, die ihn festen Fußes erwartete, und küßte ihr nicht ohne Großartigkeit die Hand.
»Ich darf gehorsamst bitten, mich der Prinzessin empfehlen zu wollen. Ich will die Künstlerin nicht stören.«
»Nein, das lassen Sie nur«, sagte die Generalin, denn die Prinzessin übte jetzt wieder Rouladen.
Der Präsident ging ab, sein linker Fuß stieß stark auf den Teppich.
»Warum hinkt er?« fragte die Generalin. »Hat er es wenigstens aus dem Kriege?«
Ihr Gatte antwortete nicht, er durcheilte, ohne davon zu wissen, den Salon. Die Generalin hielt sich an der Stuhllehne aufrecht, erschöpft fühlte sie: »Nie wieder! Eine solche Szene nie wieder! Ich, Ina Schollendorff! Kommandierende Generalin – und muß alles, was ich zeitlebens gewesen bin, mein Heiligstes, ja Heiligstes aufrechterhalten gegen Seehase. Alles andere lieber! Lieber stehlen – wie Seehase!«
Hinter ihr eilte der General. Die Generalin sah hinaus, unwissend, daß ihr Blick auf dem verschlossenen Automobil liege. »Jedes Mittel soll mir recht sein! Wir sind zu fein, es gibt eine Grenze. Jedes Mittel!«
Hierauf atmete sie stark aus. Auch der General hielt soeben im Lauf an, sie wandten einander ihr gesittetes Lächeln zu.
»Eigentlich hatte er recht«, sagte der General. Seine Frau meinte:
»Du machst dich lustig.«
»Wenn er jede Verantwortung ablehnt. Auch wir übernehmen keine. Er behauptet, immer nur den Umständen entsprechend seine Pflicht getan zu haben. Von dem Unglück, das dabei über die Welt kommt, will er nichts wissen. Nun und wir?«
»Das sieht dir wieder einmal ähnlich, lieber Freund. Du vergleichst dich mit Seehase. Hat er sich schon mit dir verglichen? Er hat sich in der Welt auf deinen Platz gesetzt. Anstatt ihm recht zu geben, sieh lieber zu, wo man ihn anfaßt.«
Nach einer Pause, mit besonders hoch getragenem Kopf: »Das Wesen erhebt die Augen zu der Prinzessin.«
»Du vermutest?«
»Da ist nichts zu vermuten. Wenn ich für Valentin verzichten wollte – Seehase läge auf beiden Knien vor mir. Natürlich denke ich nicht daran.«
»Aber die Prinzessin? Angenommen, mit Seehase stände es, wie du denkst. Er eröffnete sich ihr, sie hätte die Wahl zwischen ihm und Valentin.« Der General ward laut im Eifer. »Wie einfältig müßte sie sein –«
»St!« machte die Generalin. »Einfältig oder nicht, sie liebt.«
»Ich habe nicht den Eindruck, daß Valentin es ihr in unbeherrschbarem Maße erwidert.«
»Unser Sohn hat im Gegenteil vielleicht ganz kürzlich einmal die Herrschaft über sich verloren.«
Der General horchte ergriffen auf die Rouladen, die prächtig anschwollen.
»Woher weißt du? Wann?«
»Wir waren ausgegangen – am Sonntag vor acht Tagen. Auch der Professor war fort. Die Prinzessin blieb ganz allein. Valentin, der beim Rennen sein sollte, ist vorzeitig nach Hause gekommen. Er leugnet es, aber ich habe meine Anzeichen.«
»Welche?«
»Frauen sehen mehr. Du kannst mir glauben.«
Der General sagte einfach: »Dann muß unser Sohn die Prinzessin Adele heiraten.«
»Siehst du. Und der Präsident Seehase muß ihr die Mitgift geben.« Die Generalin lächelte gesittet.
Er fragte: »Wieso?«
»Aus Ehrgeiz«, sagte sie. Da er die Achseln zuckte, fragte sie:
»Oder weißt du sonst jemand?«
In diesem Augenblick hatten beide den Blick auf der Straße. Sie schwiegen. Plötzlich der General:
»Das dunkelblaue Auto sehe ich nicht zum erstenmal. In die Nachbarschaft gehört es nicht.«
»Jetzt steht es dort genau eine Stunde«, sagte die Generalin. Da ging hinter ihnen die Tür auf, die Prinzessin sagte mit ihrer eintönigen Sprechstimme:
»Halb acht. Und Herr von Lambart?«
Sie stand, der Antwort gewärtig, leicht vorgeneigt. Ihr blühendes Gesicht inmitten rund gestutzter aschblonder Haare sah unschuldig aus Veilchenaugen. Das süßlila Kleidchen ließ unfertige Schultern frei, hohe unreife Beinchen. Ein langgestieltes Persönchen aus der Menge der anderen trat ein und sagte: »Halb acht. Und Herr von Lambart?« Den Ohren des Generals und der Generalin klang es wie: »Ich bin die Prinzessin.« Sie grüßten stumm.
Die Prinzessin ging an ihnen vorbei mit dem Schritt der Tänzerin zum entferntesten Stuhl. Sie schlug die Beinchen übereinander, sie sagte in ungnädiger Absicht:
»Ich muß in kein Konzert gehen. Ich kann auch hier sitzen.« Aber es rührte nur.
Ihr Lehrer war ihr gefolgt, er stand nun hinter ihrem Stuhl und sagte:
»Hoheit, Herr von Lambart ist vielleicht dem Herrn Präsidenten Seehase begegnet, der ihm eröffnet hat, daß Konzerte an Bedeutung verloren haben in jetziger Welt. Wollen Hoheit sich bitte erinnern, daß auch im allgemeinen das Glück des einzelnen und sein Recht an Bedeutung verloren haben. Wir sind noch da und äußern unsere Meinung. Aber gerade der Gedanke hat jetzt den geringsten Einfluß. Erwarten Sie nur nicht, Hoheit, daß irgendwer noch Lust hat, nach ihm umzublicken!«
»Umblicken«, hörte die Prinzessin und wandte das gedankenlose Köpfchen, um in die Augen des Denkers zu sehen. Seine Augen erschienen feucht und visionär, wachsam wie eines Tieres im Walde, aber auch so ungewiß. Er war klein, über den Stuhl der Prinzessin ragte nur sein grauer Kopf mit den breiten, aber hohen Schultern.
Der General fragte: »Wer sagt Ihnen, lieber Freund, daß der Präsident nicht ganz gern Musik hört?«
Die Prinzessin sagte: »Mich hört er gern« – und sah die Generalin an, die erschrak über den Scharfblick der Einfalt. Sie warf schnell hin: »Eine Art Dieb. Ob ein Dieb gern Musik hört oder nicht –«
Hierzu blickte die Prinzessin nur veilchenblau. Der Professor erklärte: »Wir verachten niemand wegen seiner Laster und Verbrechen, sofern sie nur im Sinne der Welt sind. Es kommt einzig darauf an, der wirklichen Welt gewachsen zu sein. Das erstreben wir mit aller Frömmigkeit des Gemütes.«
Der General betrachtete ihn voll Nachsicht und Freundschaft.
»Lieber Freund, Sie begnügen sich damit, zu verstehen, was Sie nicht ändern können. Sage ich ihm aber: ich kenne Sie – dann fallen ihm die Augen zu.«
Seine Frau fragte: »Und wirst du, was du von ihm weißt, benutzen – im äußersten Falle wenigstens?«
»Dann fürchte ich wieder, daß ich lachen muß. Stellen Sie sich ein Ereignis wie dieses vor! Ich ließ mich zeitweilig in der Heimat verwenden, kurz vorher hatte ich im Schützengraben durch eigene Unvorsichtigkeit das Auge verloren.«
»Aus reiner Sorge um die Ihnen anvertraute Mannschaft, mein lieber General.«
»Genug, ich komme in ein Kriegsamt. Ein Zivilist steht dort und bietet Lieferungen an. Er sah nicht übel aus, man ließ ihn sich setzen. Indes er aber tatkräftig verhandelt, erkenne ich in ihm einen gemeinen Soldaten, der mir in demselben Amt drei Tage vorher über den Weg gelaufen war. Ich will drauflos, den Kerl entlarven, da sagt er: ›Das neutrale Ausland zahlt, was ich will, und ich muß nicht wissen, ob dahinter der Feind steckt.‹ Worauf er den Auftrag bekam. Ich hatte vor Staunen den Moment verpaßt und ließ ihn laufen. Was wollen Sie mit solchem Menschen machen?« schloß der General, senkte die Schultern und lächelte bescheiden mit seinem ganzen runden und wohlwollenden Antlitz.
»Das hattest du mir nie gesagt!« rief die Generalin. »Das war er? Daher kommt er?«
»Nicht, daß er Kaufmann war. Ich bin ihm damals nachgegangen. Er vertrat nichts und niemand. Sein einziges Subsistenzmittel war der Zufall.«
»Das fehlte noch.« Die Generalin rang die Hände. »Und du vernichtest ihn nicht.«
»Dann wäre es vorbei mit meiner heimlichen Wissenschaft und mit seinem Augenschließen – das doch mein einziger Trost ist.«
»Übrigens«, sagte der Professor weiter, »wird heute niemand mehr vernichtet, der viel Geld hat. Es wäre auch unmoralisch.«
»Das kann ich nicht länger anhören!« Die Generalin ging zur Gartentür, die Prinzessin folgte ihr.
»Wird er denn nicht kommen? Ich liebe ihn so sehr«, bat die Prinzessin kläglich. Die Generalin murmelte: »Dann lernen Sie gleich anfangs, nicht auf ihn zu rechnen!« Dies nur im Vertrauen auf die Einfalt der Armen.
»Es wäre höchst unmoralisch«, beteuerte der Professor. »Bedenken wir doch, wohin es führen muß, wenn unsere Reichsten vor Verhaftung nicht geschützt sind. In dieser Hinsicht sind kürzlich Fehler begangen worden. Die Justiz mischt sich in Dinge, die sie nichts angehn. Oberhalb von zehn Goldmillionen enden ihre Befugnisse. Das ist endgültig erworben. Es ist geheiligt. Dort beginnt das Recht der Gesellschaft auf Achtung ihres Gefüges. Niemand, dessen Bestrafung es erschüttern würde, kann ein Schurke sein. Ich neige meinen grauen Kopf vor ihm. Präsident Seehase steht für mich über dem Gesetz.«
Sein Freund, der General, sagte: »Sie sind Ordnungsmann, Professor. Aber wer dankt es Ihnen?« Mit Blick auf den Rock des Freundes, der staubig erschien, nur weil er so alt war. Der Professor erwiderte rein und in unbeirrbarer, tiefer Heiterkeit: »Glaube belohnt sich selbst. Ich bin ein Kapitalist ohne Geld. Ich habe nichts, aber ich habe auf den mühevollen Wegen des Geistes das Recht erworben auf die Anschauungen derer, die alles haben. Das Recht gebe ich nicht her.«
»Sie denken?« fragte sein Freund, »und kommen nicht zur Gesetzlosigkeit?«