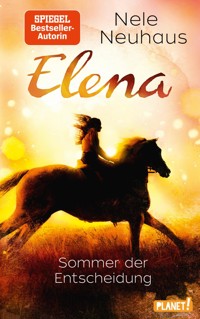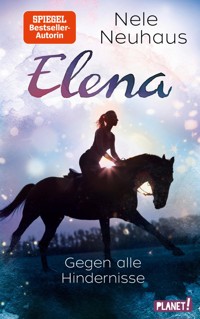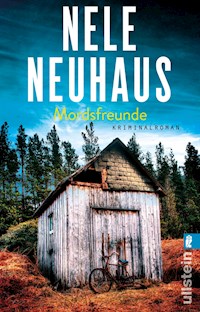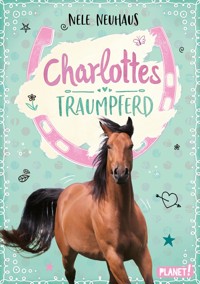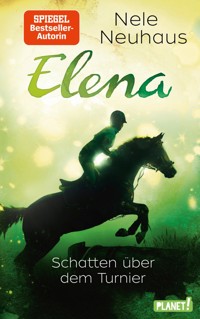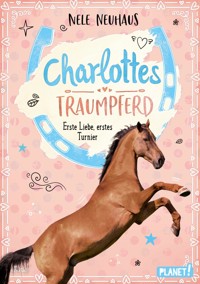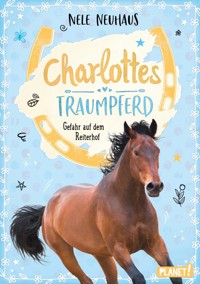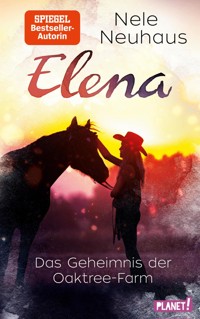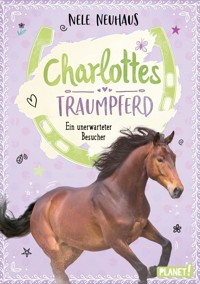10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Neu: Der Nr. 1 Bestseller von Nele Neuhaus! Der 9. Fall für das berühmte Ermittlerpaar Pia Sander und Oliver von Bodenstein. Sie hatten ein Geheimnis. Sie mussten sterben. An einem Sonntag. Im Wohnhaus einer stillgelegten Fabrik wird eine Leiche gefunden. Es handelt sich um den ehemaligen Betreiber des Werks, Theodor Reifenrath, wie Kriminalhauptkommissarin Pia Sander feststellt. In einem Hundezwinger machen sie und ihr Chef Oliver von Bodenstein eine grausige Entdeckung: Neben einem fast verhungerten Hund liegen menschliche Knochen verstreut und die Spurensicherung fördert immer mehr schreckliche Details zutage. Reifenrath lebte sehr zurückgezogen, seit sich zwanzig Jahre zuvor seine Frau Rita das Leben nahm. Im Dorf will niemand glauben, dass er ein Serienmörder war. Rechtsmediziner Henning Kirchhoff kann einige der Opfer identifizieren, die schon vor Jahren ermordet wurden. Alle waren Frauen. Alle verschwanden an einem Sonntag im Mai. Pia ist überzeugt: Der Mörder läuft noch frei herum. Er sucht sein nächstes Opfer. Und bald ist Anfang Mai. *** Ein Krimi, der unter die Haut geht… Pflichtlektüre für alle Nele Neuhaus Fans! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Muttertag
Die Autorin
Nele Neuhaus, geboren in Münster / Westfalen, lebt seit ihrer Kindheit im Taunus und schreibt bereits ebenso lange. Ihr 2010 erschienener Kriminalroman Schneewittchen muss sterben brachte ihr den großen Durchbruch, heute ist sie die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands. Außerdem schreibt die passionierte Reiterin Pferde-Jugendbücher und, unter ihrem Mädchennamen Nele Löwenberg, Unterhaltungsliteratur. Ihre Bücher erscheinen in über 30 Ländern. Vom Polizeipräsidenten Westhessens wurde Nele Neuhaus zur Kriminalhauptkommissarin ehrenhalber ernannt.
Das Buch
Zunächst sieht es wie ein trauriger Fall von sozialer Vereinsamung aus: Niemand hat bemerkt, dass der 84-jährige Theodor Reifenrath offenbar schon vor Tagen starb. Doch dann entdecken Pia Sander und Oliver von Bodenstein auf dem Grundstück des Toten die sterblichen Überreste mehrerer Frauen. War Reifenrath ein eiskalter Serienmörder, der seine Opfer unter dem Betonfundament des Hundezwingers entsorgt hatte? Im Dorf kann sich das niemand vor- stellen; Theodor Reifenrath und seine Frau Rita hatten jahrzehntelang Pflegekindern ein liebevolles neues Zuhause gegeben. Bei ihren Ermittlungen stoßen Pia Sander und Oliver von Bodenstein jedoch auf dunkle Kapitel in der Vergangenheit der Reifenraths: Kinder, die vom Jugendamt aus der Familie geholt wurden. Eine leibliche Tochter, die an einer Überdosis starb. Ein Nachbarskind, das in einem nahegelegenen Teich ertrank. Und der mysteriöse vermeintliche Selbstmord von Rita Reifenrath. Da verschwindet wieder eine Frau, und Pia muss erkennen, dass nichts so ist, wie es scheint. Gelingt es ihr, das Rätsel rechtzeitig zu lösen und den Mörder zu stoppen?
Nele Neuhaus
Muttertag
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
ISBN 978-3-8437-1880-6
© 2018 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagmotiv: gettyimages/Michael Breuer; gettyimages/Gabriele Grassl/EyeEm; arcangel/Hayden VerryAutorenfoto: © Gaby GersterE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Personenregister
Motto
Prolog
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
Tag 8
Tag 9
Tag 10
Tag 11
Tag 12
Tag 13
Liste der Zitate und zur Recherche verwendeten Texte:
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Personenregister
Widmung
Für AndreaFreundin und Agentin –danke für deine Freundschaft und Unterstützung
Prolog
Sonntag, 10. Mai 1981
Er lehnte mit dem Rücken am narbigen Stamm der mächtigen Trauerweide, deren Äste ins Wasser des Sees hingen, und genoss das seltene Glück, völlig allein zu sein. Dies war sein Lieblingsort. Hier konnte er ungestört seine Gedanken schweifen lassen. Hinter dem Vorhang aus Laub fühlte er sich geborgen und sicher, weil er wusste, dass ihm niemand hierherfolgte. Die Jüngeren entfernten sich nie so weit vom Haus, aus Angst vor den Strafen, die es unweigerlich geben würde, wenn man erwischt wurde. Die Älteren waren zu faul, so weit zu laufen, erst recht an einem so warmen Tag wie heute. Sie hingen am liebsten herum, rauchten heimlich, hörten Musik, drangsalierten die Kleinen und machten sich gegenseitig fertig, bis zum Schluss irgendwer heulte, meistens eins der Mädchen. Er hasste sie. Alle. Aber am meisten hasste er IHN. Wenn er nicht rechtzeitig zurück war, würde ER ihn bestrafen. Manchmal, wenn ER gut gelaunt war, gab es nur eine Tracht Prügel. War ER schlecht gelaunt, wurde es schlimmer. Viel schlimmer. Er spürte, wie sein Mund trocken wurde vor Angst, nur beim Gedanken daran, und er zwang sich, an andere Dinge zu denken. Am liebsten dachte er an Mama, seine schöne Mama, die so weit weg war. Sie roch so gut. Und wenn sie ihn umarmte, ihn »mein kleiner Prinz« nannte und mit ihm in den Zoo ging oder in ein vornehmes Café in Frankfurt, dann war er glücklich. Früher hatte er geglaubt, was sie ihm versprach, wenn sie ihn besuchen kam. Nämlich, dass sie ihn bald, ganz bald, zu sich holen würde und sie dann eine richtige Familie wären. Immer wenn es besonders schlimm war, hatte er sich ausgemalt, wie es wäre, bei Mama zu wohnen. Er hatte nicht verstanden, warum er hier sein musste, aber der Gedanke, dass es nur vorübergehend war und sie ihn bald holen würde, hatte ihn getröstet und alles ertragen lassen. Manchmal hatte er befürchtet, sie würde ihn vergessen, aber dann kam sie wieder und alles war gut. Wenigstens für ein paar Stunden. Als er noch kleiner war, hatte er beim Abschied geweint und sich an sie geklammert, weil er nicht wollte, dass sie wieder wegfuhr und ihn zurückließ. Das machte er jetzt nicht mehr, schließlich war er schon dreizehn, da heulte man nicht mehr wie ein Baby.
Noch immer hoffte er insgeheim, dass sie ihr Versprechen irgendwann wahr machen würde. Immerhin hatte er eine Mama. Die anderen nicht. Ach, wenn er das doch bloß für sich behalten hätte! Wie dumm von ihm, das ausgerechnet zu IHM zu sagen! Seitdem verspottete ER ihn und sagte gemeine Sachen über Mama. »Du bist nur ein hässlicher, kleiner Bastard«, hatte er einmal gesagt. »Wie blöd bist du eigentlich? Die hat dich abgeschoben, weil sie dich nicht will. Die holt dich niemals, kapiert? Wann schnallst du das endlich, du Trottel?«
Er presste die Augen zusammen, um nicht zu heulen. Es tat so schrecklich weh. Beim letzten Mal, als Mama ihn besucht hatte, hatte er all seinen Mut zusammengenommen und sie gefragt. Ob sie ihn nicht haben wollte, weil er ein hässlicher, kleiner Bastard sei. Da hatte sie aufgehört zu lächeln und ihn ganz komisch angeguckt. »Das darfst du nie, nie, niemals glauben, mein kleiner Prinz«, hatte sie geflüstert und ihn ganz fest in die Arme genommen. Das war am Muttertag vor zwei Jahren gewesen. Letztes Jahr war sie nicht gekommen. Und heute würde sie wohl auch nicht mehr kommen, um ihn abzuholen.
Er schluckte die Tränen herunter, atmete tief den erdigen Duft ein, den der Waldboden verströmte. Weit über ihm am wolkenlosen blauen Himmel zog ein Bussard träge seine Kreise. Ab und zu ließ er einen Schrei erklingen, der ein bisschen wie das Miauen einer Katze klang. Insekten summten geschäftig um ihn herum. Im Unterholz in der Nähe raschelte irgendein kleines Tier, eine Maus vielleicht. Er stellte sich vor, wie ihr kleines Mäuseherz vor Angst panisch pochte, weil sie den Bussard hörte und nicht wusste, ob und wann er herabstoßen würde, pfeilschnell und lautlos, und wenn sein Schatten über sie fiel, dann war es zu spät, um zu fliehen … Genau wie ich, dachte er. Wie wir alle, wenn wir SEINE Stimme hören und nicht wissen, was als Nächstes passiert.
Er öffnete wieder die Augen und ließ den Blick über den See schweifen, der still dalag, glatt wie eine Glasscheibe. Zwei Libellen brummten über dem Schilf. Ein Wasserläufer krabbelte über das Wasser, in das plötzlich Bewegung kam. Er hob den Kopf und lauschte, hörte in der Ferne Stimmen, dann ein Platschen und das Rauschen von Rudern im Wasser. Das alte Ruderboot, das auf der anderen Seite des Sees im Schilf vertäut lag, war so morsch, dass es streng verboten war, es zu benutzen. Er kroch auf allen vieren näher ans Ufer und linste durch die Schilfhalme. Sein Herzschlag beschleunigte sich und ein Schauer freudigen Triumphs flutete seinen Körper. Die beiden hatten nicht geahnt, dass er ihren kurzen Wortwechsel vorhin nach der Messe belauscht hatte.
»Um zwei am Froschpfuhl?«, hatte ER geraunt, ohne sie anzusehen.
»Lieber um drei«, hatte sie genauso leise geantwortet. »Da sind meine Eltern weg.«
Er hatte gesehen, wie sich ihre Hände berührt hatten, fast wie zufällig in dem Gedränge der Menschen, die sich durch den Mittelgang des Kirchenschiffs Richtung Ausgang schoben. Es hatte definitiv Vorteile, unsichtbar zu sein. Manchmal war es demütigend, aber meistens gefiel es ihm. Jetzt hörte er Noras Stimme, ihr Lachen schwebte glockenhell durch den stillen Nachmittag. Sie lag hinten im Boot, die Ellbogen aufgestützt, ihre sonnengebräunten Beine lässig überkreuzt. Das lange blonde Haar fiel ihr in Wellen über die Schultern, ein Arm hing ins Wasser. Was sie sprachen, konnte er nicht verstehen, aber ER ließ die Ruder auf einmal durchs Wasser schleifen, stellte sich im Boot aufrecht hin, brachte es zum Schaukeln.
»Ey, hör auf mit dem Scheiß!« Nora richtete sich auf.
»Nur, wenn du mir einen Kuss gibst«, erwiderte ER.
»Ich denk nicht dran!«, sagte Nora hochmütig. »Los, ruder weiter! Sonst frag ich das nächste Mal jemand anders, wenn du so blöd bist.«
Es war wundervoll, sie streiten zu hören. Wie Nora ihn kränkte, mit nadelspitzen Gemeinheiten, die sich mit Widerhaken in der Seele festsetzten. Er wusste genau, wie sich das anfühlte.
Nora. Er hasste sie. Und liebte sie. Sie war das schönste Wesen, das er jemals gesehen hatte. Und das böseste zugleich.
ER schaukelte das Boot immer heftiger, bis es schließlich kenterte. Nora kreischte auf, als sie ins Wasser fiel, dann folgte ein Hagel empörter Beschimpfungen, aber ER beachtete sie nicht mehr. ER kraulte ans Ufer und verschwand zwischen den Bäumen.
Nun war er ganz alleine mit Nora. Einen kurzen Moment wurde ihm schwindelig, als ihm die Tragweite dieser Tatsache bewusst wurde. Nora. Sie war noch immer im Wasser, kam nicht vom Fleck. Der gekenterte alte Kahn war halb untergegangen.
»Hilfe!«, schrie sie. »Hilfe! Ich hänge fest!«
Zum ersten Mal klang das, was sie von sich gab, ehrlich. Er streifte die Sandalen von den Füßen, zog T-Shirt und Shorts aus und bahnte sich einen Weg durch das Schilf. Kalt und schleimig fühlte sich der Boden unter seinen nackten Fußsohlen an, und er musste aufpassen, dass er sich an den messerscharfen Schilfhalmen nicht verletzte. Nora schrie noch immer um Hilfe, als er aus dem Schilf trat und auf sie zuschwamm. Sie ruderte hektisch mit den Armen, Panik in den Augen. Noch ein paar Schwimmzüge und er war bei ihr. Nie zuvor war er ihr so nahe gewesen.
»Ich häng mit dem Fuß fest«, keuchte sie und versuchte, seinen Arm zu ergreifen. Er schwamm auf der Stelle. Selbst jetzt, so nass und voller Angst, war sie noch immer wunderschön. Tief in seinem Innern regte sich etwas, das schon lange darauf gewartet hatte, geweckt zu werden. Seine Hände schlossen sich um Noras Hals. Sie wollte wieder schreien, aber er drückte sie unter die Wasseroberfläche. Es war nicht leicht, sie dort zu halten, und wahrscheinlich wäre es ihm nicht gelungen, hätte sich ihr Fuß nicht in den Algen verfangen. Sein Blut begann schneller zu kreisen, als er mit Armen und Beinen ihren Körper umfing. Je verzweifelter sie sich wehrte, desto köstlicher war das Gefühl der Macht. Sie zappelte und kämpfte, aber er war stärker als sie. Mühelos hielt er sie jetzt mit den Knien unter der Wasseroberfläche. Fasziniert beobachtete er Nora beim Sterben, er sah die Todesangst in ihren weit aufgerissenen Augen, die sich in Unglauben verwandelte. Dann brach ihr Blick, wurde stumpf und leer wie der einer Puppe. Er spürte, wie das Leben aus ihr wich. Als ihr Körper erschlaffte, ließ er ihn los. Noras Haare breiteten sich aus und schwebten im Wasser wie ein goldener Fächer. Aus Mund und Nase drangen letzte Luftbläschen. Nora Bartels’ elfengleiche Schönheit war für immer dahin. Weil er es so gewollt hatte. Er sah zu, wie sie versank, kostete das herrliche Gefühl von Macht und Entzücken und Herrschaft noch ein wenig aus, dann schwamm er zurück ans Ufer, zog sich an und rannte los, rannte so schnell, dass seine Lungen brannten. Er erreichte das große Haus, ohne jemandem zu begegnen. Als spätnachmittags die Nachricht kam, ein Kind sei im Froschpfuhl ertrunken, erinnerten sich alle nur an den Jungen, der mit nassen Klamotten gesehen worden war, nicht an ihn. Manchmal war es wirklich von Vorteil, unsichtbar zu sein.
Als er an jenem Abend im Bett lag, wurde ihm klar, dass er an diesem Tag eine wichtige Lektion gelernt hatte, nämlich wie einzigartig und erregend der Moment war, in dem Leben zu Tod wurde. Das Gefühl der Allmacht, das er empfunden hatte, würde er niemals vergessen. Vorsichtig zog er die Haarsträhne hervor, die er Nora im Eifer des Kampfes ausgerissen und an seinem Geheimplatz zwischen der Matratze und dem Bettgestell versteckt hatte, schnupperte daran und presste sie an seine Wange. Ab heute, das wusste er, würde er nie mehr Opfer sein. Ab heute war er ein Jäger.
Zürich, 19. März 2017
Dichter Nebel hing wie Watte über dem See, nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit. Im Frühling konnte das Wetter binnen Stunden zwischen Regen und Sonnenschein, Stürmen und Schnee wechseln, aber wenn kein Wind aufkam, dann blieb der Nebel den ganzen Tag lang hängen. Fiona Fischer saß in der Tram Nr. 6, die vom Zoo den Zürichberg hinunterfuhr, wie schon unzählige Male zuvor in ihrem Leben. Aber noch nie war sie so aufgeregt gewesen. Die ganze Nacht hatte sie wach gelegen, darüber nachgedacht, was sie anziehen, was sie sagen sollte. Um 12 Uhr würde sie ihren Vater treffen, an den sie sich nicht mehr erinnerte. Seit Mamas Beerdigung waren vierzehn Tage vergangen. Der Brief, den sie ihm mit der Todesanzeige an eine Adresse nach Basel geschickt hatte, war zurückgekommen: Adressat unbekannt. Da hatte sie den Mut gefunden, Mamas Schreibtisch und die Kontaktliste auf deren Natel zu durchsuchen, und war auf eine Nummer von Ferdinand Fischer gestoßen. Direkt anzurufen hatte sie sich nicht getraut. Wie hätte sie sich melden, was hätte sie sagen sollen? »Hoi, ich bin’s, deine Tochter!« Nein. Unmöglich. So etwas konnte man nicht zu einem Mann sagen, der Frau und Tochter verlassen und sich zwanzig Jahre nicht mehr gemeldet hatte, weder zu Weihnachten noch zu ihrem Geburtstag.
Fiona hatte oft an ihn gedacht und versucht, sich an sein Gesicht oder seine Stimme zu erinnern – vergeblich. Manchmal hatte sie geglaubt, sein Lachen zu hören, einen bestimmten Geruch zu riechen, den sie mit ihm verband. Aber im Laufe der Jahre war es mehr und mehr verblasst. Und Fotos von ihm gab es keine. Das hatte sie sehr traurig gemacht, denn sie hatte sich danach gesehnt, einen Vater zu haben, einen Papa, wie alle ihre Freundinnen. Selbst die, deren Eltern geschieden waren, hatten Kontakt zu ihren Vätern. Sie war die Einzige, die unter Frauen aufgewachsen war, wie in einem Kloster. Ihr ganzes Leben lang hatte sie allein mit ihrer Mutter und ihrer Näni in deren Haus im Heubeeriweg auf dem Zürichberg verbracht. Im Sommer waren sie zu dritt in die Toskana gefahren, im Winter Skilaufen im Wallis. Sie hatte die Ballettschule besuchen und Tennis spielen dürfen, und später hatte sie mit ihrer Clique im Sommer die Nachmittage im Strandbad Mythenquai verbracht. Es war kein schlechtes Leben gewesen, nein, aber eben ein vaterloses. Von ihrem Vater hatte ihre Mutter, wenn überhaupt, nur verächtlich gesprochen. Er hatte sie beide im Stich gelassen, so viel hatte Fiona begriffen. Als sie klein gewesen war, hatte sie geglaubt, er sei ihretwegen weggegangen. Irgendwann hatte sie herausgefunden, dass er nicht einmal Unterhalt für sie bezahlte. »Der grässliche Hunne! Deine Mutter wollte freiwillig kein Geld von ihm«, hatte die Näni einmal gesagt und gegrummelt, er sei sowieso ein komischer Typ gewesen. Durch diese Bemerkung hatte Fiona erst erfahren, dass ihr Erzeuger Deutscher war.
Die Tram stoppte an der Haltestelle Flunterner Kirche, Fiona stieg aus und wartete zusammen mit einer Gruppe japanischer Touristen auf die Tram der Linie 5, die bis hinunter zum Bellevue fuhr. Sie fand einen Fensterplatz im Mittelteil der Tram, die heute, am Sonntag, halb leer war. Fiona hatte den Namen »Ferdinand Fischer« bei Google eingegeben und ein paar Hunderttausend Treffer erhalten. Da sie keine Ahnung hatte, wo er lebte, wie er aussah und was er beruflich machte, hatte sie es bald aufgegeben. Schlussendlich hatte sie ihrem Vater eine SMS geschickt, an deren Wortlaut sie lange und sorgfältig gefeilt hatte. Zu ihrem Erstaunen hatte er, der vor zwanzig Jahren so sang- und klanglos aus ihrem Leben verschwunden war, nur eine Stunde später geantwortet und war mit einem Treffen einverstanden gewesen. Um 12 Uhr im Café Odeon am Limmatquai hatte er vorgeschlagen, ausgerechnet. Ihr wäre ein ruhigerer Ort lieber gewesen, denn sie hatte so viele Fragen, die sie ihm stellen wollte. Stellen musste. Außer ihm hatte sie schließlich niemanden mehr auf der ganzen Welt.
Die blau-weiße Tram rumpelte am Universitätsspital vorbei. Drei Haltestellen weiter, am Bellevue, stieg sie aus, schulterte den kleinen blauen Rucksack und überquerte die Straße. Ihr Magen krampfte sich vor Aufregung zusammen, als sie das Café betrat. Stickige Luft schlug ihr entgegen, es roch nach nasser Wolle, frisch gebrühtem Kaffee und Knoblauch. Jeder Platz am Tresen war besetzt, wie auch die meisten Tische. Fiona schob sich durch die Leute und blickte sich suchend um. Ganz hinten in der Ecke neben einem Haken, an dem Tageszeitungen in Holzklemmen hingen, war noch ein Tischchen frei. Ein Touristenpärchen hatte es auch erspäht, aber Fiona gewann den Wettlauf. Zehn vor zwölf. Sie hatte unbedingt etwas früher da sein wollen, um in Ruhe alle Männer studieren zu können, die ins Café kamen. Vielleicht würde er sie erkennen … wobei sie ihrer Mutter nicht im Geringsten ähnelte. Mama war brünett, klein und mollig gewesen, bevor der Krebs und zig Chemotherapien sie bis auf die Knochen ausgezehrt hatten. Fiona betrachtete sich in der verspiegelten Wand gegenüber und sah eine blasse junge Frau mit langem dunkelblonden Haar und großen blauen Augen, deren Gesicht zu knochig war, um wirklich hübsch zu sein. Erschöpft sah sie aus. Und so fühlte sie sich auch. Erschöpft und leer und kraftlos. Mamas lange Krankheit war auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen. Sie wog nur noch 51 Kilo, und das bei einer Größe von 1,76 m, alle Klamotten schlotterten um sie herum. Mama hatte sich geweigert, in ein Hospiz zu gehen, und Fiona hatte sie bis zum letzten Atemzug gepflegt. Selbst kurze Ausflüge zu MIGROS oder zur Apotheke hatte sie jedes Mal wie eine Befreiung empfunden und war sofort von schlechtem Gewissen gequält worden, wenn sie sich rasch einen Latte macchiato gegönnt oder ein Eis gegessen hatte.
»Hoi!« Ein junger dunkelhaariger Kellner blieb vor ihrem Tisch stehen. »Darf’s schon was sein?«
Fiona schreckte aus ihren Gedanken hoch und starrte ihn irritiert an.
»Äh … nein, ich … ich warte noch auf jemanden«, stammelte sie. Sie warf einen Blick auf ihr Natel. Punkt 12 Uhr. Das Café war voll, die Geräuschkulisse enorm hoch. Fiona war einen solchen Lärm und so viele Menschen nicht mehr gewohnt. Am liebsten wäre sie aufgestanden und gegangen, hinaus an die frische Luft, und sie hoffte fast, er würde nicht mehr kommen. Doch in diesem Moment trat jemand an ihren Tisch. Fiona verspürte einen Stich der Enttäuschung bei seinem Anblick. Sie hatte nicht gerade George Clooney erwartet, aber auch nicht diesen schwammigen Mann Mitte fünfzig mit schütterem braunen Haar, das an den Schläfen grau wurde, einem konturlosen Allerweltgesicht und braunen Augen hinter den Gläsern einer Goldrandbrille. Seine Kleidung sah teuer aus, genauso wie die Uhr, die er am Handgelenk trug.
»Ich bin Ferdinand Fischer. Sind Sie Fiona?«, fragte er und schuf mit der Anrede eine Distanz, die Fiona entmutigte.
»Ja.« Sie zwang sich zu einem Lächeln und stand auf. Seine Hand fühlte sich an wie ein toter Fisch und Fiona ertappte sich dabei, dass sie ihre Handfläche verstohlen an ihrer Jeans abwischte, als sie wieder saß. »Danke, dass du gekommen bist.«
Ein holpriger Beginn.
»Ja, gerne.« Er musterte sie mit unverhohlener Neugier, sodass sie sich unwohl zu fühlen begann. »Sie … äh … du bist eine schöne Frau geworden. Du erinnerst mich an die junge Uma Thurman.«
Fiona spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss, und sie senkte verlegen den Blick. Glücklicherweise kehrte der Kellner in diesem Moment zurück und bewahrte sie davor, darauf eine Antwort geben zu müssen. Ihr fiel auf, dass ihr Vater nicht in die Karte blickte, um seine Bestellung – Rindstatar Classic und ein Feldschlösschen vom Fass – aufzugeben; sie bestellte einen Schinken-Käse-Toast, das günstigste Gericht, und eine kleine Apfelschorle. Bis die Getränke und das Essen kamen, machten sie Konversation. Fiona erzählte, dass sie vor drei Jahren am MNG Rämibühl ihre Matura bestanden und sich an der Université de Fribourg für ein Studium der Mathematik eingeschrieben hatte, aber dann war die Mama krank geworden, und sie hatte ihre Pläne bis auf Weiteres auf Eis legen müssen. Was sie ihm nicht erzählte, war, dass Silvan und sie deswegen in Streit geraten waren. Sie hatte angenommen, dass ihre Mutter wieder gesund würde, aber das war nicht der Fall gewesen, und so hatte sie die letzten drei Jahre mit der Pflege der Schwerstkranken verbracht. Er hörte ihr aufmerksam zu, kondolierte ihr ohne echtes Mitleid und wollte wissen, ob ihre Großmutter noch lebe und sie nach wie vor im Haus in Fluntern wohne. Recht schnell kamen ihre Bestellungen, ihr Vater steckte sich die weiße Stoffserviette in den Hemdkragen und begann mit gutem Appetit zu essen. Fiona nahm das Besteck zur Hand und schnitt zögerlich eine Ecke des Toasts ab. Vorhin hatte sie Hunger gehabt, aber der Appetit war ihr vergangen.
»Bist … du öfter hier?«, erkundigte sie sich. Es fühlte sich komisch an, diesen Fremden zu duzen.
»Zwei bis drei Mal pro Woche«, antwortete er kauend. »Ich arbeite auf der anderen Seite der Limmat. Als Wirtschaftsprüfer.«
»Ach! Tatsächlich?« Fiona konnte ihr Erstaunen nicht verbergen. Der vertraute Schmerz aus Jugendtagen traf sie unvorbereitet mitten ins Herz. Ihr Vater arbeitete in Zürich! Vielleicht, nein, ganz sicher, war sie ihm schon ein Mal über den Weg gelaufen, denn Zürich war eine kleine Stadt! Weshalb hatte er sie dann in all den Jahren nicht ein Mal kontaktiert und sie besucht? Warum hatte sie mit dem Stigma der Vaterlosigkeit aufwachsen müssen? Und als Wirtschaftsprüfer verdiente er sicherlich genug Geld, um Unterhalt für sie zahlen zu können, wenn er sie schon nicht hatte sehen wollen! Ob Mama darüber Bescheid gewusst hatte?
»Wir wohnen auf der anderen Seeseite, in Wädenswil«, sagte Ferdinand Fischer beiläufig und häufte Tatar auf seine Gabel. »Mein Mann und ich haben uns dort vor ein paar Jahren ein Haus gekauft.«
Fiona starrte ihn so entgeistert an, als ob er sie in den Magen geboxt hätte. Mein Mann und ich … Kurz befielen sie Zweifel, ob sie überhaupt dem richtigen Ferdinand Fischer gegenübersaß. Was, wenn sie sich geirrt hatte? Aber nein, er musste es sein, denn woher hätte er sonst von ihrer Näni und dem Haus wissen sollen? Als ihr Vater ihre Fassungslosigkeit bemerkte, verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht.
»Sag bloß …«, begann er mit deutlichem Unbehagen, brach kopfschüttelnd ab und legte das Besteck beiseite. Er betrachtete sie. »Nein. Oh mein Gott. Du weißt es tatsächlich nicht.« Nun schien er fassungslos zu sein. »Ich hätte es wissen müssen, dass sie …« Er verstummte, wirkte plötzlich hilflos.
»Was weiß ich nicht? Und was hättest du wissen müssen?« Fiona kämpfte mit den Tränen und hasste sich dafür, weil sie sich nicht besser im Griff hatte. Dass mein weggelaufener Vater ein Schwuler ist, der all die Jahre keine fünf Kilometer von mir entfernt gelebt hat und mich trotzdem niemals sehen wollte? Ihre Stimme bebte. »Hast du deswegen keinen Unterhalt bezahlt und mich nie besucht? War ich dir … peinlich? Hast du dich geschämt, vor deinem Mann, dass du ein Kind hast?«
Den letzten Satz hatte sie fast geschrien, und die Leute an den Nachbartischen guckten neugierig herüber, doch das bemerkte sie nicht.
»Fiona, bitte!« Dem Mann, den sie für ihren Vater hielt, war die ganze Situation sichtlich unangenehm. Er streckte besänftigend die Hand aus, aber sie zuckte vor ihm zurück. »Es war alles ganz anders!«
»Ich will es nicht hören! Es tut mir leid, dass ich dich kontaktiert habe!« Tränenblind raffte sie ihre Sachen zusammen, stopfte das Natel in ihren Rucksack und ergriff ihre Jacke. Keine Sekunde länger konnte sie das alles ertragen! Sie musste weg von hier, hinaus, an die frische Luft.
»Warte, Fiona!«, bat Ferdinand Fischer sie eindringlich und erhob sich halb, die Serviette noch immer im Hemdkragen. »Du musst die Wahrheit erfahren, wenn sie sie dir nicht erzählt hat! Ich bin nicht dein Vater! Und Christine war auch nicht deine Mutter!«
Tag 1
Dienstag, 18. April 2017
Kriminalhauptkommissarin Pia Sander saß auf der untersten Treppenstufe und band ihre Sneakers zu. Beim Versuch aufzustehen, fuhr ihr der inzwischen schon vertraute Schmerz zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel messerscharf durch den Rücken, und sie sackte mit einem unterdrückten Stöhnen zurück. Bevor sie nach dem Treppengeländer griff, um sich wie eine alte Frau daran empor zu hangeln, lauschte sie auf die Geräusche, die aus der Küche drangen. Es musste nicht sein, dass Christoph Zeuge dieser demütigenden Aktion wurde. Pia streckte vorsichtig den Rücken und der Schmerz ließ nach. In ein paar Wochen wurde sie fünfzig, und auch wenn sie sich im Grunde genommen gar nicht so alt fühlte, rächte sich ihr Körper nun für den Raubbau, den sie an ihm getrieben hatte. Das war einer der Gründe, weshalb Christoph und sie im Januar beschlossen hatten, den Birkenhof zu verkaufen. Der Hauptgrund war jedoch gewesen, dass sie sich auf dem Hof nicht mehr wohlgefühlt hatte. Zwei Mal war bei ihnen eingebrochen worden, das letzte Mal im vergangenen November, während sie alleine zu Hause gewesen war. Es war eine glückliche Fügung, dass just zu der Zeit die Leute, die vor ein paar Jahren Christophs Häuschen in Bad Soden auf Rentenbasis gekauft hatten, aus dem Rhein-Main-Gebiet wegziehen wollten und darum gebeten hatten, den Vertrag aufzulösen, was Christoph nur zu gerne getan hatte. Pia war die Entscheidung, den Birkenhof zu verkaufen, leichter gefallen, als sie befürchtet hatte. Ihre Pferde und Hunde waren nacheinander dahingeschieden, nur eine Katze war verblieben und die war mit umgezogen. Einen Käufer für den Hof zu finden war überhaupt kein Problem gewesen, sie hatten sogar die Wahl gehabt und schließlich an den Meistbietenden, einen türkischen Landschaftsgärtner, verkauft. Am vergangenen Donnerstag hatte Pia eine Mail vom Notar erhalten, dass der Kaufpreis in voller Höhe auf dem Notar-Ander-Konto eingegangen war, sodass die Schlüsselübergabe wie geplant morgen Abend um 18 Uhr stattfinden konnte.
Als Pia die Küche betrat, stand Christoph an der Kochinsel mit einer Tasse Kaffee in der Hand und studierte die Zeitung, die er vor sich ausgebreitet hatte. Die schwarz-weiß gefleckte Katze hatte es sich auf der Eckbank gemütlich gemacht und beobachtete jede seiner Bewegungen aus unergründlichen grünen Augen.
»Na, was macht dein Rücken nach der Kistenschlepperei gestern?« Er warf Pia einen prüfenden Blick über den Rand seiner Lesebrille zu.
»Alles super«, behauptete sie und gab ihm einen Kuss. »Ich bin fit wie ein Turnschuh.«
»Wirklich? Du hast dich ganz schön hin und her gewälzt heute Nacht.«
»Man ist halt nicht mehr fünfundzwanzig.« Pia nahm einen Kaffeebecher aus dem Hochschrank, stellte ihn unter den Kaffeeautomaten und drückte auf die Taste mit dem Symbol für Caffè Crema. »Ich habe aber richtig gut geschlafen.«
Und das stimmte. Nach zwölf Jahren direkt neben einer der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands empfand sie das Fehlen des beständigen Dröhnens als unglaublich wohltuend. Christoph war glücklich, wieder in dem Haus zu wohnen, in dem er zwanzig Jahre lang gelebt hatte. Seine jüngste Tochter Antonia wohnte mit ihrem Mann Lukas und ihren zwei kleinen Kindern nur ein paar Häuser weiter. Drei Monate hatten Umbau und Modernisierung gedauert, und in der Woche vor Ostern hatten sie Urlaub genommen, um ihre gesamte Habe in Kisten zu packen und den Hof aufzuräumen. Der neue Eigentümer hatte sämtliche Gerätschaften sowie Traktor, Miststreuer, Pferdehänger und sogar Pias uralten Geländewagen mitgekauft, was die Sache enorm erleichtert hatte. Am Gründonnerstag um acht war der Möbelwagen gekommen und innerhalb von zwei Stunden hatten die Möbelpacker alles verladen. Als sie das Tor des Birkenhofs hinter sich abgeschlossen hatte, hatte Pia Erleichterung verspürt statt Wehmut. Es war an der Zeit, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, genauso wie damals, vor zwölf Jahren, als sie nach der Trennung von Henning den Birkenhof gekauft und sich in die Arbeit gestürzt hatte.
Pia nahm einen Schluck heißen Kaffee und blätterte durch den Lokalteil des Höchster Kreisblatts, den Christoph schon gelesen hatte. Sie überflog die Artikel und wie üblich die Todesanzeigen auf der letzten Seite.
»Weißt du«, sagte sie zu ihrem Ehemann, »vorhin im Bad habe ich darüber nachgedacht, wie sehr mir doch Straßenlaternen, Nachbarn, das Läuten von Kirchenglocken, Geschäfte und Restaurants in Laufdistanz gefehlt haben. Ist es schlimm, wenn ich dem Birkenhof so gar nicht nachtrauere?«
»Überhaupt nicht«, erwiderte Christoph. »Wir hatten eine schöne Zeit dort, jetzt geht es hier weiter. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Das wusste schon Hermann Hesse.«
Pia musste lächeln. Christoph brachte die Dinge immer auf den Punkt. Sie trank den Kaffee aus und stellte die Tasse in die Spülmaschine.
»Bis heute Abend«, sagte sie, ergriff Jacke und Tasche, winkte der Katze zum Abschied und verließ zum ersten Mal ihr neues Zuhause, um arbeiten zu gehen.
Im K 11 war nicht viel los. Laut Dienstplan weilten Kathrin Fachinger und Cem Altunay im Urlaub, und der Chef der Abteilung, Kriminalhauptkommissar Oliver von Bodenstein, hatte noch drei Tage frei, war allerdings nicht verreist und deshalb in Bereitschaft. Nur die Kriminaloberkommissare Tariq Omari und Kai Ostermann hielten die Stellung. Letzterer futterte gerade eine Zimtschnecke und hob grüßend die Hand, als Pia das Büro betrat, das sie sich mit ihm teilte.
»Wünsche frohe Ostern gehabt zu haben«, sagte er kauend.
Pia kannte keinen Menschen, der so viel essen konnte, ohne dabei dick zu werden, wie ihren Kollegen Kai, obwohl er durch seine Behinderung gehandicapt war und nicht in dem Umfang Sport treiben konnte, wie es andere Leute mit seiner Kalorienzufuhr wohl hätten tun müssen, um schlank zu bleiben.
»Gleichfalls.« Sie zog drei Packungen Schokoladenostereier und einen Schokohasen aus ihrer Schultertasche und legte sie auf einen von Kais Schreibtischen. »Frohe Ostern nachträglich.«
»Oh, danke!«
»Besser, du isst das Zeug als ich.« Pia zwinkerte ihm zu. »Bei mir geht jedes Gramm mittlerweile auf die Hüften.«
Früher, in einem Büro mit Pia und Frank Behnke, hatte Kai Ostermann sich mit einem einzigen Schreibtisch begnügen müssen, aber seit Behnke nicht mehr da und Pia während Bodensteins Abwesenheit ins Chefbüro umgezogen war, hatte er sich einen u-förmigen Arbeitsbereich aus drei Tischen errichtet, der mit den vier Bildschirmen und mehreren Tastaturen ein bisschen so aussah, wie Pia sich den Handelsraum einer Großbank vorstellte. Sie hatte ihn nie gefragt, wie er die Mittel für seine Technik bei Kriminaldirektorin Dr. Engel lockergemacht hatte, aber wahrscheinlich hätte er es ihr ohnehin nicht verraten.
»Hattest du einen schönen Urlaub?« Kai verstaute die Mitbringsel in einer Schublade, die immer gut mit Knabberzeug gefüllt war. Die Zeiten, in denen er mit Schlabberhosen, abgetragenen T-Shirts und einer fettigen Pferdeschwanzfrisur herumgelaufen war, waren vorbei. Seitdem er eine Freundin hatte, achtete er sehr auf sein Äußeres. Auch heute hatte er sein kurz geschnittenes Haar mit Gel zurückfrisiert und trug zu einer engen dunkelblauen Jeans ein schneeweißes Hemd und eine Weste. Seine Verwandlung hatte dazu geführt, dass Dr. Nicola Engel, die Leiterin der Kriminalpolizei bei der Regionalen Kriminalinspektion Hofheim, Pia in einem Vier-Augen-Gespräch unmissverständlich zu verstehen gegeben hatte, sie erwarte von ihr einen der Position als Interims-Kommissariatsleiterin angemessenen Kleidungsstil, außerdem sei sie für Jeans, Kapuzenjacken und Turnschuhe wohl mittlerweile zu alt. Pia hatte sich gemaßregelt gefühlt und verärgert erwidert, sie werde sich weiterhin exakt so kleiden, wie es ihr passe, und das hatte sie auch getan. Aber seitdem dachte sie jeden Morgen beim Anziehen an dieses Gespräch, und die Unbefangenheit war dahin, obwohl sie die Leitung der Abteilung letztes Jahr wieder an ihren alten und neuen Chef Oliver von Bodenstein übergeben hatte. Sicher hätte der Vorfall erheblich weniger an Pia genagt, wenn Dr. Engel nur ihre Chefin gewesen wäre, aber sie war seit fünf Jahren auch die Lebenspartnerin ihrer jüngeren Schwester Kim, also fast so etwas wie ihre Schwägerin, und sie hatte mit der ihr eigenen Impertinenz Kim dazu gebracht, sich einzumischen und ihre Partei zu ergreifen, was zu einem Zerwürfnis zwischen den Schwestern geführt hatte.
»Wir sind doch umgezogen«, erinnerte Pia ihren Kollegen. Sie ließ sich hinter ihrem Schreibtisch nieder, schloss die Schubladen auf und suchte nach der Packung Ibuprofen, die sie dort deponiert hatte. »Da kann von Erholung keine Rede sein. Was war hier los?«
»Letzte Woche so gut wie gar nichts«, erwiderte Kai. »Tariq ist gerade in Frankfurt beim Haftrichter. In einer Flüchtlingsunterkunft in Flörsheim gab’s gestern Abend eine Messerstecherei mit tödlichem Ausgang.«
»Haben wir den Täter?«
»Ja. Ein abgelehnter marokkanischer Asylbewerber. Eine Stunde nach der Tat wurde er am S-Bahnhof festgenommen. War vollumfänglich geständig.«
Da Kriminaloberkommissar Tariq Omari, der seit drei Jahren zum Team des K 11 gehörte, fließend Arabisch sprach, brauchte er keinen Dolmetscher, wenn es in den Flüchtlingsunterkünften zu Straftaten kam, was leider immer häufiger der Fall war.
»Sehr gut.« Pia hatte die Tabletten gefunden und drückte eine aus der Blisterpackung. »Ist die Engel eigentlich im Haus?«
»Ich glaube, ja. Zumindest habe ich vorhin ihr Auto auf dem Parkplatz gesehen.«
Pia fuhr ihren Computer hoch, checkte die E-Mails, die in der letzten Woche eingegangen waren. Ein paar externe Anfragen, eine Doodle-Umfrage für die Verabschiedung eines Kollegen, ein Rundschreiben des Polizeipräsidenten, der wieder einmal mahnte, für dienstliche Kommunikation ausschließlich die Dienst-BlackBerrys zu nutzen und keine unsicheren Messenger-Dienste. Nichts wirklich Dringendes. Sie griff gerade nach der Post, die auf dem Stapel Akten lag, als das Telefon auf ihrem Schreibtisch klingelte.
»Hi, Pia«, meldete sich der Polizeiführer vom Dienst. »Ich hab etwas für euch. Wir haben gerade die Meldung reinbekommen, dass in einem Haus in Mammolshain eine männliche Leiche entdeckt wurde. Eine Streife ist auf dem Weg.«
»Wer hat die Leiche gefunden?«, wollte Pia wissen.
»Die Zeitungsausträgerin. Sie hat sich über den vollgestopften Briefkasten gewundert und durch ein Fenster geguckt. Offenbar liegt der Tote schon ein bisschen länger da.«
»Alles klar.« Pia legte die Briefe wieder zur Seite. »Ich fahre hin. Hast du eine Adresse?«
Sie notierte einen Straßennamen und eine Hausnummer, bedankte sich und stand auf.
»Ich muss nach Mammolshain«, sagte sie zu Kai. »Wie es aussieht, haben wir eine Wohnungsleiche.«
»Soll ich Tariq anrufen und ihn auch hinschicken?«
»Nee, lass mal.« Pia ergriff ihre Tasche. »Ich schau mir das erst mal an und melde mich.«
Kriminalhauptkommissar Oliver von Bodenstein hatte den Vormittag genutzt, um sich noch einmal gründlich auf seine morgige Aussage im Mordprozess vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Frankfurt vorzubereiten. Verhandelt wurde gegen einen 56-jährigen Mann und seine 49-jährige Freundin wegen des vor zweiundzwanzig Jahren gemeinschaftlich begangenen Mordes an der Ehefrau des 56-Jährigen. Der Vorwurf lautete auf Mord aus Habgier und weiteren niederen Beweggründen, denn die getötete Ehefrau war wohlhabend gewesen, und die heute 49-jährige Freundin damals schon die Geliebte des Ehemannes. Zweiundzwanzig Jahre hatte man den beiden nichts nachweisen können, denn die Freundin hatte dem Mann ein Alibi gegeben, das nicht zu widerlegen war. Vom Geld der ermordeten Ehefrau hatten sie in Saus und Braus gelebt, unbehelligt von der Polizei und ausgerechnet in dem Haus, in dem die Frau im Badezimmer getötet worden war, während nebenan die gerade zweijährige Tochter des Ehepaares geschlafen hatte. Da Mord in Deutschland nicht verjährt, war der Fall vor einem halben Jahr routinemäßig wieder überprüft worden, und man hatte die damals festgestellten Spuren erneut untersucht. Seit 1995 hatte sich in der Kriminaltechnik, besonders auf dem Gebiet der DNA-Analyse, sehr viel getan, und so hatte die Auswertung der Spurensicherungsfolien, mit denen der gesamte Körper der Leiche abgeklebt worden war, ein spektakuläres Ergebnis erbracht: DNA-Spuren der Freundin, die seinerzeit behauptet hatte, nicht im Haus des Ehepaars gewesen zu sein, waren am Arm der Toten festgestellt worden. Ein erdrückender Beweis dafür, dass sie entgegen ihrer Aussage doch im Badezimmer gewesen sein und physischen Kontakt zu der Getöteten gehabt haben musste. Damit war auch das Alibi, das sie ihrem Freund verschafft hatte, geplatzt, und Bodenstein hatte die beiden vor vier Monaten festgenommen. Der Haftrichter hatte das Paar umgehend in U-Haft geschickt und nun wurde ihnen der Prozess gemacht. Kein Zweifel, dass das Urteil für jeden lebenslänglich lauten würde.
Es erfüllte Bodenstein mit tiefer Zufriedenheit, alte, ungeklärte Fälle wie diesen zu lösen und den Angehörigen der Opfer späte Genugtuung zu verschaffen. Unter anderem deshalb war er in seinen Beruf zurückgekehrt, denn aufgrund von Umstrukturierungen hatte man dem K 11 der Regionalen Kriminalinspektion Hofheim die Abteilung für ungeklärte Altfälle angegliedert, was nicht nur eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen vom LKA bedeutete, sondern außerdem den unbeschränkten Zugriff auf alle Ressourcen von LKA und BKA.
Vor drei Jahren hatte er ernsthaft vorgehabt, den Polizeidienst zu quittieren. Sein letzter Fall hatte ihn an seine seelischen Grenzen und den Rand eines Burn-outs gebracht, und er hatte für sich entschieden, dass er eine Pause und ein wenig Abstand brauchte. Das Jahr hatte er genutzt, um in Ruhe darüber nachzudenken, wie es für ihn weitergehen sollte. Die Aussicht, Vermögensverwalter seiner Ex-Schwiegermutter zu sein, hatte ihn nicht wirklich gereizt. Schließlich war es seine langjährige Kollegin und Interims-Nachfolgerin Pia Sander gewesen, die ihn zur Rückkehr bewegt hatte. Da Bodenstein mehr Zeit für seine Tochter und seine Frau haben wollte, hatte er sich mit Pia, Dr. Engel und den zuständigen Stellen im Polizeipräsidium darauf geeinigt, dass er zwar wieder die Leitung des K 11 mitsamt allen anfallenden administrativen Aufgaben übernehmen würde, allerdings nur in Teilzeit zu achtzig Prozent.
Bodenstein steckte die Unterlagen in seine Aktentasche, erhob sich von seinem Schreibtisch und schlenderte hinüber ins Fernsehzimmer, wo Karoline schon seit dem frühen Vormittag bei heruntergelassenen Jalousien ihre Lieblingsserie auf Netflix guckte. Er blieb im Türrahmen stehen und lächelte beim Anblick seiner Frau, die ungeschminkt und in Jogginghosen faul auf der Couch lag. Karolines 16-jährige Tochter Greta war für vierzehn Tage mit der Familie ihres Vaters nach Florida geflogen, Sophia hatte die Feiertage bei ihrer Mutter verbracht und würde noch bis Freitag dortbleiben, und so war Ostern in diesem Jahr zu einer herrlich entspannten Angelegenheit geraten. In der Osternacht waren sie gemeinsam mit seinen Eltern in Fischbach in die Kirche gegangen, sonst hatten sie einfach nur »gechillt«, wie Sophia das so schön nannte. Während seines Sabbaticals hatte auch Karoline ihr Leben überdacht und ihren Job bei dem Beratungsunternehmen, dessen sie ohnehin seit Langem überdrüssig gewesen war, gekündigt. Sie hatte an Bodensteins Stelle die Vermögensverwaltung für Gabriela von Rothkirch übernommen, und das war auch gut so, denn Karoline kannte sich erheblich besser mit solchen Dingen aus. Bodensteins ehemalige Schwiegermutter hatte Karoline auf Anhieb vertraut, und gemeinsam hatten die beiden das millionenschwere Vermögen der Rothkirchs neu strukturiert und in verschiedene Stiftungen aufgeteilt. Selbst Cosima hatte erkannt, dass es der neuen Frau ihres Ex-Mannes nicht um persönliche Bereicherung ging, und ihre Ressentiments gegen Karoline aufgegeben. Sie reiste weiterhin um die Welt, produzierte Dokumentarfilme und hielt höfliche Distanz, aber die Absprachen bezüglich Sophia funktionierten mittlerweile.
»Ich bin schon bei Folge sieben von Staffel zwei.« Karoline gähnte und streckte sich genüsslich, als er hereinkam. »Mir tut es jetzt schon leid, dass ich nur noch sechs Folgen zu gucken habe.«
»Die nächste Staffel kommt bestimmt.« Bodenstein grinste.
»Findest du es schlimm, wenn ich an einem normalen Werktag faul vor der Glotze herumhänge?«, fragte sie ihn.
»Kein bisschen. Das ist der Vorteil, wenn man Freiberuflerin ist.« Er beugte sich über sie und gab ihr einen Kuss. Die Versuchung, sich zu ihr auf die Couch zu legen und den Rest des Tages zu verdämmern, war groß, aber er widerstand erfolgreich. »Ich wollte ein bisschen nach draußen an die frische Luft, bevor es anfängt zu regnen.«
»Schon klar.« Karoline erwiderte sein Grinsen. »Viel Vergnügen!«
Im letzten Jahr hatten sie geheiratet, auf Schloss Bodenstein mit der ganzen Familie gefeiert und anschließend Flitterwochen im Haus von Freunden an der Algarve verbracht. Bei ihrer Rückkehr hatte in der Garage eine Überraschung auf ihn gewartet, ein Geschenk von Gabriela, das er in seiner Bescheidenheit niemals angenommen hätte, wenn sie ihn zuvor gefragt hätte. Weil sie ihn jedoch gut genug kannte, hatte sie dies nicht getan, und so waren ihm fast die Augen aus dem Kopf gefallen, als er unverhofft vor seinem Traumwagen stand, einem nachtschwarzen Carrera 4 GTS Cabrio mit beigen Ledersitzen und Doppelkupplungsgetriebe, der so atemberaubend schön war, dass es ihm die Sprache verschlagen hatte. Greta, die seit zwei Jahren streng vegan lebte und radikale Ansichten zu den Themen Umwelt und Konsum vertrat, hatte verächtlich angemerkt, damit sei sein ökologischer Fußabdruck jetzt wohl so groß wie ganz Afrika, und sie würde sich vor ihren Freunden in Grund und Boden schämen, ihn als Stiefvater zu haben. Bodenstein hatte daraufhin entgegnet, bevor sie den Stab über ihn breche, solle sie bitte mal ausrechnen, was ihr Vater als Pilot eines Jumbos der Umwelt antue. Damit war das Thema erledigt gewesen. Mittlerweile gestattete Greta es ihm sogar gnädig, sie gelegentlich mit dem Porsche durch die Gegend zu kutschieren, allerdings stieg sie immer vor Erreichen des eigentlichen Zieles aus, damit sie vor ihren Freunden nicht an Glaubwürdigkeit verlor.
Bodenstein nahm seine Jacke von der Garderobe und den Autoschlüssel aus der Schublade der Kommode im Flur. Als er die Verbindungstür von der Küche zur Garage öffnete, lächelte er unwillkürlich beim Anblick des Autos, von dem er geträumt hatte, seitdem er ein kleiner Junge war. Noch in der Garage öffnete er das Dach, das sich automatisch hinter ihm zusammenfaltete, zog das Windschott hoch und brauste wenig später durch die Frühlingsluft Richtung Hintertaunus.
Pia verzichtete darauf, sich einen Dienstwagen aus dem Fuhrpark geben zu lassen, und fuhr stattdessen mit ihrem eigenen Auto nach Mammolshain. Nach dreizehn Jahren in spritfressenden, unhandlichen Geländewagen genoss sie das Fahrgefühl in ihrem Mini Cabrio in Volcanic Orange, das sie ziemlich günstig bekommen hatte, weil die Vorbesitzer sich schon nach wenigen Monaten an der auffälligen Farbe sattgesehen hatten. Immer wieder schielte sie auf den Tacho. In der letzten Woche war sie gleich zwei Mal geblitzt worden, weil sie sich noch nicht an die Spritzigkeit ihres Mini gewöhnt hatte. Sie fuhr die B 519 Richtung Königstein, bog kurz vor dem Kreisel rechts ab und folgte der Straße, die in Kurven durch den Wald abwärts nach Mammolshain, einem Stadtteil Königsteins, führte.
In Gedanken war sie bei dem, was sie am Ziel ihrer Fahrt erwartete. Leichen, die schon länger in geschlossenen Wohnungen lagen, waren nicht nur ein schlimmer Anblick, sondern vor allen Dingen extrem deprimierend, denn schließlich bedeutete der fortgeschrittene Zustand der Verwesung nichts anderes, als dass niemand den Menschen vermisst und die soziale Kontrolle vollkommen versagt hatte. Die meisten Wohnungsfaulleichen wurden nicht etwa wegen des Geruchs gefunden, sondern erst, wenn Maden unter einer Tür hindurch in den Hausflur krochen. Erst unlängst hatte ihr Ex-Mann Henning Kirchhoff, Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts der Frankfurter Goethe-Universität, den unglaublichen Fall erlebt, dass Nachbarn in einem Hochhaus eine Wohnungstür, unter der Maden hindurchgekrochen waren, von außen einfach mit Decken und Zeitungen zugestopft hatten. Erst als Leichenflüssigkeit durch die Decke der darunterliegenden Wohnung gedrungen war, hatten deren Bewohner Alarm geschlagen. Die alte Dame, die über sechzig Jahre in dem Haus gelebt hatte, war sechs Wochen zuvor verstorben. Da die Miete automatisch von dem Bankkonto abgebucht worden war, auf das jeden Monat die Rente einging, war das Ableben der Frau der Hausverwaltung nicht aufgefallen. Tragödien wie diese kamen leider häufig vor, und auch wenn Verwesung und Zersetzung eines Organismus aus biologischer Sicht ganz natürliche Vorgänge waren, so empfand Pia es immer wieder als pietätlos, wenn diese öffentlich vonstattengingen, nur weil sich niemand verantwortlich gefühlt hatte.
»In zweihundert Metern links abbiegen!«, kommandierte die Computerstimme des Navigationsgeräts, als Pia die scharfe Spitzkehre in der Mitte des kleinen Ortes hinter sich gelassen hatte. »Achtung! Das Ziel liegt an einer zufahrtsbeschränkten Straße!«
Pia verlangsamte die Fahrt, um ungefähr hundert Meter vor dem Ortsausgang in ein schmales, von Schlaglöchern übersätes Sträßchen einzubiegen, das durch ein kleines Waldstück abwärts führte.
»Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich links.«
Hinter den letzten Bäumen tauchten mehrere große Gebäude aus verwittertem Backstein auf, die einen kopfsteingepflasterten Hof umgaben, in dem das Unkraut schon vor einer ganzen Weile die Vorherrschaft übernommen hatte. Das rostige Tor machte den Eindruck, als wäre es nicht erst seit gestern geschlossen. In altmodischen Lettern prangte der verblichene Schriftzug E. Reifenrath & Cie – Taunus-Mineralbrunnen Gesellschaft. Seit 1858 auf der Fassade eines der Gebäude.
»Wenn möglich, bitte wenden!«, forderte das Navi, aber Pia achtete nicht darauf und fuhr weiter. Hinter einer Kurve erblickte sie einen Streifenwagen. Der uniformierte Kollege, der am Kotflügel lehnte, hob die Hand und stellte sich ihr in den Weg. Pia ließ das Fenster herunter.
»Ach, Sie sind’s!« Aus der Nähe erkannte sie der junge Beamte. »Neues Auto, hm? Haben Sie Ihren alten Panzer endlich verschrottet?«
»Verkauft. Jetzt ist Spritsparen angesagt.« Sie lächelte. »Wo muss ich hin?«
»Durchs Tor und dann immer die Auffahrt lang.«
Pia bedankte sich und nahm den Fuß von der Bremse. Das große schmiedeeiserne Tor stand weit offen. Eine asphaltierte Zufahrt schlängelte sich zunächst durch einen düsteren Wald aus Tannen, Thujen und meterhohen Rhododendronbüschen. Sonne und Regen im Wechsel hatten in den vergangenen Wochen die Natur geradezu explodieren lassen. Das Gras wucherte, überall blühten Narzissen, und Teppiche von Buschwindröschen leuchteten weiß unter den großen Edelkastanien, an deren Zweigen sich das erste helle Grün zeigte. Hinter einer Biegung tauchte das Wohnhaus auf. Aus der Ferne wirkte es geradezu majestätisch mit seinen Türmchen und einer Freitreppe, die zu einem von vier Säulen getragenen Portikus führte, doch aus der Nähe war nicht zu übersehen, wie sehr der Zahn der Zeit an dem großen Gemäuer genagt hatte. Putz war großflächig abgeblättert, das Dach war von Moos bedeckt und hing an vielen Stellen durch wie der Rücken eines alten Pferdes. Hier und da fehlten Dachziegel und im obersten Stockwerk waren einige Fenster mit Brettern vernagelt.
Pia hielt auf dem geschotterten Vorplatz an und stieg aus. Neben Polizeioberkommissar Cordt stand eine Frau. Sie war ungefähr in Pias Alter, das kurz geschnittene mausgraue Haar, durchzogen von gelblichen Strähnchen, wie es nur schlechte Friseure hinbekommen, schmeichelte ihrem hageren Gesicht nicht. Ihre Augen funkelten vor Aufregung.
»Das ist die Dame, die uns verständigt hat«, erklärte POK Cordt. »Frau … äh … trägt morgens die Zeitungen aus, und ihr ist aufgefallen, dass der Briefkasten voll ist. Dann hat sie am Haus nach dem Bewohner schauen wollen und durch ein Küchenfenster eine leblose Person gesehen.«
Die Frau nickte ungeduldig zu jedem Wort, das er sagte. Sie brannte darauf, endlich loszuwerden, was sie gesehen und erlebt hatte, und für einen Moment im Mittelpunkt zu stehen.
»Wahl, Monika Wahl«, sagte sie eifrig. »Ich trage hier seit sieben Jahren die Zeitungen aus. Das Haus vom Herrn Reifenrath ist immer das Letzte auf meiner Tour, weil ich dann noch mit meiner Peppi, also meinem Hund, unten im Quellenpark spazieren gehe. Ich hätte ja viel eher gemerkt, dass da etwas nicht stimmt, aber ich hatte die letzten zwei Wochen Urlaub und deshalb habe ich …«
»Langsam, langsam!« Pia hob die Hand, um den Redeschwall der Zeitungsausträgerin zu bremsen. »Wie sind Sie zum Haus gekommen? Stand das Tor offen?«
»Ja, und das hat mich gewundert«, erwiderte Frau Wahl. »Das Tor ist normalerweise immer zu! Ich stelle mein Auto immer ganz an den Straßenrand, dann lass ich die Peppi rausspringen, stecke die Zeitung in den Briefkasten und drehe meine Runde. Aber heute ist die Peppi gleich abgezischt, durchs offene Tor und weg war sie! Und ich bin hinterher, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Der Herr Reifenrath hat doch auch einen Hund, so einen Schäferhund, also, so einen belgischen … einen Maloni … Milano …«
»Malinois?«, half Pia.
»Ja, genau, einen Malinua«, bestätigte Frau Wahl.
Sie war die lange Auffahrt entlanggerannt und hatte ihren Hund am Hintereingang des Hauses gefunden, wo er aufgeregt an der Tür gekratzt und herumgeschnüffelt hatte. Frau Wahl hatte an der Küchentür geklopft, und als niemand reagiert hatte, hatte sie durch die Küchenfenster gespäht und den Toten entdeckt.
»Sie haben das Haus also nicht betreten?«, fragte Pia nach.
»Nein, die Tür war ja zu. Ich hab von meinem Handy aus sofort die Polizei angerufen!« Die Zeitungsfrau wirkte kurz verunsichert. »Das war doch okay, oder?«
»Absolut«, bestätigte Pia. »Wissen Sie, um wen es sich bei dem Toten handeln könnte?«
»Ich denke, das wird der alte Herr Reifenrath sein. Er ist schon weit über achtzig«, erwiderte Frau Wahl und schauderte. »Aber so genau habe ich nicht hingeschaut.«
»Wohnt er hier alleine?«
»Ja, soweit ich weiß. Ich hab hier nie jemand anders gesehen.«
»Zeigen Sie uns doch bitte, wo Sie entlanggegangen sind und von wo aus Sie die Leiche gesehen haben«, bat Pia sie. Die Zeitungsfrau führte sie und POK Cordt zielstrebig um das Haus herum und deutete auf einen Seiteneingang, zu dem ein Weg aus brüchigen Waschbetonplatten führte.
»Durch das Fenster da können Sie ihn sehen.« Monika Wahl wies auf eines der beiden Küchenfenster, hielt sich aber in sicherer Entfernung. »Ich will mir das ehrlich gesagt nicht noch mal angucken. Und überhaupt – brauchen Sie mich noch? Ich müsste nämlich dann mal weiter.«
»Nein, Sie können jetzt ruhig gehen.« Pia lächelte freundlich. »Vielen Dank, dass Sie so aufmerksam waren und uns verständigt haben.«
Monika Wahl errötete vor Stolz über das Lob.
»Ich wusste gar nicht, dass hier unten so ein großes Haus steht«, sagte Pia zu ihrem uniformierten Kollegen, als die Frau verschwunden war. Sie blickte an der Hausfassade hoch. »Das ist ja beinahe schon ein kleines Schloss.«
Da die Küchentür abgesperrt war, gingen sie zum Eingangsportal zurück. Die Haustür war offen und der Türschnapper war umgestellt worden. Daran war eigentlich nichts Ungewöhnliches. Pia hatte das auf dem Birkenhof selbst auch so gehalten, zumindest tagsüber, wenn sie öfter rein und raus musste. Sie betrat das Haus, blieb auf der Schwelle stehen und schnupperte. Ein Hauch von Ammoniak und verdorbenem Käse drang ihr in die Nase. Typischer Leichengeruch. Sie wühlte in ihrer Jackentasche, fand ein Paar Latexhandschuhe und streifte sie über.
»Soll ich mit reingehen?«, fragte Cordt.
Pia sah ihm an, dass er nicht scharf auf eine Wohnungsfaulleiche war.
»Nicht nötig. Fordern Sie Verstärkung an und verständigen Sie einen Bestatter«, sagte sie und erntete dafür ein dankbares Nicken. Pia blickte sich in der Eingangshalle um. Das Haus bestach durch puritanische Schlichtheit. Abgesehen von einem großen geschnitzten Holzkreuz waren die Wände von der hüfthohen, dunklen Holzverkleidung an aufwärts völlig kahl. Einziger Blickfang war ein monströser Kachelofen in Weiß und Blau auf der rechten Seite der Halle. Ein verstaubter Kronleuchter hing von der hohen Decke herab. In der Mitte der Halle führte eine breite Freitreppe aus hellem Sandstein in die oberen Stockwerke. Links und rechts zweigten Flure ab. Durch zwei schmale Kirchenfenster aus Bleiglas fiel Licht herein und zeichnete bunte Muster auf den Marmorboden. Pia betrat den vorderen Flur auf der rechten Seite. Kalte Luft wehte ihr entgegen, und der faulige Leichengeruch wurde intensiver, je näher sie der Tür am Ende des Ganges kam. Pia legte kurz die Hand auf einen der altertümlichen Heizkörper. Er war eiskalt. In der Küchentür blieb sie stehen und zwang sich, nur durch den Mund zu atmen. Nach ein paar Minuten gewöhnte man sich an den Geruch, das wusste sie aus langjähriger Erfahrung, man durfte sich nur nicht zu sehr darauf konzentrieren. Im ganzen Haus war es so still wie in einer Kirche. Das Einzige, was zu hören war, war das Summen einer Fliege, die unermüdlich gegen die Scheibe eines der Küchenfenster flog.
Der Raum war groß und rechteckig. Auf der linken, fensterlosen Seite befand sich eine typische 60er-Jahre-SieMatic-Einbauküche in Traubengrün mit Griffleisten in Alu-Optik. Die gleiche hatte es in Pias Elternhaus zu ihrer Jugendzeit gegeben, nur in einer tristeren Farbe. Pias Blick glitt über eine Eckbank auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, den Küchentisch mit schraffierter Resopalplatte, auf der eine aufgeschlagene Zeitung neben benutztem Frühstücksgeschirr lag. In der Kaffeetasse wuchsen Schimmelpilze, das angebissene Brot war ebenfalls schimmelig und bog sich an den Rändern nach oben. Ein leerer Fressnapf und ein großer Hundekorb aus geflochtener Weide waren die einzigen Hinweise auf den Malinois, den die Zeitungsfrau erwähnt hatte. Von dem Tier selbst war nichts zu sehen. Die sterblichen Überreste des Mannes, die auf einer Art Diwan lagen, befanden sich in einem Zustand fortgeschrittener Verwesung. Fäulnisgase hatten den Körper grotesk aufgebläht, auf der grünlich marmorierten Haut des Toten hatten sich Blasen gebildet. Aus dem Mund quoll die dunkel verfärbte Zunge. Der weiße Haarschopf bildete einen bizarren Kontrast zu der rotbraun verfärbten Gesichtshaut. Wäre es in der Küche ein paar Grad wärmer gewesen, dann hätte der Leichnam wahrscheinlich von Maden gewimmelt. Es war ein wirklich grauenhafter Anblick, selbst für Pia, die schon viele Leichen gesehen hatte. Sie musste keine Rechtsmedizinerin sein, um zu sehen, dass der Mann nicht erst gestern gestorben war. Aber wieso hatte ihn niemand vermisst?
An Haken neben der Tür, die ins Freie führte, hingen mehrere Jacken neben einer Hundeleine, darunter stand auf einer Fußmatte ein Paar grüner Gummistiefel. Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre der Mann eines natürlichen Todes gestorben. Vielleicht war ihm beim Frühstück schlecht geworden, und er hatte sich kurz auf den Diwan gelegt, doch dann hatte sein Herz aufgehört zu schlagen. Mit über achtzig durchaus denkbar. Pia betrachtete die Leiche genauer und hielt plötzlich inne. War das getrocknetes Blut im Gesicht des Toten? Sie ging neben dem Diwan in die Hocke. Ja, tatsächlich! Es sah ganz so aus, als ob er eine Verletzung oberhalb der linken Augenbraue hätte. Ob diese von einem Sturz oder einem Schlag herrührte, musste ein Fachmann beurteilen, auf jeden Fall brachte es ihre Theorie von einem natürlichen Tod ins Wanken. Sie erhob sich, zog ihr Smartphone aus der Jacke und rief ihren Ex-Mann an.
»Ja?«, meldete der sich nach dem zweiten Klingeln.
»Bist du im Institut?«, fragte Pia, ohne sich mit einem Gruß aufzuhalten.
»Natürlich. Wo sonst?« Professor Henning Kirchhoff klang gereizt. »Ist es dringend oder willst du bloß plaudern?«
»Wann bitte schön habe ich dich jemals angerufen, um mit dir zu plaudern?«, erwiderte Pia genauso ruppig. »Ich brauche einen Rechtsmediziner.«
Henning wurde wirklich immer verschrobener. Vor anderthalb Jahren war auch seine zweite Ehe mit Pias Schulfreundin Miriam Horowitz endgültig in die Brüche gegangen. Pia hätte ihrem Ex eine glückliche Beziehung gewünscht, aber Miriam gegenüber empfand sie einen leisen Triumph, denn diese hatte anfänglich so getan, als würde ihr locker gelingen, was Pia nie geschafft hatte, nämlich Henning zu normalen Arbeitszeiten zu zwingen. Doch Henning Kirchhoff war und blieb ein Workaholic, er lebte für seine Arbeit, die für ihn mehr Berufung als Beruf war. Im Gegensatz zu Pia, die sich das Scheitern ihrer Ehe eingestanden hatte und ausgezogen war, hatte Miriam Henning jedoch eine Szene nach der anderen gemacht, war theatralisch mehrmals aus- und wieder eingezogen, bis Henning schließlich in die Dienstwohnung des Instituts geflüchtet war, wo er bis heute auf 35 Quadratmetern hauste.
»Ach ja?« Hennings Stimme klang plötzlich interessiert. »Hast du eine Leiche?«
»Wofür bräuchte ich wohl sonst einen Rechtsmediziner«, erwiderte Pia.
»Na ja, es hätte ja sein können, dass du Sehnsucht nach mir hast«, witzelte Henning, wurde aber gleich wieder ernst, als Pia ihm schilderte, was sie vorgefunden hatte.
»Ich komme selbst«, sagte er dann. »Fass nichts an, bis ich da bin! Und lass die Fenster zu!«
»Ich bin keine Anfängerin«, erinnerte Pia ihren Ex-Mann, gab ihm die Adresse durch und warf einen Blick auf ihre Uhr. Kurz nach elf. Sie verließ die Küche und sah sich in den benachbarten Räumen um. Gleich neben der Küche befand sich ein Schlafzimmer. Wuchtige Möbel aus Nussbaumholz, ein großer Kleiderschrank, ein Bett mit hohem Kopf- und Fußteil und ein Nachttischchen mit einem Wecker, der um zwanzig nach zehn stehen geblieben war. Über einem Waschtisch mit Marmorplatte hing ein wolkiger Spiegel mit Rosenholzrahmen. Auf einem stummen Diener eine ordentlich gefaltete Hose, ein kariertes Hemd und ein grüner Pullover. Die Möbel wirkten zu groß für den Raum; Pia mutmaßte, dass die fortschreitende Gebrechlichkeit den alten Mann dazu veranlasst hatte, sich auf das Erdgeschoss des großen Hauses zu beschränken. Sie zog die Schubladen der Kommode auf und ein eigenartiges Gefühl beschlich sie. Hier stimmte etwas nicht. Die Unterwäsche und Socken waren durchwühlt worden. Pia öffnete den Schrank. Kleidungsstücke waren von den Bügeln gerissen und achtlos auf den Schrankboden geworfen, Hemden waren auseinandergefaltet und einfach in die Schrankfächer geknüllt worden. Gegenüber lag das Badezimmer. Pia öffnete den Spiegelschrank. Auch hier sah es so aus, als ob jemand alles aus- und hastig wieder eingeräumt hätte: Rasierzeug, Zahnpasta, eine Haarbürste. Haftcreme, Gebissreiniger, Wattestäbchen, Rasierwasser. Sie fand eine Packung Aspirin, Hustensaft, Lutschpastillen, aber auch Omeprazol, Betablocker und ACE-Hemmer, was die Vermutung nahelegte, dass der alte Mann unter Magenbeschwerden, Bluthochdruck und Herzproblemen gelitten hatte. Neben dem Schlafzimmer befand sich ein etwas größerer Raum, der wohl als Büro und Fernsehzimmer gedient hatte. Der Fernsehsessel musste ein Lieblingsmöbelstück seines Besitzers gewesen sein, so fadenscheinig waren Armlehnen und Kopfteil. Der abgetretene Perserteppich war übersät mit Hundehaaren. An den Wänden hingen Ölbilder, die Landschaften darstellten und nicht besonders wertvoll wirkten. Ein helleres Rechteck auf der verschossenen Tapete ließ vermuten, dass ein Bild fehlte. Pias Blick glitt über den Schreibtisch aus dunklem Mahagoniholz mit Messingbeschlägen, über einen angestoßenen Aktenschrank aus Metall und einen Koloss von Tresor, der jeden Einbrecher zur Kapitulation gezwungen hätte. Pia rüttelte am Griff, aber er ließ sich nicht öffnen. Der Aktenschrank war gewaltsam aufgehebelt worden. Sie öffnete die Schreibtischschubladen, dann ging sie zurück in die Küche und durchsuchte die Anrichte und die Taschen der Jacke, die neben der Tür hing. Keine Spur von einem Portemonnaie oder einer Brieftasche! Jemand schien hier irgendetwas gesucht zu haben, aber derjenige war ziemlich diskret vorgegangen, nicht wie Drogensüchtige, die auf der Suche nach Schmuck, elektronischen Geräten und Bargeld Matratzen aufschlitzten, Möbel umwarfen und den Inhalt von Schubladen auf den Fußboden ausleerten. Hatten der oder die Einbrecher den Alten überrascht und umgebracht, oder war der ungebetene Besuch erst nach Reifenraths Ableben aufgetaucht?
Zürich, 19. März 2017
Sie hatten das stickige Café verlassen und spazierten die Uferpromenade entlang, vorbei am Sechseläutenplatz und den Stegen der Bootsverleiher, die an einem Tag wie heute vergeblich auf Kunden warteten. Die Äste der blattlosen Platanen glänzten vor Nässe, und auf dem See dümpelten lustlos ein paar Stockenten und Schwäne.
»Ich habe Christine damals über einen Kollegen kennengelernt«, begann Ferdinand zu erzählen. »Es war im Sommer 1994, und ich war in einer verzweifelten Situation, denn meine Arbeitserlaubnis für die Schweiz war abgelaufen und ich hätte zurück nach Deutschland gemusst. Da wollte ich aber auf keinen Fall wieder hin, denn erstens hatte ich Differenzen mit dem deutschen Finanzamt, und zweitens hatte ich mich kurz zuvor in Raphael, meinen jetzigen Mann, verliebt.«
Er räusperte sich, schlug den Kragen seines Mantels hoch.
»Christine suchte einen Mann, weil sie ein Kind adoptieren wollte«, fuhr Ferdinand Fischer fort. »Sie hatte einige Versuche, auf künstlichem Wege schwanger zu werden, hinter sich, ihr erster Mann hatte es satt und ließ sich scheiden. Aber ohne Mann hatte sie keine Chance auf ein Kind, zumal sie bestimmte Vorstellungen hatte. Ein Mädchen sollte es sein, und zwar kein asiatisches oder afrikanisches. Und am besten von intelligenten Eltern abstammend. Schwierig, wie du dir denken kannst.«
Aber typisch Mama, dachte Fiona. Sie hatte ihren ersten Schock überwunden. Die frische Luft tat ihr gut.
»Sie hatte also einen Plan und brauchte dafür einen Ehemann. Sie war Schweizerin, ich Deutscher. Wir schlossen einen Vertrag ab. Ich würde sie heiraten und mit ihr verheiratet bleiben, bis sie ein Kind adoptiert hatte. Dann würden wir eine Frist von fünf Jahren abwarten, damit wir uns nicht der Scheinehe verdächtig machten. Anschließend würden wir uns scheiden lassen, ohne Ansprüche gegeneinander. Sie hätte ihr Kind, ich die Schweizer Staatsbürgerschaft, fertig.«
»Aber ich habe nirgendwo in Mamas Unterlagen eine Adoptionsurkunde gefunden«, entgegnete Fiona.
»Konntest du auch nicht.« Ferdinand blieb stehen, seine Miene wurde düster. »Denn während Christine händeringend auf ein passendes Kind wartete und jeden Abend darum betete, dass irgendeine intelligente Frau ihren hellhäutigen weiblichen Säugling in eine Babyklappe legen würde, griff das Schicksal ein.«
Fiona lauschte wie betäubt einer schier unglaublichen Geschichte. Mit jedem Wort, das Ferdinand Fischer sagte, zerbrach ihre Welt ein Stückchen mehr.