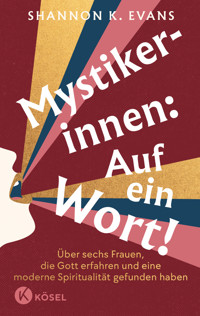
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Entdecke das Empowerment radikaler Mystikerinnen
Gibt es eine christliche Spiritualität, die die ganze Realität des Frauseins abbildet?
Wohl eher nicht, ertappt man sich beim reflexartigen Antworten. Shannon K. Evans hält dagegen. Im Christentum ist eine dezidiert weibliche Spiritualität beheimatet, die so aktuell ist wie eh und je und die von Frauen gefühlt und gelebt wurde, die lange vor uns da waren – Teresa von Ávila, Margery Kempe, Hildegard von Bingen, Juliana von Norwich, Katharina von Siena und Thérèse von Lisieux. Diese sechs Mystikerinnen offenbaren einen Glauben, der alle Erfahrungen von Weiblichkeit umfasst: Begehren, Lust und Sex; das Verlangen nach körperlicher Selbstbestimmung; die Herausforderungen von Mutterschaft; Gewalterfahrungen; der Kampf um Freiheit und Identität unter jahrhundertelanger männlicher Vorherrschaft. Diese sechs Frauen – selbstbestimmt, durchsetzungsstark und vor allem durch und durch sie selbst – stellten in ihrer jeweiligen Zeit Fragen, die heute erstaunlich aktuell sind. Sie kämpften damals dafür, dass die Belange von Frauen gehört, anerkannt, respektiert werden. Denn letztendlich sind weibliche Erfahrungen heilige Erfahrungen und das verdient Anerkennung. Mystikerinnen: Auf ein Wort! In diesem Buch entdeckt jede Frau kraftvolle spirituelle Impulse für ihr persönliches Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Entdecke das Empowerment radikaler Mystikerinnen!
Gibt es eine christliche Spiritualität, die die ganze Realität des Frauseins abbildet?
Wohl eher nicht, ertappt man sich beim reflexartigen Antworten. Shannon K. Evans hält dagegen. Im Christentum ist eine dezidiert weibliche Spiritualität beheimatet, die so aktuell ist wie eh und je und die von Frauen gefühlt und gelebt wurde, die lange vor uns da waren – Teresa von Ávila, Margery Kempe, Hildegard von Bingen, Juliana von Norwich, Katharina von Siena und Thérèse von Lisieux. Diese sechs Mystikerinnen offenbaren einen Glauben, der alle Erfahrungen von Weiblichkeit umfasst: Begehren, Lust und Sex; das Verlangen nach körperlicher Selbstbestimmung; die Herausforderungen von Mütterlichkeit; Gewalterfahrungen; der Kampf um Freiheit und Identität unter jahrhundertelanger männlicher Vorherrschaft. Diese sechs Frauen – selbstbestimmt, durchsetzungsstark und vor allem durch und durch sie selbst – stellten in ihrer jeweiligen Zeit Fragen, die heute erstaunlich aktuell sind. Sie kämpften damals dafür, dass die Belange von Frauen gehört, anerkannt, respektiert werden. Denn letztendlich sind weibliche Erfahrungen heilige Erfahrungen und das verdient Anerkennung. Mystikerinnen: Auf ein Wort! In diesem Buch entdeckt jede Frau kraftvolle spirituelle Impulse für ihr persönliches Leben.
SHANNON K. EVANS
Über sechs Frauen, die Gott erfahren und eine moderne Spiritualität gefunden haben
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Liebl
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »THEMYSTICSWOULDLIKE A WORD: Six Women Who Met God and Found a Spirituality for Today« bei Convergent. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Convergent, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit konnte eine gendergerechte Schreibweise nicht durchgängig eingehalten werden. Bei der Verwendung entsprechender geschlechtsspezifischer Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung jedoch ausdrücklich alle Geschlechter angesprochen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlag: zero-media.net, München, nach einer Vorlage von Convergent
Umschlagmotiv: Shutterstock/Nubefy
Innenteilillustrationen: Dani @andhersaints
Satz: Uhl + Massopust GmbH
ISBN 978-3-641-32855-9V001
www.koesel.de
Allen Frauen gewidmet, deren Geschichte nie die Aufmerksamkeit erfuhr, die sie verdient hätte.
Inhalt
EINFÜHRUNG
TERESAVONÁVILA
1 Selbstvertrauen macht dich nicht zum Ketzer
2 Sinnlichkeit, Sexualität und das Leben als Person in einem Körper
MARGERYKEMPE
3 Die größten Propheten waren geistesgestört
4 Wie du wieder zur Jungfrau wirst
HILDEGARDVONBINGEN
5 Spiritualität erfordert Umweltgerechtigkeit
6 Die Welt brennt: Warum noch Kunst machen?
JULIANAVONNORWICH
7 Das weiblich Göttliche ist nicht nur erlaubt, es ist notwendig
8 Worin Sünde und Hölle einen Großteil ihrer Macht einbüßen
THÉRÈSEVONLISIEUX
9 Subversive Bedeutungslosigkeit in einer ruhmeshungrigen Welt
10 Wie du die Mutterwunde versorgst
KATHARINAVONSIENA
11 Wie man Aktion und Kontemplation in Einklang bringt
12 Horror, Blut, Tod und die Notwendigkeit, sich mit dem eigenen Schatten auseinanderzusetzen
DANKSAGUNG
BIBLIOGRAFIE
In einer Gemeinschaft, in der jede Stimme zählt, blühen wir alle auf.
Terry Tempest Williams, When Women Were Birds
Einführung
Dieses Buch ist durch puren Zufall entstanden – falls du an so etwas glaubst. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf mich zutrifft. Geschichte war noch nie meine Stärke, und soweit es meinen Glauben angeht, hatte ich mit mittelalterlichen Heiligen nicht viel am Hut. Meine spirituellen Helden waren moderner, greifbarer. Gebt mir die Dorothy Days, die Oscar Romeros, die Thomas Mertons. Gebt mir Schriften, die mich nicht auf der Stelle einschlafen lassen.
Als ich vor gut zehn Jahren Katholikin wurde, lösten die weiblichen Heiligen, die man mir als Vorbilder präsentierte, ein Gefühl der Frustration in mir aus. Diese Frauen wurden mir immer als besonders fügsam und sanft geschildert. Frauen, von denen ich lernen könnte, wie man demütig spricht, nicht jedoch, wie man seine innere Wahrheit in Worte packt. Natürlich gab es da Ausnahmen: Ich wusste, dass Katharina von Siena und Teresa von Ávila der Ruf des Skandalösen anhaftete, aber niemand konnte mir die Gründe dafür nennen. Jeanne d’Arc unterschied sich massiv von ihnen, aber als Pazifistin konnte ich die Rolle nicht akzeptierten, die sie mit ihrer Gewaltbereitschaft historisch gespielt hatte. Mir schien, als sei die Beschäftigung mit dem Leben der Heiligen eher was für andere Leute, aber nicht für mich.
Die schicksalhafte Wende kam, als ich Mirabai Starrs Buch Wild Mercy: Living the Fierce and Tender Wisdom of the Women Mystics in die Hände bekam. Zu dieser Zeit stieg in mir der Wunsch auf, in meiner spirituellen Erfahrung eine Repräsentation des göttlichen Weiblichen zu finden. Daher genügte schon der Klappentext, um meinen ohnehin sehr willigen Online-Bestellfinger zu jucken. Starrs Buch machte mich mit Mystikerinnen aus den unterschiedlichsten religiösen und spirituellen Traditionen bekannt. Damals war ich mir nicht einmal sicher, ob ich überhaupt Christin bleiben wollte, daher kam mir dieser breite Ansatz sehr gelegen. Was mich dann aber überraschte, war die Tatsache, dass es eben jene christlichen Frauen waren, die mich am meisten ansprachen. Und die Frauen, die ich glaubte, am besten zu kennen, waren für mich die größte Überraschung. Nun, da diese Autorin (noch dazu eine Jüdin, die frei war von der obligatorischen Verehrung für christliche Institutionen und Autoritäten) ihre Gedanken in eine moderne Lesart übersetzt hatte, wurden diese historischen Figuren für mich real, faszinierend, vielschichtig und ja, auch glaubwürdig. Erst da merkte ich, dass die traditionelle Darstellung weiblicher Heiliger und Mystikerinnen durch und für den männlichen Blick geprägt war. Und mir wurde klar, dass ich mit meiner snobistischen Annahme, sie hätten mir nichts zu geben, zur ungeminderten kollektiven Herabwürdigung dessen, was diese Frauen waren und was sie uns zu sagen hatten, beitrug.
Der Deal war besiegelt, als ich ein Jahr später las, was ein päpstlicher Nuntius (ein regionaler Repräsentant des Papstes) zu ihren Lebzeiten über Teresa von Ávila gesagt hatte. Der gute, alte Erzbischof Filippo Sega nämlich meinte: »Sie ist eine ruhelose Herumtreiberin, ein ungehorsames und verstocktes Weib, das falsche Lehren und eine ebensolche Frömmigkeit verbreitet, und … anderen gegenüber als Lehrerin auftritt, was im Gegensatz zum Willen des heiligen Paulus steht, der Frauen untersagt hat, den Glauben zu lehren.«
Na also, Schwester. Ich folge dir nach, selbst wenn es die Klippe hinuntergeht!
Und so begann meine spirituelle Liebesaffäre mit diesen Frauen. Zuerst Teresa, dann Juliana von Norwich, dann Hildegard von Bingen, Margery Kempe, Katharina von Siena und schließlich, nach einigem Widerstreben, auch Thérèse von Lisieux. Jedes Mal, wenn ich auf die Schriften von einer weiteren Mystikerin stieß, erklärte ich sie zu meiner neuen Favoritin. Und ich kann mich immer noch nicht für eine einzige entscheiden. Denn diese Frauen sind alles andere als eindimensional, auch wenn sie immer ganz anders dargestellt werden. Sie sind weder unbedeutend noch querulantisch oder zerbrechlich. (Gut, Thérèse von Lisieux war vielleicht ein bisschen irritierend und auch zerbrechlich, aber du wirst sehen, warum sie ihren Platz in diesem Buch verdient hat.) Diese Frauen waren selbstbestimmt, hartnäckig, eigenwillig, schneidig und kompromisslos sie selbst. Fünf der sechs Frauen in diesem Buch trugen die Ordenstracht, und trotz meiner anfänglichen Vorurteile fühlten sie sich berufen, nicht etwa, weil sie sanftmütig gewesen wären, sondern weil sie es gerade nicht waren. Ich begriff, dass Klöster früher Rettungsinseln für Frauen waren, die mit dem Leben als pflichtgetreue Gattin und Mutter nichts anfangen konnten – von der großen Wahrscheinlichkeit, im Kindbett zu sterben, ganz zu schweigen. Im Kloster konnte eine Frau selbstbestimmt über sich und ihren Körper entscheiden. Sie konnte sich ihren theologischen Leidenschaften widmen. Und häufig erhielt sie auch eine gute Erziehung. Es ist kein Zufall, dass einige der stärksten Stimmen in der Geschichte Nonnen gehören, wie es in der katholischen Kirche von heute ja immer noch der Fall ist. Die einzige Laiengläubige in diesem Buch ist Margery Kempe, Mutter von vierzehn Kindern, die mit der Diskrepanz zwischen ihrer Rolle als Frau und Mutter und der spirituellen Berufung zu Gebet und Lehre schwer zu kämpfen hatte.
Das Wort »Mystikerin« hat einen fast übersinnlichen Beiklang. Wir verbinden damit eher Einsiedler, die sich in ihren Klausen mit der Kunst der Levitation beschäftigen, als ganz gewöhnliche Menschen, die ein ganz normales Leben führen. Und schon gar nicht denken wir dabei an uns selbst. Ein Mystiker beziehungsweise eine Mystikerin ist aber letztlich nur ein Mensch, der einen kurzen Blick auf das Ewige erhascht hat und nun mehr darüber wissen möchte. Das Mystische ist nicht nur einigen wenigen Auserwählten vorbehalten. Es ist vielmehr eine Einladung an jeden von uns. Vor nicht einmal einer Lebenszeit sagte der Jesuit und Theologe Karl Rahner: »Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein.« Für viele von uns fühlt sich diese Entscheidung unheimlich persönlich an.
Glücklicherweise fehlt es uns nicht an Persönlichkeiten, die uns führen können. Die sechs Frauen in diesem Buch sind dazu mehr als befähigt: Sie besaßen faszinierende geistige Gaben, waren beseelt von einer glühenden Leidenschaft, und trotzdem wurde ihr Beitrag zum spirituellen Fortschritt der Menschheit in Zeit, Raum und Religion nie gebührend gewürdigt. Und das wiederum bringt uns zurück zu der Frage, warum dieses Buch zufällig entstanden ist.
Sobald ich das Schatzkästlein geöffnet hatte, in dem die Weisheit der Mystikerinnen verborgen lag, erkannte ich, wie relevant ihre Einsichten auch für uns Heutige sind. Manchmal war ich richtig geschockt davon, wie fortschrittlich sie dachten und wie recht ihre Gedanken für unsere Zeit kamen. Können wir Gott als weiblich sehen? Fragen wir doch Juliana von Norwich. Wie wirkt sich eine mentale Störung auf unsere spirituelle Erfahrung aus? Margery Kempe hat dazu einiges zu sagen. Sollten wir die Politik aus der Kirche heraushalten? Katharina von Siena vertritt in dieser Frage einen klaren Standpunkt.
Als ich meiner Theologenfreundin Ellie erzählte, dass ich dieses Buch schreibe, meinte sie, die Mystikerinnen seien Botschafterinnen der Christenheit. All jenen, die abgeschreckt werden von den extremen Erscheinungsformen unserer Religion, bietet die einladende Theologie der Mystikerinnen einen Raum, in dem Suchende ihren Platz finden. Und all den Menschen, die sich an den Rändern unserer Kirche aufhalten und sich zweifelnd fragen, ob sie nicht besser gehen sollten, zeigen diese sechs Frauen, dass es möglich ist zu bleiben.
Was ich am Christentum besonders schätze – und was einer der Hauptgründe ist, warum ich trotz mancher Desillusionierung immer noch dabei bin –, ist seine Bandbreite. Natürlich ist auch die Tiefe wichtig, doch wie ich festgestellt habe, findet sich Tiefe in jeder oder auch in keiner Religion, wenn man nur sucht. Aber es ist die Breite des Christentums, die mir sowohl Herausforderung als auch Bestätigung ist: die Tatsache, dass so unterschiedliche Menschen unter ein und demselben spirituellen Dach Zuflucht finden. James Joyce sagte einmal ganz richtig über die katholische Kirche: »Hier kommt jedermann.« Selbst wenn du kein Katholik beziehungsweise keine Katholikin bist, kann man sagen, dass Joyces Aussage für uns alle steht. Wenn du dich mit dem Christentum identifizierst, ganz egal, wie und in welcher Form, dann würde ich darauf wetten, dass du mehr als einmal auf Menschen gestoßen bist, die dich in den Wahnsinn getrieben haben. Und im Zeitalter der Globalisierung und des Pluralismus ist es einfacher als je zuvor, dann einfach wegzugehen. Dieser Entschluss ist vertretbar, angesichts dessen, was wir über den Missbrauch in der Kirche wissen, und darüber, wie unsere Missionstätigkeit den Kolonialismus gefördert hat. Viele Menschen, die ich liebe, sehen sich selbst nicht länger als Christen, und ich kann ihnen das nicht vorwerfen. Ich verstehe das Trauma, die Trauer und die Desillusionierung, die sie bewogen haben, der Kirche den Rücken zu kehren.
Und trotzdem bin ich immer noch hier. Ich schätze meine religiöse Tradition. Ihre Sprache, ihre Symbole und Riten, ihre Kultur sind die Tore, die mich von Kindesbeinen an in eine Gotteserfahrung eingeführt haben, und ich möchte sie nicht missen. Daher habe ich beschlossen, den Brunnen der Christenheit auszuschöpfen, bis ich auf frisches Quellwasser stoße – wieder und wieder und wieder. Andererseits habe ich festgestellt, dass diese Aufgabe unmöglich ist ohne die Gefährtenschaft gleichgesinnter Freunde, ob nun unter den Lebenden oder unter den Toten.
Die sechs Frauen, die ich dir hier vorstelle, sind einige dieser Freunde. Meine innigste Hoffnung ist, dass sie auch die deinen werden. Da das Interesse an weiblicher Spiritualität überall auf der Welt zunimmt, wäre es nachlässig von uns, die Führerinnen zu ignorieren, die wir bereits kennen, oder ihre Lehren gar zu verwässern. Schließlich müssen wir hier das Rad nicht neu erfinden. Es hat schon seinen Grund, dass die Schriften dieser Frauen die Prüfung der Zeit bestanden haben und uns durch die Jahrhunderte weiter erleuchten. Mögen wir sie als unsere Ahninnen würdigen. Mögen wir die Reife entwickeln, die Zeitlosigkeit ihrer Weisheit zu erkennen, auch wenn wir ihr erst so viele Jahre später begegnen.
Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Worte mitgeben, die die Inhalte dieses Buches betreffen. Es schmerzt mich, dass es weder Schwarze noch Indigene oder People of Color unter diesen sechs Frauen gibt. Die kalte, harte Wahrheit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist: Das Christentum war historisch so eng mit den politischen Kräften Europas verflochten, dass dabei bestimmte Stimmen fast vollkommen ausgelöscht wurden. Unsere spezielle religiöse Tradition hat – zu ihrem großen Schaden – nur die Narrative von Angehörigen der weißen Mittel- oder Oberschicht bewahrt.
Die Entscheidung, welche Frauen ich in mein Buch aufnehmen wollte, habe ich anhand bestimmter Kriterien getroffen. Es sollten allgemein anerkannte christliche Mystikerinnen sein, die mindestens ein schriftliches Werk hinterlassen hatten, das ich studieren und zitieren konnte. Zwar hat die katholische Kirche eine Vielzahl von Heiligen mit unterschiedlichstem ethnischen Hintergrund anerkannt, doch haben die wenigsten von ihnen ausführliche Schriftzeugnisse hinterlassen und auch über ihr inneres Leben ist uns wenig bekannt. Unzählige andere Frauen haben gleichfalls den Ehrentitel der Mystikerin verdient, aber die hier vorgestellten sechs sind sicher so etwas wie die Crème de la Crème.
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass jede dieser Frauen zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort der Menschheitsgeschichte geschrieben hat. Eben diese Geschichte hat uns gelehrt, wie problematisch einige ihrer Ansichten waren. Ich werde in diesem Buch keine dieser Ansichten zitieren, die ich abstoßend finde, aber wenn du dich weiter in das Werk dieser Frauen vertiefst, wirst du Belege finden für Antisemitismus, Xenophobie, Misogynie, toxische Askese und mehr. Natürlich ist es eine Enttäuschung, wenn sich so etwas bei unseren spirituellen Mentorinnen findet. Gleichzeitig aber haben wir dadurch die Möglichkeit zu begreifen, welches Privileg wir haben: Wir leben in einer Zeit, in der das menschliche Bewusstsein sich enorm weiterentwickelt hat, vor allem vielleicht, was unseren Blick auf Gott betrifft. Außerdem werde ich mich in Kapitel 4, in dem es um Margery Kempe geht, auch mit der Tatsache beschäftigen, dass sie mehrfach Opfer von Vergewaltigung in der Ehe wurde. Meiner Ansicht nach ist dies ein wichtiger Punkt ihrer Biografie, der gewöhnlich unter den Tisch fällt. Wenn du mit diesem Thema aus persönlichen Gründen Schwierigkeiten hast, dann bitte ich dich, genauestens auf dich zu achten, wenn du dieses Kapitel liest. Oder du überspringst es einfach, falls dies nötig sein sollte.
Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich keine Historikerin bin. Ich habe für dieses Buch viel recherchiert, aber es geht hier auch nicht um akademische Würden. Mein Ziel ist durch und durch spiritueller Natur: Ich hoffe, dass dieses Buch dein kontemplatives Leben und deine Gebete inspiriert, dass es dir die Erlaubnis gibt, deine Neugier auszuleben und vielleicht sogar deine Ansichten zu ändern. Und dass es deine Beziehung zu Gott weiter beleben möge. Wenn du die Werke der hier vorgestellten Mystikerinnen selbst lesen möchtest, dann sei gewarnt: Sprache und Stil der Übersetzungen fallen hier besonders ins Gewicht. Mit den Büchern von Mirabai Starr aber kannst du nichts falsch machen.
Und nun überlassen wir uns der führenden Hand der weisen spirituellen Mütter, wenn wir uns fragen, welche Rolle Glaube und Befreiung in unserer modernen Welt spielen – in der festen Überzeugung, dass das Eine, das Göttliches Mysterium ist, Raum genug für uns alle bietet, sodass wir unsere Zuflucht unter diesem Dach finden.
TERESA VON ÁVILA
1 Selbstvertrauen macht dich nicht zum Ketzer
In meiner Brust zog sich etwas zusammen, als ich diesen Kommentar las. Es war mir zwar schon öfter passiert, dass ich auf Instagram von Fundamentalisten kritisiert wurde, doch haben sie in den meisten Fällen zumindest versucht, einen Anschein von Höflichkeit zu wahren. Doch hier fuhr eine Frau so richtig ihre Klauen aus. »Hör auf, so zu tun, als seist du Christin«, kanzelte sie mich in ihrer Antwort auf einen meiner Posts ab. »Du täuschst die Leute ganz bewusst. Aber wir alle wissen nur zu gut, dass du eine Wicca bist.«
Spoileralarm: Liebe Leserinnen, liebe Leser, ich bin keine Wicca. Ich glaube sogar, dass ich nicht einmal Leute kenne, die einer Wicca-Tradition angehören. Mein gesamtes Wissen über Wicca stammt aus der Fernsehserie Buffy – Im Bann der Dämonen, wo es eine Wicca namens Willow gibt. Als Teenager habe ich mir das gerne angeschaut, meine Kenntnisse sind also eher lückenhaft, dafür aber mit einer Portion Humor gewürzt.
Und doch bekam ich in diesem Moment Herzrasen und meine Wangen brannten, als hätte mich jemand bei etwas Verbotenem ertappt. Ich fühlte mich an den Pranger gestellt und sehr verletzlich. Nicht etwa, weil man mich mit Fug und Recht als Heidin entlarvt hatte, sondern weil die Diagnose der Dame zwar falsch war, aber nichtsdestotrotz ein Körnchen Wahrheit enthielt: Ich hatte gegen die für christliche Weiblichkeit geltenden Gesetze verstoßen.
Mein Vergehen? Ich hatte eine Bemerkung gepostet, die den wilden, rohen, hungrigen Geistern in der weiblichen Psyche Ausdruck verlieh, jenen Orten in uns, an denen wir die Macht der inneren Mysterien bewundern und manchmal auch fürchten. Mein Post endete mit dem Satz: »Wir werden uns nie mit einem kleinen Gott zufriedengeben, mit einer winzigen inneren Flamme. Wir wissen, dass in unseren Körpern mehr steckt.«
Es war ganz einfach ein Appell, auf die tiefsten Regungen in unserem Inneren zu hören und sie zu würdigen. Aber die Aussicht auf Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, auf den Wunsch nach einem ungezähmten Leben, verstörte diese Frau. Und sie ließ den Schauer ihrer Ängste auf mich niedergehen, eine eher konfliktscheue Person, die mit so etwas nicht wirklich umgehen konnte. Dabei ging es gar nicht um mich. Es ging um ihr Bewusstsein, um ihre eingesperrten Ansichten, die miteinander im Clinch lagen. Hinter den Gittern des Patriarchats können Frauen ganz schön angriffslustig werden, wenn sie frei umherschweifende Artgenossinnen erspähen.
Natürlich ist dies ein ziemlich extremes Beispiel. Die meisten Frauen hinterlassen keine Hassbotschaften unter den Social-Media-Posts anderer Frauen. (Wenn du das machst … bitte lass es.) Die meisten von uns führen diesen Kampf im Inneren. Erkennen wir das Grummeln im Bauch oder lesen wir weiter von dem Skript ab, das man uns in die Hand gedrückt hat?
Viel zu oft fühlen sich bestimmte Themen im Raum unseres Glaubens deplatziert an, während umgekehrt unser Glaube in manchen Bereichen wichtiger sozialer Kritik Anstoß erregt. Wenn ich zum Beispiel sage, dass ich Christin und Feministin bin, dann schreckt das Feministische die Christen ab und das Christliche die Feministen. Wie viele Frauen von heute habe ich den Druck verspürt, mich zwischen der Treue zu meiner Religion und progressivem Denken entscheiden zu müssen. Ein Punkt, an dem ich schon einmal gestanden bin – und zu dem zurückzukehren ich nicht die Absicht habe.
Vor einigen Jahren schrieb ich für ein bekanntes katholisches Frauenwerk, wo ich mich zugehörig und in Freundschaft angenommen fühlte, gefeierte Beiträge. Gemeinschaft war immer schon ein bedeutender Teil meines spirituellen Lebens, und die Frauen, die dort aktiv waren, waren damals meine wichtigste Gemeinde. Sie repräsentierten ein breites Spektrum sozialer, politischer und theologischer Überzeugungen, aber ihre übergreifende Identität war konservativer als die meine. Und doch war ich überzeugt, dass ich bei ihnen meinen Platz gefunden hatte, vor allem, weil meine Artikel ja so gut ankamen. Also zensierte ich meine eher kontroversen Meinungen und Überzeugungen, um dazuzugehören. Schlimmer noch: Ich ließ mich auf mentale Verrenkungen ein und bei bestimmten Dingen, die dort gesagt, getan und gelehrt wurden, belog ich mich selbst. Ich verspürte in mir nicht die Erlaubnis, mir selbst zu vertrauen, meinem Gewissen oder der Art, wie ich den Geist in mir verstand. Also hörte ich auf andere.
Ich erwachte nur sehr langsam. In meinem Privatleben kamen Prüfungen auf mich zu, die mich zwangen, mich ehrlich damit auseinanderzusetzen, wie sehr ich mich von meinem authentischen Selbst entfernt hatte. Dadurch fand ich den Mut, auf meine Instinkte und meine innere Stimme zu hören. Ich packte immer wieder mal ein bisschen Kritik am Patriarchat in meine Artikel und trat für Führungspositionen von Frauen in religiösen Institutionen ein, ja selbst für die Priesterinnenweihe. Ich kritisierte Politiker, die Kirche und Staat vermischten, um sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Und ich sprach offen über meine Vorliebe für Yoga und das Enneagramm. Obwohl ich diese Ansichten nur in meinem persönlichen Blog und auf meinen Social-Media-Accounts äußerte, begann mein Status im Frauenwerk zu bröckeln. Langjährige Leser beschwerten sich über mich, was ich ebenso demütigend wie empörend fand. Ein Priester und ein Bischof arbeiteten mit vereinten Kräften darauf hin, mich mundtot zu machen. Das öffnete mir die Augen dafür, wie fein gesponnen das klerikale Netz ist. Als mir dann die Leitung des Frauenwerks mitteilte, ich müsse meine persönlichen Ansichten künftig ganz für mich behalten, wenn ich weiter Teil des Teams bleiben wolle, trat ich zurück, und zwar auf eine, wie ich dachte, freundschaftliche und anständige Art. Zu meinem Entsetzen aber redete eine große Mehrheit jener Frauen, die ich für meine Freundinnen gehalten hatte, nie wieder mit mir. Das Gefühl, benutzt und dann ausgesondert worden zu sein, tat mehr weher als die Zensur.
Die Trauer ging tief. Ich verlor Freundschaften, die ich für real gehalten hatte. Ich verlor die größte Plattform zur Veröffentlichung meiner Texte. Ich verlor meine spirituelle Gemeinschaft und das Gefühl der Zugehörigkeit. Ich trauerte monatelang darüber – und wenn ich ehrlich bin, trauert ein Teil von mir immer noch. Und doch lernte ich dabei, wie es sich anfühlt, mir selbst treu zu sein. Ich lernte, dass ich mir vertrauen konnte. Und das war es mehr als wert.
Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die eine solche Erfahrung durchgemacht hat. Wenn man überlegt, wie verbreitet diese Art von Druck ist, ist es weiter kein Wunder, dass Angstzustände und Depressionen bei Frauen epidemische Ausmaße annehmen. Um weiter dazugehören zu können, disziplinieren wir uns selbst, sodass wir weiter innerhalb der überkommenen Grenzen dessen verharren, was man uns zu denken, glauben oder praktizieren erlaubt, statt unser Dasein an dem auszurichten, was wir tatsächlich denken, glauben und praktizieren wollen. Um uns Gewissheit zu verschaffen, wo die Grenzen des Erlaubten verlaufen, richten wir uns nach Ehegatten, Angehörigen, Pastoren oder Nachrichtensprecherinnen. Wir haben sehr viel mehr Vertrauen in die Autorität der Stimmen von außen statt in die Führung unserer Seele. Allein bei der Vorstellung, uns selbst zu vertrauen, wird uns schon mulmig: Steht nicht in der Bibel, dass wir das nicht tun sollen?
Es stimmt schon, es gibt Stellen in der Bibel, die uns davor warnen, Vertrauen in uns selbst zu setzen. Als ich noch ein braves Baptistenkind war, das regelmäßig an Bibel-Wettbewerben teilnahm, war einer der ersten Verse, die ich auswendig lernte: »Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit; such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade.« (Spr 3, 5–6) Ich bestreite ja nicht, dass dies ein weiser Rat ist: Auf uns zu vertrauen, wenn wir nicht in der Einheit mit Gott sind, ist der beste Garant für Katastrophen jeglicher Art. Sind wir nicht mit der Quelle unseres Lebens verbunden, dann verhalten wir uns gewöhnlich eher selbstsüchtig und destruktiv.
Das heißt aber nicht, dass wir unseren inneren Kompass über Bord werfen können. Wenn wir wirklich in Einheit mit dem Geist leben wollen, dann führt der Weg von der spirituellen Kindheit zur Reife über das Vertrauen, dass wir selbst die Pforte sind, durch die das göttliche Leben in uns eintritt. Jesus selbst sagte, dass das Himmelreich nicht rechts oder links von uns, sondern mitten unter uns ist. (Lk 17, 21) Wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eine beängstigende Aussicht. Es kann sich sicherer anfühlen, das Himmelreich außerhalb von uns selbst zu suchen, bei Autoritäten, in unserer religiösen Kultur oder im Sicherheitsnetz der Orthodoxie. Man fühlt sich nun mal sicher, wenn man glauben kann, dass jemand anderer mehr weiß als man selbst, dass diese Person oder Personen transzendente Antworten gefunden haben, die uns nicht offenstehen. Jesu Worte mögen zwar gut und schön sein, aber im Ernstfall sind wir doch überzeugt, er will, dass wir unser spirituelles Leben einigen wenigen Auserwählten anvertrauen.
Was aber wäre, wenn Jesus, als er das sagte, tatsächlich auch meinte – und lass das einen Moment nachwirken –, dass das Himmelreich in dir liegt? Ich weiß. Klingt verrückt. Was, wenn du tatsächlich eine leise, kleine Stimme hast, die dich führt? Wenn du alles, was du fürs Leben und die Frömmigkeit brauchst, schon besitzt? Wenn es nicht darum geht, dass du lernst, was du glauben sollst, sondern gezeigt bekommst, wie du besser auf das hören kannst, was du längst glaubst?
Wenn du gezeigt bekämst, wie du auf dich selbst vertrauen kannst, wie würde das deine Gotteserfahrung verändern? Wie würde dein gesamtes Dasein sich wandeln? Und wenn das möglich wäre, wer sollte es dich lehren?
Teresa von Ávila kam 1515 als Teresa de Cepeda y Ahumada in Spanien zur Welt. Ihre Familie war jüdisch, aber der grassierende Antisemitismus und die Macht des christlichen Reiches zwangen Teresas Großvater väterlicherseits, zum Katholizismus überzutreten, um seinen Kindern eine bessere Zukunft zu sichern. Doch die Familie wurde von der spanischen Inquisition angeklagt, weil sie insgeheim weiter jüdischen Riten folgte. (In ihrem Buch Wild Mercy weist Mirabai Starr darauf hin, dass im Judentum die Matriarchin der Familie das geheiligte wöchentliche Sabbatabendessen ausrichtet. Vermutlich war also Teresas Großmutter der »schuldige« Teil der Familie.) Zur Strafe wurde die Familie sieben Freitage hintereinander in schrillen Gewändern durch die Straßen der Stadt geführt und gezwungen, vor jeder Kirche niederzuknien, während die Bevölkerung sie anbrüllte, bespuckte und mit Steinen bewarf. Hätte sie sich nicht schuldig bekannt, wäre sie noch schlimmer, vielleicht sogar mit dem Tod bestraft worden.
Teresas Vater war damals noch ein Junge. Er schwor sich, dass weder er noch seine Familie je wieder eine solche Schmach erdulden sollten, und so befolgte er sklavisch die katholischen Sitten und Gebräuche. Sein Wunsch ging in Erfüllung, aber nicht uneingeschränkt. In der zweiten Hälfte ihres Lebens wurde Teresa von der Inquisition wieder und wieder verhört, weil man ihrer ekstatischen Intimität mit Gott und ihrem Reformeifer misstraute – aber ich will nicht vorgreifen.
Teresa von Ávila war von Beginn an das, was man wohl ein schwieriges Kind nennen würde. Voller Fantasie und Charme, leidenschaftlich und charismatisch, eine geborene Führungsgestalt. Als Kind überzeugte sie ihren älteren Bruder, mit ihr von zu Hause wegzulaufen, um die Mauren zu missionieren und geköpft zu werden, damit sie als Märtyrer in den Himmel kamen. Sie schafften es bis zu den Stadttoren, bevor man sie aufgriff und wieder nach Hause brachte. In ihrer Autobiografie bekennt Teresa, dass es nicht die Liebe zu Gott oder den Mauren gewesen war, die sie dazu angetrieben hatte. Sie wollte vielmehr das Fegefeuer vermeiden und post mortem auf direktem Weg in den Himmel kommen, um die dortigen Freuden zu genießen. Als dieser Plan fehlschlug, beschlossen die Kinder, stattdessen Einsiedler zu werden. Sie bauten sich im elterlichen Garten Klausen aus kleinen Steinen und reagierten frustriert, als eine nach der anderen einstürzte. Was immer man über Teresa sagen mag, eines muss man ihr lassen: Sie war ein Kind voller Visionen.
Ihre Jugend- und Teeniejahre allerdings verliefen so seicht, dass es ihr später peinlich sein sollte. Stark beeinflusst von einer Freundin und geblendet von den Ritterromanen ihrer Mutter, bestand Teresas Leben in erster Linie aus Klatsch, Eitelkeit und Oberflächlichkeit. In diesen entscheidenden Jahren verlor sie auch ihre Mutter, die im Kindbett starb. Mit etwa sechzehn Jahren wurde Teresa bei einer Liebelei erwischt. Genaueres wissen wir nicht. Vorstellbar ist alles Mögliche, von einem nicht überwachten Gespräch bis hin zu Sex vor der Ehe. Die Konsequenzen folgten auf dem Fuß: Ihr gewissenhafter verwitweter Vater schickte Teresa als Schutz und Strafe zugleich für eine kurze Zeit ins Kloster. Doch zur großen Überraschung aller – auch der Teresas – blühte sie dort auf. Sie nahm sich für eine endgültige Entscheidung noch Zeit, aber im Alter von neunzehn Jahren trat sie in ein Karmelitinnenkloster ein. Zwei Jahre später legte sie die ewige Profess, das Ordensgelübde, ab und nannte sich Teresa von Jesus.
Zeit ihres Lebens als Nonne hat Teresa stets viel geschrieben: Sie war eine Frau, die etwas zu sagen hatte und auch das Selbstvertrauen besaß, das zu tun. Jedes ihrer vier Hauptwerke gilt als unschätzbar wertvoller Beitrag zur Fortentwicklung der mystischen Tradition, aber vor allem Die innere Burg – das Werk, das sie gegen Ende ihres Lebens verfasste – wird als spirituelles Meisterwerk angesehen. Darin beschreibt sie die Seele als Burg mit sieben »Wohnungen«, die immer weiter nach innen führen. Die erste Wohnung ist der aufrichtige erste Schritt auf Gott zu. In der siebten Wohnung hingegen erlebt die Seele die vollkommene Verschmelzung mit dem Göttlichen. Die fünf Wohnungen dazwischen stehen für die Stadien, die das erwachende Bewusstsein auf seinem Weg zu zunehmender spiritueller Reife durchläuft. Während wir uns auf die spirituelle Reife zubewegen, so erklärt sie, durchmessen wir notwendigerweise jede Wohnung der inneren Burg. Wir steigen tiefer und tiefer hinein in uns selbst – und verbinden uns tiefer und tiefer mit Gott.
Die Radikalität dieser Vorstellung kann gar nicht hoch genug geschätzt werden, vor allem für eine spanische Katholikin zur Zeit der Inquisition. Die Spiritualität der meisten ihrer Zeitgenossen, die unter der Fuchtel religiöser und politischer Führer standen, die auf Machterhalt bedacht waren, bestand letztlich aus Gehorsam gegenüber der Autorität und Angst vor dem Jenseits. Den kirchlichen Autoritäten konnte die Radikalität von Teresas Ideen nicht entgehen – und so versuchten sie, sie mundtot zu machen. Teresa lag nichts ferner als Rebellion um der Rebellion willen. Doch sie ließ sich den Mund nicht verbieten, wo es um die von ihr erkannte Wahrheit ging. Vor Männern, die mit der Macht des Patriarchats im Rücken hofften, sie so weit bringen zu können, dass sie klein beigab, kam sie niemals ins Wanken. Sie schrieb, sie hätte so einiges mit gelehrten Männern erlebt. Und: »Jedoch habe ich auch mit ängstlichen Halbgelehrten meine Erfahrungen gemacht, die mir sehr teuer zu stehen kamen.«
Unser Mädchen redet jetzt schon Klartext.
Teresa lehrte, dass die Einheit mit Gott nicht dadurch vollzogen wird, dass man eine Leiter baut, die bis in den Himmel reicht. Es geht vielmehr darum, in die tiefsten Quellen unseres Selbst einzutauchen. Es ist kein Aufstieg, würde sie sagen, sondern ein Hinuntersteigen. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Viele von uns haben jahrelang von ihren Religionslehrern gehört, wir müssten über uns hinausgehen, um mit Gott vereint zu werden. Das kann heißen, dass wir unsere Persönlichkeit ändern müssen, nicht selbst denken dürfen, unsere Sexualität unterdrücken, uns ständig mit dem Thema »Sünde« beschäftigen müssen und so weiter. Jeder von uns hat eine einzigartige Geschichte, aber zuletzt läuft es immer auf dasselbe hinaus: darauf, dass du dich selbst überwinden musst, um zu Gott zu gelangen, der irgendwo da draußen ist, wie es so zweideutig heißt. Teresa hält das schlicht für Bullshit.
Teresa sagt uns, dass wir keineswegs über uns selbst hinauswachsen müssen, um Gott zu begegnen. Wir sollten vielmehr voller Neugier und Verletzlichkeit in uns eintauchen und dabei weiter gehen, als es für uns bequem ist. »Kann es etwas Schlimmeres geben, als dass wir uns im eigenen Haus nicht zurechtfinden?«, fragt sie. »Wie können wir hoffen, in anderen Häusern Ruhe zu finden, wenn wir sie im eigenen nicht zu finden vermögen?«





























