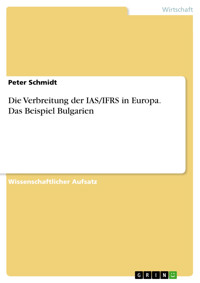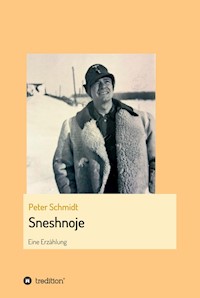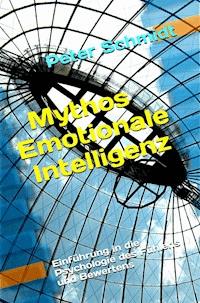
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Emotionale Intelligenz ist seit Daniel Goleman zum geflügelten Begriff geworden. Definierte Goleman noch, dabei handele es sich um "die Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle und die anderer zu erkennen, uns selbst zu motivieren und gut mit Emotionen in uns selbst und in unseren Beziehungen umzugehen", so wurde schon bald klar, dass eine so vage Definition weniger nützt als in die Irre führt. Denn was heißt es eigentlich, "gut" mit Emotionen umzugehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Schmidt
Mythos Emotionale Intelligenz
Einführung in die Psychologie des Fühlens und Bewertens
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ZUM BUCH
ÜBER DEN AUTOR
Teil A
Einleitung
1 Emotionale Desorientiertheit
2 Was uns zu emotionalen Irrläufern werden lässt
3 Wie sich emotionales Irrläufertum zeigt
4 Eine kritische Bestandsaufnahme unserer mentalen Verfassung
5 Typische emotionale Irrläufer
6 Was Werterfahrungen zu Werterfahrungen macht
7 Was Unwerterfahrungen zu Unwerterfahrungen macht
8 Gefühl als Kategorie sui generis
9 Unsere emotionale Grundverfassung
10 Wertgerichtetheit als mentales Hauptprinzip
11 Hedonismus oder objektivistische Wertbegründung?
12 Relativität der Werte
13 Wie Gefühle erlernt und wie sie wieder verlernt werden
14 Emotionale Desorientiertheit und der Sinn des Lebens
Teil B
15 Werturteile als Beweggrund politischer Entscheidungen
16 Das Versagen der Philosophie
17 Probleme der Psychologie mit dem Gefühlsbegriff
18 Die Schieflage der Neurobiologie
19 Moralbegründung und emotionale Desorientiertheit
20 Plädoyer für ein neues Verständnis der Werte
21 Was sollen wir tun? Worauf können wir hoffen?
Zitierte Literatur
Personenregister
Impressum
ZUM BUCH
Emotionale Intelligenz ist seit Daniel Goleman zum geflügelten Begriff geworden. Definierte Goleman noch, dabei handele es sich um „die Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle und die anderer zu erkennen, uns selbst zu motivieren und gut mit Emotionen in uns selbst und in unseren Beziehungen umzugehen“, so wurde schon bald klar, dass eine so vage Definition weniger nützt als in die Irre führt. Denn was heißt es eigentlich, „gut“ mit Emotionen umzugehen?
Dem schönen Schein Emotionaler Intelligenz könnte man angesichts unserer gesellschaftlichen Verhältnisse durchaus die harten Fakten realer emotionaler Desorientiertheit entgegensetzen.
Denn neue Analysen zeigen, dass das autoritäre Verhalten des wertobjektivistischen Despoten, die Vorurteile des Selbstmörders, die Resignation des Verzweifelten, die emotionale Desorientiertheit des Nihilisten ohne falsch verstandene Gefühle kaum denkbar wären.
Aber welche Rolle genau spielen Gefühle in unseren privaten und sozialen Konflikten? Was bewirken emotionale Entscheidungen? Welcher Stellenwert kommt ihnen beispielsweise bei Gewalt und Krieg, Diktatur und Fundamentalismus zu? Man könnte glauben, diese Fragen seien mit dem Siegeszug von Golemans Weltbestseller „Emotionale Intelligenz“ (1995) und dem fast unüberschaubaren Titelangebot seiner Nachfolger längst beantwortet.
Tatsächlich jedoch ist die Situation hinsichtlich des Gefühls- und Emotionsbegriffs völlig kontrovers. Zahlreiche Ansätze versuchen Charakter und Gesetzmäßigkeiten des Fühlens zu bestimmen, ohne dabei Übereinkunft zu erzielen. Der amerikanische Philosoph Robert C. Solomon stellte angesichts der Verschiedenartigkeit der Deutungen ernüchtert fest: „Was ist ein Gefühl? Man sollte vermuten, dass die Wissenschaft darauf längst eine Antwort gefunden hat, aber dem ist nicht so, wie die umfangreiche psychologische Fachliteratur zum Thema zeigt.“
Neurobiologie, Psychologie und Philosophie haben gleichermaßen darin versagt, uns zu erklären, was genau Gefühle sind und in welchem Verhältnis sie zu unseren Werterfahrungen und Sinnvorstellungen stehen. Deshalb leben viele Menschen in einem Zustand permanenter Desorientiertheit. Ihre Motive und Wertvorstellungen sind über weite Strecken Selbsttäuschungen. „Mythos Emotionale Intelligenz“ vollzieht die längst fällige kopernikanische Wende unseres Selbstverständnisses – und liefert die fehlenden Ergänzungen und Korrekturen zum populären Begriff der Emotionalen Intelligenz
gesellschaftlich
ÜBER DEN AUTOR
Peter Schmidt, geboren im westfälischen Gescher, Schriftsteller und Philosoph, studierte Literaturwissenschaft und sprachanalytische und phänomenologische Philosophie mit Schwerpunkt psychologische Grundlagentheorie an der Ruhr-Universität Bochum.
Teil A
Leer ist jenes Philosophen Rede,
durch die keine Leidenschaft
des Menschen geheilt wird
EPIKUR
Einleitung
Warum wir unsere Gefühle nicht verstehen
Es ist schwer zu glauben: aber die meisten Menschen verstehen ihre Gefühle nicht. Man könnte meinen, von Gefühlen müsste man auch nicht mehr verstehen, als wir ohnehin schon wissen. Das wäre richtig, wenn wir immer befriedigend mit unseren Gefühlen umgingen. Leider beweisen unsere großen und kleinen Lebenskatastrophen eher das Gegenteil. Wir haben zwar Gefühle, und glücklicherweise handeln wir auch oft aus dem Bauch heraus vernünftig. Aber dieses Handeln ist überwiegend intuitiv. Wir wissen nicht so recht, was wir eigentlich tun.
Darin gleicht unser Leben einem Autofahrer, der weder Bremspedal noch Kupplung und die Bedeutung der Verkehrszeichen kennt, aber während der Fahrt so lange herumexperimentiert, dass er einigermaßen ungeschoren durchkommt.
In den Wissenschaften ist unsere Ratlosigkeit, was genau es mit unseren Gefühlen auf sich hat, ein offenes Geheimnis. Niemand hat bisher ein Konzept gefunden, mit dem es zu einem ähnlich hohen Maß an Übereinstimmung gekommen wäre wie beispielsweise in der Physik oder bei der medikamentösen Behandlung von Depressionen. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass selbst Therapeuten und Ärzte von diesem Defizit betroffen sind. Wobei man sarkastisch anfügen könnte – ein Mangel, der vielen noch gar nicht aufgefallen ist. Denn auch Therapeuten wüssten auf Nachfrage kaum zu erklären, was genau unter den Gefühlen, Emotionen, Stimmungen und Affekten zu verstehen ist, die sie ja schließlich behandeln wollen. Mit ein wenig humanistischer Bildung wird man sich damit herausreden, das sei seit den antiken Philosophen Aristippos und Epikur, Platon und Aristoteles immer noch eine offene Frage. Und vielleicht hinzufügen, dass wir doch eigentlich ganz gut ohne solche Definitionen durchs Leben kämen. Im Folgenden werde ich zeigen, dass dies ein verhängnisvoller und folgenreicher Irrtum ist.
Wenn es überhaupt so etwas wie eine gesellschaftlich Übereinkunft für den Umgang mit Gefühlen gibt, dann lautet sie:
Man soll sich nicht von seinen Gefühlen „übermannen lassen“. Man soll seine Gefühle „unter Kontrolle halten“ und nicht „gefühlsselig“ sein, „nicht emotional werden“. Wir sollen rational denken, nüchtern bleiben und die „Ruhe behalten“.
Gefühle sind nach weitverbreiteter Meinung mehr oder weniger obskur und hinderlich, ja oft sogar schädlich oder gefährlich. Selbst positive Gefühle wie Vergnügen und Unterhaltung oder Gefühle, die mit Sex, Erotik, Macht, Ruhm oder Gier einhergehen, sollten nicht die Überhand gewinnen, sagt man uns. Lust, zumal außereheliche oder womöglich sogar homosexuelle Lust, gilt nicht allein der katholischen Kirche als suspekt. Wir sind zwar etwas weniger lustfeindlich als früher, glauben aber immer noch, die Arbeit um der Arbeit willen schätzen zu sollen, die Moral um der Moral willen, das Leben um des Lebens willen. Gefühle spielen dabei höchstens eine marginale Rolle.
Allenfalls wird noch konstatiert, dass manche Gefühle (wie z.B. Trauer), oder einschneidende Lebenserfahrungen (z. B. schwere Krankheiten) uns durch Leiden „stärker machen“ und „weiterbringen“. Und die Mühsal des Lernens und der Arbeit findet vielleicht ihren Lohn materieller Sicherheit, Wohlstand und Vorsorge für das Alter. Im Übrigen sei das Leben ohne negative Gefühle doch „langweilig“.
Fragt man jemanden, der so argumentiert, wie er seinen Standpunkt begründen könnte, dann herrscht meist beredtes Schweigen. Sind diese Forderungen und Ansichten denn nicht evident? Muss man darüber diskutieren? „Nicht emotional“ zu werden oder „seine Habgier zu zügeln“ erscheinen den meisten als plausible, sozusagen sich selbst erklärende Werte.
Aber was ist eigentlich evident daran, seine Habgier zügeln zu sollen? Warum sollte ich nicht so viel haben wollen, wie ich mir wünsche? Warum sollte ich nicht emotional werden? Was genau spricht denn gegen „zu viel“ Lust an der Macht?
Bei der Antwort auf solche Fragen offenbart sich unser blinder Fleck in Sachen Gefühl. Wenn Sie mir die (zunächst noch anmaßend erscheinende) Behauptung gestatten: Mir ist noch kein Mensch begegnet, von dem ich – am gegenwärtigen Erkenntnisstand gemessen – guten Gewissens behaupten könnte, er habe ohne fremde Hilfe verstanden, worauf es bei seinen Gefühlen ankommt.
Fall sich diese These belegen lässt, ist das zweifellos ein alarmierendes und erschreckendes Ergebnis. Denn die Folgen unserer Unwissenheit sind dramatisch: Ein unerwartet großer Teil unser Fehler lässt sich anscheinend auf mangelndes Wissen über Gefühle zurückführen. Selbstverständlich nicht alle Fehler im Leben, aber doch ein viel größerer Teil, als gemeinhin angenommen wird. Je genauer man das Problem erfasst, desto mehr drängt sich sogar der Eindruck auf, dass wir in Gefühlsfragen geradezu „emotionale Irrläufer“ sind – wir sind „emotional desorientiert“.
Der Appell an unsere vielbeschworene Emotionale Intelligenz erweist sich so als Mythos
Denn er zielt auf etwas ab, das wir nicht einmal mehr schlecht als recht verstanden haben. Charakter und Ziel Emotionaler Intelligenz liegen im Dunkeln. Emotionale Intelligenz bleibt ein Mythos, so lange es sich um Bauchentscheidungen mit oft gefährlichem Ausgang handelt.
Sie bemerken: Ich versuche zu provozieren, um die Dringlichkeit des Themas zu verdeutlichen! Inzwischen bestätigt sich immer klarer, dass unsere Blindheit hinsichtlich des Phänomens Gefühl nicht nur für viele Tragödien im Privatleben verantwortlich ist, sondern ein noch viel tragischeres Unwesen in Politik, Wirtschaft und Kultur treibt – genaugenommen in allen gesellschaftlichen Bereichen des Lebens.
1 Emotionale Desorientiertheit
Fast die ganze Welt, so könnte man glauben, ist sich selbst entfremdet. Denn viele Menschen leben in einem Zustand permanenter Desorientiertheit hinsichtlich ihrer allgemeinen Lebensziele und ihres Lebenssinns. Unsere Motive und Wertvorstellungen sind über weite Strecken Selbsttäuschungen.
Wir wissen zwar im Einzelnen recht genau, was wir jeweils wollen. Aber wir wissen nicht oder nur äußerst selten, warum wir wollen, was wir wollen. Folglich mangelt es uns an Klarheit darüber, warum wir eigentlich wollen sollten, was wir nicht so genau wissen. Und warum man nur das aus guten Gründen wollen kann, was wir wollen sollten.
Ein wichtiger Grund für diese Selbstentfremdung, die man durchaus als „emotionale Desorientiertheit“ bezeichnen könnte, liegt in unseren mangelnden Begriffen und in unserer geistigen Trägheit und Bequemlichkeit, auf grundsätzliche Lebensfragen intelligente Antworten zu finden. Was die Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens anbelangt, sind wir Dilettanten geblieben. Darin erreicht unsere Intelligenz auch nicht annähernd ein ähnlich hohes Niveau wie bei der Lösung der Aufgaben, ein Garagentor einzubauen, zum Mond zu fliegen oder die Leistung unserer Computerchips zu steigern. Hier steht die Aufklärung bestenfalls am Anfang.
Auch Philosophie und Psychologie, die Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften haben darin versagt, uns zu erklären, was das Ziel des menschlichen Handelns ist – vielleicht, weil sie zu voreilig davon ausgingen, dass es sich um eine Vielzahl höchst unterschiedlicher, individueller Ziele handelt? Offenbar lag es ihnen fern, auch nur die Möglichkeit zu erwägen, in all unseren Wertvorstellungen, Motivationen und Entscheidungen lasse sich ein identisches Prinzip finden.
Hinsichtlich der zentralen Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens ist die Geschichte der Philosophie eine Folge blamabelster Fehlschläge, die jeden Philosophiestudenten an der Kompetenz all jener hoch geschätzten Theoretiker der Vergangenheit und Gegenwart zweifeln lassen sollte. Wir finden überall einen Mangel an Grundlagendenken. Bezeichnend für dieses Versäumnis ist die resignative Haltung des Philosophen Ludwig Wittgenstein, wonach Philosophie unsere Lebensprobleme im Kern gar nicht berühre.
Sieht man von – allerdings oft rudimentären und völlig ungenügenden – Ansätzen in der Antike, in der englischen Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, der deutschen Wertphilosophie, etwa bei Windelband, Rickert, N. Hartmann und Scheler oder der Existenzphilosophie nach dem Ersten Weltkrieg ab, gelang es bisher nie, überzeugend zu bestimmen, worin Wert und Ziel des Lebens bestehen.
Auch die sogenannte Psychologie der „Emotionalen Intelligenz“ geht bei allen Verdiensten als Vorreiter eines neuen Nachdenkens über Gefühl und Intelligenz hinsichtlich der Frage nach dem Wert eher halbherzig zu Werke. Ihr publizistischer Initiator, der amerikanische Psychologe Daniel Goleman, hatte 1995 in Emotionale Intelligenz eine Reihe psychologischer Vorarbeiten und Untersuchungen zusammengefasst, die zeigen sollten, dass unser gewöhnlicher Intelligenzbegriff nicht zureichend ist, um erfolgreiches Handeln zu charakterisieren. Vielmehr bedarf es zu dessen Erklärung eines weiteren Faktors, den man „emotionale Intelligenz“ nannte, der aber vielleicht treffender „emotionale Klugheit“ genannt werden sollte. (Während der Intelligenzbegriff eher starre Fähigkeiten charakterisiert, beinhaltet „emotionale Klugheit“ auch ein gewisses Maß an Erfahrung und wohlüberlegter Intention, sich weiser zu verhalten, als es spontane Intelligenz nahelegen würde.)
Golemans Arbeit fand sowohl Zustimmung wie Kritik. Emotionale Intelligenz wurde zu einem populären Begriff. Eine Fülle von Untersuchungen und Ratgebern bemächtigte sich des neuen Themas. Doch einigen kritischen Köpfen war nicht entgangen, dass seine Theorie auf ziemlich tönernen Füßen steht. So fehlt ihr fast vollständig der geistesgeschichtliche Bezug. Bis auf wenige Ausnahmen vermitteln Golemans Ausführungen den Eindruck, es habe Denker wie Aristippos, Epikur, Hobbes, Hume, Bentham, Kant, Nietzsche, Brentano, Wundt und Scheler nie gegeben – oder was sie zum Thema beizusteuern hätten, sei zumindest recht belanglos gewesen. Aber vor allem mangelte es seinen Ausführungen an grundsätzlichen Bestimmungen.
Was ist eigentlich ein „Gefühl“? Merkwürdigerweise wird diese Frage bei Goleman nirgends hinreichend thematisiert. Unterscheiden sich Gefühle von Emotionen? Welche Funktion haben Gefühle und Emotionen? In welchem Verhältnis stehen sie zu den Stimmungen, Affekten, Neigungen und Leidenschaften? Welche Beziehungen haben Gefühle zu unseren Werterfahrungen und Werturteilen?
Golemans Definition der emotionalen Intelligenz lautet: Es ist „die Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle und die anderer zu erkennen, uns selbst zu motivieren und gut mit Emotionen in uns selbst und in unseren Beziehungen umzugehen.“ (Daniel Goleman: EQ2.Der Erfolgsquotient, München 1999, S. 387.)
Dem kann man schwerlich widersprechen. Etwas gut zu tun, war schon immer unser unwidersprochenes Ideal. Selbst der Teufel wird sein Werk in guter Weise tun wollen, also erfolgreich in seinem Sinne; auch wenn das Ergebnis dann weniger wünschenswert für uns ausfällt.
Goleman versäumte es jedoch wie seine amerikanischen Kollegen, den zentralen Faktor seiner Definition zu erläutern, geschweige, ihn hinreichend zu analysieren. Was heißt es eigentlich, „gut“ mit Emotionen umzugehen? Emotionale Intelligenz bleibt so lediglich ein Mythos.
Erst durch eine genauere Analyse des Gefühlsbegriffs war es möglich, zu bestimmen, was als das alleinige Ziel unseres Handelns anzusehen ist.
Die Bestimmung des Begriffs „Gefühl“ ist nun allerdings ein sehr altes, fast schon ehrwürdiges Problem. Es gilt vielen Theoretikern offensichtlich als unlösbar wegen des schillernden und schwer greifbaren Charakters der Gefühle. Man kann die Gefühle anderer Menschen nicht direkt mit den eigenen vergleichen, sondern nur mittels Beschreibung und Analogieschluss. Wir verfügen nur über eine intuitive Bestimmung des Begriffs. Wir wissen zum Beispiel, dass Sorgen und Schmerzen zu den „negativen“ Gefühlen gehören, Glück und Wohlbehagen dagegen zu den „positiven“.
Der Begriff des Gefühls wurde in der Antike vornehmlich unter den Begriffen „Lust“ und „Unlust“ oder auch, je nach Übersetzung, „Freude“ abgehandelt. Später sprach man von „Leidenschaften“, aber erst seit dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert wird die Bedeutung des Begriffs umfassender thematisiert. (Adolf Hitler: Mein Kampf, Band zwei, 14. Kapitel, „Ostorientierung oder Ostpolitik“). Dabei betraf die Kontroverse vor allem die Rolle von Lust und Unlust, wie zum Beispiel in Thomas Hobbes sehr einflussreichem „Leviathan“.
Dieser Streit scheint nun im Wesentlichen durch neuere Analysen und Definitionen geklärt, auf die später ausführlich eingegangen wird. Möglich war dies erst, nachdem auf befriedigende Weise der Zusammenhang der Begriffe Gefühl und Wert entwickelt wurde. Klarere Begriffe öffnen uns oft die Augen für Sachverhalte, die sonst durch die zu weiten Maschen unserer von der gerade geltenden Sprachkonvention geprägten Wahrnehmung fallen.
Das Ergebnis dieses neuen Blicks auf das Leben stimmt allerdings alles andere als optimistisch:
Wir sind Opfer unserer allgegenwärtigen emotionalen Desorientiertheit
Es erscheint nicht übertrieben, uns eher als „emotionale Irrläufer“ denn als zielstrebig auf Lebenssinn und Werte orientierte intelligente Lebewesen zu verstehen.
Bei einigen Menschen handelt es sich dank angeborener emotionaler Intelligenz oder erworbener emotionaler Klugheit eher um milde Formen von Irrläufertum, insofern sie nicht oder nur sehr vage wissen, wozu sie leben. Allerdings führt auch diese Desorientiertheit in Krisensituationen leicht zu Fehlern und Irrwegen.
In anderen, schwereren Fällen finden wir alle nur denkbaren negativen Folgen wie Nihilismus, Despotismus, Zynismus, Egozentrik, Zerstörung und Gewalt, die sich nicht selten in Selbstmord, Amokläufen, Kriegen und Terrorismus, fundamentalistischen Werteinstellungen und Gewaltherrschaft äußern. Oder solche emotionale Desorientiertheit führt zu Depressionen und wahnhaften psychotischen Reaktionen als Fehleinschätzungen der Realität.
Vom Nachweis dieses Sachverhalts, seiner genaueren Bestimmung und von möglichen Auswegen aus unserem emotionalen Desaster handelt diese kritische Untersuchung
Krieg und Terrorismus, Verbrechen, Unterdrückung, Ausbeutung und Fundamentalismus, aber auch Depression und Sinnleere, erscheinen nach dieser Bewertung als in gewissem Sinne folgerichtige Verhaltensweisen, die zu einem erheblichen Teil aus unserer allgegenwärtigen Desorientiertheit resultieren. Es mag daher Anlass zu der Hoffnung geben, dass Aufklärung hinsichtlich der wahren Rolle unserer Gefühle hier gegenzusteuern vermag – dass schon ein Fünkchen mehr emotionale Klugheit, wie sie aus einem besseren Grundverständnis unseres Fühlens – nennen wir es die „Grammatik der Gefühle“ – entstehen könnte, zu weniger Leiden führt. Solche Analysen erfordern allerdings eine fast schon kopernikanische Wende unseres Selbstverständnisses.
Wenn wir uns als Erdenbewohner nicht mehr heliozentrisch verstehen, wenn wir uns als durch Evolution aus dem Tierreich entstanden erkennen, wenn wir uns als das Ergebnis von unbewussten Prozessen begreifen, wie es die Psychoanalyse und Untersuchungen des amerikanischen Neurophysiologen B. Libet nahelegen – dann sind dies Veränderungen unseres Selbstbildes, denen zunächst verständlicherweise beträchtlicher Widerstand entgegengesetzt wurde, weil man sich so nicht sehen wollte; weil es unangenehm war, diesen Wahrheiten ins Auge zu blicken.
Die längst fällige kopernikanische Wende in unserem Selbstverständnis der Motivationen ist womöglich ein Schritt, der unser Selbstbild noch radikaler entzaubert. Denn hier geht es darum, viele Tausend Jahre alte, selbstverständlich gewordene Wertvorstellungen als Illusionen zu entlarven. Unsere Kultur lebt von solchen Selbsttäuschungen, wie sich noch zeigen wird. Sie sind ein allgegenwärtiges Agens der Geschichte – aber sie sind auch ein klares Zeichen der Selbstentfremdung.
Selbstentfremdung wird hier als ein mentaler Zustand definiert, in dem wir gar nicht oder nur eingeschränkt unsere persönlichen Ziele und Motive verwirklichen können
Selbstentfremdet zu sein, bedeutet, mehr als nötig zu leiden. Und zwar aus Gründen zu leiden, die weniger in widrigen Umständen und im gewöhnlichen Lebenskampf liegen als in unserem mangelnden Verständnis allgemeiner Lebensprinzipien. Selbstentfremdung bedeutet, in Krisensituationen (wie zum Beispiel bei einem Suizid) nicht angemessen reagieren zu können, weil uns die Grundorientierung fehlt.
Selbstentfremdung zeigt sich aber auch in unseren versäumten Lebensmöglichkeiten, in der Lebensqualität, die uns entgeht, weil wir nicht wissen, wozu wir eigentlich da sind und welchen für alle Menschen identischen Sinn das Leben über den individuellen Sinn hinaus hat, den jeder für sich selbst entdecken kann.
Der Begriff der Selbstentfremdung wird hier also umfassender verwendet als im üblichen Sprachgebrauch:
1) Selbstentfremdung ist nicht wie bei Marx beschränkt auf die fehlende Kontrolle des Arbeitenden über die Arbeit, weil er keine Produktionsmittel besitzt.
2) Oder im weiteren Sinne als selbstentfremdeter Zustand des Menschen durch die ihm von den Herrschenden aufoktroyierte Massenkultur, insofern sie der Emanzipation und Aufklärung im Wege steht, wie bei Horkheimer und Adorno. Oder auch, ähnlich, als Nicht-bei-sich-selbst-Sein, sondern stattdessen der Alltagsroutine und Oberflächlichkeit in der Masse verfallen wie bei Heidegger.
3) Selbstentfremdung wird hier auch nicht begrenzt auf den seelischen Zustand, bei dem bewusste und unbewusste Bereiche nicht auf dasselbe Lebensziel hinarbeiten, weil sie sich widersprechen oder ihnen der Einklang fehlt, wie bei Freud.
Sondernalle diese Faktoren – aber auch völlig andere – können je nachdem mehr oder weniger ursächlich sein für jenen allgemeineren – ja allgemeinsten – Begriff der Selbstentfremdung, die darin besteht, dass wir das, was wir insgeheim wollen, nicht erreichen, weil wir gar nicht wissen, was wir wollen sollen.
Wenn wir selbstentfremdet sind, wird Konventionen und Bräuchen mehr Gewicht beigelegt als nötig. Dann sind wir nicht selbstbestimmt, sondern zu unserem eigenen Nachteil außengeleitet, und neigen dazu, in kleinlicher Regelbefolgung zu erstarren. Oft fehlt es uns dabei an Lebendigkeit und Entdeckerfreude, an Kreativität und Vitalität, an Freude und Optimismus.
Im Zustand der Selbstentfremdung tendiert unsere Stimmung dahin, gedrückt oder doch wenigstens nichtssagend und unattraktiv zu sein. Denn die Frage „Wozu das alles?“ steht unausgesprochen oder ausgesprochen im Raume. Das gilt erst recht, wenn wir Belastungssituationen ausgesetzt sind. Wir spüren, dass wir nicht genau wissen, wozu wir leben. Und leider reagieren unsere Gefühle auf „Sinnleere“ und oberflächliche Vergnügen nur all zu oft mit Frustration und Aggression, mit psychosomatischen Beschwerden, mit Zynismus und übertriebener Kritik oder dem Bedürfnis nach Exzessen, gleichgültig, ob solche Eskapaden unsere Gesundheit schädigen oder das gesellschaftliche Klima vergiften.
Unsere Äußerungen sind dann oft blass und einfallslos oder auch auf manische Weise rechthaberisch. Denn wir spüren, dass wir etwas ändern müssen, wissen aber nicht genau, wo wir den Hebel ansetzen sollen. Hier liegt das objektivistische Missverständnis der Werte besonders nahe: Die anderen machen irgendetwas falsch. Und wo sonst sollte dieser Fehler liegen, wenn nicht in den objektiven Verhältnissen und Verhaltensweisen? Der andere wird dabei oft als Langweiler wahrgenommen, als manischer Egomane oder Narziss, wenn nicht sogar als rücksichtsloser Egoist und Ausbeuter, der allerdings alles daran setzt, seinen Egoismus zu rationalisieren und zu bemänteln. Ist man unter solchen gesellschaftlichen Bedingungen nicht gezwungen, es den anderen gleichzutun?
Selbstentfremdung bedeutet darüber hinaus, für den anderen, die Gemeinschaft und das gesellschaftliche Umfeld ein Faktor zu sein, der Negativität erzeugt. Der Politiker, der Lehrer, der Diktatur, der Geschäftsmann, der Feldherr, der sich selbst entfremdet ist und der seine eigenen mentalen Hauptprinzipien nicht erkannt hat, d.h. jene Prinzipien, die ihn ein positives, erfülltes Leben anstreben lassen:
Wer selbst nicht intakt ist, droht seine Negativität auch auf andere zu übertragen
Was unsere wahren Ziele und Motive sind, braucht dabei nicht immer genau bekannt sein. Wir können vordergründige Ziele verfolgen, die uns sehr plausibel erscheinen, deren genauere Analyse dann aber zeigt, dass wir uns selbst nicht verstanden haben. Auch darin – in dieser Desorientiertheit – liegt unsere Selbstentfremdung. Und die Folge dieses Mangels ist, dass wir wegen unserer Desorientiertheit unsere eigentlichen Lebensziele nicht realisieren.
Selbstentfremdung kann als allgegenwärtiges Problem unserer Kultur angesehen werden
Hier könnte man einwenden: Aber wie ist denn überhaupt generelle Kritik möglich angesichts der großen Verschiedenheit der Menschen, ihrer unterschiedlichen Wünsche, Motivationen und Ansichten? Setzt Gesellschaftskritik nicht voraus, über die persönlichen Ziele anderer besser Bescheid wissen als der Betroffene selbst? Wäre es nicht vermessen, über die „wahren“ Lebensziele anderer urteilen zu wollen?
Unsere Legitimation, auch die Individualität des anderen in die Analyse einzubeziehen, leitet sich daraus ab, dass wir eben nicht nur Individuen mit ganz unterschiedlich Gefühlen, Motivationen und Interessen sind, sondern darüber hinaus trotz aller Verschiedenheit identischen mentalen Prinzipien gehorchen. Unser Werterleben
2 Was uns zu emotionalen Irrläufern werden lässt
Viele Menschen wissen intuitiv, wie ein friedliches, produktives und erfülltes Leben zu führen ist. Sie handeln aus dem Bauch heraus „klug“ und „vernünftig“. Und dieser Teil der Menschheit ist dafür verantwortlich, dass wir Gesetze und brauchbare Verhaltensregeln entwickeln, dass wir Moral und Freiheit, Toleranz, Kunst und Kultur und die Wissenschaften fördern.
Aber die wenigsten sind im Stande, ihr Verhalten rational zu erfassen, geschweige denn, es auf den Punkt zu bringen. Sie leben in einem Zustand leichter Selbstentfremdung, doch ohne jene negativen Folgen wie Hass, Krieg, Terror und Intoleranz und Gewalt, für die echte emotionale Irrläufer verantwortlich sind.
Emotionales Irrläufertum ist ein komplexes Phänomen, das unterschiedliche Ursachen hat. Ein typischer und dabei besonders schwer wiegender Grund liegt wie schon angesprochen darin, dass wir nicht wissen, wozu wir leben. Dann handeln wir auf vage oder gar nicht bekannte Ziele hin und drohen wegen dieser Ziellosigkeit öfter zu scheitern als notwendig. Uns fehlen überzeugende Kriterien. Stattdessen rechtfertigen wir Werte intellektuell, ohne Bezug zu Gefühlen. Wir diskutieren mit großem Ernst und manchmal im wahrsten Sinn des Wortes bis aufs Blut über Mittel, ohne den genauen Zweck zu kennen, den diese Mittel haben könnten oder sollten.
Wenn wir unsere Ziele nicht kennen, werden wir sie nur schwer oder gar nicht erreichen.
Wenn wir nicht erkennen, dass es fast unmöglich ist, unsere Ziele allein und ohne Hilfe anderer zu erreichen, drohen wir ebenfalls scheitern.
Wenn wir nicht sehen, dass andere, um uns behilflich zu sein, von uns das Gleiche erwarten, dann ist die Kooperation damit der Beliebigkeit ausgeliefert.
Im Folgenden dazu eine kurze, noch sehr abstrakte und allgemein gehaltene Zusammenfassung, die dann später durch konkrete Analysen belegt werden soll.
10 THESEN
Wir werden zu „emotionalen Irrläufern“:
Weil wir nicht oder nicht klar genug wissen, dass das Fühlen der Hauptzweck des Lebens ist.
Weil der „Wertblick“ des Menschen in der natürlichen Einstellung am Wesentlichen vorbeisieht und das vermeintlich Wichtige gar nicht das Wesentliche, das vermeintlich Akzidentielle das eigentlich Wichtige ist.
Weil wir zu oft bei bloß „verkopften Werten“ oder Werten als Mitteln, beim bloß Nützlichen stecken bleiben, das keinen Bezug zu unseren Gefühlen hat.
Weil wir zu oft an ambivalenten Wertgefühlen und fixen Wertvorstellungen anhaften, die uns schaden.
Weil unsere emotionale Grundverfassung aus physischen und mentalen Gründen zu sehr auf Leiden beruht; anders ausgedrückt: weil die Aversio überwiegt.
Weil Befriedigung und Erfüllung zu oft hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Weil wir nicht erkennen, welchen Prinzipien unsere Werterfahrungen und unsere Werturteile gehorchen.
Weil uns genaue Maßstäbe zum Vergleich von gefühlten Werten fehlen.
Weil die emotionalen Wirkungen unserer Handlungen oft nur schwer vorauszusehen sind.
Weil wir meist nur intuitiv das Zusammenspiel unserer Gefühle mit den Gefühlen anderer innerhalb des emotionalen Systems einzuschätzen vermögen, in dem wir alle gemeinsam leben.
Emotionales Irrläufertum ist dabei einerseits bereits in unserer menschlichen Grundverfassung angelegt – dabei handelt es sich also um eine allgemeine Disposition. Wir sind mental wenig dafür prädestiniert, zu durchschauen, was uns zu emotionalen Irrläufern werden lässt.
Wir sind aber von dieser Grundverfassung abgesehen leider auch allzu oft individuelle Irrläufer.
Unsere These ist nicht, dass wir alle zwangsläufig unglücklich sind, weil wir die Bedingungen des Glücks und der Zufriedenheit nicht kennen – wir handeln hier oft intuitiv richtig –, sondern dass wir Leiden vermindern, Positivität vermehren und oft tragische Irrwege vermeiden könnten, wenn wir mehr über die „Grammatik unserer Gefühle und Werterfahrungen“ wüssten.
Unsere Analysen in den folgenden Kapitel werden zeigen, wie diese Thesen genau zu verstehen sind und warum ihre Folgerungen unausweichlich erscheinen.
3 Wie sich emotionales Irrläufertum zeigt
Rolf K. gilt weder als krank oder dumm noch als geistesgestört. Und doch ist sein Leben eine einzige Kette emotionaler Katastrophen. Vielleicht würde man sie sogar nur als „Kataströphchen“ bezeichnen wollen – und sie entbehren auch nicht einer gewissen Komik, die uns geneigt macht, ihn eher in die Kategorie liebenswerter, aber tragischer Narren einzuordnen.
Im Abstand von wenigen Wochen gerät er in Situationen, die fast den Stoff für eine Komödie abgeben könnten. So plant K. ein Vierteljahr lang mit seinem Freund eine Zwei Monate dauernde Reise an die jugoslawische Adria. Unzählige Prospekte und Karten werden gesichtet und Vorbereitungen getroffen. Doch etwa eine Woche vor dem Termin scheint er wie unter einem geheimen Zwang sein für den Urlaub gespartes Geld in nächtlichen Zechgelagen auf den Kopf zu hauen. Am Morgen der Abfahrt ist er völlig pleite.
Nicht, dass er plötzlich das Interesse an der Reise verloren hätte. Ganz im Gegenteil, mit viel Mühe gelingt es ihm, sich am Abfahrtstag das fehlende Geld zu leihen und doch noch in Urlaub zu fahren.
In einem anderen Fall bekommt K. Streit mit seinem Wirt. Der erteilt ihm Lokalverbot. Draußen vor der Kneipe, wohl unter Alkoholeinfluss, gefällt es ihm plötzlich, mit der Faust in die kleinen gelben, bleigerahmten Butzenscheiben des Fensters zu schlagen. Dabei verletzt er sich seine rechte Hand. In der Notaufnahmen erkundigt sich die Ärztin beiläufig, nachdem sie seine Schnittwunden verarztet hat, wie denn das Unglück passiert sei. Er antwortet: „Ich habe den Teufel hinter den Scheiben gesehen – und da hab’ ich ihm eins zwischen die Hörner gehauen!“
Die Ärztin nimmt diese Auskunft, die als Witz gemeint war, ernst. Nach wenigen Minuten kehrt sie mit zwei Pflegern zurück und Rolf K. verbringt die Nacht angeschnallt auf einer Pritsche, bis am nächsten Morgen geklärt ist, dass es sich nicht um einen gefährlichen Geisteskranken handelt.
Ein andermal, als er seinen Führerschein verloren hat, schenkt ihm sein Vater das Geld für die Führerscheinprüfung. Am Abend vor der Prüfung betrinkt er sich bis zum Black-out. Am nächsten Morgen ist sein Geld verschwunden. Rolf K. hat keine Erklärung, wo es geblieben sein könnte. Es mutmaßt, dass man ihm in der Kneipe K.-o.-Tropfen ins Getränk getan hat. Ein anderer Fall, offenbar ebenfalls unter starkem Alkoholeinfluss, spielt sich auf dem Campingplatz ab, wo sein Vater einen Wohnwagen angestellt hat. Irgendwann will ihn der Wirt des Platzes verweisen. Da packt er kurzer Hand einen anderen Campingplatzbewohner bei der Gurgel und bedroht mit an die Kehle gesetztem Messer den Wirt, ihm freies Geleit zu geben.
K. lebt, nachdem er keine Arbeit mehr findet, von Arbeitslosenhilfe. Noch im Besitz eines Fahrzeugs, fährt er eines Morgens zu einem Termin, zu dem ihn sein Arbeitsamt bestellt hat. Doch das bevorstehende Gespräch verursacht ihm so viel „Bauchschmerzen“, dass er nur das Gebäude umrundet und nach Hause zurückfährt, um sich wieder ins Bett zu legen.
Das alles geschieht, von seinen Gefühlen und seinem Hang zum Alkohol abgesehen, ohne ersichtlichen Grund, als zwänge ihn irgendetwas, die Dinge immer ins Negative zu wenden. Rolf K. ist ein emotionaler Irrläufer per excellence. Er scheint nicht genau zu wissen, welche Gefühle ihn beherrschen und wie man sich von ihnen lösen könnte.
Über die Rolle von Gefühlen im Leben befragt würde er vermutlich antworten, dass er darüber nichts sagen kann und dass sie allenfalls eine nebensächliche Rolle spielen. Es fehlt ihm an Impulskontrolle. Aber es mangelt ihm vor allem, wie den meisten emotionalen Irrläufern, an prinzipiellen Einsichten, die ihm helfen könnten, zu verstehen, wozu man lebt.
Menschen wie er gibt es vermutlich zuhauf. Angst, Abneigung, Impulsivität, Bequemlichkeit gehen bei ihnen eine verhängnisvolle Liaison ein. Wir stufen solche Charaktere leicht als „labil“ oder „neurotisch“ ein oder sehen sie sogar in die Nähe der Psychopathie. Dabei fragen wir dann selten nach kognitiven Defiziten. Wir interpretieren ihr Verhalten als „Charakterschwäche“. Man ist so von Geburt oder weil man falsch erzogen wurde. Tatsächlich kann dies nur die eine Seite der Medaille sein.
Unsere Auffassung vom Leben hat eine außerordentlich verhaltensändernde, motivierende oder demotivierende Kraft. Es spricht viel dafür, dass Rolf. K. ohne das für unsere Kultur so typische Maß an emotionaler Desorientiertheit manche Dummheit hätte vermeiden können
Ein berühmteres Beispiel für emotionale Desorientiertheit ist der Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson. 1991 trifft Tyson Desiree Washington, eine Teilnehmerin am Schönheitswettbewerb „Miss Black America“. Beide gehen in den frühen Morgenstunden auf Tysons Zimmer. Später zeigt Desiree Washington den Boxer wegen Vergewaltigung an.
Tyson wird zu zehn Jahren Haft verurteilt, von denen vier zur Bewährung ausgesetzt werden. 1993 bestätigt ein Berufungsgericht die Verurteilung Tysons. Tyson konvertiert zum Islam und wird nach drei Jahren wegen guter Führung entlassen.
Aber schon im Juni 1997 wird Tyson bei der Revanche gegen Evander Holyfield disqualifiziert, weil er Holyfield in der dritten Runde ein großes Stück aus dem rechten Ohr beißt. Fortan tituliert ihn die Presse als „Beißer“. Tyson wird auf unbestimmte Zeit die Lizenz entzogen. Er zahlt rund drei Millionen Dollar Geldbuße.
Im September 1988 reicht Richard Hardick Klage wegen Körperverletzung gegen Tyson ein. Nach einem Auffahrunfall auf den Mercedes von Tysons Frau Monica habe Tyson ihn in den Unterleib getreten.
Ein so hohes Maß an aggressiver Impulsivität sollte eigentlich jeden zur Besinnung bringen. Doch diese Art emotionaler Desorientiertheit tendiert dazu, sich zu wiederholen. Und sie tendiert umso mehr dazu, je weniger wir über unser Gefühlsleben wissen, je weniger wir es in Frage stellen. Aggressivität wird als richtiges Urteil erlebt, als angemessene Reaktion und als notwendige Bestrafung oder um jemanden davon anzuhalten, das zu wiederholen, was uns aggressiv macht.
Im Oktober 1988 wird nach fünftägigen Untersuchungen ein ärztliches Gutachten veröffentlicht. Tyson werden Depressionen und mangelndes Selbstwertgefühl attestiert.
Im Januar 2002 platzt der mit Spannung erwartete Kampf zwischen Doppelweltmeister Lennox Lewis und Herausforderer Mike Tyson für ein Rekordbudget von rund 170 Millionen in Las Vegas, als es während der Vorstellung der beiden Faustkämpfer zu einer Massenschlägerei in einem New Yorker Hotel kommt. Lewis erklärt: „Mike Tyson biss durch meine Hose und riss ein ordentliches Stück Fleisch aus meinem Oberschenkel heraus.“
Obwohl er damit seine Karriere als Boxer zu ruinieren droht und ihm mehrere Male die Lizenz entzogen wird, scheint er unfähig zu sein, sich zu ändern:
November 2009. „Im Flughafen von Los Angeles hat Mike Tyson einen Fotografen niedergeschlagen. Tyson war mit seiner Frau und ihrem zehn Monate alten Kind unterwegs, als er auf den Paparazzo traf. Wer den Streit begonnen hat, ist nicht ganz klar. Tyson wurde vorübergehend festgenommen. Der amerikanische Boxer Mike Tyson hat auf dem Flughafen von Los Angeles einen Pressefotografen niedergestreckt. Der Paparazzo wurde ins Krankenhaus, Tyson in eine Zelle der Flughafenpolizei gebracht.“ Mike Tyson mangelt es wie vielen emotionalen Irrläufern an Impulskontrolle.
Dafür mag es Gründe geben – z.B. Erziehung oder Frustration oder Veranlagung. Aber solche Erklärungen reichen bei näherem Hinsehen keineswegs aus.
Es wäre auch fatal, nur hirnphysiologische Gründe wie etwa überschießende Aggressivität, wie sie durch den des Mandelkern gesteuert wird, dafür verantwortlich zu machen. Auch dass Gefühlsempfindungen in hohem Maße z.B. von Endorphinen, Serotonin und Acetylcholin abhängig sind, bedeutet natürlich nicht, unser Gefühlsleben sei rein chemisch gesteuert. Wir sind nicht so simpel gestrickt, dass unsere emotionalen Programme unbeeinflussbar durch Einsicht wären. Verstehen wir besser, wie wir funktionieren und worum es im Leben geht – und verinnerlichen wir diese Einsichten und nehmen sie ernst, weil wir sie als zutreffend erachten –, dann tendiert unser Bewusstsein durchaus dazu, solche Einsichten in seine Rechnung mit ein zu beziehen.
Viele unserer Gefühle, Emotionen und Stimmungen sind veränderbar
Auch Tysons Irrläufertum beruht nach allem, was wir inzwischen über die Psychologie unseres Gefühlslebens wissen keineswegs zwangsläufig auf unabänderlichen Emotionen. Seine Einstellungen sind zumindest teilweise durch Übung und Überzeugung und fehlende Gegensteuerung erlernt und fixiert.
Emotionale Desorientiertheit ist auch eine der Ursachen, die Selbstmördern ihre Situation so ausweglos erscheinen lässt, dass sie dem Leidensdruck nicht länger standhalten zu können glauben. Anders gesagt: Selbstmord ist weder nur ein sachlich „objektives“ noch ein emotionales Problem, sondern zunächst einmal vor allem auch ein „kognitives“.
Als Hemingway im Juli 1961 aus der Mayo-Klinik für Psychiatrie entlassen worden war, beging er Selbstmord, indem er sich mit einer doppelläufigen Schrotflinte in den Mund schoss. Zuvor hatte man ihn mit einer List in eine psychiatrische Anstalt gebracht und ihm mehr als zwanzig Elektroschocks gegeben. Sein Kommentar zu dieser Behandlungsmethode:
„Diese Schockärzte haben keine Ahnung von Schriftstellern und derartigen Dingen... Welchen Sinn hat es, meinen Kopf zu ruinieren, mir mein Gedächtnis und damit mein Kapital auszulöschen und mich arbeitsunfähig zu machen? Es war eine großartige Behandlung, aber der Patient ist tot...“
Die vermuteten Gründe, dass er seinem Leben ein Ende setzte: zahlreiche Verwundungen aus Kriegen und von Flugzeugabstürzen, Arteriosklerose, Diabetes, Depressionen...
„Sein Selbstmord machte es noch einmal deutlich: Hemingway war nicht der strahlende Sieger, zu dem er sich in immer neuen Rollen als Jäger, Boxer, Fischer und Weiberheld stilisierte. Seine Bücher zeigten schon immer einen anderen Hemingway: den täglich aufs Neue mit seinen Existenzängsten kämpfenden Menschen.“
Weder Ruhm und Reichtum noch der Nobelpreis reichten zuletzt aus, um das Leben als lebenswert zu erachten, unterstellt man einmal, dass die Motive für seinen Selbstmord nicht nur auf der rein physischen Seite zu suchen waren.
Und doch wäre sein Tod auch nach dem damaligen Stand der Medizin zu vermeiden gewesen. Sein Leidensdruck, ob auf physischem oder seelischem Gebiet, hätte wahrscheinlich mit Medikamenten und psychotherapeutischer Behandlung genügend gelindert werden können, um Hemingway seinen Entschluss noch einmal überdenken zu lassen.
Hemingway war wie wohl die meisten Selbstmörder Opfer eines „objektivistischen Fehlschlusses“. Solche Fehlschlüsse haben verschiedene Aspekte, auf die wir noch genauer eingehen, sobald geklärt ist, was es bedeutet Werterfahrungen zu haben und was Werturteile sind.
Der Blick des Selbstmörders geht einerseits auf die Sache oder die Lebenssituation, die als ausweglos und unerträglich eingeschätzt wird, und andererseits auf das Leiden, das diese Situation verursacht. In beiden Fällen handelt es sich oft um einen Fehlschluss. Objektivistisch ist ein Fehlschluss z.B. dann, wenn wir – um ein Beispiel zu konstruieren – denken: „Ich werde niemals mehr so gute Bücher schreiben wie früher. Und weil ich das nicht kann, ist das Leben nicht mehr lebenswert.“
Was man damit behauptet, kann man gar nicht wirklich wissen. Es handelt sich um Scheinevidenz. Natürlich kann man seiner Intuition vertrauen. Und oft liegt man mit dieser Intuition auch richtig. Nicht zu unterschätzen ist dabei aber die Frage, inwiefern unser Urteil hier nicht bereits die Funktion einer selbsterfüllenden Prophezeiung hat.
Ein weiterer Aspekt des objektivistischen Fehlschlusses ist, dass man das Urteil durch eine negative Gefühlsbrille betrachtet – in diesem Beispiel vielleicht der pessimistischen Grundstimmung, in der man sich gerade befindet. Das negative Werturteil ist selten rein sachlich, sondern fast immer auch Gefühlsurteil. Man kann sich diese Gefühlsbrille wie eine negative Tönung vorstellen, durch die wir unsere Gedanken wahrnehmen. Unser Fehlschluss besteht dann darin, dass die subjektive Gefühlsbrille mit der objektiv gemeinten Bedeutung („an den Dingen“) des Urteils „Ich werde niemals mehr so gute Bücher schreiben wie früher“, verwechselt wird.
Und drittens: Was macht uns so sicher, dass dieselbe pessimistische Gefühlswahrnehmung andauert? Was macht uns so sicher, dass wir unser Urteil über die Sinn- oder Wertlosigkeit des Lebens nicht schon morgen revidieren müssen? Da Gefühle nie als notwendig zur Sache gehörig angesehen werden dürfen, von der sie ausgelöst werden oder in deren Licht sie erscheinen, sondern vielmehr als „kontingent“ (also zufällig, d.h. wirklich oder möglich, aber nicht wesensnotwendig), muss das Urteil in aller Regel als voreilig angesehen werden.
Jedes unerwartete Ereignis kann die Wende herbeiführen, eine unerwartete Liebe, Spontanheilung, neuere Medikamente oder ein besserer Arzt – oder auch nur simple Luftveränderung.