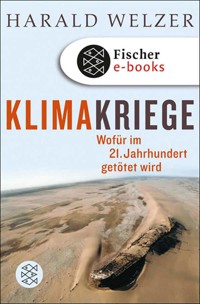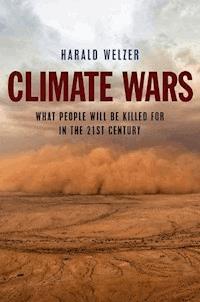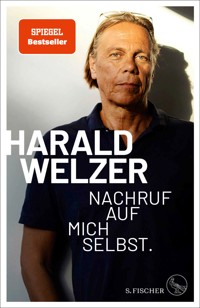
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestseller-Autor Harald Welzer stellt fest, dass unsere Kultur kein Konzept vom Aufhören hat. Deshalb baut sie Autobahnen und Flughäfen für Zukünfte, in denen es keine Autos und Flughäfen mehr geben wird. Und sie versucht, unsere Zukunftsprobleme durch Optimierung zu lösen, obwohl ein optimiertes Falsches immer noch falsch ist. Damit verbaut sie viele Möglichkeiten, das Leben durch Weglassen und Aufhören besser zu machen. Diese Kultur hat den Tod genauso zur Privatangelegenheit gemacht, wie sie die Begrenztheit der Erde verbissen ignoriert. Harald Welzer zeigt in einer faszinierenden Montage aus wissenschaftlichen Befunden, psychologischen Einsichten und persönlichen Geschichten, wie man aus den Absurditäten dieser gesellschaftlichen Entwicklung herausfindet. Man muss rechtzeitig einen Nachruf auf sich selbst schreiben, damit man weiß, wie man gelebt haben will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Harald Welzer
Nachruf auf mich selbst.
Die Kultur des Aufhörens
Über dieses Buch
Unsere Kultur hat kein Konzept vom Aufhören. Deshalb baut sie Autobahnen und Flughäfen für Zukünfte, in denen es keine Autos und Flughäfen mehr geben wird. Und versucht, unsere Zukunftsprobleme durch Optimierung zu lösen, obwohl ein optimiertes Falsches immer noch falsch ist. Damit verbaut sie viele Möglichkeiten, das Leben durch Weglassen und Aufhören besser zu machen. Diese Kultur hat den Tod genauso zur Privatangelegenheit gemacht, wie sie die Begrenztheit der Erde verbissen ignoriert.
Bestsellerautor Harald Welzer zeigt in einer faszinierenden Montage aus wissenschaftlichen Befunden, psychologischen Einsichten und persönlichen Geschichten, wie man aus den Absurditäten dieser gesellschaftlichen Entwicklung herausfindet. Man muss rechtzeitig einen Nachruf auf sich selbst schreiben, damit man weiß, wie man gelebt haben will.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Harald Welzer hat schon mit vielem aufgehört: mit Forschungsthemen, wenn sie keine Fragen mehr aufwarfen, mit seinem Leben als Galerist, mit dem Motorradfahren zum Beispiel. Ohne Aufhören kann man nichts anfangen. Jetzt ist er Direktor von Futurzwei – Stiftung Zukunftsfähigkeit, hat den Rat für Digitale Ökologie gegründet, und wenn er sich nicht gerade leidenschaftlich in eine Debatte wirft, schreibt er Bücher: in den FISCHER Verlagen sind u. a. erschienen »Selbst denken« (2013), »Die smarte Diktatur. Ein Angriff auf unsere Freiheit« (2016) und »Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen« (2019). Harald Welzer lebt in Berlin.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Debora Mittelstaedt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491451-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Hauptteil]
I Weg von hier
Die tote Masse und das Leben
Die Zeit davor
Der große Refraktor
Media in vita
Tote Menschen haben keine Probleme
Der gezähmte Tod
Die Schlünde des Nichts
Die Philosophie hilft auch nicht
Herzinfarkt
Reste
Weltreichweitengeschichten
Herr Ochs bekommt Angst
Sympathy for the devil
Der entgrenzte Mensch
Die entgrenzte Aufklärung
Man kann mit der Natur nicht verhandeln
Das Herz
Die schönsten Strophen sind die Katastrophen
Das 21. Jahrhundert ist schon alt, während wir noch denken, es sei jung
Was heißt eigentlich: als Mensch geboren werden?
Naturkultur
Das Neue
Zwischenfrage
II Geschichten vom Aufhören und vom Leben
Reinhold Messner
Jan Vermeer van Delft.
Tino Sehgals
Realities:united
Jan und Tim Edler
Johannes Heimrath
Katja Baumgarten.
Thomas Kessler
Christiane zu Salm,
Hans-Dietrich Reckhaus.
Peter Sillem
Klaus Wiegandt
Slicky Baby.
III Nachruf auf mein zu lebendes Leben
1. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er konnte gut Zeit verschwenden.
2. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er hatte gelernt, das Optimieren zu lassen.
3. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er hat sich stets bemüht, gute Fehler zu machen.
4. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er war albern, unernst, interessant, anregend, arrogant, ärgerlich, lehrreich, ungerecht – aber nie banal.
5. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er war immer radikal, aber doch jederzeit bereit, inkonsequent zu sein.
6. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er hat einen Unterschied gemacht.
7. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er hat Menschen Handlungsspielräume eröffnet.
8. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er war bereit, die Dinge ernst zu nehmen, ohne sich dabei zu verspannen.
9. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er war beim Skat nie so gut, wie er selbst glaubte, aber er war bei Gott ein Skatspieler.
10. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er hat keine Entscheidungen getroffen oder mitgetragen, die zukünftige Menschen in ihrer Entfaltung beeinträchtigen.
11. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er hat immer versucht, die Dummheit zu bekämpfen.
12. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er fand gar nichts dabei, zu sagen, was er dachte.
13. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er war stets von Schönheit verführbar.
14. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er hielt die richtigen Fragen für wichtiger als die falschen Antworten.
15. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht: Er hatte gelernt, keine Angst vor dem Tod zu haben.
IV Eine ungeheure Reise
Wer will ich gewesen sein?
Anmerkungen
Danksagung
Abbildungsnachweis
Register
Für Nicholas Czichi-Welzer
[Hauptteil]
IWeg von hier
Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeute. Er wußte nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: »Wohin reitest du, Herr?« »Ich weiß es nicht«, sagte ich, »nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.« »Du kennst also dein Ziel?« fragte er. »Ja«, antwortete ich, »ich sagte es doch: ›Weg-von-hier‹, das ist mein Ziel.« Franz Kafka, Der Aufbruch.
Die tote Masse und das Leben
Die Masse der von Menschen hergestellten Objekte hat sich seit 1900 etwa alle 20 Jahre verdoppelt. Damals betrug sie etwa drei Prozent der Biomasse, drei Prozent also alles dessen, was lebt. Im Jahr 2020 hat die tote Masse – also Häuser, Asphalt, Maschinen, Autos, Plastik, Computer usw. usf. – die Biomasse erstmals übertroffen. Die Biomasse aller Wildtiere ist in den letzten 50 Jahren dagegen um mehr als vier Fünftel geschrumpft. Ein atemberaubender Vorgang: Während die Biomasse durch Entwaldung und Zerstörung von Böden und Meeren und Artensterben weiter sinkt, wächst die menschengemachte Masse immer schneller an. So berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom israelischen Weizmann-Institut.[1]
Man hat versucht, diesen Vorgang dadurch zu veranschaulichen, dass jede Woche für jeden Menschen auf der Welt Produkte geschaffen werden, die seinem Körpergewicht entsprechen. 52 Mal im Jahr kommt das Äquivalent von einem selbst zur toten Masse dazu. Das ist ziemlich gruselig, scheint mir, wobei betont werden muss, dass diese 52-mal-ich-Produktmenge aus Substanzen besteht, die den lebendigen Böden, den Wäldern, den Meeren und Flüssen entnommen werden – woanders können sie ja nicht herkommen. Mit anderen Worten: Die Welt wird in immer noch wachsender Geschwindigkeit von einer natürlichen in eine künstliche oder besser: von einer lebendigen in eine tote umgewandelt. Hergestelltes schlägt Biomasse. Totes schlägt Lebendiges.
Am 23. März 2021 geschah etwas, was die Sache mit der toten Masse live und in Farbe illustrierte: Das 400 Meter lange und fast 60 Meter breite Containerschiff »Ever given« blieb im 1869 eröffneten und für diese bombastische Größe nicht ausgelegten Suezkanal buchstäblich hängen und blockierte auf diese Weise einen erheblichen Teil des globalen Güterverkehrs. Schon nach kurzer Zeit stauten sich 150 weitere Frachter zu beiden Seiten des Kanals, also im Mittelmeer und im Roten Meer. Die durch einen solchen Stau entstehenden Kosten sind gigantisch, weil das ganze Zeug in den Containern und Tanks ja nun nicht pünktlich dort ankommt, wo es nach der auf knappe Umschlagszeiten geeichten globalen Logistik ankommen soll – und Chemie-, Auto- und Elektronikproduzenten warteten entsprechend händeringend darauf, dass das Monsterschiff bitte sofort freikommen möge. Kam es aber nicht. Denn zu seinem Eigengewicht von 220000 Tonnen trug es noch einmal mehr als 20000 Container, und wenn eine solche Masse erst einmal auf Grund gelaufen ist, hebt sie so schnell keiner raus.
Abb. 1: Ever Given, leider eingeklemmt
Wie um die Absurdität unserer Lebens- und Wirtschaftsform auf den Punkt zu bringen, trägt dieses Schiff auch noch den Namen »Ever Given – ewig gegeben«, und so wie das Ding da hilflos eingeklemmt war, so scheint die Fortsetzung unseres Kulturmodells genauso hilflos eingeklemmt zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Die radikalisierte Stoffumwandlung verarbeitet ihre eigenen Voraussetzungen – irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter mit diesem »Ever Given«. Ich habe gerade bei dem Anthropologen Michael Tomasello gelesen, dass die menschliche Kultur zu dem faszinierenden koevolutionären Prinzip der kulturellen Vererbung geführt hat. Neue Menschenkinder wachsen immer in eine Welt hinein, in der sie an den jeweiligen Errungenschaften der kulturellen Evolution der vorangegangenen Generationen anknüpfen können. Tomasello nennt das den »Wagenhebereffekt« der menschlichen Lebensform: Die jeweils neue Generation fängt nie von vorn an, sondern immer dort, wo die vorangegangene angelangt ist. Das unterscheidet die menschliche Lebensform von der aller anderen Lebewesen. Sie ist koevolutionär – Menschen existieren nicht nur in einer natürlichen Umwelt, sondern immer auch in einer selbst erschaffenen. Die nennen wir Kultur.
Was Tomasello sich nicht fragt: Was, wenn die kulturelle Entwicklung eine falsche Richtung eingeschlagen hat, wenn sie nicht lebensdienlich war? Dann geht das Ganze ein paar Generationen so weiter, und da die Welt, in die die jeweils Nächsten hineingeboren werden, »ihre« Welt ist, die einfach so ist, wie sie sie kennenlernen, bleibt natürlich lange Zeit unerkennbar, wenn die Entwicklungsrichtung ohne Zukunft ist. Denn die Kultur, in die man hineinwächst, ist nichts Äußerliches – sie sitzt nicht nur in unseren Infrastrukturen und Institutionen, in unserem Grundgesetz, unseren Lehrplänen und Verkehrsregeln, sondern in unseren Gewohnheiten, in unseren Wahrnehmungen und Deutungen, in unserer Psyche, unserem Selbst. Wir sind ja nicht nur Gestalterinnen und Gestalter dieser Lebensform, sondern gleichzeitig von ihr gestaltet, und diese Gestaltung erfolgt nicht bewusst und absichtsvoll, sondern durch die Praxis.
Zum Beispiel durch die, dass man in modernen Hyperkonsumgesellschaften alles immer und immer alles haben kann. Das scheint uns ganz selbstverständlich, und nur wenn es durch eine Havarie wie der im Suezkanal zu »Engpässen« kommt, wird einem gelegentlich klar, dass all das Zeug in den Einkaufszentren nicht einfach »da«, sondern irgendwo hergekommen ist. Unser Kulturmodell blendet die Frage, wo das alles herkommt, systematisch aus. Das ist das kulturell Unbewusste, und daher sind wir alle, als Mitglieder dieser Kultur, gut durchtrainierte Vergessenskünstler – denn wenn wir so ein schönes neues iPhone in Händen halten, interessiert uns die Frage nach seiner höchst vielfältigen und komplexen Herkunft durchaus nicht. Wir kommen nicht mal drauf, uns für diese Frage zu interessieren, so selbstverständlich ist Verfügbarkeit für uns.
Oder: Wie sich wirtschaftlicher Erfolg quantitativ bemisst und in Börsenkursen und im Bruttoinlandsprodukt seinen Ausdruck findet, so hat sich das Messen in fast jede Facette unserer Leben eingeschrieben – von den Schulnoten und credit points bis hin zur Zahl der absolvierten Dates oder der Schritte, die man am Tag zurückgelegt hat. Besonders für die Kontrolle des Körpers mittels iPhone, Apple-Watch und Peloton-Heimtrainings gilt, dass Zahlen sich ganz selbstverständlich in die Darstellung, aber auch in die Wahrnehmung des eigenen Selbst eingefügt haben. Auch diese Einwanderung von Quantitäten in das eigene Selbst und seinen mentalen Haushalt macht klar, dass eine Kultur nie etwas Äußerliches ist, was um die Menschen herum existiert wie eine möblierte Umwelt, sondern sich immer auch in die Innenwelten, in die Psyche und in den wahrgenommenen Selbstwert übersetzt. Und weil sich die Kultur wandelt, sind wir immer schon andere als unsere Vorgängerinnen und Vorgänger, bis in unsere Sinneswahrnehmungen, unsere Gefühle und unsere Selbstbilder hinein.
Deswegen ist es so schwer, sich vorzustellen, dass die Kultur, der man angehört, eine »falsche« Richtung eingeschlagen haben könnte. Diese Kultur ist ja für jeden von uns immer schon »da«, eine Selbstverständlichkeit, so wie für einen Fisch das Wasser. Aber vielleicht kann man so viel sagen: Eine Kultur, die wie unsere ihre eigenen Voraussetzungen konsumiert, muss im Irrtum sein. Das wäre auch menschheitsgeschichtlich gar nichts Neues. Wir haben massenmörderische Kulturen gesehen, wahnhafte und solche, die ihr kulturelles Gepäck in Lebensräume getragen haben, wo es nicht hinpasste. Oder die einen Weg eingeschlagen haben, der ins Desaster und in die Selbstabschaffung führte.
Jared Diamond hat über untergegangene Kulturen das wichtige Buch »Kollaps« geschrieben, wobei das, was in der historischen Rekonstruktion als Irrtum erscheint, in der Wahrnehmung der Zeitgenossen keiner ist, sondern – einfach das, was man immer schon so gemacht hat. Entwaldung, Bodenerosion, Versalzung, Überjagung und Überfischung, Bevölkerungszunahme und wachsender Wohlstand[2] haben ja in der individuellen Wahrnehmung keinen Zeitindex. Unsere Wahrnehmung verändert sich mit der sich verändernden Umwelt, und allenfalls wird in der Rückschau mit Erschrecken registriert, dass man den falschen Pfad eingeschlagen hatte. Im Normalfall aber surfen wir gewissermaßen mit den sich verändernden Verhältnissen mit – und dann fehlen uns die Referenzpunkte, an denen man festmachen könnte, was sich verändert hat und ab welchem Punkt eine Sache aus dem Ruder gelaufen ist. Solche »shifting baselines«[3] verstellen die Einsicht in einen sich abspulenden Niedergang oder gar einen Untergang regelmäßig, weshalb zum Beispiel so ein epochales Ereignis wie der Untergang des kompletten Ostblocksystems inklusive der DDR 1989 nicht einmal von den zuständigen Wissenschaften – Geschichte, Politologie, Soziologie, Ökonomie – vorhergesehen wurde, sondern scheinbar einfach so und ziemlich plötzlich geschah. Ups.
Wenn man also Fragen stellt wie: »Was hat der Mann gedacht, der die letzte Palme auf der Osterinsel gefällt hat?«, »Was dachten die grönländischen Wikinger, als sie unter höchstem Ressourcenaufwand unter arktischen Bedingungen Viehwirtschaft zu treiben versuchten?«, »Was hatten Ingenieure im Sinn, die in Zeiten des Klimawandels tonnenschwere Geländewagen für Stadtbewohner entwickelten?«, dann lautet die Antwort jedes Mal: gar nichts. Denn alles dieses basiert ja auf Entwicklungen, die sich über lange Zeit hinweg vollzogen und als kulturelle Praxis eingeschrieben haben. Und in deren Fließen die neu Dazukommenden, also die Kinder, gleichsam eingefügt werden – wie heute jedes Kind in eine Welt voller Autos und Bildschirme. Heißt: Tomasellos Wagenhebereffekt vollzieht sich unabhängig davon, ob die jeweils sich entwickelnde Kultur langfristig lebensdienlich ist oder nicht. Wo man immer Bäume gefällt hat, fällt man Bäume.
Kulturelle Praxis ist gelebte Praxis, keine diskursive, reflektierte, gedachte Angelegenheit, wo man einfach sagen kann: Moment, hier stimmt was nicht! Deshalb wird eine solche Praxis manchmal auch um die Gefahr der Selbstaufgabe nicht verlassen. Auf unsere heutige Form von Wirtschaft übertragen: Wo man immer mehr produziert hat, produziert man immer mehr – ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gilt als um jeden Preis zu vermeidende Katastrophe. Als die Coronakrise ausbrach, war die Zunft der Ökonomen zwar komplett unfähig, auch nur eine einzige Idee zur Krisenbewältigung vorzulegen, konnte aber flugs ausrechnen, dass die Wirtschaft im vierten Quartal um soundsoviel Prozent wachsen würde, mit Kommastelle. Und 2021 um soundsoviel Prozent. Das war zwar falsch, wie meistens, was aber komischerweise nichts macht. Die Standardökonomie betrachtet sich als Wissenschaft und wird auch von der Gesellschaft als solche betrachtet, ist aber nichts anderes als Priestertum. Sie hat Rituale der Verkündigung (des Ratschlusses der »Wirtschaftsweisen«), Wallfahrten (zum World Economic Forum in Davos) und magische Erklärungen für die Einrichtung der Welt (der Markt hat …), nicht anders als die Priesterschaft der Osterinsel. Ihr Gott heißt Wachstum.
Es könnte sein, dass das Prinzip des Wachstumskapitalismus zur Kategorie der irrtümlichen Kulturmodelle zählt. Und das ist insbesondere deshalb sehr schwer zu begreifen, weil der Kapitalismus ja so konkrete Verbesserungen von Bildung, Gesundheit, Recht, Freiheit mit sich gebracht hat, wie man sie sich zuvor kaum hätte vorstellen können. Die Menschen in den reichen Gesellschaften leben heute allesamt besser als Ludwig der XIV., keine schlechte Bilanz für den Kapitalismus. Aber seine Geschichte ist, gemessen an den 200000 Jahren Geschichte des Homo sapiens, sehr kurz, schlappe 200 Jahre; seine globale Verbreitung zählt erst ein paar Jahrzehnte.
Die meisten untergegangenen Kulturen haben länger durchgehalten, 800, 900 oder auch ein paar tausend Jahre. Das vermag den Eindruck einer Nachhaltigkeit unseres Kulturmodells nochmals zu relativieren. Vielleicht ist ja der Anfang von seinem Ende genau damit markiert, dass die tote Masse größer geworden ist als die lebendige. Vielleicht ist das ein tipping point, einer jener Punkte, von dem aus man nicht mehr zurück in den vorherigen Zustand kommen kann, ab dem etwas unkorrigierbar wird. Aber vielleicht gibt es in der Geschichte der Menschen solche Punkte gar nicht, weil ihre Lebensform, wie gesagt, ohnehin in permanenter Veränderung und Anpassung besteht.
Und in Techniken der Vorausschau. Was den nieder- und untergegangenen Gesellschaften gefehlt hat, war die Möglichkeit, sich wie in einem Gedankenexperiment von außen zu betrachten – so, wie ich mir manchmal vorstelle, wie Historikerinnen und Historiker in 300 oder 500 Jahren versuchen, unsere zuweilen seltsame Welt im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts zu verstehen. Ein solcher Verfremdungseffekt wäre aufschlussreich und hilfreich dafür, Pfade zu finden, die von falschen Richtungen hinwegführen. Eigentlich müssten moderne Gesellschaften Nachrufe auf sich selbst schreiben, in denen sie entwerfen, wie sie sich entwickelt haben werden wollen. Das hört sich grammatisch schwierig an, aber so eine Rückschau aus einer imaginierten Zukunft bricht die Diktatur der Gegenwart, in der zu viele Entscheidungen aus dem kulturellen Unbewussten heraus getroffen werden. Und es bricht den horizontlosen Katastrophismus, in dem wir uns kulturell eingerichtet haben, weil wir fürchten, dass die Zukunft auf jeden Fall eines sein wird: schlechter als die Gegenwart. Wir müssen Zukunft wieder als Gestaltungsaufgabe sehen lernen, nicht als etwas, was man am liebsten vermeiden möchte, weil so vieles – Erderhitzung, Artensterben, Konjunktur der Diktatoren – so düster aus einer kommenden Zeit heraufscheint.
Aber es gibt kein Ende der Geschichte. Die Geschichte ist nur dann zu Ende, wenn die Menschen sich abgeschafft haben. Werden. Die Geschichte wird dann zu Ende gewesen sein, wenn die Menschen sich abgeschafft haben werden. Das ist ein sinnloser Satz. Denn wenn das der Fall ist, gibt es ja niemanden mehr, der das zur Kenntnis nehmen könnte. Jeder sinnvolle Satz setzt eine zukünftige Welt voraus.[4] Solange wir miteinander sprechen, ist die Geschichte nicht zu Ende.
Die Zeit davor
Es wäre also ziemlich blöd, ein Buch für die Zeit danach zu schreiben. Was wir brauchen, sind Bücher für die Zeit davor. Also nicht noch eins zum Verhängnis der Welt, zur Klimakatastrophe, zum Artensterben, zur Plastikflut, zum Untergang. Letztlich sind das ja Bücher für die Zeit danach, wenn es niemanden mehr gibt, der sie lesen könnte.
Freundinnen und Freunde: Lasst uns uns besser um die Zeit davor kümmern! Lasst uns aufhören, Abgesänge auf die Zukunft zu schreiben. Die sind nur rituelle Beschwörungen dessen, dass es das Ende der Geschichte nicht geben kann, weil es das nicht geben darf. Aber alle diese Beschwörungen – es ist noch nicht zu spät, wir haben gerade noch Zeit, es ist ganz kurz vor zwölf (wie lange eigentlich schon?) – lenken permanent von dem einfachen Sachverhalt ab, dass das Leben vor dem Tod spielt. Deshalb sollten wir, individuell wie gesellschaftlich, das Leben vor dem Tod nach der Maßgabe dessen gestalten, wer und wie wir gewesen sein wollen.
Ich war selten melancholischer als in den Tagen nach dem Tod von Frank Schirrmacher. Kaum jemand hat jemals so viele Nachrufe bekommen wie er, der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ihr Feuilletonchef. Sein Wirken war so eindrucksvoll und wichtig, dass man sich nach seinem »viel zu frühen« Tod kaum genug daran tun konnte, alles aufzuzählen, was er Wichtiges und Bedeutendes gesagt und getan hatte. Und wie groß der Verlust sei.
Undsoweiterundsoweiter. Was mich so melancholisch machte, war der Umstand, dass es nur einen einzigen Menschen gab, der alle diese Verdienste nicht zur Kenntnis nehmen, nicht in all den Nachrufen nachlesen konnte. Dieser Mensch war ausgerechnet Frank Schirrmacher selbst, den seine Nachrufe nicht mehr erreichen konnten, denn er war ja nun mal tot. Wie gesagt: Jeder sinnvolle Satz setzt eine zukünftige Welt voraus. Insofern wären Nachrufe nur dann sinnvoll, wenn sie für das Leben davor geschrieben würden, nicht für das danach, das es ja nicht gibt.
Deshalb sollte jede und jeder einen Nachruf über sich selbst schreiben, darüber, wie sie oder er gelebt zu haben hofft, wenn er noch lebt. Danach schreiben die Nachrufe andere, und dann ist es einem zwangsläufig nicht nur egal, was da drinsteht, man hat auch keinen Einfluss darauf. Ich habe den Verdacht, dass die Aufgabe, einen Nachruf auf sich selbst zu schreiben, eine sehr produktive Sache wäre, denn in gewisser Weise würde man sich ja selbst verpflichten, so werden zu sollen, wie man gewesen zu sein gehofft hatte. Dabei kommt natürlich viel mehr heraus, als wenn man nur so vor sich hinlebt und gelebt wird, und dann kriegt man einen Nachruf. Wenn es hoch kommt. Die meisten kriegen ja keinen. Den Nachruf auf mich selbst können Sie ab S. 207 lesen, erst möchte ich Ihnen aber noch ein paar Geschichten erzählen.
Der große Refraktor
Eine der zahllosen Tagungen zum Klimawandel und zur notwendigen Klimapolitik fand im Großen Refraktor auf dem Telegraphenberg in Potsdam statt, keine Ahnung, wann genau das war. Sagen wir, vor zehn Jahren, im Grunde ist es auch egal. Der Große Refraktor ist so etwas wie das Teleskop an sich, 1899 von Kaiser Wilhelm eingeweiht, ein Monument des wissenschaftlich-technischen Zeitalters, noch heute das viertgrößte Teleskop der Welt, tolle Sache.
Ich erinnere mich an diese Konferenz nicht nur wegen des wahrlich eindrucksvollen Ortes, sondern auch deswegen, weil sie als open space organisiert war, also ausnahmsweise kein festgelegtes Programm – Vortrag, Diskussion, Vortrag, Diskussion usw. – hatte, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst Themen für Sessions vorschlagen konnten, deren Ergebnisse dann wiederum vorgestellt und debattiert wurden. Es gab eine Menge Themen – CO2-Bepreisung, bessere Kommunikation der Klimaproblematik, Strategien der Einwerbung von Forschungsgeldern –, die gut angenommen und bearbeitet wurden. Ich hatte das Thema »What if we fail?« vorgeschlagen. Es schien mir sinnvoll, dieses open space einmal dafür zu nutzen, ganz »open« die Möglichkeit zu besprechen, dass nach Lage der Dinge alle Anstrengungen, das damals noch postulierte 2-Grad-Ziel zu erreichen, ebendieses Ziel verfehlen könnten, dass man mithin den Klimawandel nicht einbremsen würde – was dann?
Abb. 2: Schöner ist es immer draußen: Großer Refraktor
Auch heute noch, mindestens ein Jahrzehnt später, bin ich der Auffassung, dass die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten, davon abhängt, die Bedingungen dafür realistisch zu betrachten, also nicht nur von dem Wunsch getrieben, dass das doch bitte irgendwie gutgehen möge, trotz aller Daten, die dagegensprechen. Und ein solcher Realismus muss das Scheitern einkalkulieren, sonst weiß man gar nicht, welche Maßnahmen und Forderungen entwickelt werden müssen, um das Scheitern zu verhindern oder dessen Folgen zu vermindern. Es ist ja erheblich wahrscheinlicher, dass es nicht gelingen wird, die Klimaerwärmung bei 2 Grad plus einzubremsen, als dass es gelingen wird[5] – was aber dann? Ist dann die Welt zu Ende? Oder nur die Klimapolitik? Macht es dann keinen Sinn mehr, menschliches Handeln so zu modernisieren, dass die große Zerstörung der Lebensgrundlagen aufhört oder wenigstens zurückgefahren wird? Und dass wir ruinierte Wälder, Gewässer, Moore, Böden wieder restaurieren?
Also schien mir die Frage »What if we fail?« gerade für eine Konferenz zum Klimawandel höchst naheliegend zu sein, und im Übrigen interessierte mich die Antwort auf diese Frage selbst brennend. Schließlich ist sie als Überlebensfrage alles andere als trivial, besonders wenn sie unbeantwortet bleibt. Aber außer mir gab es nur einen einzigen anderen Teilnehmer, der dieses Thema interessant fand, also plauderten wir ein bisschen, verpassten alles andere und hatten zum abschließenden Plenum nicht ernsthaft etwas beizutragen. Die Abstimmung mit den Füßen hatte ja die Relevanz der Frage nach dem Scheitern empirisch schon hinreichend dementiert. »What if we fail?« war als Thema abgewählt worden.
Inzwischen ist bekanntlich das 2-Grad-Ziel auf das 1,5-Grad-Ziel erhöht worden, ganz unbeschadet der Tatsache, dass die Emissionen zwischenzeitlich in einem Ausmaß weiter angewachsen sind, dass bereits die 2 Grad noch unrealistischer geworden sind als zum Zeitpunkt ihres ersten Ausrufens. Aber solche sozialen Tatsachen stören eine naturwissenschaftliche Vernunft nicht, die auf der Grundlage höchst komplexer Mess- und Berechnungsverfahren einfach die Notwendigkeit einer solchen Begrenzung festlegt.[6] Wenn es 1,5 Grad sein müssen, müssen es 1,5 Grad sein, fertig. Leider jedoch nimmt das Klimasystem eine solche wissenschaftlich unbestechliche Festlegung nicht zur Kenntnis, sondern verarbeitet die ganz ungebrochen wachsende Emissionsmenge von Treibhausgasen, indem es sich munter weiter erwärmt.
Dass das Ganze noch an einem historischen Ort der Huldigung der modernen Wissenschaft stattfand, erschien mir durchaus symbolisch. Denn der riesige Raum, in dem der große Refraktor stand, war ja ausschließlich dafür geschaffen, aus ihm hinauszublicken, in die unendlichen Weiten des Universums. Um in sich und in das eigene Tun hineinzublicken, dafür war er nicht gedacht. Deshalb heißt er ja auch Refraktor und nicht Reflektor.
Seit diesem Erlebnis denke ich darüber nach, was es bedeutet, dass es innerhalb der wissenschaftlichen Vernunft nicht möglich zu sein scheint, für denkbar zu halten, dass die ganze Sache schlecht ausgehen könnte. Einfacher gesagt: Innerhalb dieser an die Geschichte der Aufklärung gebundenen Vernunft gibt es einfach keine Kategorie der Endlichkeit und keine Strategie des Aufhörens mit irgendetwas, das man mal begonnen hat. Soweit ich sehe, gibt es auch keine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Endlichkeit menschlicher Bemühungen befasst. Zwar gibt es Regalmeter apokalyptischer Schriften, nicht nur aus der esoterischen Abteilung, sondern vor allem aus der öko- und klimatologischen, aber die enden dann alle nicht mit einem »Lasst fahren dahin«, sondern mit dem unvermeidlichen »Es ist noch nicht zu spät.« Und dann folgen ebenso unvermeidlich »die gemütlichen kleinen Gesten des Fahrradfahrens, Energiesparlampen-Benutzens, Kurzduschens und Elektrogeräte-Reparierens«, wie Eva Horn angemessen wütend formuliert.[7]
Das Ende und die Endlichkeit kommen nur unwissenschaftlich vor, in der Lebenserfahrung, in der Literatur oder in der Kunst. Und, natürlich, in der Religion und damit in der Apokalypse. In der wissenschaftlich-technischen Welt gibt es dafür keinen Platz, was ungünstig für den Fall ist, in dem man es tatsächlich mit einem Endlichkeitsproblem zu tun hat. Und damit zurück zum Refraktor: In dem blickt man nach draußen, weil man entdecken möchte, was es außerhalb der Welt gibt. Außerhalb der Welt gibt es erfreulicherweise die Unendlichkeit, das Universum, und damit nichts, was eine Grenze bilden würde. Und tatsächlich ist ja die Unbegrenztheit des Fortschritts, das Überschreiten von Grenzen des für möglich Gehaltenen, die mythische Voraussetzung der modernen Wissenschaft – mit Nobelpreisen ausgezeichnet wird ja niemand, der festgestellt hat, dass etwas nicht geht. Nobelpreise bekommt man, wenn man es geschafft hat, eine Grenze der Erkenntnis oder des für machbar Gehaltenen zu überschreiten. Nicht zufällig datiert man ja den Beginn der modernen Wissenschaft auf die Dezentrierung des Weltbildes, die mit Kopernikus die Erde aus dem Zentrum des Sonnensystems rückte und zu der Galilei das Teleskop lieferte. Seit wir nicht mehr das Zentrum sind, schauen wir lieber nach draußen. Dafür steht der Große Refraktor: für den grenzenlosen Blick.
Würde man dagegen nach innen blicken, also auf sich selbst und das eigene Tun, Hoffen und Streben, käme man am Sichten zumindest einer Grenze definitiv nicht vorbei. Denn man würde unausweichlich mit einer simplen Tatsache konfrontiert werden: dass es auf jeden Fall eine Sache gibt, die endlich ist, und das ist leider ausgerechnet das eigene Leben. Wir alle wissen, dass wir sterblich sind, und das ist eine höchst unangenehme Tatsache. Der Tod passt nicht ins Leben, weil er sein Gegenteil ist, und ich werde noch ausführen, weshalb er besonders in der Moderne nicht ins Leben passt und gerade hier, in unserer Epoche, als so ausgesprochen fehl am Platze, furchterregend und als Antithese zu allem, was man versucht, empfunden wird. Aber ja, das Leben ist endlich, und die grotesken Ideen, dass man es verewigen könne, indem man seinen Geist, oder was man dafür hält, auf eine Festplatte lädt, sprechen ja nur Bände darüber, wie furchterregend der Tod gerade für diejenigen ist, die ihn technisch zu überwinden hoffen und sich notfalls dafür zu Lebzeiten kryokonservieren lassen möchten, um wieder aufgetaut zu werden, wenn die Wissenschaft dann schon mal ein Stückchen weiter ist.
Bevor in unserem Kulturmodell eine Endlichkeitskrise auch nur in Sicht kommt, werden technische Phantasien mobilisiert: Die Digitalisierung wird ein Wunder der Energieeinsparung vollbringen, Wasserstoff wird die Rettung sein, das E-Auto wird den Klimawandel abwenden, und so wird es grüner Treibstoff für die Flugzeuge tun. Statt es für möglich zu halten, dass in Zukunft weniger Energie erzeugt und verbraucht wird, weil es zum Beispiel keine Autos und Flugzeuge mehr gibt, werden um zwei Generationen zu spät gekommene Technohelden wie Elon Musk glühend verehrt, hofiert und mit Geld zugeschissen, obwohl sie nichts anderes zu bieten haben als die Mobilitätsutopien der 1950er Jahre: Raketen, Autos und Hyperloops, alles Dinge, mit deren Hilfe man rasend schnell irgendwo hinkommen soll, ohne dass auch nur einmal die Frage gestellt wurde, was man da denn soll. Diese Zukunft ist höchst antiquiert und erzählt eigentlich nur eine Geschichte vom Verlust der sozialen und moralischen Intelligenz im 21. Jahrhundert.
Denn die wesentlichen Fortschritte im Zivilisationsprozess basierten auf der Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Menschen, und die Technik kam dabei nur dann zur Hilfe, wenn man wusste, wie man sie zu dieser Verbesserung einsetzen konnte. Dass es in modernen Gesellschaften so viel weniger Gewaltopfer als im Mittelalter gibt, liegt nicht an besserer Waffentechnik oder an Überwachungskameras, sondern am Gewaltmonopol des Staates, und das ist das Ergebnis sozialer Intelligenz, nicht wissenschaftlicher. Solche Intelligenz muss sich immer auf einen normativen Zweck hin begründen, was dann herauskommt, ist nicht Innovation, sondern Fortschritt.
Dass gegenwärtig der Begriff der Innovation den des Fortschritts ersetzt zu haben scheint, ist kein Zufall: denn die Innovation braucht keine normative Referenz, sie ist ja schon erreicht, wenn etwas neuer ist als etwas anderes, unabhängig von der Frage, ob es überhaupt der Erneuerung bedurfte. Die Verkehrsunfallstatistiken führen vermehrt Unfälle auf, die dadurch entstehen, dass Autofahrer heute etwa die Einstellung des Scheibenwischers auf eine andere Intervallgeschwindigkeit in Untermenüs auf Touchscreens suchen müssen und dabei dann leider nicht auf die Straße gucken und irgendwo dagegensemmeln. Einen klassischen Hebel am Lenkrad kann man einstellen, ohne hinzusehen. Seine Bedienfunktion auf einen Bildschirm zu verlagern ist zwar innovativ, aber idiotisch. Fortschritt entscheidet sich demgegenüber an der Frage, ob eine Erneuerung etwas zu einem normativ begründeten Zweck beisteuert. Wenn nicht, kann man ihn auch sein lassen. Genauso wie man sinnlos oder obsolet gewordene Entwicklungen abbrechen und sein lassen könnte.
Aber wir haben leider keine Methodik des Aufhörens, weil es dem magischen Denken unserer gegenwärtigen Sinnwelt nach ja immer weitergeht und Endlichkeitsprobleme systematisch nicht existieren. Weg-von-hier, das ist das Ziel. Weil wir keine Methodik des Aufhörens haben, hören wir auch nicht auf.
Auf das Problem der Erderhitzung bezogen: Um das zu bewältigen, müsste man mit vielem aufhören, dem Bergen von immer mehr Rohstoffen zur Erzeugung von immer mehr Produkten und Dienstleistungen zum Beispiel. Man müsste aufhören, den Umfang unseres wirtschaftlichen Stoffwechsels zu vergrößern, und damit beginnen, ihn zu verringern. Man müsste Endlichkeit methodisch übersetzen, und das bedeutet eben nichts anderes als lernen aufzuhören. Man müsste anzuerkennen lernen, dass Leben Sterben bedeutet, unausweichlich. Als Individuum kommt man um dieses Lernen nicht herum, auch wenn man sich noch so sehr dagegen sträubt. Als Gesellschaft verfügen wir über eine riesige, ausgebaute und höchst komplexe Apparatur, um dieses Lernen um jeden Preis zu vermeiden. Wir sind in diesem Sinn keine »Wissensgesellschaft«, sondern eine »Wissensvermeidungsgesellschaft«. Als Kultur haben wir kein Konzept unserer eigenen Endlichkeit; der Tod ist keine kulturelle Kategorie, gesellschaftlich gibt es ihn gar nicht.
Media in vita
Als kleines Zwischenspiel zwei Strophen aus dem Gedicht »Media in vita« von Theobald Tiger (Kurt Tucholsky) 1931:
Jeden Morgen, wenn ich mich rasiere,
denk ich in dem Glanz des Lampenscheins,
während ich mich voller Seife schmiere:
jetzt sinds nur noch x-mal minus eins.
Und da steh ich voller Schaum und Frömmigkeit,
und ich tu mir außerordentlich leid.
Da, wo sich die Parallelen
schneiden, fliege ich dann hin.
Ach, ich werde mir doch mächtig fehlen,
wenn ich einst gestorben bin,
Andern auch –? Wer seine Augen aufmacht, sieht:
Sterben ist, wie wenn man einen Löffel aus dem Kleister zieht.
Tote Menschen haben keine Probleme
»Der Tod ist ein Problem der Lebenden. Tote Menschen haben keine Probleme.« So lakonisch sagt es Norbert Elias und zeigt sich damit ganz als Mitglied einer aufgeklärten, nachmetaphysischen Kultur, in der der tote Mensch glasklar als lebloser Körper, als Materie ohne Bewusstsein betrachtet wird, der dementsprechend auch keine Empfindungen und somit keine Probleme haben kann. Rational, also im Rahmen seiner modernen Vernunft, wird man dieser Sicht zustimmen, emotional ist das aber gar nicht so sicher – wahrscheinlich ertappt man sich gelegentlich, bei einer Beerdigung oder bei einem Spaziergang über einen Friedhof, doch bei der unangenehmen Frage, wie es denn wohl ist, wenn man tot ist. Und diese Frage ist unangenehm nur deshalb, weil man sich ja doch unwillkürlich irgendwie irgendwo so eine Art Bewusstsein über sich selbst unterstellt, wenn man an sich als Gestorbenen denkt. Daher sind scheinbar klar zu beantwortende Fragen, etwa nach der Organspende, nach Erd- oder Feuerbestattung, nach Patientenverfügungen, Testamenten usw. usf., bei reflexiver Betrachtung gar nicht so klar: Denn schließlich denkt man bei Fragen solcher Art ja über sich selbst in einem Zustand nach, den man aus seinem Leben nicht kennt. Sagen Sie es nicht weiter, aber ich ertappe mich auf Friedhöfen bei der Frage, ob es nicht unangenehm ist, im Grab nebenan einen Gestorbenen liegen zu haben, den man nicht ausstehen kann. Oder zu dicht an der Straße beerdigt zu sein. Seltsam: Wir alle müssen sterben, das weiß man sicher; aber niemand weiß, wie es ist, tot zu sein.
Genau aus diesem Grund betrachtet die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem menschlichen Verhältnis zum Tod, egal ob sie philosophischer, soziologischer oder psychologischer Natur ist, ebendieses Verhältnis als höchst spannungsvolles: Denn die Menschen sind, vermutlich, die einzigen Tiere, die um ihren eigenen künftigen Tod wissen, aber sie können gegen dessen Unabänderlichkeit am Ende so wenig ausrichten wie alle anderen Tiere auch. Beim Nachdenken über »die letzten Dinge« kommt unausweichlich eine andere Kategorie ins Spiel, über die, vermutlich, auch nur die Menschen sich den Kopf zerbrechen, nämlich: der Sinn des Lebens. Auch wenn man Douglas Adams und seine Geschichte vom Computer mag, der mit der Beantwortung der Frage nach dem »Sinn des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest« befasst ist und schließlich nach mehreren Millionen Jahren Rechnerei als Ergebnis »42« ausspuckt, mithin das Leben und das Universum für prinzipiell sinnlos hält, wird man es doch unbefriedigend finden, auch sein eigenes geliebtes Leben, seine Hoffnungen, Enttäuschungen, das Gelingende, Gelungene, Misslungene, Glänzende und Peinliche unter »42« einzuordnen. Denn egal ist es einem ja durchaus nicht, das eigene Leben. Den meisten jedenfalls.
Zweifellos: Der Tod steht als »großes Umsonst« (Ernst Bloch) unseren ganzen Wünschen nach Dauer, Ewigkeit, Unsterblichkeit kühl und sachlich entgegen, und die schon erwähnte heutige Phantasie, sich postmortal geistig auf eine Festplatte geladen und gewissermaßen ewig weiterdenkend anzustreben, ist auch nicht vielversprechender als die Hoffnung, man werde als ein anderes Wesen wiedergeboren, erreiche eine nächste Seinsform als Licht-, Geist- oder Astralwesen, komme in den Himmel oder in die Hölle oder habe Sex mit 72 Jungfrauen, falls man ordentlich als Märtyrer abgetreten ist. Egal wie die Aussichten sind: Sicher sind sie in keinem Fall, und auch der IS-Kämpfer hat entsetzliche Angst davor, zum Beispiel ausgerechnet von einer kurdischen Peschmerga zur Strecke gebracht zu werden und deswegen postmortal kein Ticket für den hübschen Platz im Macho-Märtyrerhimmel zu bekommen. Das Jenseits ist ein unsicherer Ort.
Die bedrückende Unsicherheit gegenüber dem Tod und der wahrscheinlich sehr langen Zeit, die danach auf einen wartet, ist natürlich in der säkularisierten Moderne besonders ausgeprägt, in der der Tod insbesondere deshalb keinen rechten Ort hat, weil man ja weder Himmel noch Hölle noch irgendein anderes Jenseits empirisch auffinden kann und ihn, den Tod, dementsprechend in einer Abteilung unterbringen muss, die dem ganzen rationalen Normalbetrieb nicht zugehört und in die man nicht gern geht, eigentlich nur, wenn man muss. Das heißt, der Tod steht schon erkenntnismäßig außerhalb der Moderne, deren Selbstverständnis ja darin liegt, dass alle natürlichen Vorgänge durch eine fortschreitende Wissenschaft wenn nicht gleich, dann doch peu à peu restlos aufzuklären seien. Aber auch wenn das Genom entschlüsselbar ist, schwarze Löcher fotografiert und Hirnaktivitäten mit bildgebenden Verfahren sichtbar gemacht werden, künstliche Intelligenz bei der Tumorerkennung hilft und Impfstoffe in zuvor für unmöglich gehaltenen Zeiträumen entwickelt werden: Was der Tod ist, das weiß immer noch niemand. Und wie man ihn abschaffen könnte, schon gar nicht. Da muss alle Wissenschaft passen. Mit anderen Worten: Der Tod ist das Andere der Aufklärung, der unaufklärbare Rest, eine lästige Erinnerung daran, dass Wissenschaft Grenzen hat und, leider, auch daran, dass jedes Leben endlich ist.
Ich habe jetzt das eine oder andere Werk zur »Geschichte des Todes« oder zu »Tod, Modernität und Gesellschaft« gelesen, weil mich der Gedanke beschäftigt, dass unsere moderne Gesellschaft kein Verhältnis zum Tod und damit zur Endlichkeit hat und dass dieser merkwürdige Sachverhalt viel mit dem Unvermögen zum Aufhören zu tun hat, das unser Kulturmodell seit dem Aufstieg des Wachstumskapitalismus mehr und mehr prägt. Und wenn wir nicht aufhören können, können wir mit Endlichkeitsproblemen wie dem Klimawandel oder dem Artensterben auch nicht fertigwerden. Das ist eigentlich sehr einfach.
Umgekehrt ist es zweifellos so, dass die vormodernen Gesellschaften ein Verhältnis zum Tod hatten und auch haben mussten, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. In Zeiten, in denen die Lebenserwartung wie um 1700 bei unter 30 Jahren oder – wie in Deutschland noch vor nur 150 Jahren – bei unter 40 Jahren liegt, ist man dem Tod gewissermaßen immer nahe, näher jedenfalls, als wenn einem wie heute statistisch mehr als die doppelte Lebenszeit zur Verfügung steht. Das Anwachsen der durchschnittlichen Lebenserwartung vollzieht sich parallel zum Aufstieg des Industriekapitalismus und damit der modernen Gesellschaft westlichen Typs; allein zwischen 1871/1881 und 1949/1951 hat sich, wie Statista schreibt, »die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt für Männer um 29 Jahre und für Frauen um 30 Jahre erhöht. In der zweiten Hälfte des 20. bis hinein ins 21. Jahrhundert, von 1949/1951 bis 2016/2018, ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt für Männer um 13,9 Jahre und für Frauen um 14,8 Jahre gestiegen.«[8]
Ein solcher Anstieg der Menge an Zeit, die ein Leben bereithält, wäre zu Beginn des 19. Jahrhunderts für völlig unmöglich gehalten worden, und er ist nicht allein, obwohl das meist gesagt wird, auf den medizinischen Fortschritt zurückzuführen. Zwar kann man heute viele Krankheiten heilen, an denen die Menschen vor ein paar Jahrzehnten noch gestorben sind, aber schon wenn man an die gigantischen Erfolge bei der Eindämmung von Infektionskrankheiten denkt, kommen statistische Effekte in den Blick. Denn richtig alt geworden sind einzelne Menschen auch früher schon, aber eben nur wenige. Die meisten raffte es schon in jüngeren Jahren dahin, sei es wegen einer entzündeten Zahnwurzel, einer Blinddarmentzündung, einer Cholera-Infektion, aber eben auch wegen eines allgemeinen Gewaltniveaus, das die Wahrscheinlichkeit, eines »unnatürlichen« Todes zu sterben, um ein Vielfaches höher gemacht hat, als es heute in modernen Rechtsstaaten der Fall ist.[9]
Mit anderen Worten: Es war nicht der wissenschaftliche Fortschritt allein, der die Lebenszeit für sehr viele Menschen verlängert hat – es waren auch Fortschritte in der Organisation des menschlichen Zusammenlebens, also des Zivilisationsprozesses, die den Abstand von der Geburt zum Tod so außerordentlich vergrößert haben.
Psychologisch bedeutet es aber, wenn der eigene Tod nicht schon kurz nach dem Eintritt ins Erwachsenenalter in den Horizont des Erwartbaren rückt, sondern normalerweise eine Angelegenheit des »Alters« ist, dass man sich erst mal fünf, sechs Jahrzehnte darüber keine ernsthaften Gedanken machen muss. Der Tod ist für den Hauptteil des Lebens nicht so wichtig.
Eine andere statistische Größe, die sich auf die durchschnittliche Lebenserwartung auswirkt, ist die Säuglings- und Kindersterblichkeit. Um 1820 stirbt jedes fünfte Kind im ersten Jahr nach der Geburt, etwa ein weiteres Drittel erreicht das Erwachsenenalter nicht. Unter solchen Bedingungen ist der Tod eines Kindes eine Normalität, was nicht heißt, dass das kein höchst schmerzhaftes Ereignis für die betroffenen Eltern gewesen wäre. So schreibt etwa Karl Marx 1855 nach dem Tod seines achtjährigen Sohns Edgar an Friedrich Engels: »Es ist fast unbeschreiblich, wie das Kind uns überall fehlt. Ich habe schon allerlei Pech durchgemacht, aber erst jetzt weiß ich, was ein wirkliches Unglück ist.«[10]