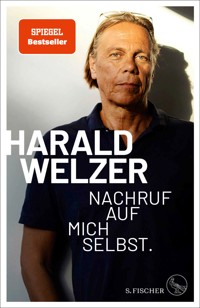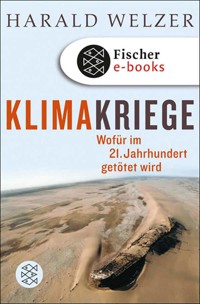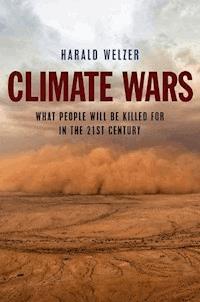14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sinkende Wahlbeteiligung, Kirchenaustritte, fallende TV-Quoten und Zeitungs-Auflagen: Viele Menschen fühlen sich vom Angebot, das ihnen die politische und mediale Öffentlichkeit in Deutschland macht, nicht mehr angesprochen. Zugleich erhöhen Multi-Krisen und eine immer kaputtere Daseinsvorsorge – Schienenverkehr, die Schulen, die Verwaltung – den Stress der Bürgerinnen und Bürger. Jetzt wird das Erbe von vier Jahrzehnten neoliberaler Fehlsteuerung des Staates als Erosion der materiellen und mentalen Infrastrukturen erkennbar. Wo Polizisten, Ärztinnen, Rettungspersonal oder Zugbegleiterinnen angegriffen werden, wirken die Rituale der Politik nur zynisch. Wenn Kinder keinen ordentlichen Unterricht mehr bekommen, Schwimmbäder und Krankenhäuser schließen und öffentliche Orte verwahrlosen, wächst die Enttäuschung über eine Politik, die ihre Wähler aus dem Blick verliert. Zumal, wenn eine zentral wichtige Aufgabe wie der Kampf gegen den Klimawandel nicht bewältigt wird. Stattdessen kämpft die Regierung gestrige Positionen gegeneinander aus, simuliert Konzepte in endlos aufeinanderfolgenden Gipfeltreffen und kompensiert die vorhandene Ideenlosigkeit mit einem Überschuss an Moralismus. Das alles wird von einem Mediensystem unterstützt, das sich mehr für den Schauwert von Politik interessiert als für das Gelingen von Gesellschaft. Ein Buch über die Fahrlässigkeit und Arroganz einer politischen und medialen Klasse, denen die gefährlich groß werdende Distanz zwischen der Bürgerschaft und der Bundespolitik gleichgültig zu sein scheint und die längst die Fühlung für die soziale Wirklichkeit im Land verloren hat. Und eine Ermutigung für alle Empörten, nicht länger still zu bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Harald Welzer
ZEITEN ENDE
Politik ohne Leitbild, Gesellschaft in Gefahr
Über dieses Buch
Viele Menschen fühlen sich vom Angebot, das ihnen die politische und mediale Öffentlichkeit in Deutschland macht, nicht mehr angesprochen. Multi-Krisen und eine immer kaputtere Daseinsvorsorge erhöhen den Stress der Bürgerinnen und Bürger. Jetzt wird das Erbe von vier Jahrzehnten neoliberaler Fehlsteuerung des Staates als Erosion der materiellen und mentalen Infrastrukturen erkennbar. Es wächst die Enttäuschung über eine Politik, die ihre Wähler aus dem Blick verliert.
Ein Buch über die Arroganz einer politischen und medialen Klasse, denen die gefährlich groß werdende Distanz zwischen Bürgerschaft und Bundespolitik gleichgültig zu sein scheint und die längst die Fühlung für die soziale Wirklichkeit im Land verloren hat.
Aber auch eine Ermutigung für alle Empörten, nicht länger still zu bleiben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Harald Welzer, geboren 1958, ist Sozialpsychologe. Er ist Direktor von FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit und des Norbert-Elias-Centers für Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg. In den Fischer Verlagen sind von ihm u. a. erschienen: »Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden«, »Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird«, »Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen«, »Nachruf auf mich selbst. Die Kultur des Aufhörens« und – gemeinsam mit Richard David Precht – »Die vierte Gewalt. Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist«. Seine Bücher sind in 21 Ländern erschienen.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60395 Frankfurt am Main
Covergestaltung: LINELAND Werner Marschall
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491911-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
1. Wer bewohnt Deutschland?
Uwe
Kündigungen
Die moralische Substanz
2. Was war noch mal die »Zeitenwende«?
Politische Folklore
Natur spricht
Demokratie muss man persönlich nehmen
3. Das Krisengeflecht
Von sich selbst nicht aufgehalten sein
Vorbeben
Das Krisengeflecht
Die Käfer reagieren nicht adäquat
4. Kein Rückzug, nirgends
Normalitätserwartungen
Die Renaissance des Imperialismus
Klimawandel und Krieg
Die Utopie des Gewaltverzichts
Ein aufgeklärter Pazifismus
Der moralische Imperativ von Rückzug und Verzicht
Moralische Phantasie
5. The rest of the West. Oder: Versiegen lernen
6. »Die« Wirtschaft
Der Mythos der »Dekarbonisierung«
Der Mythos der Nachhaltigkeit
Eine Ökonomie der Endlichkeit
Wirtschaftsavantgarden
7. »Die« Medien
Einseitige Berichterstattung
Die Akteure
Panzerlieferungen
Panzer? Wieso Panzer?
Zurück an die Arbeit
8. »Die« Politik
Mission impossible
Von der Politikerpolitik zur Politik der Teilhabe
9. »Die« Leute
Die verletzlichste Gruppe ist die wichtigste Gruppe
10. Gesellschaft in Gefahr
Der Verlust einer gemeinsamen Welt
Welches Land wollen wir sein? Oder: Orte des Zusammenhalts
Heimat
Epilog
Bildnachweis
Register
Die Abbildungen des Buches
In memoriam Jutta Limbach
1.Wer bewohnt Deutschland?
Uwe
Am 21. Juli 2022 starb Uwe Seeler, in Norderstedt, einer Stadt von 80000 Einwohnern, die an Hamburg angrenzt. Dort hatte er, zusammen mit seiner Frau Ilka, 63 Jahre lang gewohnt. Seeler war berühmt geworden als Mittelstürmer beim Traditionsverein HSV, die Stadt Hamburg hatte ihn 2003 zum Ehrenbürger ernannt. Legendär ist Seeler nicht nur wegen seiner fußballerischen Erfolge, sondern auch wegen seiner »Normalität«. Er selbst hielt es, wie er in einem Film von Reinhold Beckmann sagt, »für das Schönste, normal zu sein«, und dazu gehörte auch, 1961 ein für die damalige Zeit ungewöhnlich hoch dotiertes Angebot von Inter Mailand abzulehnen, obwohl dessen Trainer Helenio Herrera persönlich nach Hamburg gekommen war, um ihn abzuwerben.
Nach drei Tagen Verhandlungen entschied Seeler, in Hamburg zu bleiben. Das Geld interessierte ihn nicht, schließlich hatte er neben dem Fußball seine Arbeit als Sportartikelvertreter und: »Ich könnte ja nicht öfter als dreimal am Tag ein Steak essen.« Seine Frau Ilka erzählte, dass die Italiener einen Fehler gemacht hätten: Sie hätten nur mit ihm gesprochen, nicht mit ihr, das gehöre sich nicht – ein weiterer Grund für die Ablehnung des Angebots. Auch nach seiner aktiven Zeit blieb Uwe Seeler seinem Verein und Hamburg eng verbunden, wurde kurzzeitig und nicht ganz glücklich auch Präsident des HSV, gründete eine Stiftung, die Menschen mit Einschränkungen unterstützt, trat gelegentlich im Fernsehen auf und verkörperte bis zum Schluss – Normalität.
Wenn es einen Gegentyp zum Angeber gibt, dann war es dieser weltberühmte Fußballer, der gern Autogramme gab, mit den Leuten schnackte, nie selbst zu empfinden schien, dass er – wie man heute sagen würde – prominent war. Er sprach, wie der Sportsoziologe Gunter Gebauer über ihn sagte, immer in der ersten Person Plural. Seine Rolle im Westdeutschland der Nachkriegszeit beschrieb die Frankfurter Rundschau in einem Nachruf so: »Uwe Seeler wirkte auf andere Weise als durch die Liste an Erfolgen. Er stand für Werte, in ihm spiegelte sich eine aufstrebende Nation, die sich vorgenommen hatte, im Wirtschaftswunder nicht abzuheben, weil schließlich noch die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs auf ihr lastete.«
Da ist etwas dran. Die Werte der westlichen Nachkriegszeit hatten – uneingestanden und eingestanden – die Verbrechen der Nazizeit und die Schuld am Zweiten Weltkrieg im Rücken, das bedeutete Vorsicht gegenüber allem, was zu groß und ambitioniert erschien. Noch nie, schreibt der Historiker Ulrich Herbert mit Bezug auf die Entstehung der Bundesrepublik, sei »ein deutscher Staat mit so gebremster Emphase und Zukunftsgewissheit ins Werk gesetzt worden wie dieser. […] die nüchterne, von der Katastrophe der Nazizeit und der Kargheit der Nachkriegsjahre geprägte, ganz aufs Vorläufige gestimmte Gründung des westlichen Teilstaats litt auch nicht, wie die deutsche Republik von 1919, unter dem Druck überspannter, unerfüllbarer Erwartungen.«[1]
Daher gehörte es zum Wertekorsett der frühen Bundesrepublik, eben nicht abzuheben, »normal« zu bleiben, selbst wenn man sehr erfolgreich war. »Maßhalten« war denn auch die Parole, die der damalige Wirtschaftsminister und spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard 1962 in einer Radioansprache ausgab: »Noch ist es Zeit, aber es ist höchste Zeit, Besinnung zu üben und dem Irrwahn zu entfliehen, als ob es einem Volk möglich sein könnte, für alle öffentlichen und privaten Zwecke in allen Lebensbereichen des einzelnen und der Nation mehr verbrauchen zu wollen, als das gleiche Volk an realen Werten erzeugen kann oder zu erzeugen gewillt ist.« Wirtschaftswunder und Konsumgesellschaft waren auch damals schon Schlagworte, aber Ludwig Erhard hatte bereits in seinem Bestseller »Wohlstand für alle« die Ökonomik aufgefordert, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass es eine Zeit nach dem Güterwachstum geben würde – eine Aufforderung, der die etablierten Wirtschaftswissenschaften bis heute nicht nachgekommen sind.
Sein Staatssekretär Alfred Müller-Armack hatte für das Wirtschaftsmodell der Nachkriegszeit den Begriff »Soziale Marktwirtschaft« erfunden – jenen, wie man damals sagte, »dritten Weg« zwischen Kapitalismus und Sozialismus, der mittels der ordnungspolitischen Begrenzung der reinen Marktkräfte eine allgemeine Steigerung des Wohlstands und damit vor allem auch Systemzustimmung zur jungen Demokratie versprach. Und tatsächlich auch lange Zeit realisierte.[2] Der Fortschrittsbegriff der westlichen Nachkriegszeit umfasste weit mehr als jene permanente Steigerung von Konsummöglichkeiten, auf die er heute zusammengeschnurrt zu sein scheint.
Denn vom heutigen Hyperkonsum war die Welt Seelers und Erhards trotz aller »Maßhalte«-Mahnungen noch weit entfernt – die durchschnittlich in Anspruch genommene Wohnfläche pro Kopf lag 1960 bei 20 Quadratmetern[3] (heute 55), auf 1000 Einwohner gab es 81 Autos[4] (heute rund 580), der durchschnittliche Urlaub dauerte fünf Tage und führte nicht zum Helikopterskiing nach Kanada, sondern mit dem Zelt an die Ostsee, und wenn es hochkam und man etwas mehr Zeit hatte, ging es mit der NSU-Lambretta oder dem Käfer nach Italien.[5] In dieser Welt, die trotz aller Begeisterung über Motorräder, Autos, Stabmixer, Waschmaschinen und Weltraumflüge erheblich nachhaltiger war als die heutige,[6] genossen die Bergarbeiter im Ruhrgebiet und im Saarland hohes Ansehen, schaffte man »beim Daimler« oder stand bei Edeka hinter dem Tresen.
Fast zwei Drittel der Jugendlichen gingen 1960 in die Hauptschule, 12,5 Prozent in die Realschule, nur sechs Prozent machten Abitur.[7] Der Soziologe Helmut Schelsky hatte schon 1953 den Begriff von der »nivellierten Mittelstandsgesellschaft« geprägt, die Westdeutschland kennzeichne – aus heutiger Perspektive eine erstaunliche Diagnose, wo doch Menschen mit »niedrigen« oder gar überhaupt keinen Bildungsabschlüssen heute gewiss nur in Ausnahmefällen in die Mittelschicht aufsteigen. Aber die Arbeiterschicht galt damals auch nicht als gesellschaftliche Restkategorie, auf die man herabblickte, sondern hatte gerade in einer Gesellschaft, in der Kategorien wie »Aufbau« und »Aufstieg« und schließlich »Wirtschaftswunder« für das Selbstbild wichtig waren, ein eigenes Selbst- und ein durchaus positives Klassenbewusstsein. Und nicht zuletzt mit der SPD eine eigene Partei, mit der Mitbestimmung einen für kapitalistische Gesellschaften ungewöhnlichen Teilhabestatus und mit starken Gewerkschaften Durchsetzungsmöglichkeiten für ihre Interessen.
Abb. 1: Keiner hätte je »Herr Seeler« gesagt.
Vor diesem Hintergrund wird man, auch wenn Mentalitätsgeschichte eine schwierige Sache ist, diese Gesellschaft im Vergleich zur heutigen insgesamt als deutlich integrierter beschreiben können. Sicher, es gab Jugendkrawalle, eine zahlenmäßig nicht kleine NPD, die Deutsche National-Zeitung mit einer Auflage von 100000 Exemplaren und eine starke Ausgrenzung der ab 1961 ins Land geholten »Gastarbeiter«, aber gleichwohl gab es so etwas wie ein Gefühl der nicht voraussetzungslosen, aber erreichbaren Zugehörigkeit zur Normalgesellschaft. Man war nicht nur »wieder wer«, sondern man war auch wer ohne Abitur, ja sogar ohne Schulabschluss und als »Angelernter« – was es nicht zuletzt wegen des Krieges nicht selten gab und was keineswegs als Deklassierungsmerkmal galt.
Das ist die Welt von Uwe Seeler, der aus einer Arbeiterfamilie kam und einen Hauptschulabschluss hatte. Mich hat sein Tod im vergangenen Jahr auch deshalb betroffen, weil er die letzte öffentliche Person in Deutschland war, die »nur« einen Hauptschulabschluss hatte. Ich beginne dieses Buch mit ihm, weil Menschen ohne Abitur, ohne akademischen Abschluss, ohne den selbstverständlichen Habitus des gehobenen Mittelstands, heute in der Öffentlichkeit dieses Landes nicht mehr vorkommen. Uwe Seeler war der Letzte seiner Art.
Stimmt nicht ganz: Natürlich kommen auch Menschen mit abgebrochener Schulkarriere, ohne Studium oder mit einem scheinbar einfachen Weltbild in der Öffentlichkeit noch vor – aber nur in genau zwei Erscheinungsformen: erstens im Trashfernsehen von RTL als Figuren, die einem sich besser dünkenden Publikum vorgeführt werden, und zweitens als Problemfälle einer Gesellschaft, wenn etwa über die »Tafeln« berichtet wird oder über Unterstützungsempfänger, früher von »Hartz IV«, heute von »Bürgergeld«. Die Tagesschau beliebte, wenn es um Hartz IV ging, die Rückenansicht einer Familie in Joggingklamotten einzublenden, die durch einen Park spazierte. In dieser Illustration steckte schon das komplette Selbstbild des auf die Unterschichten herabblickenden Mittelstands – auf »die anderen«. Und eben das Fremdbild von passiv und unambitioniert durch den Sozialstaat schlurfenden schlechtangezogenen Menschen, deren Kinder – wen wundert’s – genauso sind und bleiben werden wie sie selbst.
In den Redaktionen fiel offenbar niemandem auf, wie denunziatorisch solche Darstellungen sind – als würden die allermeisten derjenigen, die auf die Unterstützung des Sozialstaats angewiesen sind, sich nicht nach Kräften darum bemühen, gerade nicht »anders« auszusehen, sich gut zu kleiden, zu wohnen, ihre Kinder zu unterstützen, ihnen die Teilnahme am Klassenausflug zu ermöglichen, einen Job zu finden usw. Man bezeichnet sie routiniert als »bildungsfern«, diese Leute, so als würde nicht den allermeisten alles daran gelegen sein, dass ihre Kinder gut in der Schule sind, genau um dem Leben am Rand der Mittelstandsgesellschaft zu entkommen. Dass Bildung dafür ein Ticket ist, wissen sie. Dass dieses Ticket allein noch lange nicht reicht, um dazugehören zu dürfen, nicht.
An der Theke kam ich unlängst mit einem Lastwagenfahrer ins Gespräch: »Ich höre den ganzen Tag Radio. Und immer höre ich: ›Hallo, ihr da draußen jetzt auf dem Weg ins Büro, für euch haben wir jetzt…‹ Ich bin aber nicht auf dem Weg ins Büro. Ich bin überhaupt nie in einem Büro. Ich sitze auf dem Bock und bringe Sachen irgendwohin.« Genauso wie fast zwei Drittel der arbeitenden Menschen in diesem Land niemals in einem Büro sind. Denn die fahren Paketautos, putzen U-Bahn-Stationen, versorgen Menschen auf Intensivstationen oder in Pflegeheimen, bändigen Kinder in Tagesstätten, schrauben Autos am Fließband zusammen, graben Gräber auf Friedhöfen, verputzen Wände auf Baustellen, heften Strafzettel unter Scheibenwischer oder schneiden anderen Menschen die Haare oder Fußnägel.[8]
Diese Menschen, die oft erheblich weniger verdienen als die in den Büros, sind in der medialen Öffentlichkeit nicht existent. In den Drehbüchern der Massenware von »SOKO irgendwas«, »Tatort« und »Polizeiruf« kommen sie entweder in der Rolle der Ausstattungskomparsen von eben Baustellen, Fabriken oder Krankenhäusern vor oder gern auch als Leute, die Probleme machen. Günter Wallraff mit seinen Reportagen wie »Ganz unten«, in der er in die Rolle eines türkischstämmigen Arbeiters namens Ali Levent Sinirlioğlu schlüpfte und über die Arbeitsbedingungen unter Tage oder bei McDonalds berichtete, ist ziemlich aus der Mode gekommen; die Bücher von Julia Friedrichs, die die Lebenssituation von Kassiererinnen und Reinigungskräften beschreibt, sind eine Ausnahme auf einem Buchmarkt, in dem solche Menschen eher nicht vorkommen.
Aber da ist der Buchmarkt nur genauso wie die Parlamente. Mehr als neunzig Prozent der heutigen Bundestagsabgeordneten haben Abitur oder Fachhochschulreife, im Bevölkerungsdurchschnitt haben das nur etwas mehr als ein Drittel. 87 Prozent der Abgeordneten verfügen über eine abgeschlossene Hochschulausbildung – im Vergleich zu etwa einem Fünftel in der Gesamtbevölkerung. 16 Prozent der Politikerinnen und Politiker führen einen Doktortitel, aber nur 1,2 Prozent der Menschen im Bundesdurchschnitt. Lediglich sechs Prozent der Abgeordneten haben als höchsten Bildungsabschluss eine Lehre, in der Gesamtbevölkerung gilt das für die Hälfte. In den Landtagen sieht es ähnlich aus, desgleichen in den Wirtschaftsunternehmen und nicht zuletzt in den Medienhäusern.
Der Elitenforscher Michael Hartmann schreibt: »Am exklusivsten präsentiert sich die Wirtschaftselite. Nicht einmal jeder Vierte ist ein sozialer Aufsteiger. Arbeiterkinder bekleiden sogar weniger als sechs Prozent der Spitzenpositionen.«[9]
83 Prozent dieser Positionen sind von Menschen besetzt, die dem Bürger- oder Großbürgertum entstammen, in Justiz und Verwaltung sind es etwa zwei Drittel. In den privaten Medienanstalten und Printverlagen gilt dasselbe für drei Viertel der Spitzenpositionen, im öffentlich-rechtlichen Sektor etwa für die Hälfte der Intendanten und Programmdirektoren.
Vor diesem Hintergrund wird das Verschwinden der größten Teile der Bevölkerung aus der öffentlichen Wahrnehmung erklärlich: Die politischen, wirtschaftlichen und medialen Eliten rekrutieren sich mehrheitlich aus gehobenen sozialen Milieus, und sie kennen die Lebenswelten der Bevölkerungsmehrheit kaum aus eigener Anschauung und Erfahrung. Wer zu diesen vielfältigen Welten gehört, tritt vielleicht als Angestellte oder Arbeiter, als Reinigungsfrau oder als Supermarktkassierer in die Optik der Eliten, nicht aber als Mitbewohnerinnen und Mitbewohner derselben Gesellschaft. Dieser Befund ist betrüblich für die Demokratie, denn er bedeutet eine gesellschaftliche Verarmung.
Kündigungen
2021 war ein Rekordjahr, was Kirchenaustritte angeht – rund 280000 Menschen verließen die evangelische Kirche, genau 359205 die katholische. Zusammen mit den immer weiter gestiegenen Austrittszahlen der Vorjahre sank damit die Zahl derjenigen, die in Deutschland noch Mitglied einer der beiden christlichen Konfessionen waren, auf weniger als die Hälfte. Die Mitgliedschaft in einer der Gewerkschaften, die im DGB vertreten sind, sank von knapp zehn Millionen im Jahr 1994 auf 5,6 Millionen im Jahr 2022. Die Parteimitgliedschaften in der SPD sanken von 1990 bis 2022 von etwa 950000 auf knapp unter 400000, in der CDU von knapp 800000 ebenfalls auf unter 400000.
Immerhin 23,4 Millionen Menschen sind in Deutschland Mitglied in Sportvereinen, aber auch hier sind die Zahlen rückläufig, auch die der Vereine selbst. Hier gibt es Überschneidungen zum Ehrenamt: »Auf Grundlage der bevölkerungsrepräsentativen Studie VuMA (Verbrauchs- und Medienanalyse) wurden von den insgesamt 70,54 Millionen in Deutschland lebenden Personen ab 14 Jahren knapp 15 Millionen Personen im Jahr 2021 zu der Gruppe der Ehrenamtlichen gezählt. Sie zeichneten sich durch andere demografische Strukturen als die Gesamtbevölkerung aus. Die Mehrheit der Ehrenamtlichen in Deutschland war zu dieser Zeit über 50 Jahre alt – knapp ein Fünftel war 70 Jahre und älter. Insgesamt verfügten sie über eine höhere Schul- und Berufsausbildung als die Gesamtbevölkerung: Gut ein Drittel besaß die allgemeine Hochschulreife und etwa 18 Prozent hatten einen Hochschulabschluss. Die Ehrenamtlichen waren zudem zu zwei Drittel voll Berufstätige oder Rentner, die früher berufstätig waren. Außerdem verfügten die Personen mit ehrenamtlichem Engagement über ein insgesamt höheres Haushaltsnettoeinkommen als die deutsche Bevölkerung.«[10] Auch wenn man die Werte zum Ehrenamt als ein gutes Zeichen deuten kann – wobei die Zahlen in diesem Bereich im Unterschied zu den zuvor genannten nicht sinken –, sieht man eine Verzerrung in Richtung höheres Lebensalter und höhere Bildung. Der Nachwuchs etwa bei den freiwilligen Feuerwehren oder beim Roten Kreuz nimmt dagegen ab, seit der Corona-Pandemie verstärkt.
Nimmt man die hier nur kursorisch ausgewählten Daten, zeichnet sich also seit Jahren ein zurückgehender Organisationsgrad in Institutionen ab, die – wie Gewerkschaften und Kirchen – für Gemeinschaftsbildungen stehen. Besonders die Kirchen waren einmal Institutionen, zu denen unabhängig von Bildung, Einkommen und Vermögen fast alle Menschen einer Gemeinde zählten. Und auch wenn sie höchst polyvalente Institutionen mit zum Teil durchaus fragwürdigen Praktiken waren (deren Offenlegung und Aufarbeitung ein ziemlich zähes Unterfangen ist), war ihre integrative Funktion für die Gesellschaft erheblich, ebenso wie die der Gewerkschaften und der Parteien.
Der fast überall sinkende Organisationsgrad zeigt – neutral formuliert – den Fortgang eines Prozesses der Individualisierung an, wie er für moderne Gesellschaften kennzeichnend ist und in der Soziologie schon seit einigen Jahrzehnten beschrieben wird. Individualisierung ist nicht nur ein Verlust an Zugehörigkeit zu Gemeinschaften, sondern auch ein Zeichen für Emanzipation und Eigenständigkeit, auch in der Wahl der Lebensformen. Dazu passt, dass gerade unter jüngeren Menschen die gesunkene Bereitschaft, formales Mitglied einer Organisation zu sein, wenig darüber aussagt, ob und wo und wie sehr man sich engagiert – man geht nur nicht mehr in dem Maße wie früher die Verbindlichkeit formaler Mitgliedschaft ein. Auch die Spendenbereitschaft ist in Deutschland groß; knapp 19 Millionen Menschen haben 2022 Geld für Katastrophenhilfe, Flutopfer usw. gespendet.
Die moralische Substanz
Das Bild ist also differenziert, gleichwohl können die gerade beschriebenen Austritte aus der organisierten Zivilgesellschaft aus Sicht der Demokratietheorie nicht optimistisch stimmen. Denn Demokratien leben vom Einsatz ihrer Bürgerinnen und Bürger für ein Gemeinsames. Die berühmteste Formulierung dafür hat der Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde gefunden, als er geschrieben hat, dass der freiheitliche Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Böckenförde entwickelte diesen Befund 1964 vor dem Hintergrund der Beobachtung, dass die Rolle der Religion und der Kirchen in der Entwicklung der modernen Staaten schon damals mehr und mehr schwand. Das warf die Frage auf: »Woraus lebt der Staat, worin findet er die ihn tragende, homogenitätsverbürgende Kraft und die inneren Regulierungskräfte der Freiheit, deren er bedarf, nachdem die Bindungskraft der Religion für ihn nicht mehr essentiell ist und sein kann?«[11]
Das Paradox des modernen freiheitlichen Staates besteht darin, dass er – im Unterschied zu autokratischen oder totalitären Systemen – die Freiheit der Einzelnen garantiert, aber gleichzeitig nicht erzwingen kann, dass diese Freiheit auch im Sinn der Allgemeinheit und des Gemeinwohls gelebt wird. Am Aufstieg des Neoliberalismus und am Wirken einer Porschefahrerpartei ist auch in der Bundesrepublik zu sehen, wie ein einseitig auf die bloßen Freiheitsrechte des Individuums verkürzter Freiheitsbegriff in der Konsequenz die organisatorisch Mächtigen und finanziell Starken bevorteilt und diejenigen benachteiligt, die ärmer und schlechter organisiert sind.
Eine solche Form der rücksichtslosen Freiheit ist für die Demokratie als Staatsform der formal gleichen Teilhabe an der politischen Willensbildung schlecht, weshalb Böckenförde von einem »Wagnis« spricht, das der Staat »um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben«.[12]
Es bedarf also sowohl der moralischen Substanz der Einzelnen als auch des Leitbildes eines gesellschaftlichen Ganzen, damit eine freiheitliche Ordnung funktionieren kann. Man kann die »moralische Substanz« vielleicht wieder am Beispiel Uwe Seelers illustrieren, der ja seinen Erfolg eben keineswegs ausschließlich als individuelle Leistung, sondern immer im Kontext seiner Herkunft, seiner Mannschaft, seiner Heimatstadt usw. verstand und deshalb meist in der ersten Person Plural sprach. Und umgekehrt ist ein großes Ganzes, das nicht in undurchschaubare und widersprüchliche Einzelaspekte und -akteure zerfällt, die Bedingung dafür, dass sich diese moralische Substanz an etwas binden, sich realisieren und erhalten kann.
Und das wiederum wirft die nicht einfach zu beantwortende Frage auf, wie solche nicht durch Gesetze, Verordnungen und Zwangsmaßnahmen garantierbaren Voraussetzungen des freiheitlichen Staates gewährleistet werden können, wenn es doch so viele Anzeichen dafür gibt, dass ein gefühltes gemeinsames Ganzes für viele, wenn nicht die meisten Mitglieder der Gesellschaft gar nicht mehr existiert. Und wenn dieses gemeinsame Ganze durch seltsame und zunächst gar nicht zu verstehende Angriffe etwa auf Feuerwehrleute, Sanitätspersonal, Ärzte und Polizistinnen ganz konkret attackiert wird – sind doch diese Personengruppen genau diejenigen, die nicht für ihre individuellen Interessen, sondern für die allgemeinen zuständig sind. Oder wenn die Gesellschaft von anderen Personengruppen durch Steuervermeidung, -hinterziehung und Cum-Ex-Geschäfte angegriffen und geschädigt wird. Das Gemeinsame löst sich von beiden Rändern her auf. Und die Frage, die sich heute für die freiheitliche Ordnung stellt, ist: Welche Formen der Vergemeinschaftung muss eine Gesellschaft bieten und eine Politik als Leitbild vor Augen haben, damit die »moralische Substanz« der Einzelnen eine Verbindung mit einem gemeinsamen Ganzen eingehen kann? Oder, anders formuliert, damit alle sich als Teil von etwas verstehen können, von dem die anderen auch ein Teil sind?
Die Antwort darauf ist nicht, nach den Angriffen auf Feuerwehr und Polizei in der Berliner Silvesternacht 2022 einen »Gipfel gegen Jugendgewalt« einzuberufen, besonders dann nicht, wenn die einberufende Bürgermeisterin Teil jener Partei ist, die seit zwanzig Jahren regiert und ganz offenbar eben diese Jugendgewalt tatenlos hat anwachsen lassen. Die Antwort auf eine sich verbreitende Gefühlslage von gesellschaftlicher Heimatlosigkeit ist auch nicht, dem Innenministerium ein Heimatministerium einzugliedern, wie der hinlänglich in gesellschaftlicher Spaltung engagierte ehemalige Innenminister Seehofer es getan hat, ohne dass bisher auch nur in Spurenelementen zu sehen wäre, was auf den dort vorgesehenen 144 Planstellen so gemacht wird.
Die Antwort wäre hingegen, dass in der politischen Klasse ein waches Bewusstsein darüber existiert, dass in der gesellschaftlichen Praxis ein Mindestmaß an Zusammenhalt und Vergemeinschaftung gelebt sein muss und dass die gesellschaftlichen Institutionen – die Verwaltungen, die Schulen, die Gerichte, die Krankenhäuser usw. usf. – so funktionieren, dass die Bürgerinnen und Bürger den konstanten Eindruck haben, diese Organisationen seien für sie da und nicht umgekehrt. Das heißt, es muss Zusammenhaltstiftendes geben, damit Zusammenhalt empfunden wird. Das sehen auch die Bürgerinnen und Bürger so.
Eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der Rechtsschutzversicherung Roland von Ende 2022 zeigt, dass lediglich 22 Prozent der repräsentativ Befragten den Zusammenhalt in der Gesellschaft für stark bzw. sehr stark halten, fast zwei Drittel halten ihn für schwach (ein deutlicher Rückgang des Gefühls von Zusammenhalt: 2018 waren erst 56 Prozent der Auffassung, der Zusammenhalt sei schwach, 28 Prozent hielten ihn damals für stark). Und wenn man sie nach den Gründen dafür fragt, sagen 71 Prozent, dass die soziale Schicht das trennendste Moment ist, 70 Prozent nennen Einkommen und Vermögen, 62 Prozent die Herkunft.[13] Das ist bemerkenswert, genauso wie der Befund, dass drei Viertel jener 45 Prozent Befragten, die glauben, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden kann, dabei auf die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu Hilfsbereitschaft setzen, »74 Prozent auf die Bekämpfung von Hass und Mobbing im Internet, 73 Prozent auf die Förderung von Chancengleichheit und 72 Prozent auf die Förderung von Solidarität und Hilfsbereitschaft gegenüber Minderheiten und Schwächeren.« Die Begrenzung der Einwanderung halten demgegenüber nur 38 Prozent für eine geeignete Sache, die Förderung von Patriotismus (die man ja hinter der Einrichtung eines Heimatministeriums vermuten darf) lediglich 23 Prozent.
Der »Freiheitsindex«, den das Allensbach-Institut regelmäßig vorlegt, zeigt eine gesunkene Identifikation mit dem Staat. Den Aussagen, »›der Staat, das sind wir alle‹ und dass es ›an uns Bürgern liegt, wie sich Deutschland entwickelt‹, stimmen insgesamt 43 Prozent der Befragten zu. Im Vorjahr waren es noch 47 Prozent, vor zehn Jahren lag die Zahl mit 37 Prozent allerdings noch tiefer als derzeit. Die Meinung ›wir Bürger haben wenig Einfluss darauf, wie sich der Staat entwickelt‹ vertreten derzeit 46 Prozent, etwas mehr als die 42 Prozent vom Vorjahr. Vor zehn Jahren sahen es allerdings noch 54 Prozent der Befragten so.«[14]
Nun ja, auch ich habe, wenn ich es mir genau überlege, wenig Einfluss darauf, wie sich der Staat entwickelt – den entsprechenden Wert kann man auch als Ausdruck von Realismus lesen. Die 43 Prozent, die den emphatischen Aussagen »der Staat, das sind wir alle« und »es liegt an uns Bürgern, wie Deutschland sich entwickelt« zustimmen, kann man ebenso wie die Zahlen zum Ehrenamt und zur Spendenbereitschaft so deuten, dass ein sehr großer Teil der Bürgerschaft in Deutschland eine starke Ressource für die Demokratie ist. Die Klage, die aus der Politik oft zu hören ist, in der Bevölkerung verstehe man den Staat mehrheitlich als Liefersystem, bildet sich in solchen Zahlen jedenfalls eher nicht ab.
Die Demokratiezufriedenheit ist mit kleineren Schwankungen recht hoch: Im Winter 2022/23 lag sie bei 66 Prozent (»sehr zufrieden« und »ziemlich zufrieden«), immerhin ein Drittel zeigt sich unzufrieden. Vor allem das Management der Corona-Pandemie dürfte hier für eine Steigerung gesorgt haben (2018 waren 25 Prozent unzufrieden mit der Demokratie).[15] Aus meiner Sicht spricht aus solchen Zahlen, bei denen übrigens die Werte für den Osten Deutschlands konstant schlechter ausfallen, immer noch eine recht hohe Systemzustimmung, obwohl die Leute – wie bei der Frage des Zusammenhalts – negative Entwicklungen wahrnehmen.
Und diese Systemzustimmung bildet auch eine Basis dafür, die »moralische Substanz«, auf die der freiheitliche Staat bauen muss, zu stärken. Demokratie, so wird ja gerade in verschiedenen Veröffentlichungen gesagt, sei immer auch eine Zumutung, allerdings eine positive – nämlich selbst für den Erhalt und die Fortentwicklung der Demokratie »in Anspruch« genommen zu werden.[16] Demokratie, schreibt Felix Heidenreich, »ist vor allem nicht eine Zumutung, die den Bürgerinnen und Bürgern von anderen, von ›denen da oben‹ angetan wird, sondern etwas, das sich eine demokratische Gemeinschaft von Bürgerinnen und Bürgern selbst auferlegt. Demokratie ist dann nicht etwas, auf das ›wir‹ Bürgerinnen und Bürger Anspruch haben, sondern etwas, das uns in Anspruch nimmt.«[17]
Gut, kann man da sagen. Und die Zahlen zum Ehrenamt und zur Spendenbereitschaft deuten ja an, dass ein erheblicher Teil der Menschen in diesem Land sich gern in Anspruch nehmen lässt. Man kann sie noch ergänzen um die vielen jungen Menschen, die ohne jede Verpflichtung ein freiwilliges soziales (oder politisches oder ökologisches) Jahr leisten – mehr als 50000 jährlich. Oder die sich bei Fridays for Future, der letzten Generation, in Ökodörfern, bei Tafeln usw. engagieren, ohne formelle Mitgliedschaften zu haben.
Aber nehmen sich umgekehrt die politischen, medialen und wirtschaftlichen Eliten eigentlich selbst für die Demokratie so in Anspruch, wie es notwendig wäre, wenn man den vielfältig zu beschreibenden Erosionsprozessen der Demokratie etwas entgegensetzen möchte? Oder sind sie vielfach nicht eher Teil von Parallelgesellschaften, die sich von den Zumutungen und Ansprüchen einer Bürgerinnengesellschaft im emphatischen Sinn abgekoppelt haben und ihr Ding machen? Felix Heidenreich spricht von einer »Resonanzverweigerung« aufseiten der Bürgerinnen und Bürger, wenn sie mehr auf ihre Rechte pochen als auf ihre Pflichten achten, sich rücksichtslos verhalten und den Staat verächtlich machen. Aber man kann diese Resonanzverweigerung auch aufseiten der Eliten antreffen, zum Beispiel dort, wo anonyme Redenschreiber dem Bundeskanzler folkloristische Texte in den Mund legen, in denen von »Unterhaken« die Rede ist, gar von »you never walk alone«, und man sofort denkt, welche DHL-Botin, welcher U-Bahn-Stationen-Reiniger, welche prekär Beschäftigten, welche »Normalos« überhaupt würden sich von solchem Bullshit nicht beleidigt fühlen?
Dasselbe gilt für Politfolklore wie einer »Respekt-Rente« – mein Vater hätte gesagt, ich habe mein Leben lang gearbeitet und Beiträge gezahlt, was hat mein Recht mit »Respekt« zu tun? Oder das »Gute-KiTa-Gesetz«, wie es Franziska Giffey erfunden hat. Solche Beispiele zeugen ja mehr von einem elitären Paternalismus, der die Bürgerinnen und Bürger wie Kinder anspricht und vermutlich auch so betrachtet. Von Kinderkram wie dem »Doppel-Wumms« sprechen wir höflicherweise gar nicht, auch nicht davon, dass wir ihn nicht serviert bekommen, sondern als Steuerzahler finanzieren. Wir reden auch nicht von der unfasslichen Arroganz des erklärungseingeschränkten Bundeskanzlers, mit der er in einer Pressekonferenz eine ausländische Journalistin abfertigte und das selbst offenbar sehr spaßig fand.[18]
Das alles und noch viel mehr deutet, sagen wir, eine erhebliche lebensweltliche Distanz des politischen Betriebs von den – wie Helmut Kohl zu sagen pflegte – »Menchen in unserem Lande« an, eine Distanz, die mit den Eigenlogiken von Parteikarrieren genauso zu tun hat wie mit den eingangs genannten Herkünften und Bildungshintergründen. Und diese Distanz spiegelt sich auch in einem Medienbetrieb, der sich seinerseits mehr für »das politische Berlin« und dessen interne Verfahren, Intrigen und Ränke interessiert, als für das empirische Geschehen im Land, wie alle medienwissenschaftlichen Studien zur Berichterstattung über die vergangenen und aktuellen Krisen zeigen. Und sie reflektiert sich wiederum in Haltungen und Handlungen der wirtschaftlichen Eliten, die vielfach über den Wassern zu laufen scheinen und sich – wie bei einer öffentlich finanzierten Bahn, die kaum 60 Prozent Pünktlichkeit schafft – Boni in Millionenhöhe auszahlen. Offenbar für besondere Leistungen, die der Kundschaft aber verborgen bleiben.[19]
Mir geht es hier nicht um ein pauschales Bashing von Politikerinnen, Medien- und Wirtschaftsleuten – das wäre selbst Teil des Problems, das ich in diesem Buch zu beschreiben versuche. Ohne jeden Zweifel gibt es unglaublich tolle Menschen in der Politik – und zwar auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, und ich persönlich bin viel zu faul, um deren Arbeitspensum bewältigen zu wollen. Und selbstverständlich gibt es im Journalismus Frauen und Männer, die Reportagen und Analysen liefern, die uns helfen, das, was da in der Welt vorgeht, zu verstehen. Und die sich noch für die engagieren, über die sie berichten. Und natürlich haben wir eine Menge von Unternehmerinnen und Unternehmern, Managerinnen und Managern, die sich für das Gemeinwohl nicht nur interessieren, sondern auch engagieren – nicht wenige nicht nur privat, sondern mit ihren Unternehmen. All diese Menschen sind extrem wichtig für eine freiheitliche Ordnung, die im Sinn von Böckenförde funktioniert, und sie alle bemühen sich um jenes Resonanzverhältnis, in dem sich auch die Bürgerinnen und Bürger als Gleiche zu Hause fühlen können.
Aber dummerweise gibt es auch nicht wenige, die mit diesem Resonanzverhältnis absichtlich oder nur aus Ignoranz Schindluder treiben und die erheblich dazu beitragen, die Demokratie auf den Hund zu bringen. Die folgenden Kapitel werden daher nicht nur die Fahrlässigkeiten und Verwahrlosungen im demokratischen Betrieb thematisieren, sondern jeweils auch an Beispielen zu zeigen versuchen, wie es besser gehen kann, als es gerade geht. Denn eine lebendige Demokratie braucht eine Politik, deren Horizont sich nicht auf die Gegenwart und deren Reparaturerfordernisse beschränkt. Politik braucht ein Leitbild. Und ein solches Leitbild ist nichts für kostenlose Festreden, sondern muss in der alltäglichen Praxis der Demokratie gelebt werden, empfunden werden, belastbar sein. Dafür braucht es eine Menge Menschen, die dieses Leitbild in ihrem Handeln verkörpern.
Gerade in Zeiten, in denen weltweit die Zahl der Demokratien zurückgeht und die der Autokratien und Diktaturen zunimmt, genügt es nicht, von Werten zu reden, ohne zu prüfen, ob sie erstens noch in Geltung und zweitens noch zeitgemäß sind. Wenn man eine »wertegeleitete Außenpolitik« propagiert und zugleich Waffenbauteile an das menschenverachtende Regime in Saudi-Arabien liefert, aber absolut nichts für die 87 Millionen Frauen und Männer im Iran tut, die mit Todesmut für ihre Freiheit kämpfen – sollte man einfach tun, was man tun zu müssen glaubt, aber bitte nicht von Werten reden. Und wer der Auffassung ist, dass eine Wachstumswirtschaft, die ihre eigenen Voraussetzungen – Böden, Gewässer, Wälder – zunehmend radikal zerstört, um jeden Preis fortgesetzt werden muss, sollte einfach sagen, dass ihm oder ihr so ziemlich gleichgültig ist, ob nach ihrer besonders wertvollen Existenz andere auch noch leben dürfen. Und wer als Medienschaffende zu keiner Form von Selbstreflexion, geschweige denn Selbstkritik in der Lage ist, sollte eigentlich begreifen, dass sie oder er den Beruf verfehlt hat. Dessen Relevanz bestimmt sich nämlich nach seinem Beitrag für eine lebendige Demokratie, nicht nach Klickzahlen, Reichweite und Werbeeinnahmen.
In einem 21. Jahrhundert, das fast schon zu einem Viertel vorbei ist, braucht es kein selbstgewisses Senden entschiedener Botschaften, sondern die gemeinsame Vergewisserung darüber, dass es eine offene Frage ist, wie zivilisiert man durch dieses Jahrhundert kommen kann. Und zwar so, dass die Jüngeren die Freiheit haben, ihre Zukunft zu gestalten. Die Demokratie und die freiheitliche Ordnung sind in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts nichts Gegebenes, sondern ein Lernprozess, der Gemeinschaftlichkeit voraussetzt, ein zivilisatorisches Projekt. Um dieses Projekt ging es Uwe Seeler. Und geht es mir in diesem Buch.
2.Was war noch mal die »Zeitenwende«?
»Kriegsschiffe statt Kreuzfahrtschiffe: Ist das die Zeitenwende?« – »Wenn Sie es so plakativ formulieren wollen.«[20]
Politische Folklore
Man sollte, das lehrt die Geschichte, sehr vorsichtig sein, wenn man die Bedeutung von Ereignissen seiner Gegenwart für eine künftige Geschichtsschreibung einschätzen will. Vieles von dem, was tagesaktuell als »historisch« erscheint – eine Bundestagswahl, der Rücktritt von irgendwem, eine Naturkatastrophe, ein technischer Unfall, eine Erfindung –, wird später nicht in Geschichtsbüchern auftauchen oder höchstens als Fußnote. Eine Wahl wird ja nur dann bedeutsam gewesen sein, wenn in der folgenden Legislaturperiode etwas Fundamentales geschieht – vielleicht so etwas wie die »Hartz-IV-Reformen«, das tatsächlich einzige wirklich tiefgreifende politische Reformwerk der letzten dreißig Jahre deutscher Politik. Rücktritte lassen die Zurückgetretenen bald in der Versenkung verschwinden, das liegt in der Natur der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Vielleicht tauchen sie später noch mal in der Rubrik »Was macht eigentlich…« auf oder versuchen eine neue Karriere, wie der hochstaplerische Ex-Minister Guttenberg.
Naturkatastrophen werden in einer Zeit der Extremwetterereignisse schnell von einer nächsten übertroffen – die vielen »Jahrhundertfluten«, die das 21. Jahrhundert schon erlebt hat, kann man gar nicht mehr zählen. Dasselbe gilt für technische Großunfälle; Wiederholung normalisiert sie und macht sie historisch uninteressant. Und Erfindungen? Na gut, auch da wird Grundstürzendes nur alle paar Jahrzehnte gemacht. Die letzte Erfindung, die die Welt verändert hat, war das Smartphone, die vorletzte das Internet. Sonst war nicht viel in den letzten dreißig Jahren.
Umgekehrt wird manches »historisch«, was zur Entstehungszeit gar nicht beachtet wurde. Der Tagebucheintrag von Franz Kafka vom 2. August 1914, »Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. – Nachmittags Schwimmschule« ist der Klassiker dazu. Später wird dieses Datum der Beginn der »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« gewesen sein. Die Kurzsichtigkeit der Zeitgenossenschaft erklärt sich daraus, dass die Ereignisse, die in einer Gegenwart erlebt werden, ihre Bedeutung ja erst in der Zukunft dieser Gegenwart entfalten – und die kann niemand wissen. Außerdem kann je nach dem Gegenwartszustand ein Ereignis aus der Vergangenheit erst zu historischer Bedeutsamkeit aufgewertet werden, wie es etwa mit dem »Wunder von Bern«, dem Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft über die ungarische 1954 geschah, was zum Zeitpunkt des Geschehens gar nicht viele Menschen interessierte.[21] So etwas kann später durch Filme oder Romane oder auch durch politische Mythologie geschehen – »invented traditions«,[22] die sich für politische Instrumentalisierungen eignen. »Die Schlacht auf dem Amselfeld«, die der serbische Diktator SlobodanMilošević als Gründungsmythos für ein Großserbisches Reich instrumentalisierte, gehörte in Wahrheit zu den eher belanglosen, aber retroaktiv aufgewerteten historischen Ereignissen, der Rütlischwur desgleichen.
Zudem: Die Gedächtnisse von Gesellschaften sind wie die von Individuen opportunistisch. Immer werden Erinnerungen an dieses oder jenes im Licht der Gegenwart verwendet und dabei stets umgeschrieben. Im Fall von Gesellschaftsgeschichten gibt es mit der Geschichtswissenschaft allerdings eine professionelle Disziplin, die die historischen Fakten festhält, was diese Fakten aber nicht davor schützt, immer wieder neu interpretiert zu werden. Zumindest gilt dies, solange Ereignisse noch im Zeitraum des »kommunikativen Gedächtnisses« lebendig sind und verhandelt werden – das betrifft jenen Raum, den etwa drei Generationen umspannen, in dem also »Zeitzeuginnen« und »Zeitzeugen« mit ihren Enkelinnen und Enkeln direkt kommunizieren können.[23] In dieser Spanne ist die Geschichte »heiß«, Deutungen werden verhandelt, neu entwickelt, revidiert. Dieses Fluide hat das »kulturelle Gedächtnis« nicht mehr – in ihm sind Erinnerungs- und Vergangenheitsbestände erkaltet, zu fester Form geronnen und verkörpert in Gestalt von Denkmälern, Geschichtsbüchern, Museen usw. usf.[24] Aber auch das ist nicht in Marmor gemeißelt: Gruppen, die im kulturellen Gedächtnis marginalisiert sind, können unter bestimmten Bedingungen dagegen rebellieren und für eine Reformulierung der Geschichte kämpfen – wie man es in der Gegenwart infolge der Black-Lives-Matter-Bewegung und des postkolonialen Diskurses erlebt.
Also: Was »historisch« ist und was nicht, entscheidet sich irgendwann, aber ganz sicher nicht in der Gegenwart. Insofern ist es schon kurios, wenn am Tag nach der Verkündigung einer »Zeitenwende« durch den Bundeskanzler alle Medien die zugehörige Rede als »historisch« deklarieren und dieser Begriff fürderhin wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung durch den aktuellen Sprachgebrauch geistert, wahlweise auch als »neue Zeit«. Der Anlass für die Verkündigung dieser »Zeitenwende« ist bekanntlich der Angriff Russlands auf die Ukraine, was in historischer Perspektive möglicherweise als Regionalkrieg ohne besondere historische Bedeutung verzeichnet werden wird. Je nachdem, wie er sich entgrenzt und eskaliert, hat er auch das Potenzial, als »Dritter Weltkrieg« höchst geschichtsbedeutsam zu werden, was dann übrigens eine ganz andere Zeitenwende wäre, als der Kanzler glaubt. Aber auch dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass die Bedeutung von Geschehnissen erst später erkennbar wird. Die Zukunft entscheidet, was »historisch« gewesen sein wird, nicht die Gegenwart.
Man kann aber davon abgesehen fragen: Was macht denn eine »Zeitenwende« aus – der Wechsel eines militärpolitischen Paradigmas? Das wäre die Umstellung der Militärdoktrin von der Verteidigungsbereitschaft gegenüber terroristischen Gruppen und der flexiblen Kampfbereitschaft einer Einsatzarmee für »kleine Kriege« zurück auf den großen zwischenstaatlichen Krieg, wie er sich gerade vollzieht und zu erheblichen Aufrüstungen führt. Aber ist das schon eine Zeitenwende, wenn doch alles andere in der Gesellschaft, von Verschiebungen in den jeweiligen Haushalten abgesehen, gleichbleibt? Niemand verändert das Wirtschaftssystem, auch wenn es frivole Versuche gibt, gleich mal eine »Kriegswirtschaft« zu fordern. Niemand fordert dazu auf, die staatliche Institutionen-Architektur zu verändern, Wahlen auszusetzen, den Notstand auszurufen. Nichts verändert sich im routinierten Abarbeiten oder Liegenlassen von Aufgaben in den zuständigen Institutionen, die Kinder gehen zur Schule, die Erwachsenen zur Arbeit, niemand macht Revolution, nirgendwo ist ein Bürgerkrieg zu sehen, nicht einmal neue Parteien treten auf den Plan.
Wieder einmal gilt Odo Marquards Diktum, dass immer mehr Nichtkrise als Krise herrscht – und tatsächlich ist wohl eine Zeitenwende nicht zu sehen, wenn von einem »Sondervermögen« in Höhe von sagenhaften 100 Milliarden Euro nach einem Jahr noch nicht ein einziger Cent abgerufen wurde. Auch die Zeitenwende ist, wie die Energiewende, die Wärmewende, die Verkehrswende, ein offensichtlich behäbiger Vorgang. Wahrscheinlich ist sie gar keine, sondern nur Politfolklore.
Die Definition einer Zeitenwende müsste ja voraussetzen, dass sich ein Vorher und ein Nachher grundsätzlich unterscheiden, wie etwa nach einer Revolution, einer tiefgreifenden Pandemie, dem Untergang einer Weltmacht. Die Französische Revolution war gewiss eine Zeitenwende, die Pest ebenso, das dritte Beispiel ist schon fraglich. Sicherlich war der Untergang des Ostblocks als einer kompletten politischen Hemisphäre ein tiefer Umbruch, aber gerade der fiel und fällt im Ergebnis ganz anders aus, als die Zeitgenossen 1989 glaubten. Statt des finalen Siegeszugs des westlichen Systems, gleich ausgerufen als das »Ende der Geschichte«, bildete es den Beginn einer neuen geopolitischen Machtfiguration, in der womöglich nicht das Ende der Geschichte, aber der Geschichte des Westens heraufdämmert. So kann man sich täuschen.
Aber zurück in die Gegenwart: Gibt es 2023 ein Nachher, das ganz anders ist, als das Vorher 2022 war? Offensichtlich nicht. Insofern ist die Rede von der Zeitenwende nur dummes Zeug, das alle nachplappern. Aber vielleicht sind der Angriffskrieg Russlands und die damit verbundenen politischen Umsortierungen in der EU und in den Staaten des NATO-Bündnisses ein Unterpunkt im Prozess einer viel umfassenderen Zeitenwende, einer, die tatsächlich das Etikett »historisch« verdient hätte.
Diese mögliche Zeitenwende hat zwei Linien, die man jetzt schon ziehen kann und die einen zukünftigen Geschichtsraum mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit definieren werden. Die eine Linie betrifft jene geopolitische Neuordnung, die mit dem Aufstieg Chinas und anderer im 20. Jahrhundert noch wenig mächtiger Staaten verbunden ist. In diesem Feld haben sich die bestehenden Machtbalancen eindeutig zu Ungunsten der seit 1989 dominierenden Machtfiguration »Westen« und zugunsten eines sich gerade konturierenden Blocks verschoben. Einige Entwicklungsländer von damals agieren inzwischen ihrerseits als globale Mächte: »Im Ranking der zwanzig wirtschaftlich stärksten Länder besetzen sie fast die Hälfte der Positionen und erwirtschaften kaufkraftbereinigt ein größeres Bruttoinlandsprodukt als die dem Westen zugerechneten Staaten. In den kommenden Jahren werden sie eine klare Vormachtstellung erringen; während die USA sich vorläufig noch behaupten, fällt Europa ins zweite oder dritte Glied zurück. Der Kontinent, der noch im Kalten Krieg den Hauptschauplatz bildete, rückt an den Rand des Weltgeschehens.«[25]
Das Entstehen dieser Figuration ist von der US-amerikanischen Außenpolitik spätestens seit der ersten Regierung Obama gesehen worden; Europa selbst hat sich dieser Entwicklung gegenüber bis 2022 außenpolitisch blind und passiv verhalten. Diese Entwicklungslinie ist für alles, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geo- und machtpolitisch geschehen wird, höchst bedeutsam. Ob sie in einer langfristigen historischen Optik mehr ist als eines der üblichen Aufstieg- und-Fall-Szenarien von Imperien, die die Geschichtswissenschaft beschreibt, weiß man nicht.
Die andere Linie zeichnet eine noch tiefgreifendere Veränderung ab. Sie geht nicht auf neue Machtbalancen und Systemkonkurrenzen – also auf soziale Faktoren – zurück, sondern auf die tiefgreifende Modifikation der Überlebensbedingungen für die menschliche Lebensform, also auf naturale Faktoren. Das ist neu und war bislang noch nicht Gegenstand der Geschichte, die Menschen machen. Ausnahmslos alle einschlägigen wissenschaftlichen Befunde zeigen vehemente Veränderungen in der Biosphäre und im Klimasystem. Und deren Folgen für das Weiterleben der Menschen reichen von Bodenverlusten und Extremwetterereignissen über Ernährungsprobleme und Migrationsströme bis hin zu den sogenannten Kipp-Punkten im Erdsystem, die das hochkomplexe Gesamtgefüge von Meeresströmungen, Klimazonen, Kohlenstoffsenken usw. stören und Folgen haben können, die man beim besten wissenschaftlichen Wissen noch gar nicht vorhersagen kann. Nur dass sie nicht förderlich sein werden, kann man annehmen.
Für solche grundstürzenden, umfassenden Veränderungsprozesse in einer hochgradig interdependenten Welt mit der größten Gesamtbevölkerung, die es je gegeben hat, liegt keinerlei historisches Erfahrungswissen vor. Was jetzt geschieht, gab es noch nicht. Und bedauerlicherweise ist es wahrscheinlich, dass die bisherigen Erfahrungen und Wissensbestände in Sachen Krisenbewältigung nicht viel hergeben für die künftige Entwicklung, weil es sich bei dieser Veränderung nicht um eine vorübergehende Veränderung von Teilsystemen – wie bei einer Pandemie, einem Krieg, einer Revolution – handelt, nach deren Bewältigung Regulierungen einsetzen, die ein Teilsystem innerhalb des Erdsystems neu justieren. Sondern es geht, nach allem, was wir wissen, ums Ganze, und damit müssen die Menschen zum ersten Mal umgehen.
Einstweilen tun sie das, indem sie die Dimension verleugnen und deshalb »Zeitenwenden« für vergleichsweise kleine Phänomenbereiche ausrufen. Tatsächlich spricht aus meiner Sicht viel dafür, den Ukrainekriegim größeren Zusammenhang der Veränderung im Erdsystem zu betrachten (vgl.
S. 83). Denn wenn diese Veränderung immer und längerfristig mehr und mehr Veränderungen in den Überlebensbedingungen der Menschen mit sich bringt, dann werden imperialistisch motivierte Landnahmen und Kriege schon deswegen wahrscheinlicher, weil bewohnbares Land mit lebensdienlichen klimatischen Verhältnissen weniger wird. Wir können in diesem Zusammenhang auch über Wasser sprechen, über Hitze, über Hurrikans und noch über vieles mehr. Und über Ressourcenkonkurrenz, die heftiger wird, je knapper die Ressourcen werden. Die zivilisatorischen Fortschritte, die in den vergangenen Jahrhunderten erreicht wurden und die sich in einem immer weiter absinkenden Gewaltniveau und höherer Lebenssicherheit niederschlugen, können schnell dahin sein, wenn es für immer größer werdende Gruppen um die Sicherung ihrer wirtschaftlichen Grundlagen unter wachsendem Umweltstress geht.[26]
Alles das ist, und nun kommt der entscheidende Punkt, überhaupt keine Neuigkeit. Wir wissen das seit Jahrzehnten. Die Neuigkeit ist, dass Ignorieren nicht mehr hilft.
Gerade weil dieser Vorgang ein erstmaliger in der Geschichte der Menschheit ist, lag es ein halbes Jahrhundert lang nahe, ihn nicht zur Kenntnis zu nehmen. Tatsächlich ist das der dominante Umgang mit allem diesbezüglichen Wissen seither. Man hat trotz aller Daten und Befunde, aller Studien und Phänomene erst mal so weitergemacht wie zuvor. Das liegt vor allem daran, dass das bis weit in das 20. Jahrhundert hinein dominierende Menschheitsproblem die soziale Frage war. Die Frage nach der möglichst gerechten Verteilung von Lebens- und Überlebenschancen hat die Arbeiterbewegung genauso hervorgebracht wie den Faschismus und den Sowjetkommunismus, die soziale Marktwirtschaft wie den Austromarxismus, die verschiedenen Ausprägungen kapitalistischer Systeme, liberale und totalitäre Lösungen, freiheitliche und gewaltvolle, integrative und ausgrenzende gesellschaftliche Formen.
Immer ging es darum, wie und für wen man Teilhabe an den verfügbaren Gütern und Leistungen gewährleisten konnte und wollte. Die Lösung, die wahrscheinlich am meisten zur Befriedung der sozialen Frage beigetragen hat, war die in der westlichen Nachkriegszeit entwickelte soziale Marktwirtschaft, die erhebliche Wohlstandszuwächse und nichtmaterielle Vorteile wie Bildungs-, Gesundheits- und Sozialversorgung gebracht hat. Aber egal, welche Lösung der sozialen Frage versucht wurde: Immer dominierte sie das gesellschaftliche Naturverhältnis. Denn die Natur wurde systemunabhängig als ein grenzenloses Lager voller Rohstoffe für die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse definiert und als solches behandelt.
Natur spricht
Man konnte dabei zunächst überhaupt nicht absehen, welche Folgen ein solches Naturverhältnis für die langfristigen Überlebensbedingungen haben würde – die Entwicklung von menschlichen Gesellschaften vollzieht sich global ungleichzeitig, und die Entwicklungshorizonte sehen in einer leeren Welt anders aus als in einer vollen.[27] Egal: Die Folgen dieses räuberischen Umgangs mit der Natur stellen sich, obwohl sie sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bereits abzeichneten, erst im 21. Jahrhundert in aller Dramatik dar.[28] Metaphorisch gesprochen: Die meiste Zeit, seit die Menschen begonnen haben, nichtnachhaltig zu wirtschaften, hat die Natur dazu »geschwiegen«. Tierarten sind ausgestorben, Landschaften verödet, tote Zonen sind in den Meeren entstanden. Aber jetzt, im 21. Jahrhundert, »spricht« die Natur, und zwar Klartext. Seinen Ausdruck findet dieser Text in Bränden, Dürren, Hurrikans, Überschwemmungen, Hitzewellen, Erdrutschen und Überflutungen. Und im Verschwinden von Arten: Ein Drittel der Vögel ist weg, die natürlichen Ökosysteme sind um die Hälfte reduziert.[29]
Das heißt: Neben die soziale Frage ist mit Macht die ökologische Frage getreten. Lösungen für beide Fragen stehen aber einstweilen in Widerspruch zueinander, denn die gelingende Bewältigung der sozialen Frage hat die ökologische erst entstehen lassen. Die zivilisatorische Aufgabe, beide Fragen zusammen lösen zu müssen, hat sich so noch nie gestellt (obwohl schon Marx darauf hingewiesen hatte, dass die Quellen der kapitalistischen Aneignung Kapital, Arbeit und Natur sind).
Die ausbleibende Bearbeitung dieses Problems hat mit dem Erfolg der Bewältigung des einen Teils, des sozialen, zu tun. Niemand weiß, wie man die soziale Frage befrieden soll, wenn man zugleich auch Frieden mit der Natur schließt. Deshalb ziehen die Gesellschaften und ihre Wirtschaften es vor, das Problem zu ignorieren. Und genau das erzeugt nicht nur eine Zunahme unterschiedlicher Krisen, die jede auf ihre Weise mit dem Problem zu tun haben. Sondern die Zunahme der Krisen erzeugt auch eine zunehmende Reaktanz: einen Verlust von Überblick einerseits und eine Aggressivität in den Lösungsversuchen andererseits, die kontinuierlich zunimmt.
Statt Frieden mit der Natur zu schließen, was ein höheres zivilisatorisches Niveau der menschlichen Konfliktlösungen voraussetzt, wird der Krieg gegen die Natur umso intensiver fortgesetzt, je aggressiver der Umgang der Gesellschaften miteinander wird. Und umgekehrt, denn beides bedingt sich gegenseitig. Wenn wir keinen Frieden mit der Natur schließen, wird der Weltfrieden eine unerreichbare Utopie.
Die wirkliche Zeitenwende ist definiert durch die Neuartigkeit des Überlebensproblems. Und sie wird bestimmt durch die Folgen der Versuche, den Umweltstress und die künftigen Knappheiten zu bewältigen. Je größer der Überlebensstress wird, desto verbissener wird die Konkurrenz. Das könnte eher ein Zeiten-Ende sein, denn das wird keinen Stein auf dem anderen lassen. Die vergleichsweise lächerliche Mobilisierung von mehr Mitteln für das Militär ist ja nicht mehr als ein Anachronismus, die Anwendung alter Rezepte für neue Probleme.
Eine so umrissene Zeitenwende bedeutet notwendig auch eine ganz neue Reihung von politischen Aufgaben und Prioritäten, sonst wird man sie nicht meistern und mit Pauken und Trompeten untergehen. Und schwupps sieht man: dass so etwas wie ein Krieg eine geradezu willkommene Gelegenheit ist, sich ganz intensiv den alten Aufgaben und Priorisierungen zu widmen und sich vom eigentlichen Problem abzuwenden. Ethologisch könnte man das als eine Art von Übersprungshandlung beschreiben, psychologisch als Realitätsverweigerung, politisch als Versagen vor der Aufgabe.
Wir sehen: eine Refossilisierung der Energiewirtschaft, das Kontraproduktivste, was gerade passieren kann. Wir sehen: eineRenaissance der Rüstungsspirale, das Kontraproduktivste, was gerade passieren kann. Wir sehen: eine Vereinfachung von komplexen politischen Perspektiven und Optionen auf Gut und Böse, das Kontraproduktivste, was gerade passieren kann. Wir sehen: eine Zunahme von Aggressivität gegenüber Denken, das Kontraproduktivste, was gerade passieren kann.
Und wir sehen mit Bestürzung: Eine Zeitenwende ist etwas ganz anderes. Nämlich etwas, was nicht wir machen, sondern was geschieht. Und damit eine Aufgabe, vor der wir zivilisatorisch stehen und für die wir einstweilen noch gar keine Lösung haben. Wir spüren diese Aufgabe nur, als Vibrationen im System, als mentale seismische Störungen, als Angst davor, dass die Rezepte von früher nicht mehr helfen, dieses neue Problem zu meistern.
Es gibt drei Möglichkeiten: das Problem kognitiv zu bewältigen – also so zu tun, als existiere es nicht (solange die Mittel reichen). Oder Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen und mitzuteilen, man habe jetzt mal wieder Wichtigeres zu tun. Oder es real anzugehen – und dabei davon auszugehen, dass sehr Vieles anders und gelegentlich unkomfortabler werden wird als gewohnt.
Demokratie muss man persönlich nehmen
In diesem Buch wird es um die verhängnisvolle Strategie der politischen, wirtschaftlichen und medialen Eliten gehen, die Symptome des Zeiten-Endes einer westlich geprägten Epoche zu ignorieren, anstatt sie als Impulse für einen notwendigen Richtungswechsel aufzunehmen. Das Kulturmodell der permanenten Steigerung von Wohlstand und Konsum, des Wettbewerbs und der Überbietung, des Kriegs gegen die Natur und die anderen hat sich überlebt. Und es gibt viele Leute, die das nicht nur spüren, sondern die auch zu Veränderungen bereit sind. Aber die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsene und besonders durch die Krisenereignisse der vergangenen Jahre noch vertiefte Distanz zwischen den Eliten und der Mehrheitsbevölkerung ist ein Hindernis dafür, endlich den notwendigen Richtungswechsel zu beginnen. Diese Distanz ist auch eine substanzielle Gefahr für die Demokratie.
Es genügt nicht, wenn die Politik den erodierenden gesellschaftlichen Zusammenhalt beklagt – sie muss sich selbst und ihre Praxis als eine der Ursachen für das Schwinden des Zusammenhalts begreifen. Die Politik der deutschen Gegenwart hat kein Leitbild, und schon gar keins, was an den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts geschult wäre. Eine Politik ohne Leitbild hat kein Gestaltungsziel, weiß nicht, auf welche Zukunft hin sie ein Land, eine Gesellschaft entwickeln will und soll. Und kann deshalb auch keine Orientierung geben, was besonders dann misslich ist, wenn die multiplen Krisen selbst anzeigen, dass die vorliegenden Rezepte nicht mehr helfen. Eine Politik ohne Leitbild ist, anders gesagt, selbst kaum mehr als ein Korken auf den Wellen, Kräften folgend, aber nicht orientiert und auch nicht orientierend. Deshalb all dies Kontraproduktive, Aus-der-Zeit-Gefallene, Aktionistische und Aggressive, das ich in den folgenden Kapiteln beschreiben werde.
Dabei bemühe ich mich, nach den Situations- und Problembeschreibungen jeweils auch Perspektiven, Ansätze und Beispiele für die Möglichkeiten des Gelingens des notwendigen Richtungswechsels zu zeigen. Auch wenn wir nach drei, vier Jahrzehnten zahlreicher wirtschaftlich und politisch falscher Weichenstellungen mittlerweile in einem Land leben, in dem vieles von gestern, verschlissen, verwahrlost und übernutzt ist, haben wir als Bewohnerinnen und Bewohner Deutschlands doch das ungeheure Privileg, in einer reichen und freien und demokratischen und rechtsstaatlich verfassten Gesellschaft zu leben, was bedeutet, dass wir eine Menge Handlungsspielräume haben, die Dinge zum Positiven zu verändern.
Daher ist dieses Buch der empirisch informierte Versuch zu zeigen, was aus welchen Gründen falsch läuft, wie gefährlich das für die Demokratie ist und wie man gegensteuern könnte. Dabei geht es um den Zusammenhang der Krisen, die keine voneinander unabhängigen Geschehnisse sind, um den Irrsinn des Kriegführens und des Abschieds von einer Friedenspolitik, um den Abstieg des Westens in einer grundlegend veränderten weltpolitischen Figuration und schließlich um Politik, Wirtschaft, Medien und um das Wichtigste in einer lebendigen Demokratie: die Leute.
Und immer auch um die Umrisse eines Leitbilds, das wir brauchen, um zivilisiert durch dieses Jahrhundert zu kommen.