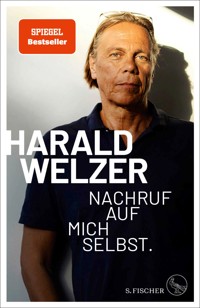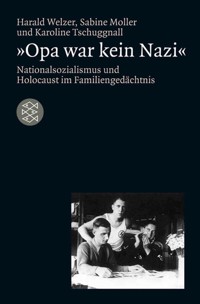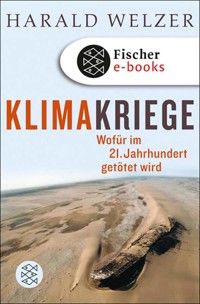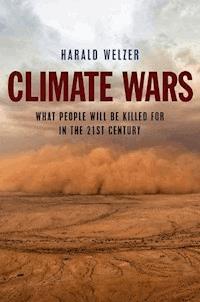9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Selbst denken für Einsteiger Monatlich wundert sich Harald Welzer in der deutschen Ausgabe des »National Geographic Magazins«: über unsere Innenstädte, die immer gleich aussehen, über Gänsebraten in der Südsee, die Effizienzfalle, Smartphones und deren Nutzer, über Gipfeltreffen, piepende Bagger, Alt-Ökos, Sofortismus, Hyperkonsum und was ihm sonst noch auffällt. Immer prägnant, immer witzig, immer politisch. Diese Kolumnen liegen nun gesammelt vor, für Fans, Einsteiger und alle, die sich beim Selbstdenken Anregungen verschaffen möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Harald Welzer
Welzer wundert sich
Rückblicke auf die Zukunft von heute
Über dieses Buch
Seit 2014 wundert sich Harald Welzer monatlich in der deutschen Ausgabe des »National Geographic Magazins«: über unsere Innenstädte, die immer gleich aussehen, über Gänsebraten in der Südsee, die Effizienzfalle, Smartphones und deren Nutzer, über Gipfeltreffen, piepende Bagger, Alt-Ökos, Sofortismus, Hyperkonsum und was ihm sonst noch auffällt. Immer prägnant, immer witzig, immer politisch. Diese Kolumnen liegen nun gesammelt vor, für Fans, Einsteiger und alle, die sich beim Selbstdenken Anregungen verschaffen möchten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
1 Gänsebraten in der Südsee
2 Gefangen in der Effizienzfalle
3 Kotau vor den Ego-Shootern
4 Die den Laden zusammenhalten
5 Was war jetzt noch mal Nachhaltigkeit?
6 Abkoppelung von da draußen
7 Fortschritt durch Rückblende
8 Es piept wohl!
9 Machen die ihren Job richtig?
10 Zwei sichere Wetten
11 Altökos, entspannt euch!
12 Unser aller Konfliktstoff
13 Die bessere Variante
14 Der reine Sofortismus
15 Der Preis des Hyperkonsums
16 Souveräne Ignoranz
17 In 5000 Jahren nichts gelernt
18 Wir müssen reden
19 So klein ist die Welt
20 Können Kinderfragen nerven?
21 Zwei beruhigende Erkenntnisse
22 In der Angeber-Welt
23 Meine Mobilitätsdepression
24 Alles so schön bequem hier!
25 Was alles super funktioniert
26 Lassen Sie mich mal sehen!
27 Neue Spielregeln
28 Kolumbus ohne GPS
29 Für immer mein
30 Schon vergessen?
31 Genug davon!
32 Gesetz der Trägheit
33 Herzliche Einladung
34 Bitteres Abendessen
35 Blasen platzen lassen
36 Nieten mit Schlips
37 Hallo?!
38 Wo sind wir eigentlich?
39 In fünf Tagen um die Erde
40 Wald für die Welt
41 Unrecht und Unrichtiges
42 Die Diktatur der Geräte
1Gänsebraten in der Südsee
… über Kreuzfahrten
»Männer für gefährliche Reise gesucht. Geringer Lohn, bittere Kälte, lange Monate kompletter Dunkelheit, ständige Gefahr. Sichere Rückkehr ungewiss. Ehre und Anerkennung im Erfolgsfall.« Dieses angeblich von dem berühmten Polarforscher Ernest Shackleton in der »Times« aufgegebene Stellenangebot ist etwa hundert Jahre alt. Es entstammt der Heldenzeit der Polarforschung, als Expeditionen noch auf grausame Weise scheiterten, Schiffe vom Polareis zerquetscht wurden, Crews entbehrungsreiche Rettungsmärsche durch das arktische Eis versuchten, viele starben, einige überlebten und auf jeden Fall viele Geschichten zum Erzählen und Weitererzählen geboren wurden.
Heute, im Jahr 2014, erzählt ein Schiffskoch in der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« über seine Passagiere: »Der Geschmack von zu Hause ist gerade für Weltreisende ein unersetzliches Erlebnis in der Ferne. Deshalb schieben wir nicht nur zur Weihnachtszeit eine Martinsgans in den Ofen, sondern auch zu anderen Jahreszeiten und auch in Asien, Südamerika und Australien« (Ausgabe vom 6. Juli 2014).
Weltreisende, so denkt man sofort, sind doch verwegene Gestalten – auch wenn die aus Heimweh verlangte Martinsgans vielleicht nicht ganz mit dem letzten Keks zu vergleichen ist, den Ernest Shackleton am 30. Januar 1909 seinem Gefährten Frank Wild überließ, als dieser auf dem Fußweg vom Polarplateau zum rettenden Schiff »Nimrod« an der Ruhr erkrankt war und auf der Strecke zu bleiben drohte. Shackleton und Wild schafften die Rückkehr fast verhungert, aber auch heute ist das Überleben an Bord keine Kleinigkeit: »Da wir nicht an Land sind und mit einem Anruf für den nächsten Tag Waren beziehen können, muss ich alles mehrere Monate im Voraus planen«, berichtet der Schiffskoch, »mittlerweile erhalten wir gut achtzig Prozent der Ware aus Deutschland. Sobald wir in Europa sind, bekommen wir alles per Lkw geliefert. Das dauert zwei bis drei Tage. Außerhalb Europas bekommen wir unsere Produkte per Schiffscontainer. Ausnahmen sind Frischeprodukte wie Käse, Joghurt und Frischmilch. Die kommen per Luftfracht, denn das können wir nicht vier Wochen lang im Container transportieren. Sie müssen sich auch die Mengen vorstellen: Das sind mitunter Hunderte von Tonnen.«
Der Koch heißt Daniel Behrendt und arbeitet nicht auf einem Expeditionsschiff, sondern auf der »MS Deutschland«, auch bekannt aus der Fernsehserie »Das Traumschiff«. Kreuzfahrten bedeuten ein Minimum an Bewegung bei einem Maximum an Mobilitätsaufwand. Wahrscheinlich hatte in der Geschichte des Tourismus nur die Mondlandung eine schlimmere Ökobilanz pro Kopf als die Kreuzfahrt: Schließlich werden ja Passagier, Gattin und gegebenenfalls der mitreisende Nachwuchs mit höchstem Aufwand bewegt, bekocht und bespaßt. Vier Fünftel der konsumierten Nahrungsmittel werden per Lkw, Schiff und Flugzeug von Deutschland aus auf den Weg gebracht, weil selbstverständlich Steinpilze gereicht werden, wenn daheim die Pilzsaison begonnen hat, auch wenn der Dampfer gerade vor Samoa kreuzt. Eine Berechnung des Transportaufwands für all den Spargel, die Pilze und die Gänse habe ich nicht, aber man geht sicher nicht fehl in der Annahme, dass sie den Traumreisenden wohl gleichgültig wäre.
Die Branche verzeichnet jedes Jahr ein Wachstum von sieben Prozent, 2014 sollen weltweit 21 Millionen Passagiere auf große Fahrt gehen, die vermutlich eher nicht interessiert, dass ihr Traumschiff täglich so 160000 Liter Ab- und bis zu zwei Millionen Liter Brauchwasser in die Meere einleitet, ebenso wenig die reichlichen Mengen Schwefelemissionen, die die weißen Schiffe unablässig ausstoßen. Ich glaube, es gibt in der Welt der reichen Länder, in denen Kreuzfahrten inzwischen auch für die unteren Mittelklassen erschwinglich sind, keine Konsumform, in der vollendete Sinnlosigkeit mit so spektakulärem Aufwand hergestellt wird. Als die Kreuzfahrerei noch eine Oberklassenangelegenheit und damit reiner Statuskonsum war, der den Mief einer zum Glück vergangenen Zeit atmete, war die Klima- und Ökobilanz pro Kopf zwar keineswegs besser als heute. Aber heute sind Kreuzfahrten ein Massenphänomen, und wer in letzter Zeit mal nachts am Mittelmeer gesessen hat und beim melancholischen Betrachten der Horizontlinie eine endlose Kette von wie Kirmesbuden blinkenden Dampfern beobachten musste, findet hier das Sinnbild dafür, dass Jahrzehnte von Umweltbildung, Aufklärung, Ökoengagement, Ergrünung der Politik und Unternehmensleitbildern nicht das Geringste dagegen ausgerichtet haben, dass jedes, aber auch jedes neue Konsumangebot seine willigen Abnehmer und Abnehmerinnen findet und ohne jede Überlegung auskommt, welcher Schaden mit all dem Aufwand angerichtet wird. Und ob man selbst, als Reisender, etwas davon hat. Ja, ob man das Ganze überhaupt als Reise bezeichnen kann.
Man muss ja nicht gleich Shackleton heißen, um ein Bedürfnis nach der Entdeckung einer Landschaft durch eigene Anstrengung zu haben, und nein, die muss auch nicht gleich wieder in eine Extremsportart mit Hightech-Ausrüstung übersetzt werden. Aber bietet die Kanutour auf der Havel, die Fahrradreise durch Masuren oder die Wanderung durch die Sächsische Schweiz nicht mehr Erlebbares und Interessantes als der lächerlich begrenzte Raum eines Containers, in den man gegen Bezahlung gesperrt wird, um bei 30 Grad Celsius in der Südsee Gänsebraten mit Rotkohl und Knödeln aus Deutschland zu essen?
Dasselbe Glück wie nach einem langen Winterspaziergang im Frost wird sie einem denn auch kaum liefern, die arme deplatzierte Gans, und tatsächlich: Spätestens, wenn dem Weltreisenden dieser Gedanke dämmert, weiß er, er wäre besser gleich zu Hause geblieben.
2Gefangen in der Effizienzfalle
… über Innovation
Neulich saß ich abends im ICE von Frankfurt nach Berlin, im Sitz vor mir eine dieser Kostümfrauen mit Laptop und Smartphone. Selbige, so ließ sich gar nicht vermeiden zu hören, kam gerade von einem Meeting und hatte nun offenbar ein Protokoll darüber zu schreiben. Ich glaube, das Wort Protokoll ist viel zu altmodisch, als dass sie es benutzt hätte, wahrscheinlich sagte sie »summary« oder so, aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass sie dieses nun still in ihren Laptop hineingeschrieben hätte. Im Gegenteil: Ohne Unterlass rief sie Menschen an, die offenbar an demselben Meeting teilgenommen hatten, informierte sie darüber, was sie zu schreiben gedenke und dass sie zur Information noch dieses oder jenes »sheet« und ein paar andere »attachments« senden würde, über die sie eine Rückmeldung erbitte, weil sie das dann noch in ihr »summary« einbauen wolle und so weiter. Natürlich riefen die Angerufenen auch immer zurück, um der Frau zu sagen, dass sie das »sheet« erhalten hätten. Vermutlich gingen auch viele Mails bei ihr ein. Habe ich schon gesagt, dass es inzwischen 21 Uhr geworden war? Auch um diese Zeit arbeiteten also alle noch, besser gesagt: ließen sich von ihrer Kollegin auf Trab halten.
Das bringt mich zu der Frage: Ist Arbeit eigentlich noch Arbeit? Also eine Betätigung, die dazu dient, etwas zu erzeugen oder bereitzustellen? Gar eine schöpferische Tätigkeit, wie Philosophen sagen würden? Das wird anscheinend zunehmend unklar: Unlängst hat die Unternehmensberatung Bain & Company die Arbeitsabläufe in 17 Konzernen untersucht und festgestellt, dass eine durchschnittliche Führungskraft 30000 E-Mails im Jahr erhält und 21 Stunden pro Woche in Meetings sitzt. Jeder Meeting-Teilnehmer wiederum verschickt während der Sitzung vor lauter Langeweile im Schnitt vier bis sechs Mails je Stunde, was man jetzt mühelos auf die Bahnfahrt zurückbeziehen und schließen kann: Alle machen das genauso wie die Frau vor mir, was bedeutet, dass sie sich alle gegenseitig mit Fragen und Antworten und Missverständnissen und Rückfragen und unklaren Bemerkungen überschütten und eine unglaubliche Menge an Aufwand produzieren, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, woran sie da eigentlich »arbeiten«. Jede Führungskraft brauchte daher eigentlich noch mal ein bis zwei weitere Personen, die abarbeiten, was an zusätzlichem Aufwand erzeugt worden ist, aber da die wahrscheinlich genauso vorgingen, würde sich der Aufwand nur potenzieren.
Das alles ist das Ergebnis jener »Innovationsrevolutionen«, von denen die IT- Industrie behauptet, sie machten unser Leben immer toller und unsere Arbeit immer effizienter, weshalb sie unablässig neue Geräte erzeugt, die alles noch viel schneller mit noch weniger Aufwand und Energie erledigten. Schön, dass dabei auch die Politik ganz vorne mit dabei ist, zum Beispiel mit der Hightech-Strategie der Bundesregierung, die vollständig sinnfrei so annonciert wird: »Einzelne Technologiefelder werden als Beitrag zur Lösung wichtiger gesellschaftspolitischer Zielstellungen oder Innovationstreiber für andere Technologiefelder (›Schlüsseltechnologien‹) sowie gesellschaftliche Veränderungen als wesentliche Voraussetzung technologischer Wissensgenerierung verstanden. So wird der Innovationsstandort Deutschland gestärkt und noch attraktiver.« Das hätte die Frau im Zug nicht besser formulieren können!
Ist eigentlich schon mal jemandem aufgefallen, dass »Innovation« im Unterschied zu »Fortschritt« keinen Bezugspunkt außerhalb seiner selbst hat, also schon begrifflich permanent leerläuft? Innovation ist bloß eine andauernde Simulation, die irgendetwas, das da ist, durch irgendetwas ersetzt, das neu ist.
Und wieder alle auf Trab hält.
Damit wären wir direkt wieder beim Smartphone und beim Laptop im Hochgeschwindigkeitszug.
»Warum eigentlich«, denkt die Frau jetzt womöglich, »sitze ich hier eigentlich noch um 21 Uhr und arbeite wie verrückt?« Und es überfällt sie vielleicht ein furchtbarer Gedanke: »Weil ich selber immer mehr mache, seit ich effizienter bin! Während ich früher die drei Ergebnisse des Meetings in einem kurzen Vermerk festgehalten und abgeheftet hätte, darauf vertrauend, dass alle Teilnehmer ohnehin über ein Gedächtnis verfügen, habe ich nun 30 Mitarbeiter (und mehrere Zugreisende) drei Stunden lang damit beschäftigt, ein Nichts mit höchstem Aufwand festzuhalten!« Schlimmer noch: Wenn Bain & Company recht haben, war ja schon das ganze Meeting überflüssig, somit auch die Fahrt, die Zeit, der Aufwand für Reisekostenabrechnungen, Taxi, Babysitter, nach Hause telefonieren und so weiter.
»Mein Gott«, denkt die Frau, »alles, was ich jeden Tag tue, ist nicht nur komplett sinnlos, sondern produziert nur immer noch mehr Sinnlosigkeit!« Sie bestellt einen Wein, trinkt einen Schluck. Sie schließt die Augen. Ein »Pling« holt sie aus den Gedanken, es zeigt ihr an, dass die nächste E-Mail eingegangen ist. »Schickst du noch das Briefing für morgen raus?« Und sofort klackert wieder die Tastatur. »Was man manchmal doch für einen Unsinn denkt«, geht der Frau noch durch den Kopf. Aber das hat sie gleich schon wieder vergessen.
3Kotau vor den Ego-Shootern
… über Turbokapitalisten
In der gutbürgerlichen »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« wurde am 28. September 2014 ein Mann namens Oliver Samwer porträtiert, weil, wie der Untertitel des Artikels ankündigte, »dieser Mann eine Sensation« sei. Samwer verkauft mit »Zalando« Kleidung im Internet und kopiert ansonsten Geschäftsideen, mit denen man in Amerika schon erfolgreich war. Seine Person? Ein »Haudrauf-Unternehmer«, der alle anderen niederringt und der dem stationären Handel den Todesstoß versetzen will: »Geschäfte sind Mittelalter, gebaut nur, weil es noch kein Internet gab.« Samwer kleidet sich der Autorin zufolge nachlässig, was allerdings Mitteilungscharakter hat: »Dieser Mann hat Wichtigeres zu tun, als sich um sein Äußeres zu scheren. Er hat keine Zeit für Smalltalk, Schnickschnack und dumme Fragen, er liest keine Bücher und geht nicht ins Theater. Er hat eine Mission. Die muss er erledigen. Koste es, was es wolle. Er würde sterben, um zu gewinnen, hat Oliver Samwer mal getönt. ›Think big‹ hat er seinen Leuten als Losung ausgegeben. Dafür ackert er sieben Tage die Woche. Jede Stunde am Tag, die er nicht schläft, ist er bereit, alles für seine Firmen zu geben, ›whatever it takes‹, wie er es formuliert. Meist hat er ein Handy am Ohr, ein zweites in der Hosentasche, das ständig vibriert. E-Mails schreibt er, während er mit anderen spricht, unternehmerische Entscheidungen fällt er im Minutentakt. Wer bei ihm anheuert, von dem verlangt er ebensolche Höchstleistungen, am besten rund um die Uhr. ›Execution now‹, ist einer seiner Lieblingsbefehle am Telefon, bevor er das Gespräch wegdrückt. Ohne Abschiedsgruß.«
Ich kenne den Mann nicht persönlich, aber das Porträt beschreibt jemanden, der zu asozialem Verhalten und selbstzerstörerischen Handlungen neigt und offenbar von Allmachtsphantasien getrieben ist. Ach so, vielleicht sollte man dazu sagen, dass seine Unternehmen bislang noch nicht mal Geld verdient haben – zum Zeitpunkt des Erscheinens des Porträts machten sie bei 757 Millionen Euro Umsatz sage und schreibe 442 Millionen Euro Verlust. Das Geld, das er zum Verlieren braucht, sammelt er bei Milliardären ein, die unkonventionelle Investments suchen.
Was mich nun wundert? Dass ein solcher Typ gesellschaftlich heute offenbar als attraktiv und interessant, ja geradezu als vorbildlich gelten kann. Wir kannten diese Sorte bislang ja vor allem in der Gestalt von Fernsehpöblern wie Dieter Bohlen und Stefan Effenberg, nun gilt sie plötzlich auch in der Welt der Wirtschaft als Rollenvorbild. Samwer ist ja nicht der einzige Ego-Shooter, der derzeit gehypt wird: Da gibt es zum Beispiel noch den Paypal-Investor Peter Thiel, der öffentlich den Monopolismus propagiert, oder den Hedgefonds-Milliardär Nicolas Berggruen – alles Leute, die sich durch radikale Staatsferne und handfeste Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Gemeinwohl auszeichnen. Man könnte sagen: Diese Leute gewinnen Status, indem sie sich besonders asozial verhalten und geben.
Das kommt sogar bei Politikern gut an, wie man besonders im Fall Berggruen gesehen hat, dem man für sage und schreibe einen einzigen Euro leichtfertig das Schicksal vieler Tausender Angestellter anvertraut hatte. Originellerweise hat das »Berggruen Institute on Governance« im Mai 2013 eine Konferenz in Paris ausgerechnet zum Problem der Jugendarbeitslosigkeit veranstaltet, bei der zum Beispiel Ursula von der Leyen und Wolfgang Schäuble auf dem Podium saßen. Berggruen pflegt, was man in seinem Buch mit dem wunderbaren Titel »Klug regieren« nachlesen kann, durchaus eigene politische Vorstellungen, die jedenfalls mit Demokratie, wie wir sie kennen, nicht arg viel zu tun haben. Und der hochgelobte Peter Thiel verfolgt mit dem von ihm geförderten »Seasteading-Institute« allen Ernstes das Projekt, Kleinstaaten auf Inseln zu schaffen, von denen aus »die nächste Generation von Pionieren« die Wirtschaft auf den unübersichtlichen Kontinenten steuert. Das heißt dann »competitive governance from the outside«, also »Wettbewerbssteuerung von außen«, was ungefähr so gemeinwohlorientiert anmutet wie die Aktivitäten von Dagobert Duck.
Hinreichend, solchen Leuten Bewunderung zu zollen und ihnen Geld, Unternehmen, Daten und am Ende gesellschaftliche Gestaltungsmacht zu überlassen, scheint allein schon, dass sie, wie es immer heißt, eine »Mission« haben, die sie verbissen verfolgen. Worin die besteht und ob sie irgendetwas mit demokratischen, freiheitlichen und rechtsstaatlichen Werten zu tun hat, scheint in dem Augenblick gleichgültig zu werden, in dem sie mehrmals hintereinander Sätze sprechen, in denen die Wörter »Innovation«, »Leadership«, »Milliarden«, »Strategie«, »Silicon Valley«, »Investieren« in beliebiger Reihung vorkommen. Dann kniet der kaum jemals aus Niedersachsen oder Hessen herausgekommene Wirtschaftspolitiker innerlich nieder, denkt »Dolle Sache!!« und überlegt flugs, wie man solchen Innovasoren auch im offenbar ganz und gar zurückgebliebenen Deutschland eine Bühne geben und sie zum Investieren in heimische »Start-ups« und »Innovation Labs« veranlassen kann. Als würde eine Gesellschaft funktionieren, die aus Menschen besteht, die sich hauptsächlich in ihren Omnipotenzphantasien überbieten.
Ganz falsch: Diese Gesellschaft besteht aus genau denen, die Taxi fahren, bei Karstadt an der Kasse sitzen, in Krankenhäusern Dienst tun, nebenher ihre Familie managen, sich in einem Sportverein, bei Greenpeace, Amnesty International oder bei der freiwilligen Feuerwehr engagieren, kurz: den Laden zusammenhalten, den die Samwers dieser Welt so hartnäckig zu zerstören versuchen. Entschuldigung, aber das musste jetzt mal gesagt werden. Nächsten Monat erzähle ich Ihnen etwas über diese Leute, versprochen.
4Die den Laden zusammenhalten
… über mangelnde Wertschätzung
September 2014, »vision summit« in Berlin. Bei diesem »event« unter dem Motto »We Q statt IQ« drehte sich alles um sogenannte social entrepreneurs, das sind Unternehmer, die soziale Projekte als »business cases« organisieren. Da gab es über tolle Projekte zu hören, Symphonieorchester, die in Problemschulen gehen, oder Beratungen, die Pleitiers wieder auf die Beine helfen. Seltsam bei all dem war nur die ständige Betonung, dass es hier um »neue Geschäftsmodelle« ginge, auch war viel von »leadership«, »innovation«, »share economy« und so die Rede. Ja, da gäbe es viel zu entdecken und zu fördern, was die sozialen business cases der Zukunft anbelange!
In einer Podiumsdiskussion stellten einige »entrepreneurs« ihre erfolgreichen Projekte vor – übrigens alles Männer. Als die Moderatorin das Gespräch gerade beenden wollte, rief einer der Teilnehmer, der junge Architekt Van Bo Le Mentzel, dazwischen, er habe noch eine Frage: Warum denn hier immer nur von diesen Typen die Rede sei, die so tolle Start-ups machten, nicht aber von denen, die den Laden eigentlich am Laufen hielten? Allgemeine Verwunderung – was will der Mann? Ganz einfach, erläuterte Van Bo: Warum redet man nicht von den Krankenschwestern, die im miserabel bezahlten Schichtdienst mehr tun, als in ihrem Arbeitsvertrag steht, warum nicht von denen, die ehrenamtlich in Sportvereinen oder bei der freiwilligen Feuerwehr arbeiten, warum nicht über die, die die Suppe für die pflegebedürftige Oma nebenan kochen? Sie alle seien es doch, die die Gesellschaft zusammenhielten und nicht irgendwelche Plastikwortproduzenten.
Recht hat er, man sollte viel mehr über diese Leute reden. Zum Beispiel über Timo Schmitt, der in einem ausrangierten und zur fahrbaren Kochstation umgebauten Doppeldeckerbus, dem »Kimbamobil«, Schulkindern das Kochen beibringt. Oder über Gylcan Nitsch, die »Yesil Cember« erfunden hat, den »Grünen Kreis«, der in Migrantenfamilien geht und Infos zum Stromsparen, zur Ernährung, zur Mülltrennung weitergibt. Oder über die weitgereiste Künstlerin Ursula Cyriax, die ihrem hessischen Heimatort Biedenkopf ein Jahr lang die Tristesse abtrainiert hat, indem sie Rentnerinnen zum »Guerilla-Stricken« und Schüler zum Übernachten im Wald gebracht hat. Oder über die Betreiber des Grandhotel Cosmopolis in Augsburg, das zugleich Hotel, Zuhause für Asylbewerber und Ort für Kulturveranstaltungen ist. Oder über Siggi und Hans-Günter Bartel, die in Eberstadt den Circus Waldoni aufgebaut haben, der Jugendliche, die in Schule und Job nicht zurechtkommen, seit vielen Jahren erfolgreich in Ausbildungen bringt und nicht wenige zu professionellen Artisten gemacht hat. Oder über die älteren Damen in Rheda-Wiedenbrück, die festgestellt haben, dass in ihrem Städtchen Menschen aus 96 Nationen leben, die sie nun zu ihren Kaffeeklatschsonntagen einladen, um sich gegenseitig Heimatgeschichten zu erzählen. Oder über Van Bo selbst, der Bauanleitungen für »Hartz IV«-Möbel ins Netz stellt und in Schulen geht, um den Kindern beizubringen, wie man Möbel baut.
Mir haben mal Kollegen aus dem Handel feixend erzählt, dass sie sich beim Einkauf der spießigsten und hässlichsten Klamotten im Sortiment immer eine Modellkundin, »Frau Kasupke«, vorstellen, die Salzteigbilder an der Wand und Rüschengardinen vor den Fenstern hat. Ich habe die fröhliche Runde gefragt, ob sie bei ihrer Zielgruppenanalyse auch berücksichtigen würde, dass Frau Kasupke ehrenamtlich im Hospiz arbeitet oder Kindern in der Krebsklinik vorliest, was die Stimmung ein bisschen vermiest hat. Ja, tatsächlich sind es all diese Leute, die ungefragt und unbezahlt, ganz ohne »business case« und »leadership« dort, wo sie es können, unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und das ist mehr denn je nötig, denn wir haben ja in den letzten 20 Jahren gesehen, wie unter Spar- und Renditediktaten nicht nur Unternehmen zu Effizienzhöllen umgebaut wurden, sondern auch Schulen, Universitäten, Kindertagesstätten, Krankenhäuser mit Hilfe von Zielvereinbarungen, Rankings, Evaluationen, Punkteskalen »wettbewerbsfähig« gemacht wurden – als ob Bildung, Pflege, Fürsorge auch nur das Entfernteste mit Markt und Wettbewerb zu tun hätten.
Was geschieht, wenn nun auch noch freiwillige, ehrenamtliche oder einfach nur soziale Handlungsweisen dem Markt unterworfen werden, kann man an den vielgepriesenen Internetunternehmen der »Share-Economy« sehen: Während es zum Beispiel noch vor kurzem besonders unter Studierenden weltweit gang und gäbe war, dass man Kommilitonen auf Besuch bei sich übernachten ließ und davon ausgehen konnte, dass man dasselbe jederzeit auch in Lyon, Sankt Petersburg oder Toronto würde machen können, ist diese soziale Praxis heute in eine monetäre Dienstleistung verwandelt worden, wo jede Studi-WG sich gut überlegt, ob sie ihr Gästezimmer kostenlos zur Verfügung stellt: Es könnte sich doch jeden Augenblick ein zahlender Gast über »airbnb« anmelden!
Die Leute, die »den Laden zusammenhalten«, würden nie auf die Idee kommen, dass man aus dem, was sie tun, ein Geschäft machen könnte. Was sie machen, hat nämlich keinen anderen Zweck, als irgendwo etwas besser zu machen, als es ist. Wo der Markt herrscht, wird dagegen alles zum Mittel degradiert, um dort ein Geschäft zu erfinden, wo vorher keines war. Ach, mir fällt noch eine Geschichte ein. Von dem österreichischen Schuhfabrikanten Heini Staudinger, den es ärgerte, dass der Red-Bull-Erfinder und Milliardär Dietrich Mateschitz seinen Formel-1-Rennstall als Marketing-Aufwand von der Steuer absetzen kann. Staudinger wollte auch gern einen Steuervorteil, um den bei ihm arbeitenden alleinerziehenden Müttern bei weniger Arbeitszeit mehr Gehalt zahlen zu können. Er hat jetzt auch einen Rennstall. Dort fahren Kleinkinder auf Bobby-Cars. Er nennt ihn Formel-Z. Wie Zukunft.
5Was war jetzt noch mal Nachhaltigkeit?
… über ein schweres Missverständnis